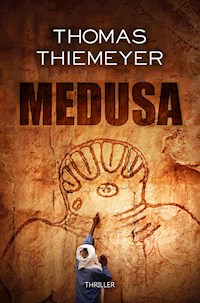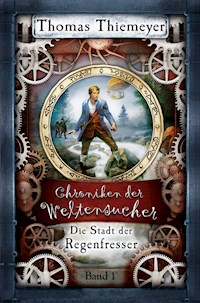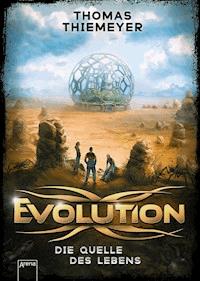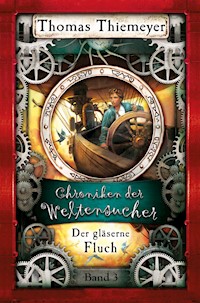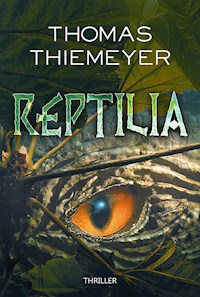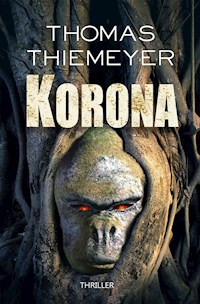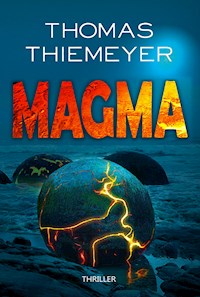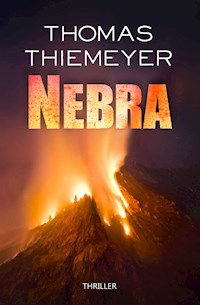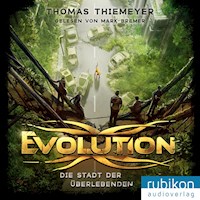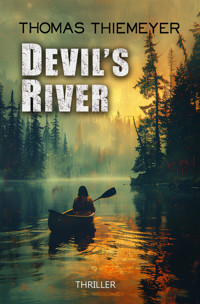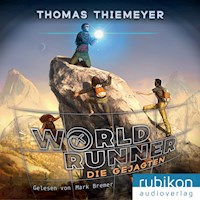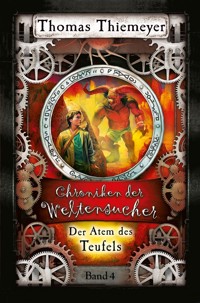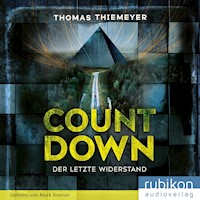
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rubikon Verlag e.K.
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit ist am Abgrund - der Countdown läuft. Ein Stromausfall stürzt die ganze Welt ins Chaos. Zwei Jahre später sind die Folgen davon noch immer gewaltig. Die ausweglosen Umstände von Ressourcenknappheit und überfüllten Städten bringen Lena und ihre Familie dazu, Unterschlupf in einer Aussteigersiedlung zu suchen. Dort trifft sie ihren alten Klassenkameraden Ben wieder. Als die beiden herausfinden, dass der Stromausfall nur der Beginn von einem größeren Plan ist, müssen sie sich entscheiden: Wollen sie weiter in der Sicherheit der Siedlung bleiben oder sich auf den schwierigen Weg machen, um die Menschheit vor einer Macht zu retten, von deren Existenz diese noch nicht einmal etwas ahnt? Das neue Buch von Abenteurer und Bestsellerautor Thomas Thiemeyer: unerbittlich, fesselnd und actionreich
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weitere Bücher von Thomas Thiemeyer im Arena Verlag:
World Runner. Die Jäger
World Runner. Die Gejagten
Evolution. Die Stadt der Überlebenden
Evolution. Der Turm der Gefangenen
Evolution. Die Quelle des Lebens
Thomas Thiemeyer,
geboren 1963, studierte Geologie und Geografie, ehe er sich selbstständig machte und eine Laufbahn als Autor und Illustrator einschlug. Mit seinen preisgekrönten Wissenschaftsthrillern und Jugendbuchzyklen, die mittlerweile in dreizehn Sprachen übersetzt wurden, ist er eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsliteratur. Seine Geschichten stehen in der Tradition klassischer Abenteuerromane und handeln des Öfteren von der Entdeckung versunkener Kulturen und der Bedrohung durch mysteriöse Mächte. Der Autor lebt mit seiner Familie in Stuttgart.
www.thiemeyer.de
www.thiemeyer-lesen.de
Thomas Thiemeyer
Countdown
Der letzte Widerstand
Ein Verlag in der Westermann Gruppe
© 2022 Arena Verlag GmbH
Rottendorfer Str. 16, 97074 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Text: Thomas Thiemeyer
Covergestaltung: Johannes Wiebel
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Herstellung:
Arena Verlag mit parsX, pagina GmbH, Tübingen
E-Book ISBN978-3-401-81000-3
Besuche den Arena Verlag im Netz:
www.arena-verlag.de
Jennifer beschirmte ihre Augen mit der Hand. Ihr Gesicht wirkte angespannt.
»Na, was denkst du?«, flüsterte sie. »Sieht verlassen aus, oder?«
Der Asphalt flimmerte. Grillen zirpten träge. Seit Tagen lag eine brütende Hitze über der Schwäbischen Alb. Kaum ein Windzug war zu spüren. Die Tankstelle sah verlassen aus, eingewachsen in hohes Gras und mannshohe Büsche. Nur der Name – rote Schrift in blauem Oval – ragte hoch über die Bäume. Das Schild hatte sie auf die Fährte gelockt. Pack den Tiger in den Tank, haha. Die Raubkatze machte in diesen Zeiten keine großen Sprünge mehr. Verbrenner sah man inzwischen kaum noch. Kein Mensch fuhr mehr mit den alten Spritfressern. Viel zu hungrig, viel zu auffällig. Ohnehin war es nicht das Benzin, auf das Ben und Jennifer scharf waren. Was sie interessierte, war der Shop.
Ben kniff die Augen zusammen. Er tat so, als würde er etwas erkennen. Was natürlich Blödsinn war. Er wusste, dass seine Schwester viel bessere Augen hatte. Seit seiner Kindheit war er auf eine Brille angewiesen. Herrje, ohne die konnte er nicht mal fünf Meter weit gucken. Trotzdem nett von ihr, dass sie ihn fragte.
»Ich denke, wir können es riskieren.«
»Worauf warten wir dann noch?« Jennifer ließ ihr E-Bike aus dem Schatten des Baums gleiten. Ben folgte ihr, die Hand am Gasgriff. Falls sich das Ganze als Falle herausstellte, mussten sie einen Notstart hinlegen.
Man konnte in diesen Zeiten nicht vorsichtig genug sein. Sie waren nicht die Einzigen, die auf Beutezug waren, und manche der Streuner waren echt krank in der Birne. Allerdings bestand um die Mittagszeit herum wenig Gefahr, entdeckt zu werden. Streuner jagten für gewöhnlich in der Dämmerung.
Langsam und nach allen Seiten Ausschau haltend, rollten die beiden auf die Straße hinaus. Die Sonne knallte von oben herab, blendete Ben.
Unwillkürlich musste er an jenen verhängnisvollen Tag vor zwei Jahren zurückdenken. Es war ein herrlicher Sommertag gewesen, genau wie heute. Mit blauem Himmel und Schäfchenwolken. Mit Vogelgezwitscher und Eichhörnchen, die durch die Bäume tollten. Ein Tag, wie geschaffen für Ausflüge und Abenteuer, für Spiele und Badespaß. Jedoch war damals niemand nach draußen gegangen. Alle hatten zu Hause gehockt und die Köpfe eingezogen, ängstlich wie die Kaninchen. Läden waren geschlossen, Telefone und Radios verstummt, die Straßen wie leer gefegt.
Genau wie heute.
Knirschend rollten sie auf die Tankstelle zu. Der Asphalt war an manchen Stellen aufgebrochen. Gras quoll aus den Ritzen. Schon erstaunlich, wie schnell sich die Natur alles zurückeroberte, wenn man es nicht pflegte. Regen und Frost ließen Risse entstehen, in denen sich Pflanzensamen ansiedelten. Ein Baum wuchs zwanzig bis dreißig Zentimeter im Jahr. Fichten brachten es sogar auf einen halben Meter. Zehn Jahre, und schwupp, hatte man einen fünf Meter hohen Baum im Garten stehen. Oder mitten auf der Straße.
Je näher sie kamen, umso deutlich wurde, dass die Tankstelle nur vom Waldrand aus so zugewuchert ausgesehen hatte. Von vorne betrachtet, war sie gut in Schuss. Die Auffahrt war frei, die Scheiben intakt und die Tür mit einer schweren Kette gesichert.
»Was denkst du?« Jennifer sah sich argwöhnisch um. »Meinst du, die ist noch in Betrieb?«
»Machst du Witze?« Ben kniff die Augen zusammen. »Warum sollte jemand diesen Laden bewirtschaften, so fernab von allem? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier keiner mehr vorbeikommt.«
»Außer uns«, sagte Jennifer.
Seine Schwester war ein Jahr älter als er und knapp einen Kopf größer. Von seinen Geschwistern war sie ihm die liebste. Sie hatte Mumm in den Knochen und war eine begnadete Armbrustschützin. Die beste in ihrem Dorf. Die rotblonden Haare und die Sommersprossen hatte sie von Mom, ihre kräftige Statur von Dad. Bei seinen Brüdern Liam und Noel war es genau andersherum: Die Zwillinge waren schlank und drahtig, besaßen aber Dads dunkle Strubbelhaare.
Ben hingegen schlug aus der Art. Zu klein für sein Alter, sagten sie. Zu kurzsichtig und zu dunkelhäutig. Man sagte ihm einen mediterranen Look nach – was immer das bedeuten mochte. Fest stand: Keiner in seiner Verwandtschaft hatte so haselnussbraune Augen wie er, keiner so dunkle Haut oder so dichte Brauen. Weshalb sich um seine Herkunft allerlei Vermutungen rankten. Vermutungen, die sogar noch zugenommen hatten, nachdem Mom fortgegangen war.
Klar verletzte ihn das, doch was sollte er tun? Gerüchte ließen sich nicht aufhalten. Inzwischen schaltete er bei diesem Geschwätz auf Durchzug. Sollten sie sich doch das Maul über ihn zerreißen. Er war, wer er war: ein echter Kowalski. Und neben Jennifer der beste Scout im Dorf. Er schob die Brille hoch bis zur Nasenwurzel. »Die Luft ist rein. Wollen wir?«
Sie stellten ihre Räder hinter den Müllcontainern ab und gingen vorsichtig auf die Eingangstür zu. Neben der Auffahrt stand eine Werbetafel, auf der ein Plakat klebte. Ein Mann im Anzug war dort zu sehen. Krawatte, Einstecktuch, markantes Gesicht. Das Antlitz eines Erfolgsmenschen. Die Arme verschränkt, blickte er herausfordernd in die Kamera.
Vertrauen Sie uns. Wir wissen, was zu tun ist.
Stärke durch Entschlossenheit.
Atlas-Union: für ein gutes Leben
Regen und Wind hatten dem Plakat schwer zugesetzt. Die Farben waren verblasst. Das Papier wölbte sich, war an manchen Stellen bereits eingerissen.
Ben hatte den Typen schon mal gesehen, er wusste nur nicht genau, wo.
Das Zirpen der Grillen schien noch schwerer geworden zu sein. Rechts stand ein üppiger Rosenstrauch, um den Dutzende von Hummeln schwirrten. Schwerer Blütenduft lag in der Luft. Die Fenster des Shops waren mit Spanplatten vernagelt und die Tür mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert.
Jennifer sah ihn forschend an. »Kriegst du das auf?«
Ben prüfte den Sicherheitszylinder und nickte. »Ein 5-Pin-Schloss. Kinderkram.« Er öffnete seine Tasche und holte den Multipick heraus.
Der Multipick war ein batteriebetriebenes Werkzeug zum Öffnen von Zylinder- und Vorhängeschlössern, das ein bisschen an einen Handbohrer erinnerte. An seiner Spitze saß ein nadelförmiger Stift, der tief ins Schloss geschoben wurde und mit seinen dreizehntausend Umdrehungen die eigentliche Arbeit verrichtete.
Ben schob den rechtwinklig gebogenen Metallhebel in den unteren Teil des Schlüsselkanals, erzeugte mit dem Zeigefinger ein wenig Druck und drückte auf die Starttaste des Multipick. Ein helles Surren ertönte. Die unglaublich schnellen Schwingungen sorgten dafür, dass die kleinen Federn im Inneren nach außen geschleudert und die Blockierung aufgehoben wurde. Der Zylinder drehte sich und das Schloss schnappte auf. Die Kette verschwand zusammen mit dem Schloss im nächstgelegenen Busch.
Jennifer grinste. »Ich werde nie kapieren, wie du das hinkriegst.«
»Jeder Schlüsseldienst hat das früher hinbekommen, es bedarf nur ein wenig Übung.« Ben freute sich natürlich über ihr Lob. Wann immer er gefragt wurde, was er später mal für einen Beruf ausüben wolle, antwortete er: Dinge reparieren.
Er hatte sogar eine eigene Lebensphilosophie. In seinen Augen war die Welt wie eine riesige Maschine. Und neigten Maschinen nicht dazu kaputtzugehen? Wenn man es genau betrachtete, war die Welt im Moment ein ziemlicher Schrotthaufen. Wenn er also nur ein wenig dazu beitragen konnte, sie wieder zu reparieren, so hätte er seine Aufgabe erfüllt.
Drinnen empfing sie brütende Dunkelheit. Ben fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Die Temperatur musste so um die vierzig Grad sein. Durch die Lücken zwischen den Spanplatten fiel etwas Licht. Es genügte, um sich zu orientieren.
Neben der Kasse lag ein Stapel alter Magazine. Eines davon, ein Heft über Astronomie und Sternenkunde, war aufgeschlagen.
Sternenexplosion, lautete die Überschrift. Werden wir alle sterben? Obwohl sie anderes zu tun hatten, überflog Ben den Text.
In den frühen Morgenstunden des 15. Juli ereignete sich am südlichen Nachthimmel ein Schauspiel von ungewöhnlicher Seltenheit und Schönheit. Die Explosion des Sterns Beteigeuze im Sternbild Orion sorgte auf der ganzen Welt für Aufsehen. Noch nie zuvor in der jüngeren Geschichte gab es ein astronomisches Schauspiel dieser Art. Auf die Frage nach den Auswirkungen antwortet Professor Dr. Konstantin Becker von der astrophysikalischen Abteilung der Universität Genf: »Zum Glück ist Beteigeuze zu weit entfernt, um ernsthaft zur Gefahr zu werden. Wäre er näher, hätte er möglicherweise das Leben auf der Erde auslöschen können – wir wären von der Neutronen- und Gammastrahlung gegrillt worden. Doch dank der großen Entfernung besteht keine Gefahr.«
Beteigeuzes Supernova wird noch wochenlang am Himmel zu sehen sein und dabei heller leuchten als der Vollmond. Eine einmalige Möglichkeit für Wissenschaftler und Hobbyastronomen, mehr über die Entstehung des Weltraums und die Rolle von uns Menschen im unendlichen Kosmos zu erfahren.
Ben presste die Lippen zusammen. So hatte es damals angefangen. Wie hätten sie ahnen können, was da auf sie zukam?
»Alter.« Jennifers Stimme riss ihn aus den trüben Gedanken. »Glück muss der Mensch haben. Das nenne ich einen Volltreffer.«
»Was denn?«
»Sag mal, hast du Tomaten auf den Augen?«
Es hatte einen Moment gebraucht, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Doch jetzt machte sein Herz einen Sprung. Der Laden wirkte, als hätte man ihn erst gestern zugesperrt. Es war alles noch da! Was wohl kaum an dem popeligen Vorhängeschloss liegen konnte. Vielleicht war er einfach zu weit ab vom Schuss, um von den Streunern bemerkt zu werden.
Kurz nach dem weltweiten Stromausfall waren die Läden alle noch voll gewesen. Die Menschen dachten, die Krise würde nur wenige Wochen dauern, danach wäre alles wie zuvor. Was für ein Irrtum! Der Stromausfall hatte sämtliche Länder und Kontinente erfasst und zu einem globalen Zusammenbruch geführt. Als nach zwei Monaten in den ersten Städten wieder Strom durch die Leitungen lief, war die Welt eine andere.
»Sieh dir das an.« Jennifer war ganz aus dem Häuschen. »Bonbons, Erdnüsse, Kaugummis und Chips!«
Ben lief das Wasser im Mund zusammen. Süßkram und Knabberzeug waren in diesen Tagen schwer zu finden. Auf dem Schwarzmarkt erzielte das Zeug Höchstpreise. Aber Chips! Das war nun wirklich die Königsklasse.
Jennifer riss eine Tüte auf, griff hinein und verdrehte genüsslich die Augen. »Hm, probier mal.«
Ben streckte seine Hand aus. Normalerweise durften sie nicht eigenmächtig so etwas Wertvolles öffnen. Immerhin war es ein begehrtes Tauschobjekt auf dem Schwarzmarkt. Angesichts dieser Fülle aber war die kleine Regelüberschreitung wohl zu verzeihen. Und Ben liebte Chips. Am meisten die ungarischen.
Knirschend zermahlte er einen davon zwischen seinen Zähnen. Der Geschmack war überwältigend. Und das Beste: Sie waren halbwegs frisch. Sie hatten schon Chipstüten gefunden, deren Inhalt geschmeckt hatte wie alter Karton. Gegessen hatten sie es trotzdem. Wählerisch zu sein, war ein Luxus, den sie sich nicht erlauben konnten.
Er wollte noch einmal reingreifen, als er etwas bemerkte. Da blinkte etwas im hinteren Teil des Ladens. Wie von einem Magneten angezogen, steuerte er auf das Blinken zu.
Ihm stockte der Atem. »Alter«, murmelte er. »Das gibt’s doch nicht.«
»Was denn?« Jennifers Worte waren zwischen den Chips kaum zu verstehen.
Ben bewegte sich wie ein Schlafwandler durch den hinteren Teil des Ladens. »Die haben Werkzeug hier«, stieß er aus. »Achtkantschlüssel, Inbus, Torx. Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Wagenheber, dazu Bohrköpfe und Stecksätze. Richtige Markenqualität, nicht so ein Billigschrott.« Er schaltete seine Stirnlampe ein, um den Fund besser untersuchen zu können. Ihm fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. »Himmel noch mal, die haben sogar Drehmomentschlüssel hier.«
»Das ist gut, oder?«
»Gut? Das ist eine Schatzgrube.«
Ehrfürchtig ließ er seine Finger darübergleiten. Dies war ein Fund, der mit Euro, Pfund oder Dollar nicht zu bemessen war – vorausgesetzt, die alten Währungen hätten noch einen Wert gehabt. Was nicht der Fall war. Die Welt war zum alten Standard zurückgekehrt: Gold, Silber, Kupfer. Wer solche Münzen besaß, konnte sich glücklich schätzen. Fest stand, für diese Entdeckung würden sie jede Menge Freistunden und Extrarationen bekommen.
»Das können wir auf einen Schlag gar nicht transportieren«, murmelte Ben. »Wir werden wiederkommen müssen.«
»Dann schlage ich vor, wir fahren zurück, schnappen uns den Transporter und laden alles ein. Dad wird Augen machen.«
»Hoffen wir, dass das Zeug dann noch da ist«, sagte Ben, der sich von dem Anblick kaum losreißen konnte. Er war immer noch so verblüfft, dass ihm um ein Haar das Geräusch entgangen wäre, das von außen an seine Ohren drang. Ein tiefes, durchdringendes Brummen.
Alarmiert sah Jennifer ihn an. »Ist das ein Verbrennungsmotor?«
Ben nickte. »Und ob. Und zwar von einer richtig fetten Maschine. Und sie wird lauter.«
Im Nu war die Chipstüte verschwunden. Wie auf ein unsichtbares Zeichen gingen beide in Deckung.
Sie bekamen Besuch!
Wie ein gepanzertes Rieseninsekt schob sich der Wagen vor die Zapfsäule. Ben sah pechschwarzen Lack, getönte Scheiben und verchromte Stoßstangen.
Abgesehen von seiner beeindruckenden Größe war es vor allem der gute Zustand, der ihn faszinierte. Die wenigen Spritfresser, die man noch draußen in der Landschaft fand, waren allesamt verrostet und straßenuntauglich. Bei den meisten hatte man Räder abmontiert, Sitze ausgebaut und Türen entfernt – schließlich konnte man all das anderweitig verwenden. Dieser Wagen jedoch sah aus, als wäre er frisch vom Band gelaufen. Auf der Fahrertür prangte in sattem Blutrot das Symbol der Atlas-Union.
Mit angehaltenem Atem betrachtete er den Titanen, der die Erdkugel auf seinen Schultern trug. Ein Fahrzeug der Parteizentrale? Hier?
Ein schmaler Lichtstreif fiel auf Jennifers erschrocken aussehendes Gesicht. Auf ihren Lippen formte sich ein kaum hörbarer Satz. »Wir müssen hier weg.«
Ben gab ihr in Gedanken recht. Über die Unionsagenten kursierten wilde Geschichten. Von Spezialwaffen war die Rede, von Verhörmethoden jenseits aller Vorstellungskraft. Allerdings hielten sich Unionsmitglieder sonst nur in schwer gesicherten Gebäuden auf. Nie verirrte sich einer von ihnen so weit raus aufs Land.
Seine Mom war der tiefen Überzeugung gewesen, dass etwas anderes hinter dem weltweiten Stromausfall steckte. Keine Sternenexplosion, sondern eine, wie auch immer geartete, neue Regierung. So überzeugt war sie von dieser Vorstellung gewesen, dass sie ihre Familie verlassen und sich Hals über Kopf einem Kerl angeschlossen hatte, der behauptete, er wäre der Kopf einer Widerstandszelle und würde Aktionen gegen die neuen Machthaber unternehmen. Sosehr Ben seine Mom auch liebte, es fiel ihm immer noch schwer, diesen Schritt nachzuvollziehen. Vielleicht war es etwas, das in ihrer Familie lag, in ihren Genen. Ihr Bruder Oswald war in dieser Hinsicht kein bisschen besser. Er hatte für kurze Zeit gegen die Atlas-Union gekämpft, sich dann aber resigniert zurückgezogen und lebte jetzt als verschrobener Einsiedler in einer verdunkelten Hütte im Wald.
Die Türen des SUV gingen auf. Zwei Personen stiegen aus, ein Mann und eine Frau. Beide hatten sie Ähnlichkeit mit dem Mann auf dem Plakat. Weißes Hemd, schlichter grauer Anzug, schwarz polierte Schuhe. Die Frau war blond und hatte einen Pferdeschwanz, der Mann trug sein pechschwarzes Haar ordentlich gescheitelt. Beide waren wohlgenährt, durchtrainiert und gesund. Weder gab es Ohrstecker noch Piercings oder Tattoos. Gesichter wie aus den Hochglanzbroschüren, die hier in der Tankstelle herumlagen. Etwas Kaltes, Militärisches ging von ihnen aus. Ihre Bewegungen waren zielgerichtet und dynamisch.
»Wenn die uns beim Plündern erwischen, sind wir dran«, zischte Jennifer. »Dahinten ist ein Lagerraum. Dort gibt es bestimmt einen Hinterausgang. Machen wir, dass wir hier wegkommen.«
»Geh du schon vor, ich komme gleich«, flüsterte Ben. »Muss nur noch kurz beobachten, was die vorhaben.«
Der Mann hatte den Tankdeckel geöffnet und den Zapfhahn reingesteckt. Glaubte er im Ernst, er könne hier tanken? Jeder Idiot wusste, dass die Pumpe Strom benötigte, um zu funktionieren. Und doch ließ sich der Fremde davon nicht abschrecken, im Gegenteil. Er öffnete die Ledertasche an seinem Gürtel und zog etwas daraus hervor. Ben kniff die Augen zusammen. Sah aus wie ein Etikettiergerät oder so was. Ergonomisch geformter Handgriff mit ein paar Knöpfen, oben ein eckiger Aufsatz. Ein blaues Lämpchen blinkte auf der Oberseite. Der Mann machte ein paar Justierungen, dann befestigte er das Ding an der Zapfsäule. Keine Ahnung, wie es da hielt – vielleicht mit Magneten. Eine Weile tat sich gar nichts, dann schaltete das blaue Lämpchen auf Gelb und fing an, heftiger zu blinken. Ein tiefes Summen ertönte.
»Ben, komm mit!« Jennifers Zischen bekam etwas Drängendes.
»Ja doch, gleich. Die haben da ein Gerät an der Zapfsäule befestigt und ich glaube … ach, du Scheiße!«
»Was denn?«
Das Lämpchen war von Gelb auf Grün gesprungen. Im selben Augenblick ertönte ein Klingelton. Die Zapfsäulen wurden aktiv. Lichter flammten auf. Nicht nur im Außenbereich, sondern vor allem hier drinnen. Blendend helles LED-Licht flutete den Laden. Ben duckte sich unwillkürlich. Doch das war es nicht, was ihn so erschreckt hatte. Irgendwas war mit dem Mann passiert, in dem Moment, als der Strom floss. Irgendeine Veränderung, die nicht erklärbar war. Oder hatte er sich das nur eingebildet?
Der Motor des Kühlschranks sprang holpernd an. Von irgendwoher begann Musik zu dudeln. Mit einem ängstlichen Laut verschwand Jennifer im dunklen Teil des Lagerraums. Ben wollte ihr folgen, als er plötzlich eine Stimme hörte.
»Geh in den Laden und sieh nach, ob die was Genießbares dadrin haben. Ich kann den Fleischextrakt nicht mehr sehen. Diese Militärrationen hängen mir zum Hals raus.« Die Stimme des Mannes klang hart und rau.
»Geh doch selbst«, entgegnete die Frau mit ebenso unangenehmer Stimme. »Ich bin nicht deine Dienstmagd.«
»Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich tanke gerade. Außerdem übernehme ich die ganze Fahrerei. Also los.«
Mit einem mürrischen Grunzen machte sich die Frau auf den Weg. Das Geräusch ihrer Schritte brachte Ben endgültig zur Besinnung. Er tauchte hinter die Regale ab und ging in die Hocke. Die Staubschicht dämmte zum Glück die Geräusche.
»Hier ist kein Schloss dran …«
»Na und?«
»Ich wollte es nur erwähnt haben.«
»Wie wär’s, wenn du einfach mal nachsiehst, anstatt mir ellenlange Vorträge zu halten?«
»Ja, ja«, grummelte die Frau so leise, dass der Mann draußen es unmöglich hören konnte. »Wenn Herr M’Enat etwas befiehlt, müssen alle springen. Was glaubt er, wen er vor sich hat? Meine Familie ist mindestens so ehrbar wie seine. Das nächste Mal soll er sich gefälligst selbst bewegen, ich habe die Nase voll.« Sie fing an, in den Regalen herumzuwühlen. »Das ist doch alles nur Mist hier. Billigstes Zeug.«
Ben hörte, wie sie Schachteln aufriss und den Inhalt auf den Boden warf. »Als Neffe des Generalgouverneurs glaubt er, sich alles erlauben zu können. Ich würde ihn ja zu einem Kass’richak fordern, wenn mir das erlaubt wäre. Dann würde er sehen, was er davon hat.«
Weitere aufgerissene Schachteln flogen zu Boden.
Ben krabbelte weiter nach hinten, bemerkte aber zu seiner Bestürzung, dass die Frau sich in dieselbe Richtung bewegte. Zwar lagen zwei Regalreihen zwischen ihnen, aber wenn sie beide gleichzeitig das hintere Ende erreichten, konnte er nicht ungesehen durch den Hinterausgang verschwinden.
»Hast du etwas gefunden?«, tönte es von draußen.
»Ja, alles noch da. Der Shop wurde nicht ausgeplündert.«
»Habe ich mir gedacht, die Tanks sind auch noch voll. Beeil dich mal ein bisschen, ich bin gleich fertig.«
»Ja, ja.«
Es lag etwas in ihrer Stimme, das Ben nicht behagte. So ein merkwürdiges Keuchen. Und noch etwas bereitete ihm Sorgen. Auf der dicken Staubschicht waren seine Fußabdrücke zu erkennen. Wenn die Frau nicht mit Blindheit geschlagen war, konnte sie die kaum übersehen. Er musste dringend hier raus.
So leise wie möglich eilte er nach hinten. Seine Tasche dicht vor die Brust gepresst, arbeitete er sich voran. Noch schien die Frau keinen Verdacht geschöpft zu haben. Sie war viel zu sehr mit Meckern beschäftigt. Unentwegt schimpfend, prüfte sie die Waren. Ihr Begleiter musste einen wirklich anspruchsvollen Geschmack haben, wenn sie bis jetzt noch nichts gefunden hatte.
Ben blickte um die Ecke und sah, dass er einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet hatte. Die Luft war rein. Jetzt oder nie. Stumm bis drei zählend, hechtete er mit angehaltenem Atem durch die Hintertür, hinein in den dunklen Lagerraum. Eine Woge der Erleichterung überfiel ihn.
Geschafft!
In diesem Moment erklang ein hässliches Knirschen unter seinen Schuhen.
»Achtung, hier ist alles voller Glas«, hörte Ben Jennifer aus der Dunkelheit heraus zischen. Doch es war bereits zu spät. Die Frau hatte ihn gehört.
»Hallo, ist da jemand?«
Ben erschrak bis ins Mark.
»Kannst du denn nicht aufpassen?«, flüsterte Jennifer.
»Hallo, wer ist denn da? Ich kann euch hören.« Die Frau schien verdammt gute Ohren zu haben. Allerdings war sie unschlüssig, wie sie sich verhalten sollte.
»Los, raus hier!« Jennifer schob Ben vor sich her. »Hier ist eine Hintertür. Sie ist durch einen Innenriegel gesichert. Ich habe auf dich gewartet. Komm!«
»Ich glaube, wir werden beobachtet!«, rief die Frau ihrem Partner zu. »Wer immer das Schloss entfernt hat, er ist noch hier.«
Jennifer schob den Innenriegel zur Seite und öffnete die Tür. Geblendet von der Helligkeit wankten sie nach draußen. Krachend fiel die Tür hinter ihnen ins Schloss. Spätestens jetzt war ihre Anwesenheit nicht länger ein Geheimnis.
»Zu den Rädern, schnell!« Jennifer legte einen beachtlichen Sprint hin. Ben versuchte, ihr zu folgen, wurde aber von seiner Werkzeugtasche behindert. Er erreichte sein E-Bike mit einiger Verzögerung.
Von der Rückseite der Tankstelle her waren Geräusche zu hören. Türen schlugen zu. Der Motor sprang an.
»Scheiße«, fluchte Ben. Sein schweißnasser Daumen rutschte vom Starthebel ab. Jennifer war bereits auf und davon. Endlich drückte er den Hebel. Die Elektromotoren stießen ein klägliches Winseln aus. Das E-Bike machte einen Satz nach vorne. Ben hatte alle Mühe, sich festzuhalten. Er wusste nicht, wann er das letzte Mal so einen Sprint hingelegt hatte. Pfeilschnell schoss er hinter dem Müllcontainer hervor und raus auf die Straße. Sein Ziel war der Waldweg, den sie vorhin heraufgekommen waren. Er war schmal genug, dass der Wagen ihnen dort nicht folgen konnte. Zumindest hoffte das Ben.
Noch etwa zweihundert Meter.
Das Gebrüll des Motors hinter ihm klang wie das eines Dinosauriers. Ben wagte nicht, sich umzudrehen. Zu tief saß der Schreck über das, was er gesehen hatte. Oder vielmehr, gesehen zu haben glaubte. Denn es war sehr viel wahrscheinlicher, dass er eine Sinnestäuschung erlitten hatte. Eine Vision, ausgelöst durch Stress und Hitze.
Und doch …
Während er verbissen um jeden Meter kämpfte, versuchte er, das Bild abzuschütteln, das sich in seine Netzhaut gebrannt hatte. Das Bild einer fließenden Form. Eines seltsamen Schattens.
Der Wind schlug ihm ins Gesicht, ohrfeigte ihn. Ben trat in die Pedalen, bis seine Knie schmerzten. Trotz seiner Brille schossen ihm Tränen in die Augen. Das Heulen des Motors hinter ihm drohte seine Ohren zu sprengen. Es klang, als wäre der unheimliche schwarze SUV nur wenige Meter hinter ihnen. Der Fahrer schien ein absolut Irrer zu sein. Wollte er sie umbringen? Was, wenn er oder Jennifer stürzten? Der Panzer würde sie glatt überrollen.
Was hatten sie denn schon groß verbrochen? Gut, sie hatten ein paar Süßigkeiten stibitzt, aber deswegen so ein Theater zu machen? Das war doch übertrieben. Oder ging es hier um etwas anderes?
Jennifer hatte die Stelle, an der die Straße in den schmalen Waldweg abzweigte, erreicht. Ohne die Bremse auch nur zu berühren, stürzte sie sich ins Dickicht und verschwand auf der steil abschüssigen Schanze.
Jetzt war die Reihe an Ben. Er riss den Lenker hoch, sprang über die Böschung und tauchte in den Schatten einer alten Eiche. Hinter ihm hörte er Bremsen quietschen. Reifen rutschten über Schotter. Das Röhren des Motors wurde leiser.
»Haha, du Loser!«, schrie Ben, während er die Schanze hinabrauschte. »In den Wald traust du dich nicht, was? Du magst mehr PS haben, aber wir haben mehr Grips.«
Er rauschte ein gutes Stück den Pfad hinunter, dann betätigte er vorsichtig die Bremse. Nur nicht zu stark, sonst würde er eine Bruchlandung hinlegen. Aber er wurde langsamer. Auf halber Strecke blieb er stehen und drehte sich um.
Hinter ihm war winzig klein die Öffnung zwischen den Bäumen zu sehen. Scherenschnittartig zeichnete sich davor der Umriss des SUV ab. Die Scheinwerfer des Autos waren voll aufgeblendet.
Ben keuchte wie ein altersschwacher Wasserkocher. Er fühlte sich zittrig. Nach seiner Trinkflasche greifend und gierig ein paar Schlucke trinkend, beobachtete er, was seine Verfolger taten. Himmel, das war knapp gewesen. Jennifer war schon längst auf und davon. Kluge Schwester. Sie war eindeutig die Vorsichtigere von ihnen beiden.
Ben fühlte, dass von seinen Verfolgern noch immer eine Bedrohung ausging. Er wendete sein Bike und wollte gerade losfahren, als eine Bewegung seine Aufmerksamkeit erregte. Vom Dach des Autos löste sich eine zweite, kleinere Form. Sie war flach, fast wie eine Schildkröte, mit vier Auslegern an den Seiten.
Was zum …? Ben kniff die Augen zusammen.
War das eine Drohne?
Im Bruchteil einer Sekunde wurde ihm klar, dass er sich zu früh gefreut hatte. Seine Verfolger hatten noch nicht aufgegeben. Sie waren nur gerade in die zweite Runde gegangen.
Die Lippen zusammengepresst, trat Ben in die Pedalen.
Der Weg machte eine Biegung und führte dann in einem zweiten, noch steiler abfallenden Stück talabwärts. Der Untergrund bestand aus lockerem Geröll, vermischt mit Blättern. Eine Mischung, ähnlich wie Schmierseife. Zu bremsen wäre Wahnsinn gewesen, weshalb Ben den Schalter seines Bikes auf Lademodus umlegte. Das verlangsamte seine Abfahrt ein bisschen, schonte gleichzeitig die Bremsen und pumpte Strom in die Akkus.
Der Generatorbetrieb des Motors – Rekuperation genannt – war eine sinnvolle Ergänzung. Damals hatte sich das Prinzip bei E-Bikes zwar nicht durchgesetzt, aber Ben hatte es verfeinert und inzwischen war es bei allen ihren Bikes eingebaut.
Das Surren wurde lauter.
Ben flitzte nach links, dann wieder nach rechts, schlug Haken wie ein Hase. Das Surren verfolgte ihn. Panik vernebelte seine Sinne. Er konnte die Drohne einfach nicht abschütteln. Allerdings war die Frage, inwieweit er sich wirklich Sorgen machen musste. Es war nur eine Drohne. Nichts weiter als ein paar Propeller und eine Kamera. Die Dinger sollten eigentlich keine ernsthafte Bedrohung darstellen.
Er überlegte, ob er anhalten und das Mistding mit seiner Steinschleuder abschießen sollte. Er war ein guter Schütze. Nicht so ein Meister wie Jennifer, aber immerhin. Im Wald war die Wirksamkeit dieser Waffe natürlich eingeschränkt. Die Drohne konnte hinter Bäumen Deckung suchen. Aber wenn es ihm gelang, sie auf freies Feld zu locken, konnte er sie dort erledigen.
Das Ende des Waldwegs kam in Sichtweite. Noch etwa hundert Meter, dann kreuzte er die Straße, die in einem weiten Bogen von oben herunterkam. Für einen kurzen Moment glaubte Ben, die Luft wäre rein, als er plötzlich rechts etwas aufblitzen sah. Scheinwerfer! Zwischen den Baumstämmen hindurch sah er schwarzen Lack und blitzende Chromleisten. Mit einem Höllentempo schoss der SUV die Straße entlang, bremste und hielt mit quietschenden Reifen an. Genau dort, wo Ben die Straße kreuzen wollte. Sie schnitten ihm den Weg ab!
Noch etwa fünfzig Meter …
Ben konnte unmöglich bremsen. Er war viel zu schnell.
Dreißig Meter …
Die beiden Fahrer verließen das Innere des Fahrzeugs. Der Mann öffnete seine Gürteltasche und zog dieses komische Gerät heraus, das er bereits an der Tankstelle im Einsatz gehabt hatte. Er zielte damit auf Ben.
Instinktiv riss Ben den Lenker herum. Er hatte vorgehabt, einen Haken zu schlagen, doch aus dem Plan wurde nichts. Der Untergrund war viel zu rutschig und Ben viel zu schnell. Wie auf einer Eispiste knirschten die Räder über den Waldboden. Immerhin gelang es ihm, dem Blitz, der heiß und glühend an ihm vorbeischoss, um wenige Zentimeter zu entgehen.
Dann passierten mehrere Dinge gleichzeitig.
Hinter ihm ertönte ein Knall, der sich anhörte, als würde der halbe Wald explodieren. Der Mann fummelte an dem Gerät herum und legte dann erneut auf Ben an. Er kam jedoch nicht mehr dazu abzudrücken, weil in diesem Moment ihre beiden Schultern mit voller Wucht gegeneinanderknallten.
Die Wucht des Aufpralls riss Ben beinahe von seinem Bike, doch wie durch ein Wunder blieb er im Sattel.
Ein Schrei ertönte.
Aus dem Augenwinkel sah er, wie der Mann über die Motorhaube geschleudert wurde. Sein Gerät flog in hohem Bogen durch die Luft und landete in einem Waldstück links von ihnen.
Ben schoss an der Motorhaube des SUV vorbei in das abschüssige Waldstück dahinter. Er hatte alle Mühe, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, stabilisierte sich nach wenigen Metern und raste weiter bergab. Seine Schulter schmerzte höllisch. Immerhin hatte das grässliche Surren aufgehört. Es klang, als wäre die Drohne nicht weiter hinter ihm her.
Trotzdem. Ben durfte kein Risiko eingehen. Er fuhr weiter, bis er die Talsohle erreichte, dann wandte er sich nach rechts und schaltete den Motor wieder zu. Diesmal hielt er nicht an, um sich umzuschauen. Hauptsache, er brachte möglichst schnell möglichst viel Abstand zwischen sich und seine Verfolger. Sein Arm fühlte sich an wie ein totes Stück Holz.
∘ ∘ ∘
Eine halbe Stunde später kam das Ziel in Sicht.
Die Hornburg, benannt nach J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe, befand sich im oberen Drittel des Albtraufs, einem Steilabfall an der nordwestlichen Flanke der Schwäbischen Alb. Der Name war eine Anspielung auf die sagenumwobene Schlacht um Helms Klamm und den letzten Rückzugsort der Menschen von Rohan.
Als Ben und seine Geschwister klein waren, hatte seine Mom ihnen immer aus den Büchern vorgelesen. Lange vor dem großen Stromausfall. Sie hatte nie viel von Fernsehern und Computern gehalten. Jetzt war sie fort und es gab niemanden mehr, der noch die alten Geschichten las.
Hinter den Dächern der Hornburg stieg der Hang hundertfünfzig Meter an, ehe er in eine Hochfläche überging, auf der früher Weide- und Viehwirtschaft betrieben wurde. Heute war dies Niemandsland.
Um ihre Siedlung herum wuchs hoher Mischwald, der sie vor neugierigen Blicken schützte. An klaren Tagen konnte man vom Wall aus bis ins vierzig Kilometer entfernte Stuttgart schauen. Ein Bach plätscherte von oben herab, durchquerte etliche Fischteiche und versorgte die Siedlung mit Wasser und Nahrung.
Seit den Tagen des großen Stromausfalls war ihre Containersiedlung beträchtlich gewachsen. Ben erinnerte sich noch lebhaft, wie er und seine Geschwister damals an seiner Schule für ihren Lebensstil gehänselt wurden. Konsumverzicht, eigene Strom- und Wasserproduktion, Vorratshaltung – Ökos hatte man sie genannt, böswillige Zungen sprachen von ihnen sogar als Prepper. Wobei das überhaupt nicht zutraf. Doch von denen, die damals gespottet hatten, hörte man heute nichts mehr. Wer nicht verhungert oder zum Streuner geworden war, hatte das Land verlassen und war in die Großstadt gezogen.
Ihre Siedlung aber hatte sich behauptet. Nicht nur hatten sie die dunklen Jahre nach dem Stromausfall überlebt, nein, das Dorf blühte auf und gedieh. Viele Menschen aus der Umgebung waren zu ihnen gestoßen, auf der Suche nach Schutz, Arbeit und Lebensmitteln. Aus den ursprünglich sieben Hochseecontainern waren inzwischen knapp vierzig geworden. Nicht nur dienten sie als Unterkünfte, sondern bildeten gleichsam einen massiven Schutzwall rund um die gesamte Anlage.
Ben stieß einen erleichterten Seufzer aus, als er den Wall der Hornburg endlich sah. Seine schmerzende Schulter dicht an den Körper gepresst, fuhr er die letzten Meter hinauf zur Burg. Kameras säumten seinen Weg. Der Wald ringsherum war gespickt mit Stolperdrähten und Fallen. Keinem Unbefugten wäre es gelungen, sich unbemerkt zu nähern. Wenn man jedoch die Sicherheitsmarker kannte und wusste, welchen Code man an der gut versteckten Safebox zu Beginn der Auffahrt eingeben musste, konnte man den Alarm für wenige Minuten ausschalten.
Jennifer erwartete ihn am Haupttor. Sie stand neben ihrem E‑Bike und hielt besorgt nach ihm Ausschau.
»Wo hast du gesteckt?«, rief sie. »Ich habe mir Sorgen gemacht. Ist was mit deinem Arm?«
Ben presste die Zähne aufeinander und rollte bis vors Tor.
»Bekomme ich keine Antwort?«
Er stieg ab und ließ das Bike auf den Boden fallen. »Hol Sven.«
Besorgt riss sie die Augen auf. »Bist du verletzt?«
Ben nickte.
Jennifer starrte auf seine Schulter, dann rannte sie ins Innere.
Seit knapp einem Jahr war Sven in der Hornburg für die allgemeine Gesundheit zuständig. Eigentlich war er Veterinärmediziner – also auf die Behandlung von Tieren spezialisiert –, aber er machte auch als Menschendoktor einen guten Job, wenn auch seine Behandlungsmethoden manchmal etwas rustikal ausfielen.
Ben fürchtete sich davor, was Sven mit ihm anstellen würde. Allerdings konnte es schlimmer kaum noch werden. Seine Schulter war ein roter, pulsierender Schmerzherd. Irgendetwas mit der Stellung seiner Knochen stimmte nicht. Am oberen Schulterblatt hatte sich ein eckiger Winkel gebildet. Zwar konnte er seine Finger zur Faust ballen, aber ein Anheben des Arms war unmöglich.
Jennifer kam in Begleitung von Sven zurück. Ein dreißigjähriger Mann mit Spitzbart, Pferdeschwanz und runder Brille, der berüchtigt war für seine schlechten Witze.
Die beiden waren nicht alleine. Jennifers Hilferuf hatte die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner erregt und so kamen etliche von ihnen mit neugierigen Blicken näher. Allesamt vertraute Gesichter, bis auf drei, die erst vor Kurzem hier eingetroffen sein mussten. Ben hob fragend die Brauen.
»Neuankömmlinge«, sagte Jennifer. »Du wirst sie nachher kennenlernen. Jetzt sind erst mal andere Dinge wichtig.«
Sven untersuchte Bens Schulter. Seinem Gesichtsausdruck nach war er nicht glücklich über das, was er sah. »Das Gelenk ist ausgekugelt«, sagte er. »Der Knochenkopf sitzt nicht mehr in der Gelenkpfanne. Ich muss das wieder einrenken. Das wird kein Spaß. Ich muss mich beeilen. Das Gewebe ist bereits angeschwollen.«
»Kriege ich ein Schmerzmittel?« Ben blickte sorgenvoll.
»Keine Zeit«, erwiderte Sven kopfschüttelnd. »Komm, halte dich an mir fest, dann lege ich dich auf den Boden. Du willst bestimmt meinen neuesten Witz hören, oder? Ich wette, den kennst du noch nicht.«
Keiner in ihrem Dorf verfügte über einen so unerschöpflichen Witzefundus wie Sven. Keine Ahnung, wo er den herhatte – vielleicht, weil er früher in einer Dorfkapelle gespielt hatte.
Ben nickte. Ihm war übel vor Angst.
Jennifer half mit, ihn flach auf die Erde zu betten. Bens Blick fiel auf die Neuankömmlinge. Aus seiner Position konnte er sie nur schlecht sehen, aber er hatte das Gefühl, das Mädchen zu kennen.
»Was macht neunhundertneunundneunzigmal Tick und einmal Tock?« Sven nahm seinen verletzten Arm und hob ihn hoch. Der Schmerz war kaum auszuhalten.
»Keine … Ahnung …«, keuchte Ben.
»Ein Tausendfüßler mit Holzbein.« Sven drückte seine Ferse als Widerlager in Bens Achsel und zog den ausgerenkten Arm fußwärts und nach außen. Mit einem hässlichen Knacken und einer Lawine aus Schmerz sprang das Gelenk zurück in die Pfanne. Ben blieb das Lachen im Halse stecken. Sein Blick war die ganze Zeit fest auf das Mädchen gerichtet. Sie war damals in seiner Klasse gewesen. In dem Moment, als er ohnmächtig wurde, fiel ihm ihr Name wieder ein.
Lena.
Lena Ahrendt.
Teil I Zwei Jahre zuvor …
Der fette Truck fuhr über den Zebrastreifen, schnitt den Schülern den Weg ab und hielt mit röhrendem Motor und qualmendem Auspuff quer vor dem Tor des Reutlinger Friedrich-Schiller-Gymnasiums an.
Lena und ihre Freundinnen waren so ins Gespräch vertieft gewesen, dass sie den Wagen nicht hatten kommen sehen. Mit laufendem Motor blieb er vor dem Haupteingang stehen und blies schwarze Rußwolken in die Luft. Die Türen flogen auf und vier Schüler stiegen aus. Ein Mädchen, drei Jungs.
Die Kowalskis. Natürlich!
Sich gegenseitig zufeixend, gingen die vier rüber zur Fahrerseite und verabschiedeten sich von ihrer Mutter, die ihren Führerschein offensichtlich im Lotto gewonnen hatte. Mit heruntergekurbelter Scheibe ließ sie sich von jedem ihrer Kinder zum Abschied einen Kuss auf die Wange drücken. Eine peinliche Szene.
»Familie Kowalski und ihre berühmten fünf Minuten. Jeden Morgen das gleiche Theater.« Ajda schüttelte den Kopf.
»Und immer müssen sie alles verstopfen mit ihrer Karre«, sagte Sandra. »Es hat deswegen schon Beschwerden gehagelt. Genutzt hat es nichts.«
»Was wohl damit zusammenhängt, dass die meisten Eltern Kunden bei Rico Kowalski sind«, sagte Lena mit schiefem Lächeln. »Immerhin versorgt er die Hälfte aller Haushalte mit Rohren, Heizungen und Bädern.«
»Wenn irgendwo ein Toilettenrohr verstopft ist – ein Anruf und Meister Kowalski pumpt die Leitung frei.« Ajda verzog den Mund. »Mit so jemandem will man es sich natürlich nicht verscherzen.«
Lena nickte düster. »Meine Eltern sind ebenfalls Kunden von ihm. Zu blöd, dass es im Landkreis kaum Konkurrenz gibt. Wer will auch freiwillig so einen Job machen?«
Eigentlich hatte sie vorgehabt, sich durch nichts und niemanden die gute Laune verderben zu lassen. Heute war Mittwoch, letzter Schultag. Morgen begannen die Ferien. Noch drei Tage, dann würde sie an der Côte d’Azur die Füße ins Mittelmeer strecken. Sommer, Sonne und das wunderbare französische Essen. Ein Traum!
Finster beobachtete sie, wie der Truck hustend und donnernd zurücksetzte, wendete und dann davonfuhr. Das Heck war mit hässlichen Aufklebern verunstaltet. Einer lautete: Einen Scheiß muss ich. Ein anderer: Baby an Bord.
»Seht euch bloß an, was die wieder tragen.« Sandra rümpfte die Nase. »Nietenrucksäcke, Armyklamotten und Schlüsselkette am Hosenbund. Das Zeug stammt doch aus der Grabbelkiste vom KiK.«
»Und dann ihre unerträgliche Art, einem beim Reden ständig auf die Pelle zu rücken«, sagte Ajda. »Immerzu müssen sie einen berühren. Erst gestern habe ich mich mit meiner älteren Schwester über Jennifer unterhalten. Darüber, wie touchy sie ist.« Sie strich über Lenas Arm und die drei Mädchen brachen in Gelächter aus.
Neben Jennifer, der Ältesten aus dem Kowalski-Clan, waren da noch die Zwillinge Noel und Liam. Ihre Namen stammten von den Gründungsmitgliedern der Band Oasis, die bekanntermaßen wüste Raufbolde und Pöbler gewesen waren. Jedenfalls gaben sie diese Geschichte gerne zum Besten, um andere Kinder einzuschüchtern. Sie waren eine Klasse unter Lena, gehörten aber zu den gefürchtetsten Schülern am Friedrich-Schiller-Gymnasium. Weil sie so rauflustig waren und immer zu zweit auftauchten. Keiner traute sich, sie in ihre Schranken zu weisen, nicht mal die aus der Oberstufe.
Der einzige Erträgliche war der Mittlere. Ben. Nicht nur war er angenehm ruhig, er hatte Lena mal die Fahrradschaltung repariert und dafür war sie ihm dankbar. Er saß eine Reihe vor ihr und war die meiste Zeit mit irgendwelchem Technikkram beschäftigt. Ein mittelmäßiger Schüler, der mehr Zeit mit dem Auseinanderschrauben von Radios und Mofas verbrachte als mit schulischen Aktivitäten.
Lena, die sich für Naturschutz einsetzte und regelmäßig bei Krötenwanderungen mithalf, hatte ihn schon mehrfach zu ihren Veranstaltungen eingeladen, ihn dort aber noch nie gesehen. Er schien keinen Pfifferling darauf zu geben, was mit der Erde passierte. Getriebe und Motoren interessierten ihn mehr als der Erhalt der Artenvielfalt.
Lärmend stiegen die Kowalskis die Treppe hoch und verteilten sich auf die verschiedenen Stockwerke. Lena folgte Ben in ihr Klassenzimmer, stellte ihre Tasche unter den Tisch und nahm Platz. Nur noch die Zeugnisvergabe, dann ging es ab in die Ferien.
Pünktlich zum Läuten der Schulglocke betrat ihre Klassenlehrerin Frau Albrecht das Schulzimmer. Alle standen auf.
»Guten Morgen, liebe 7a.«
»Gu-ten Mor-gen, Frau Al-brecht.«
»Setzt euch, Kinder.« Lächelnd blickte Frau Albrecht über die Köpfe. »Wie ihr alle wisst, ist heute die Vergabe der Ganzjahreszeugnisse und ich habe das große Vergnügen, euch mitteilen zu können, dass alle es geschafft haben.«
Applaus brandete auf. Einige Schüler rissen ihre Arme in die Luft und johlten laut. Für einige schien die Nachricht eine echte Erlösung zu sein. Lena freute sich ebenfalls, wobei sie keinen Moment lang mit einer Nichtversetzung gerechnet hatte. Sie gehörte zu den Besten ihrer Jahrgangsstufe.
Frau Albrecht sorgte mit einer Handbewegung für Ruhe. »Im nächsten Schuljahr, das am 14. September beginnt, werdet ihr also alle in die achte Klasse kommen und dabei ein neues Klassenzimmer erhalten. Infos dazu wird es zu gegebener Zeit auf der Homepage geben. Zuerst mal möchte ich euch sagen, dass ich sehr stolz auf euch bin. Trotz der Lehrerwechsel habt ihr es geschafft, den neuen Stoff gut aufzunehmen und die erforderliche Leistung zu erbringen. Nichtsdestotrotz vermisse ich bei einigen den nötigen Eifer und die Begeisterung. Sie könnten sehr viel besser sein, wenn sie nur etwas mehr Zeit auf die schulischen Arbeiten verwenden würden. Ist es nicht so, Ben?«
Ben zuckte hoch. »Hm, was?«
»Darf ich mal sehen, was du da auf deinem Schoß hast?«
Unwillig reichte er ihr eine Zeitschrift. Frau Albrecht warf einen kurzen Blick darauf. Es war eine Ausgabe der Auto Motor Sport.
Sie runzelte die Stirn. »Glaubst du, das ist die geeignete Lektüre während der Schulstunde? Ich muss euch daran erinnern, dass dies zwar der letzte Schultag ist, dass wir aber immer noch Unterricht haben. Und im Unterricht wird nicht gelesen. Du kannst dir das Heft nachher beim Direktor abholen.« Sie legte es vorne ab und atmete tief durch. »Ich kann euch nur noch einmal eindringlich ermahnen, immer gut aufzupassen und die Hausaufgaben zu machen. Das wird im kommenden Schuljahr noch entscheidender, da der Stoff systematisch aufeinander aufbaut. Das gilt besonders für dich, Ben. Du könntest so viel besser sein, wenn du nur …«
Mitten im Satz hielt sie inne. Sie sah aus, als habe sie der Schlag getroffen.
Lena zuckte zusammen. Etwas Großes und Heißes strich über sie hinweg, als hätte jemand eine Backofenklappe geöffnet. Doch die Türen und Fenster waren geschlossen. Es regte sich kein Lüftchen.
Lena fühlte, wie sich die feinen Haare auf ihren Armen aufrichteten. Es kribbelte wie von Hunderten Ameisen. Sie blickte rüber zu Sandra und erschrak. Die Frisur ihrer Freundin hatte sich in einen Pilzkopf verwandelt, so, als habe sie einen elektrischen Schlag erhalten.
Frau Albrecht, die ein Stück in Richtung Schreibtisch gewankt war, stieß einen Schrei aus. Vom Diaprojektor rechts neben der Tafel zuckte ein Blitz auf, der wie eine leuchtende Schlange über den Kartenständer wanderte. Er sprang auf die Türklinke über und ließ sie aufglühen.
»Aua!«
Nico Wendlinger hatte seine Uhr vom Handgelenk gerissen und starrte ängstlich darauf. Mit spitzem Finger tippte er sie an. Er tat so, als wäre sie lebendig. Viele von Lenas Klassenkameraden verhielten sich ähnlich. Ein durchdringendes Knistern ertönte über ihren Köpfen, umrundete sie und kreiste sie ein. Bei manchen erklangen zischende Geräusche aus den Schultaschen. Rauchwölkchen stiegen daraus hervor und es stank überwältigend nach verschmorter Elektronik. Steffi, eine weitere Freundin von Lena, öffnete ihre Tasche und leerte sie aus. Erschrocken zuckte sie zurück. Ihr Handy brannte! Sie trampelte darauf herum, bis das Feuer erloschen war.
Nach ein paar weiteren, ähnlichen Vorfällen, wurde es ruhig. Stille legte sich über das Klassenzimmer. Alle hockten da, Augen und Münder weit aufgerissen, eine giftig gelbe Wolke über ihren Köpfen.
»Nicht einatmen, Kinder!«, schrie Frau Albrecht. »Fenster auf, schnell. Los, beeilt euch, macht die Dinger auf.« Sie eilte zur Tür, nahm den Zipfel ihres Hemdes als Hitzeschutz und öffnete sie. Der Durchzug blies den Gestank davon.
Aus dem Gang ertönten Stimmen. Aufgeregte Rufe und Schreie. Auch hysterisches Weinen war zu hören.
Frau Albrecht heftete ihre Augen auf sie. »Alle bleiben auf ihren Plätzen. Niemand verlässt das Klassenzimmer. Ich bin gleich wieder da. Lena, ich möchte, dass du mich kurz vertrittst, während ich nach dem Rechten sehe.«
Lena war Klassensprecherin. Es gehörte zu ihren Aufgaben, in solchen Situationen einzuspringen. Ihr Engagement für den Naturschutz hatte ihr diesen Job eingebracht. Sie stand auf und setzte sich vorne an den Lehrertisch.
Alle redeten durcheinander, kaum dass Frau Albrecht draußen war.
»Was war das?«, fragte Ajda mit starrem Blick.
»Keine Ahnung«, erwiderte Lena. »Vielleicht ein Kurzschluss.«
»Das war kein Kurzschluss«, sagte Ben.
Ungewöhnlich, dass er überhaupt etwas sagte, wo er doch sonst immer so stumm war. Lena runzelte die Stirn. »Woher willst du das wissen?«
»Weil es Geräte erwischt hat, die gar nicht an den Stromkreis angeschlossen sind.« Er deutete auf Steffis Handy, das zwischen Stiften und Notizzetteln lag und still vor sich hin kokelte. »Checkt mal alle eure Handys!«, rief er. »Seht nach, ob irgendeines noch funktioniert.«
Die Reaktion erfolgte prompt.
»Ich krieg meins nicht an.«
»Ich auch nicht …«
»Das gibt’s doch nicht.«
»Meins ist ganz heiß.«
»Scheiße, mein brandneues iPhone ist im Arsch. Wie kann denn so etwas sein?«
In diesem Moment kam Frau Albrecht wieder herein. Ihr Gesicht glühte. Sie war sichtlich außer Atem. »Kinder, packt eure Sachen!«, rief sie. »Herr Direktor Schlösser hat den Katastrophenalarm ausgerufen. Treffen in fünf Minuten in der Mensa. Beeilt euch!«
Insgesamt dauerte es dann doch zehn Minuten, bis alle versammelt waren. Tausendzweihundert Schüler, dazu hundert Lehrer und ein paar Referendare – die Mensa platzte aus allen Nähten.
Es war ein eigener Bau mit hohen Fenstern und einer eigenen Küche. Da nicht genügend Sitzplätze vorhanden waren, stellten sich einige der Schüler entlang der Wände auf. Die Lehrer betraten die Bühne und bezogen im hinteren Teil Stellung. Sonnenschein fiel durch die große Glasfront.
Lena fand die Hitze unerträglich. Offensichtlich war die Klimaanlage ausgefallen. Ein sichtlich mitgenommener Schulleiter betrat in Begleitung eines elegant gekleideten Mannes mit blank polierten Schuhen und tadellos frisiertem Haar die Bühne. Oberschuldirektor Schlösser war knapp sechzig, korpulent und trug einen blauen Nadelstreifenanzug. Über der vergoldeten Nickelbrille wölbte sich eine Halbglatze. Seine sonst fröhlichen roten Wangen waren aschfahl. Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn. Er nahm ein Taschentuch, wischte sich die Stirn, dann hob er die Hände.
»Liebe Kollegen, liebe Schüler, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Bitte seid leise. Durch den Stromausfall wurde auch unsere Lautsprecheranlage in Mitleidenschaft gezogen.«
Es dauerte etwas, bis auch in den hinteren Reihen Ruhe eingekehrt war.
»Wie vermutlich alle mitbekommen haben, sind wir von einem massiven Stromausfall betroffen, der nicht nur die elektrische Versorgung, sondern auch das Telefonnetz sowie die Mobilfunknetze zu betreffen scheint. Zum Glück konnten wir Herrn Hartmann von der Stadtverwaltung kurzfristig dazu bewegen, ein paar Worte an euch zu richten. Ich danke Ihnen, Herr Hartmann, dass Sie so schnell zu uns kommen konnten.«
»Ist doch eine Selbstverständlichkeit, Herr Direktor. Dafür bin ich ja da.« Das Lächeln, mit dem er sich an die Schüler wandte, wirkte kalt und einstudiert.
»Wie Herr Schlösser bereits sagte, wurden wir von einem ungewöhnlichen Stromausfall betroffen. Das mag im ersten Moment besorgniserregend erscheinen, wird sich aber ganz bestimmt als harmlos herausstellen. Das Problem wird bald behoben sein. In einigen Einzelfällen scheint es zu einem Fehlverhalten der Geräte gekommen zu sein. Bitte seid vorsichtig damit und wendet euch an den zuständigen Händler. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Ich halte es für ratsam, den Unterricht an dieser Stelle zu beenden. Vertraut den Behörden und den zuständigen staatlichen Organen, sie wissen, was zu tun ist. Befolgt immer die Anweisungen der Erwachsenen und tut nichts, was andere in Aufregung versetzen könnte.« Er lächelte.
Lena war der Typ sofort unsympathisch.
Direktor Schlösser räusperte sich. »Ich möchte euch nun bitten, das Gebäude jetzt ruhig und geordnet zu verlassen und euch beim Rausgehen bei euren Klassenlehrern eure Zeugnisse abzuholen. Hoffen wir, dass der Schaden nicht allzu schlimm ist und dass der Strom bald wieder funktioniert. Ich wünsche euch schöne Ferien und einen erholsamen Urlaub. Mitte September sehen wir uns dann alle wohlbehalten wieder. Vielen Dank.« Er tupfte seine Stirn.
Lena und ihre Freundinnen gingen bei Frau Albrecht vorbei, ließen sich ihr Zeugnis aushändigen und verließen das Schulgebäude.
Draußen auf dem Parkplatz herrschte Chaos. Ganz offensichtlich hatten einige der Lehrer Probleme mit ihren Autos. Sie starteten nicht. Lena sah Herrn Limmer, ihren Biologielehrer, wie er den Schlüssel im Schloss herumdrehte, doch der Wagen gab nicht den kleinsten Mucks von sich. Herr Limmer stieg aus, öffnete die Motorhaube und blickte ratlos ins Innere.
»Hab doch gesagt, dass es was anderes ist«, hörte Lena eine Stimme hinter sich. Es war Ben. Er beobachtete Herrn Limmers verzweifelten Versuch, seinen Wagen zum Laufen zu bringen. »Hat alle Fahrzeuge erwischt, siehst du?« Er deutete nach vorne. Weitere Lehrer saßen in ihren Autos oder standen davor. Bei keinem von ihnen sprang der Motor an.
»Seltsam«, sagte Lena. »Kannst du dir das erklären?«
Ben schüttelte den Kopf. »Zumindest eines weiß ich: Was der Typ da vorhin gesagt hat, ist Bullshit. Ein normaler Stromausfall ist das nicht.«
»Hoffen wir, dass wenigstens die Busse fahren.«
An der Bushaltestelle herrschte gewaltiges Gedränge. Über hundert Schüler hatten sich versammelt und warteten auf den Bus. Der aber nicht kam. Geschlagene zwanzig Minuten standen sie sich die Beine in den Bauch. Lena reckte den Hals. Nirgendwo fuhr auch nur ein einziges Auto. Kein Flugzeug, kein Hubschrauber, nichts. Sie sah ein paar Anwohner, die sich über den Zaun hinweg mit ihren Nachbarn unterhielten. Alle waren ziemlich aufgebracht.
Die Sonne brannte unerbittlich auf sie herab. Bens Uhr, die vielleicht nur deshalb noch funktionierte, weil sie über ein mechanisches Laufwerk verfügte, zeigte an, dass schon längst einer hätte auftauchen müssen. Die Anspannung unter den Schülern war mit Händen zu greifen. Bens Geschwister Jennifer, Noel und Liam waren inzwischen ebenfalls eingetroffen.
»Ich glaube nicht, dass der noch kommt«, sagte Ben. »Ich schlage vor, wir machen uns vom Acker. Ist ein ordentlicher Marsch bis nach Hause.«
»Die ganze Strecke laufen?«, maulte Liam. »Das sind fünf Kilometer.«
»Eher sieben«, sagte Jennifer. »Trotzdem. Ben hat recht. Hat keinen Sinn, hier noch länger zu warten. Sollte der Bus doch noch kommen, können wir den Daumen rausstrecken und den Fahrer fragen, ob er uns mitnimmt.«
»Ich brauche was zu trinken«, maulte Noel. »Hab voll Durst.«
»Bestimmt finden wir unterwegs was«, sagte Jennifer. »Am Stahläcker Bach gibt es ein paar kleine Teiche. Da kannst du trinken. Das Wasser ist okay.«
Noel rümpfte die Nase. »Ich trinke doch nicht aus einem Teich. Bin ich ’ne Kuh, oder was?«
»Dann bleib halt durstig.«
Lena öffnete ihre Tasche und holte ihr Getränk heraus. »Ich habe was dabei, ich könnte dir was abgeben.«
Noels Augen verengten sich. »Was’n das?«
»Ingwerschorle. Bioqualität«, fügte sie hinzu.
»Ingwer?« Der blonde Junge mit der markanten Narbe auf der Stirn nippte daran, dann hellte sich sein Gesichtsausdruck auf. »Hey, gar nicht schlecht.«
»Darfst du behalten, wenn du willst«, sagte Lena.
»Voll cool, danke.« Er nahm einen großen Schluck und erntete dafür neidische Blicke von seinem Zwillingsbruder. Lena dachte kurz nach, dann sagte sie: »Ihr wohnt doch Richtung Ursulahochberg, oder? Darf ich mich euch anschließen? Ich habe denselben Weg.«
»Klar, warum nicht?«, sagte Ben. »Je mehr, desto besser.«
Je weiter sie sich vom Ortszentrum entfernten, desto gespenstischer wurde es. Eine Menge Menschen hatten ihre Häuser verlassen und blickten in den Himmel. Manche unterhielten sich, andere versuchten, mit ihren Handys ein Signal zu bekommen. Nirgendwo war auch nur ein einziges fahrendes Auto zu sehen. Passagiermaschinen, die Kondensstreifen erzeugten, gab es auch keine. Der Himmel über der Schwäbischen Alb war so blau wie am ersten Tag der Schöpfung. Lena war inzwischen überzeugt, dass Ben recht hatte: Das war kein normaler Stromausfall.
Während sie die Straße Richtung Osten einschlugen, fiel ihr auf, wie ruhig es war. Normalerweise war hier immer etwas zu hören, doch jetzt lag eine Totenstille über dem Ort. Weder waren Lautsprecherdurchsagen zu hören noch erklangen Radios oder Musik. Das Tal, in dem ihre Stadt lag, wirkte wie ein Trichter, der sämtliche Geräusche verstärkte. Hatte man den ersten Abschnitt des Albaufstiegs hinter sich gebracht, war es, als würde man mit einem Ballon über den Dächern schweben. Doch eine solche Stille hatte niemand von ihnen bisher erlebt.
Lena wurde es mulmig zumute. Sie musste jetzt einfach ein paar Worte reden. »Meine Eltern und ich wohnen übrigens gar nicht weit von euch entfernt, wusstet ihr das?«, sagte sie. »Luftlinie vielleicht einen Kilometer.«
»Klar wissen wir das«, sagte Jennifer augenzwinkernd. »Die piekfeine Energieplushütte am Waldrand. Unser Dad hält die Holzbauweise zwar für Schwachsinn, aber bestimmt lebt es sich dort ganz gut.«
»Tut es«, versicherte Lena. »Außerdem ist Holz ein tolles Baumaterial. Wir halten es für wichtig, nachwachsende Rohstoffe zu benutzen, um die Ressourcen zu schonen. Meine Eltern hatten diese Idee und haben es nach eigenen Plänen bauen lassen. Ein Freund von uns ist Architekt, er hat sich auf solche Gebäude spezialisiert.«
»Hat bestimmt ’ne Stange Geld gekostet«, sagte Noel.
»Meine Eltern verdienen gut.«
»Was machen die denn so?«
»Meine Mutter arbeitet im Reutlinger Energiezentrum für dezentrale Energiesysteme und Energieeffizienz. Vater hat Biologie studierte und ist jetzt beim BUND für Umweltprojekte zuständig.«
»BUND – was’n das?«, erkundigte sich Noel.
»Bund für Umwelt und Natur, du Dödel«, sagte Jennifer.
Noel grinste schief. »Ist das der Grund, warum du so komische Sachen trägst?« Er befingerte Lenas Hemd.
»Was heißt denn hier komisch? Das ist hundert Prozent Biobaumwolle aus Fair-Trade-Handel.«
»Also weich ist das Zeug ja, aber diese Farbe …« Noel grinste. »Wie nennt sich das, Schlamm?«
»Kann ja nicht jeder so schrillbuntes Zeug tragen wie du«, konterte Lena und deutete auf Noels knallrote Schuhe. »Es gibt bekanntermaßen dreiunddreißig Chemikalien, die Krebs verursachen und die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Das da gehört bestimmt dazu.«
Ben stieß ein Lachen aus. »Jetzt hat sie dich, Bro.«
»Das ist doch das alte Bundeswehrgelände, wo ihr wohnt, oder?«, fragte Lena. »Ich habe mir das mal aus der Ferne angesehen. Euer Prepper-Hof sieht ganz schön zusammengewürfelt aus.«
»Prepper?« Ben grinste. »Na, ich muss doch sehr bitten. Willst du uns beleidigen? Wenn schon, dann sind wir Survivalists.«
»Was macht euch denn zu Überlebenskünstlern? Dass ihr in einem Haufen Blechbarracken lebt?«
»Also erstens sind das keine Blechbaracken, sondern Hochseecontainer«, sagte Ben, »und zweitens leben wir dort völlig eigenständig. Wir produzieren unseren eigenen Strom, wir haben einen eigenen Brunnen, wir bauen Nahrungsmittel an, und was wir nicht selbst herstellen können, haben wir in großen Vorräten eingelagert, für den Fall, dass mal etwas passiert.«
»Ich weiß, dass uns die Leute für seltsam und verschroben halten«, sagte Jennifer, »aber das ist uns egal. Ich könnte wetten, viele von denen, die gestern noch über uns gelacht haben, sind heute neidisch auf uns.«
Lena schwieg. Wenn man den Begriff in seiner ursprünglichen Form verwendete, waren sie und ihre Eltern ebenfalls Prepper. Sie lebten unabhängig von Strom, Gas und Wasser, waren also völlig autark. Gut, sie bauten keine eigenen Nahrungsmittel an, aber ihr Plusenergiehaus versorgte sie mit allem, was nötig war. Und Lebensmittel fand man in der Natur in Hülle und Fülle – vorausgesetzt, man wusste, wo man suchen musste.
Dennoch wollte sie nicht mit den Kowalskis in einen Topf geworfen werden. Sie waren grundverschieden. Zugegeben, die Familie war nett, aber auch ziemlich prollig, laut und sehr von sich überzeugt. Dass sie in Containern wohnten, geschah aus Angst vor einer Katastrophe, nicht, weil ihnen die Umwelt am Herzen lag. Das war ein gewaltiger Unterschied.
Die Straße machte eine Kurve. Sie kamen an eine Stelle, von der aus man eine gute Aussicht runter ins Tal hatte. Unweit ihrer Schule stieg schwarzer Rauch in den Himmel.
»Seht mal, da drüben brennt es.«
Jennifer beschirmte ihre Augen. »Da war ich schon mal. Das ist die Firma für Metallgießerei.«
»Das ist aber ein großer Brand«, sagte Ben. »Normalerweise wäre da schon längst die Feuerwehr angerückt. Ich hoffe, die kriegen das in den Griff.«
»Da drüben ist noch ein Brand«, sagte Liam und deutete etwas weiter nach rechts. »Und dahinter noch einer. Überall Brände.«
Lena spitzte die Ohren. »Wisst ihr, was unheimlich ist?«
»Was denn?«, fragten alle.
»Diese Stille. Kein Martinshorn, keine Sirene, nichts.«
Alle schwiegen. Der Rauch fing an, den Himmel zu verdunkeln. Lena hatte ein ganz ungutes Gefühl im Magen. Bis jetzt hatte sie versucht, sich einzureden, dass es eine ganz einfache Erklärung für all das gab und dass bestimmt morgen alles wieder gut wäre. Doch beim Anblick dieser Rauchsäulen kamen ihr ernste Zweifel. Konnte es sein, dass sie gerade das Ende der Welt miterlebten?
Sie konnte nur hoffen, dass es ihrer Familie gut ging. Nichts wäre schlimmer für sie, als wenn ihren Liebsten etwas passiert wäre.
Doch zum Glück war nichts passiert.
Lena hatte das Grundstück noch nicht betreten, als Lupo mit freudigem Gebell auf sie zugeschossen kam, an ihr hochsprang und ihr das Gesicht ableckte. Der Druck seiner Pfoten stieß sie beinahe von den Füßen. Der Tschechoslowakische Wolfshund war halb so hoch wie sie selbst. Wild mit dem Schwanz wedelnd, rannte er um sie herum.
»Nein«, rief sie. »Aus, Lupo! Nicht freuen. Sitz!«
Er folgte ihrem Befehl, wenn auch widerwillig. Selbst im Sitzen wedelte er noch mit dem Schwanz. Der Name bedeutete einfach Wolf, gehörte aber auch zu einer Comicfigur aus der alten Heftchenserie Fix und Foxi, die ihr Papa ihr geliehen hatte. Es waren seine alten Hefte, die er wie seinen Augapfel hütete. Lupo war ein liebenswerter Vielfraß und Taugenichts. Und wie er es genoss, zwischen den Ohren gekrault zu werden!
Als ihre Eltern von Stuttgart fort und Richtung Schwäbische Alb gezogen waren, war Lena todunglücklich gewesen. Es war eine dunkle Zeit. Abschied von ihrer Schule, Abschied von ihren Freunden und ihrer vertrauten Umgebung – sie war überzeugt, niemals wieder glücklich werden zu können. Doch dann hatte sie einen Wunsch äußern dürfen und ihr war die Idee mit dem Hund gekommen. So war Lupo in ihr Leben getreten und es war die beste Entscheidung ihres Lebens. Seither hatte es keinen Tag gegeben, an dem sie alleine war. Und inzwischen hatte sie beides: Freunde und Hund. Sie hatte ihren Frieden mit dem Landleben geschlossen.
»Und, Lupo, ist denn schon jemand zu Hause? Sind Jette oder Peter da?«
Die Frage wurde umgehend beantwortet.
»Lena!« Ihre Mutter stürzte die Vordertreppe herunter, eilte auf sie zu und umarmte sie stürmisch. »Da bist du ja endlich. Ich habe mir solche Sorgen gemacht.« Noch ein herzhafter Druck, dann wurde Lena von oben bis unten begutachtet. »Wo warst du? Alles in Ordnung mit dir?«
»Alles okay, mir geht’s gut«, sagte Lena. »Sorry, dass ich so spät bin. Musste zu Fuß laufen. Die Busse sind nicht gefahren. Wo ist Papa?«
Jette schüttelte besorgt den Kopf. »Noch nicht wieder zurück. Ist in Stuttgart, auf der Suche nach einer neuen Wasserpumpe. Ich habe versucht, ihn ans Handy zu kriegen, aber die Geräte sind alle tot. Hoffentlich ist ihm nichts passiert …«
»Wolltest du heute nicht ins Institut?«
»Das war der Plan, ja. Aber dann überschlugen sich hier die Ereignisse und ich hatte alle Hände voll zu tun. Komplettausfall der Geräte im ganzen Haus. Inzwischen funktioniert das meiste wieder – abgesehen von der Wasserpumpe natürlich.« Sie neigte den Kopf. »Du sagtest, die Busse fuhren nicht? Gab es bei euch auch dieses seltsame Ereignis? Ich habe gesehen, dass es unten im Tal brennt. Ich hatte das für einen Zufall gehalten …«
Lena schüttelte den Kopf. »Totalausfall in der Elektrik. Handys, Telefone, alles tot.« Sie versuchte, sich das Ereignis noch einmal in Erinnerung zu rufen. »Es gab da diesen Moment, in dem die Luft wie mit Elektrizität aufgeladen schien. Es gab ein Knistern, dann war alles tot. Und ich meine wirklich alles.«
»Das Knistern habe ich auch gespürt!«, rief Jette aufgeregt. »Es gab einen Lichtbogen, der über die Küchenarmaturen wanderte. Manche der Geräte wurden richtig heiß. Der Kurzschluss hat einen Brand in unserer zentralen Steuerung ausgelöst. Zum Glück war ich nicht weit weg und konnte das Feuer löschen. Ich musste ein paar Platinen austauschen, jetzt arbeiten Zentralsteuerung und Fotovoltaik wieder. Ich frage mich allerdings …«
In diesem Moment erklang ein Rumpeln und Knattern von der Straße. Die Auffahrt herauf kam ein Motorrad, auf dem ein wild aussehender Fahrer saß.
Zerschlissene Lederjacke, zerbeulter Armeehelm und ein stockfleckiges Tuch, das er über Mund und Nase geschlungen hatte. Das Motorrad hustete sich die Lunge aus dem Leib, stieß schwarze Rußwolken aus und blieb dann mit einem letzten Knall vor der Einfahrt stehen.
»Warte hier.« Jette griff nach der Schaufel, die neben dem Eingang stand, und trat dem Neuankömmling entgegen. Lupo wedelte freudig mit dem Schwanz.
Lena kniff die Augen zusammen. »Papa?«
Der Fahrer stieg ab, riss sich Helm und Mundtuch vom Kopf und strich die Haare zurück. Es war tatsächlich ihr Vater. Und er sah ziemlich verdrießlich aus. Etwas unsicher auf den Beinen stehend, lag in seinen Augen etwas, das Lena noch nie zuvor gesehen hatte: Furcht.
Jette schloss ihn in ihre Arme, dann sah sie ihn verwundert an. »Ist alles in Ordnung mit dir? Was ist denn das für eine Dreckschleuder? Wo ist unser Tesla?«
»Lasst uns erst mal reingehen, okay? Ich komme um vor Durst.«