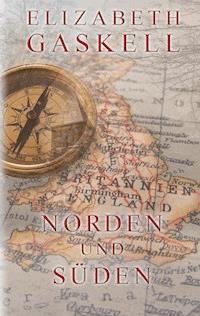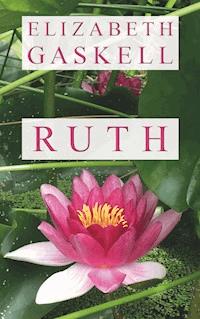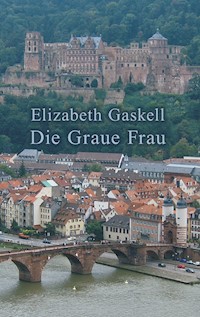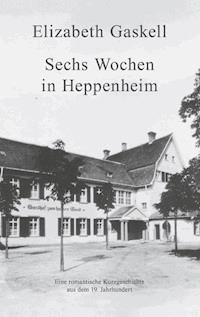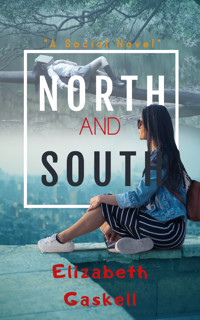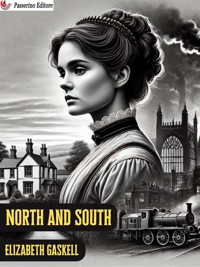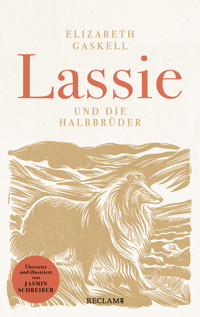8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Die Damen des fiktiven Kleinstädtchens Cranford leben in vornehmer Bescheidenheit und weigern sich entschieden, die Veränderungen des 19. Jahrhunderts anzunehmen. In ihrem Alltag gibt es aber auch genug Klatsch und Tratsch, Verwirrungen, Liebeleien und überraschende Begegnungen, die ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. In kleinen liebevollen Episoden erzählt Elizabeth Gaskell, eine enge Freundin von Charlotte Brontë, vom Landleben im viktorianischen England, von altmodischen Gewohnheiten und von stolzen Frauen, die selbstbewusst die Geschicke ihres Städtchens lenken. – Mit einer kompakten Biographie der Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Elizabeth Gaskell
Cranford
Aus dem Englischen übersetzt von Hedwig Jahn in der Bearbeitung von Barbara Fleischhauer
Reclam
2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Anja Grimm Gestaltung
Coverabbildung: © akg-images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961862-3
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020633-1
www.reclam.de
Inhalt
Unsere Gesellschaft
Der Hauptmann
Eine Liebesgeschichte aus alter Zeit
Ein Besuch bei einem alten Junggesellen
Alte Briefe
Der arme Peter
Wir sind eingeladen
»Ihre Gnaden«
Signor Brunoni
Die Panik
Samuel Brown
Verlobt!
Zahlungseinstellung
Freunde in der Not
Eine glückliche Heimkehr
Friede über Cranford
Anmerkungen
Zeittafel
Erstes Kapitel
Unsere Gesellschaft
Zuerst muss das Wichtigste gesagt werden: Cranford ist im Besitz der Amazonen. Alle Inhaber von Wohnungen über eine gewisse Miete hinaus sind Frauen. Wenn ein jung verheiratetes Paar sich in der Stadt niederlässt, dann verschwindet der Mann bald auf irgendeine Art; entweder erschrickt er zu Tode darüber, dass er der einzige Mann bei den Cranforder Abendgesellschaften ist, oder sein Verschwinden wird damit erklärt, dass er bei seinem Regiment oder auf seinem Schiffe ist oder die ganze Woche in der benachbarten großen Handelsstadt Drumble, die nur zwanzig Meilen entfernt an der Eisenbahn liegt, zu tun hat. Kurz, was auch aus den Herren werden mag, in Cranford sind sie jedenfalls nicht. Was könnten sie auch tun, wenn sie dort wären? Der Doktor freilich hat seine Praxis dreißig Meilen in der Runde und schläft in Cranford, aber es kann nicht jedermann Arzt sein. Um die schmucken Gärten voll ausgesucht schöner Blumen frei von Unkraut zu halten, um kleine Jungen fortzujagen, die sehnsüchtig nach besagten Blumen durch die Gitter gucken, um sich auf die Gänse zu stürzen, die sich gelegentlich in die Gärten wagen, wenn die Gittertüren aufgelassen worden sind, um alle literarischen und politischen Fragen zu entscheiden, ohne sich mit überflüssigen Gründen und Beweisen aufzuhalten, um genaue und gründliche Kenntnis von den Angelegenheiten aller Leute in der ganzen Gemeinde zu haben, die adretten Dienstmädchen in tadelloser Ordnung zu halten, den Armen Güte zu erweisen und sich gegenseitig in allen Notfällen wirklich freundlich beizustehen – dazu genügen die Damen von Cranford vollkommen. »Ein Mann«, so bemerkte einmal eine von ihnen zu mir, »ist einem im Hause so schrecklich im Wege!« Obgleich die Cranforder Damen genau voneinander wissen, was jede tut und lässt, ist es ihnen doch höchst gleichgültig, was andere von ihnen denken. Da nun bei jeder die Individualität, um nicht zu sagen Exzentrizität, sehr stark entwickelt ist, kommt es natürlich leicht zu Wortgefechten, aber es herrscht im Allgemeinen doch starkes Wohlwollen zwischen ihnen.
Nur gelegentlich haben die Cranforder Damen ein klein bisschen Streit, der sich in einigen gepfefferten Worten und ärgerlichem Kopfschütteln entlädt, gerade genug, dass der gleichmäßige Verlauf ihres Lebens nicht allzu sehr verflacht. Ihre Kleidung ist völlig unabhängig von der Mode; sie bemerken ganz richtig: »Was spielt es für eine Rolle, wie wir uns hier in Cranford anziehen, wo uns jedermann kennt?« Und wenn sie verreisen, so ist ihr Grund ebenso stichhaltig: »Was spielt es für eine Rolle, wie wir uns dort anziehen, wo uns niemand kennt?« Die Stoffe ihrer Kleider sind im Allgemeinen gut und einfach, und die meisten von ihnen sind fast so peinlich genau wie die säuberliche Miss Tyler seligen Angedenkens, aber ich kann versichern, dass der letzte Keulenärmel und der letzte enge Rock, der in England getragen wurde, in Cranford zu sehen war – und nicht belächelt wurde.
Ich kann von einem prachtvollen rotseidenen Familienregenschirm berichten, unter dem eine kleine sanfte alte Jungfer, die von vielen Geschwistern allein übrig geblieben war, an Regentagen in die Kirche trippelte. Gibt es etwa noch rotseidene Regenschirme in London? Es existierte eine Tradition von dem ersten her, der in Cranford zu sehen war, und die kleinen Jungen verhöhnten ihn und nannten ihn »einen Stock im Unterrock«. Vielleicht war es der von mir beschriebene rotseidene Schirm, den ein starker Vater über seinen Trupp kleiner Kinder hielt; die arme kleine Dame – die einzig Überlebende von allen – konnte ihn kaum tragen.
Dann gab es Regeln und Vorschriften für Besuche und Visiten, und sie wurden allen jungen Leuten, die sich etwa in der Stadt aufhielten, mit der Feierlichkeit mitgeteilt, mit der einmal im Jahre die alten Manx-Gesetze auf dem Tinwaldberge vorgelesen werden.
»Unsere Freunde haben sich erkundigen lassen, meine Liebe, wie Sie sich nach der gestrigen Reise befinden – fünfzehn Meilen in einem herrschaftlichen Wagen. Man wird Sie morgen noch etwas ausruhen lassen, aber übermorgen machen sie sicher ihren Besuch; halten Sie sich also von zwölf an bereit, denn von zwölf bis drei sind unsere Besuchsstunden.«
Wenn sie dann dagewesen waren, hieß es: »Es ist schon drei Tage her; ich bin überzeugt, dass Ihre Mama Ihnen gesagt hat, liebes Kind, dass man nie mehr als drei Tage warten soll, bis man einen Besuch erwidert; und ebenso, dass man nie länger als eine Viertelstunde bleiben darf.«
»Aber muss ich denn nach meiner Uhr sehen? Wie soll ich merken, dass die Viertelstunde um ist?«
»Sie müssen an die Zeit denken, mein Kind, und sie nicht über der Unterhaltung vergessen.«
Da nun jedem diese Regel vorschwebte, der einen Besuch empfing oder machte, so wurde natürlich nie von interessanten Gegenständen gesprochen. Wir begnügten uns mit kurzen Redensarten und alltäglichem Klatsch und hielten pünktlich die Zeit ein.
Ich glaube, dass einige von der guten Gesellschaft in Cranford arm waren und Schwierigkeiten hatten, durchzukommen; aber sie machten es wie die Spartaner und verbargen ihren Schmerz unter einem lächelnden Antlitz. Keiner von uns sprach von Geld, denn dieses Thema roch nach Handel und Geschäft; mochten auch einige arm sein, wir waren doch alle aristokratisch. Die Cranforder besaßen jenen freundlichen »esprit de corps«, der sie alle Unzulänglichkeiten übersehen ließ, mit denen einige unter ihnen ihre Armut zu verbergen suchten. Wenn Mrs. Forrester zum Beispiel eine Gesellschaft in ihrem Puppenhause gab und das kleine Dienstmädchen die auf dem Sofa sitzenden Damen aufstörte, damit sie das Teebrett darunter hervorholen konnte, dann nahm jede dieses Verfahren als natürlichste Sache von der Welt auf; und wir sprachen von häuslichen Formen und Zeremonien, als ob wir glaubten, dass unsere Wirtin eine regelrechte Dienerschaft mit Wirtschafterin, Hausmeister und Leutetisch besäße, anstatt des kleinen Mädchens aus der Armenschule, dessen kurze rote Arme nie stark genug gewesen wären, das Teebrett die Treppe hinaufzutragen, wenn ihre Herrin ihr nicht im Geheimen dabei geholfen hätte; dieselbe Herrin, die jetzt in vollem Staate dasaß und so tat, als ob sie nicht wüsste, was für Kuchen heraufgeschickt würden; obgleich sie es wusste und wir es wussten und sie wusste, dass wir es wussten, und wir wussten, dass sie wusste, dass wir es wussten, dass sie den ganzen Morgen damit beschäftigt gewesen war, Teekuchen und Biskuit zu backen.
Aus dieser allgemeinen, aber wohl verschwiegenen Armut und dieser so stark betonten Vornehmheit ergaben sich einige Folgen, die nicht übel waren und in vielen gesellschaftlichen Kreisen eingeführt zu werden verdienten. So begaben sich die Bewohnerinnen von Cranford unter anderem früh zur Ruhe und klapperten gegen neun Uhr abends auf ihren Holzschuhen nach Hause, begleitet von einem Laternenträger; und die ganze Stadt lag um halb elf Uhr zu Bett und war eingeschlafen. Ferner wurde es für »ordinär« (ein furchtbares Wort für Cranford) gehalten, etwas Kostspieliges an Speisen oder Getränken bei den Abendunterhaltungen vorzusetzen. Waffeln, Butterbrötchen und Biskuit waren alles, was die hochangesehene Mrs. Jamieson gab, und doch war sie eine Schwägerin des verstorbenen Grafen von Glenmire, obgleich sie solche »vornehme Sparsamkeit« walten ließ.
»Vornehme Sparsamkeit!« Wie man unwillkürlich in die Redeweise von Cranford zurückfällt! Dort war Sparsamkeit immer »vornehm« und Geldausgaben immer »ordinär und protzig«. Es war die Geschichte von den sauren Trauben, aber wir fühlten uns sehr glücklich und zufrieden dabei. Ich werde nie die allgemeine Bestürzung vergessen, als ein gewisser Hauptmann Brown nach Cranford übersiedelte und offen aussprach, dass er arm sei – nicht etwa im Flüsterton zu einem vertrauten Freunde, nachdem vorher Fenster und Türen verschlossen worden waren, sondern auf öffentlicher Straße, mit militärisch lauter Stimme! –, seine Armut als Grund anführend, dass er ein bestimmtes Haus nicht mietete. Die Damen von Cranford jammerten schon sehr über das Eindringen eines Mannes, und noch dazu eines Herrn, in ihr Gebiet. Er war ein verabschiedeter Hauptmann und hatte eine kleine Anstellung bei einer benachbarten Eisenbahn erhalten, gegen deren Anlage sich die kleine Stadt heftig aufgelehnt hatte. Und wenn er nun außer seinem männlichen Geschlecht und seiner Beziehung zu der anstößigen Eisenbahn noch so unverschämt war, von seiner Armut zu sprechen – nun, dann musste er allerdings gesellschaftlich links liegengelassen werden. Der Tod ist etwas ebenso Wahres und Alltägliches wie die Armut, und doch sprachen die Leute niemals laut davon auf der Straße. Vor vornehmen Ohren erwähnte man ein solches Wort nicht. Wir waren stillschweigend übereingekommen, nicht zu beachten, wenn eine unserer Bekannten, mit denen wir auf Besuchsfuß standen, jemals durch Armut verhindert sein würde, sich einen ihrer Wünsche zu erfüllen. Wenn wir in eine Gesellschaft zu Fuß gingen oder von ihr heimkehrten, dann taten wir es, weil der Abend so schön war oder die Luft so erfrischend; aber nicht etwa, weil Sänften so kostspielig waren. Wenn wir Kattun trugen statt Seide, dann geschah es, weil wir einen Waschstoff bevorzugten und so weiter, bis wir uns vollständig blind gegen die Tatsache gemacht hatten, dass wir alle miteinander Leute von recht beschränkten Mitteln waren. Natürlich wussten wir nun nicht, was wir mit einem Manne anfangen sollten, der von Armut sprach, als ob es keine Schande sei. Und doch gelang es Hauptmann Brown, sich eine gewisse Achtung in Cranford zu verschaffen, und es wurde ihm trotz aller gegenteiligen Beschlüsse Besuch gemacht. Ich war sehr überrascht, seine Ansichten als maßgebend angeführt zu hören, als ich etwa ein Jahr nach seiner Niederlassung in Cranford zu Besuch dorthin kam. Meine eigenen Freundinnen hatten kaum zwölf Monate vorher auf das Schärfste opponiert, als von einem Besuch bei dem Hauptmann und seinen Töchtern die Rede war, und nun wurde er sogar in den verpönten Stunden vor zwölf Uhr empfangen! Es geschah ja allerdings, um die Ursache eines rauchenden Schornsteins zu entdecken, ehe Feuer angemacht wurde, aber immerhin stieg Hauptmann Brown unerschrocken die Obertreppe hinauf, sprach mit einer für den Raum viel zu lauten Stimme und gestattete sich kleine Scherze wie ein gemütlicher Hausfreund. Er war blind gegen all die kleinen Kränkungen und Nichtachtungen gewesen, mit denen man ihn empfangen hatte. Er war freundlich gewesen, obgleich die Cranforder Damen kühl blieben; er hatte kleine sarkastische Höflichkeiten treuherzig beantwortet und mit männlicher Offenheit all das Zurückschrecken überwunden, mit dem ihm als einem Manne begegnet wurde, der sich nicht schämt, arm zu sein. Und schließlich hatte sein praktischer Menschenverstand und die Leichtigkeit, mit der er Auswege aus diesem und jenem häuslichen Dilemma fand, ihm eine außerordentliche Autorität unter den Cranforder Damen verschafft. Er ging ruhig seinen Weg weiter und merkte seine Popularität ebenso wenig wie vorher das Gegenteil; ja, ich bin überzeugt, dass er eines Tages äußerst überrascht war, als er sah, dass man einen Rat, den er im Spaß gegeben, für vollen Ernst genommen hatte.
Es handelte sich um Folgendes: Eine alte Dame besaß eine Alderney-Kuh, die sie wie eine Tochter hielt. Man konnte ihr nicht den kürzesten viertelstündigen Besuch machen, ohne von der wundervollen Milch oder der erstaunlichen Klugheit dieses Tieres zu hören. Die ganze Stadt kannte und schätzte Miss Betsy Barkers Kuh; groß war daher die Teilnahme und das Bedauern, als die arme Kuh in einem unbewachten Augenblick in eine Kalkgrube stürzte. Sie stöhnte so laut, dass man sie bald horte und herausholte, aber das arme Tier hatte inzwischen beinahe sein ganzes Haar verloren und kam in einem jämmerlichen Zustande heraus mit seiner kahlen Haut. Jedermann bedauerte das Tier, obgleich wenige bei dem komischen Anblick ein Lächeln unterdrücken konnten. Miss Barker weinte geradezu vor Kummer und Schrecken, und man sagt, dass sie daran dachte, ein Ölbad zu versuchen. Dieses Mittel war wahrscheinlich von einer der vielen Bekannten empfohlen worden, die sie um Rat fragte; aber der Vorschlag, wenn er überhaupt gemacht wurde, fiel sofort durch, als Hauptmann Brown entschied: »Besorgen Sie ihr Weste und Unterhose aus Flanell, Madame, wenn Sie sie am Leben erhalten wollen. Aber das beste wäre wohl, das arme Geschöpf gleich zu töten.«
Miss Betsy Barker trocknete die Augen und dankte dem Hauptmann herzlich; dann machte sie sich an die Arbeit, und bald darauf ging die ganze Stadt hinaus, um die Alderney zu sehen, die friedlich auf die Weide ging, ganz in dunkelgrauen Flanell gekleidet. Ich habe sie selbst manch liebes Mal beobachtet. Sieht man je in London Kühe mit grauen Flanellanzügen?
Hauptmann Brown hatte ein kleines Haus in der Vorstadt gemietet, wo er mit seinen beiden Töchtern lebte. Er muss etwas über sechzig Jahre alt gewesen sein, als ich meinen ersten Besuch in Cranford machte, nachdem ich nicht mehr ständig dort wohnte. Aber er hatte noch eine kräftige, durchtrainierte, elastische Gestalt; trug den Kopf militärisch steif im Nacken und hatte einen leichten Gang, der ihn viel jünger erscheinen ließ, als er war. Seine älteste Tochter sah beinahe ebenso alt aus wie er selbst und verriet so, dass er älter war, als er aussah. Miss Brown muss damals vierzig Jahre gezählt haben; sie hatte einen kränklichen, schmerzlichen und sorgenvollen Ausdruck im Gesicht, und es schien, als ob ihr alle jugendliche Heiterkeit längst entschwunden sei. Auch in ihrer Jugend muss sie unschön gewesen sein, mit scharfen Gesichtszügen. Miss Jessie Brown war zehn Jahre jünger als ihre Schwester und um zwanzig Prozent hübscher. Ihr Gesicht war rund und hatte Grübchen. Miss Jenkyns sagte einmal in voller Wut gegen Hauptmann Brown (den Grund will ich gleich erzählen), dass sie glaubte, »es sei Zeit für Miss Jessie, mit ihren Grübchen aufzuhören und nicht immer zu versuchen, wie ein Kind auszusehen«. Es lag wirklich etwas Kindliches in ihrem Antlitz, und ich glaube, es wird darin bleiben, und sollte sie auch hundert Jahre alt werden. Sie hatte große verwunderte blaue Augen, die einen gerade anblickten, eine nicht besonders schön geformte, etwas stumpfe Nase und rote, frische Lippen; zudem trug sie ihr Haar in kleinen Lockenreihen, was noch mehr zu dem kindlichen Eindruck beitrug. Ich weiß nicht, ob sie wirklich hübsch war oder nicht, aber ich mochte ihr Gesicht gern, und so ging es jedermann; und ich glaube, sie konnte nichts für ihre Grübchen. Sie hatte etwas von ihres Vaters flottem Wesen in Gang und Haltung, und jeder weibliche Beobachter hätte als kleinen Unterschied in der Kleidung beider Schwestern entdecken können, dass Miss Jessie vielleicht zwei Pfund mehr im Jahre dafür ausgab als die ältere Miss Brown. Zwei Pfund waren aber eine große Summe in Hauptmann Browns Jahresbudget.
Dies war der Eindruck, den die Familie Brown auf mich machte, als ich sie zum ersten Mal alle zusammen in der Kirche von Cranford sah. Den Hauptmann hatte ich schon vorher getroffen – bei Gelegenheit des rauchenden Schornsteins, den er durch eine einfache Veränderung im Heizrohr in Ordnung gebracht hatte. In der Kirche hielt er während der Morgenhymne sein Doppellorgnon an die Augen und hob dann den Kopf in die Höhe und sang laut und fröhlich mit. Er sang die Responsen lauter als der Küster – ein alter Mann mit schwacher pfeifender Stimme, der sich wohl durch den sonoren Bass des Hauptmanns zurückgesetzt fühlte und nun höher und höher quiekte.
Beim Hinausgehen aus der Kirche erwies der galante Hauptmann seinen Töchtern die zarteste Aufmerksamkeit. Er nickte und lächelte seinen Bekannten zu; aber keinem schüttelte er die Hand, bevor er Miss Brown geholfen, ihren Regenschirm aufzuspannen, und ihr das Gebetbuch abgenommen hatte; dann wartete er geduldig, bis sie mit nervös zitternden Händen ihr Kleid aufgerafft hatte, um durch die nassen Straßen nach Hause zu gehen.
Zu gern hätte ich gewusst, was die Cranforder Damen mit dem Hauptmann bei ihren Gesellschaften anfingen. Wir hatten uns früher oft gefreut, dass kein Herr vorhanden war, auf den Rücksicht genommen werden und den man bei den Spielpartien unterhalten musste. Wir hatten uns glücklich geschätzt, dass unsere Abende so gemütlich waren, und bei unserer Vorliebe für Vornehmheit und unserer Abneigung gegen die Männerwelt hatten wir uns beinahe zu der Überzeugung durchgerungen, dass es etwas »Ordinäres« wäre, ein Mann zu sein. Als ich nun erfuhr, dass meine Freundin und Wirtin, Miss Jenkyns, mir zu Ehren eine Gesellschaft geben würde und Hauptmann Brown und seine Töchter eingeladen werden sollten, war ich sehr gespannt, wie der Abend verlaufen würde. Spieltische, mit grünem Fries bezogen, wurden wie gewöhnlich schon bei Tage bereitgestellt; es war die dritte Woche im November, und der Abend fing schon um vier Uhr an. Lichter und neue Spiele Karten wurden auf jeden Tisch gelegt. Das Feuer brannte im Kamin, das adrette Dienstmädchen hatte die letzten Anweisungen erhalten, und wir standen in unseren Sonntagskleidern, jede mit einem Kerzenanzünder in der Hand, bereit, uns sofort auf die Lichter zu stürzen, sobald das erste Klopfen an der Haustür ertönte. Gesellschaften in Cranford waren festliche Gelegenheiten. Die Damen fühlten sich sehr gehoben, wenn sie in ihren besten Toiletten zusammenkamen. Sobald drei erschienen waren, setzten wir uns zu einer Partie »Préférence« nieder, wobei ich die unglückliche vierte war. Die nächsten vier Ankömmlinge wurden sofort an einen andern Tisch gesetzt, und dann stellte man die Teebretter, die ich morgens in der Speisekammer gesehen hatte, mitten auf die Spieltische. Das Porzellan war so dünn wie Eierschalen, das altmodische Silber glänzend blank geputzt, aber das Gebäck war von der einfachsten Art. Während das Geschirr noch auf den Tischen stand, traten Hauptmann Brown und seine Töchter ein, und ich konnte sehen, dass der Hauptmann bei allen anwesenden Damen beliebt war. Gerunzelte Brauen glätteten sich, scharfe Stimmen milderten sich bei seiner Annäherung. Miss Brown sah leidend und niedergeschlagen, beinahe schwermütig aus. Miss Jessie dagegen lächelte wie gewöhnlich und schien beinahe ebenso beliebt wie ihr Vater zu sein. Er übernahm sofort die Rolle des aufmerksamen Herrn; sorgte für jedermann, erleichterte dem hübschen Hausmädchen sein Amt, indem er auf leere Tassen und butterbrotlose Damen aufpasste, und tat alles mit einer so leichten und würdevollen Art; als ob es sich ganz von selbst verstände, dass die Starken für die Schwachen in allen Dingen zu sorgen haben, wobei er doch seine volle männliche Würde bewahrte. Er spielte um drei Pfennige mit einem so ernsten Interesse, als ob es sich um Pfunde gehandelt hätte, und hatte bei all seiner Aufmerksamkeit für die übrigen Gäste doch ein Auge auf seine leidende Tochter; denn leidend war sie meiner Ansicht nach wirklich, obgleich sie manchen nur reizbar erschien. Miss Jessie konnte nicht Karten spielen, aber sie plauderte mit den Nichtspielern, die vor ihrem Erscheinen zu mürrischer Laune geneigt gewesen waren. Sie sang auch und begleitete sich auf einem alten klapprigen Klavier, das meiner Ansicht nach in seiner Jugend ein Spinett gewesen war. Miss Jessie sang »Jock of Hazeldean«, ein bisschen unrein, aber wir waren alle nicht musikalisch, obgleich Miss Jenkyns – allerdings gegen den Takt – Takt schlug, um so zu erscheinen.
Das war sehr nett von Miss Jenkyns, denn ich hatte kurz vorher gesehen, dass sie sehr ärgerlich gewesen war über Miss Jessie Brown, die offen zugegeben hatte (die Unterhaltung drehte sich um Shetlandwolle), dass sie einen Onkel habe, einen Bruder ihrer Mutter, der einen Laden in Edinburgh besitze. Miss Jenkyns versuchte dieses Geständnis durch einen schrecklichen Hustenanfall zu übertönen, denn die hochangesehene Mrs. Jamieson saß am Spieltische dicht neben Miss Jessie, und was würde sie sagen oder denken, wenn sie entdeckte, dass sie sich im selben Zimmer mit der Nichte eines Ladenbesitzers befand! Aber Miss Jessie Brown (die leider kein Taktgefühl besaß, wie wir alle am nächsten Morgen feststellten) ließ sich nicht stören und versicherte Miss Pole, dass sie ihr die gewünschte Shetlandwolle leicht verschaffen könnte »durch meinen Onkel, der die größte Auswahl an Shetlandwaren in ganz Edinburgh besitzt«. Um die Gedanken auf andere Dinge zu lenken, schlug Miss Jenkyns vor, zu musizieren, und ich wiederhole daher, dass es sehr nett von ihr war, den Takt zum Gesang zu schlagen.
Als die Teebretter von neuem mit Biskuits und Wein erschienen, pünktlich um drei Viertel neun, entstand ein allgemeines Gespräch über die verschiedenen Spiele und Stiche, und nach und nach brachte der Hauptmann ein wenig Literatur aufs Tapet.
»Haben Sie einige Nummern der ›Pickwickier‹ gesehen?«, sagte er. »Etwas ganz Famoses!«
Nun war Miss Jenkyns die Tochter des verstorbenen Pfarrers von Cranford, und aufgrund einer Anzahl von Predigtmanuskripten und einer ziemlich guten theologischen Bibliothek hielt sie sich für literarisch gebildet und fasste jede Unterhaltung über Bücher als eine ihr geltende Herausforderung auf. Sie entgegnete daher: Ja, sie hätte sie gesehen und könnte sogar sagen, sie habe sie gelesen.
»Und wie denken Sie darüber?«, rief Hauptmann Brown aus. »Sind sie nicht vorzüglich?«
So in die Enge getrieben, blieb Miss Jenkyns nichts anderes übrig, als zu reden.
»Ich muss sagen, dass sie in keiner Weise an Doktor Johnson heranreichen. Indessen, der Autor ist ja noch jung. Wenn er Ausdauer hat und sich den großen Gelehrten zum Vorbild nimmt, dann kann vielleicht noch etwas aus ihm werden.« Dies war augenscheinlich zuviel für Hauptmann Brown, das konnte er nicht ruhig hinnehmen. Ich sah, wie er sich mühsam beherrschte, bis Miss Jenkyns mit ihrer Rede zu Ende war.
»Es ist ganz etwas anderes, meine Gnädige«, begann er.
»Dessen bin ich mir vollständig bewusst«, erwiderte sie. »Dafür mache ich auch Konzessionen, Hauptmann Brown.«
»Erlauben Sie mir, Ihnen nur eine Stelle aus der letzten Nummer vorzulesen«, bat er. »Ich bekam sie erst heute morgen und glaube nicht, dass schon jemand von den Anwesenden sie gelesen hat.«
»Ganz wie es Ihnen beliebt«, sagte sie, eine resignierte Miene annehmend. Er las den Bericht über das Gelage, das Sam Weller in Bath gegeben hatte. Einige von uns lachten herzlich. Ich wagte das nicht, weil ich im Hause zu Besuch war. Miss Jenkyns saß mit geduldigem Ernst da. Als der Hauptmann zu Ende war, wandte sie sich zu mir und sagte mit milder Würde: »Meine Liebe, holen Sie mir ›Rasselas‹ aus dem Bücherzimmer.«
Als ich ihr das Buch brachte, wandte sie sich an Hauptmann Brown: »Nun erlauben Sie mir, Ihnen eine Stelle vorzulesen, dann können die Damen zwischen Ihrem Liebling Boz und Doktor Johnson entscheiden.«
Sie las eine der Unterhaltungen zwischen Rasselas und Imlac mit hochgeschraubter, majestätischer Stimme, und als sie geendet hatte, sagte sie: »Ich glaube, dass ich nun in meiner Vorliebe für Doktor Johnson als Romanschriftsteller gerechtfertigt bin.«
Der Hauptmann schnitt ein Gesicht und trommelte auf dem Tisch, sagte aber kein Wort. Sie gedachte ihm noch einen letzten Hieb zu versetzen, indem sie hinzufügte: »Ich halte es für ordinär und unter der Würde eines guten Schriftstellers, ein Werk in Fortsetzungen zu veröffentlichen.«
»Wie wurde denn der ›Rambler‹ veröffentlicht, Madame?«, fragte Hauptmann Brown mit so leiser Stimme, dass ich nicht glaubte, dass Miss Jenkyns es hören konnte.
»Doktor Johnsons Stil ist vorbildlich für junge Anfänger. Mein Vater empfahl ihn mir, als ich anfing, Briefe zu schreiben. Ich habe meinen eigenen Stil nach ihm gebildet und empfehle ihn Ihrem Günstling ganz besonders.«
»Es würde mir sehr leid für ihn tun, wenn er seinen Stil gegen so ein pomphaftes Geschreibsel vertauschte!«, entgegnete Hauptmann Brown.
Miss Jenkyns empfand dies als persönliche Kränkung, und zwar in einer Weise, von der sich der Hauptmann Brown nichts hatte träumen lassen. Briefeschreiben wurde von ihr selbst und ihren Freundinnen für ihre starke Seite gehalten. Ich habe das Konzept so manchen Briefes auf die Schiefertafel geschrieben und korrigiert gesehen, bevor sie »schnell die halbe Stunde vor Abgang der Post benutzte, um ihren Freundinnen dies oder jenes mitzuteilen«, und Dr. Johnson war, wie sie sagte, ihr Vorbild bei diesen Schriftwerken. Sie richtete sich voller Würde auf und beantwortete Hauptmann Browns letzte Bemerkung nur, indem sie mit ausdrücklicher Betonung jeder Silbe sagte: »Ich ziehe Doktor Johnson Mister Boz vor.«
Man sagt – aber ich kann nicht dafür einstehen –, dass Hauptmann Brown sotto voce geäußert haben soll: »Verd-ter Doktor Johnson!« Falls das stimmen sollte, muss es ihm jedenfalls später leid getan haben, das bewies er dadurch, dass er an Miss Jenkyns’ Lehnstuhl herantrat und versuchte, sie in eine Unterhaltung über ein harmloseres Thema zu verwickeln. Aber sie blieb unerbittlich. Am nächsten Tage machte sie die schon erwähnte Bemerkung über Miss Jessies Grübchen.
Zweites Kapitel
Der Hauptmann
Es war unmöglich, einen Monat in Cranford zu leben, ohne auf das Genaueste über die Gewohnheiten aller Einwohner unterrichtet zu sein; und so wusste ich denn lange, ehe mein Besuch zu Ende ging, allerlei über das Brown’sche Trio. In Bezug auf ihre Armut war nichts Neues zu entdecken, denn sie hatten von Anfang an offen und einfach darüber gesprochen. Sie machten kein Geheimnis aus der Notwendigkeit, sparsam zu leben. Was aber noch zu entdecken blieb, war des Hauptmanns unendliche Herzensgüte und die vielfältige Art und Weise, wie er sie unbewusst offenbarte. Einige kleine Geschichten davon wurden noch längere Zeit, nachdem sie sich ereignet hatten, besprochen. Da wir nicht viel lasen und alle Damen mit guten Dienstboten versehen waren, trat oft eine wahre Hungersnot an Unterhaltungsstoff ein. Wir besprachen daher auf das Eingehendste den Vorfall, dass der Hauptmann einer armen alten Frau an einem Sonntag bei schlechtem Wetter und schlüpfrigem Boden ihre Mittagsmahlzeit aus der Hand genommen hatte. Er traf sie bei der Rückkehr vom Backhaus, als er selbst aus der Kirche kam, und bemerkte ihren unsicheren Gang; mit der Würde, mit der er alles tat, befreite er sie von ihrer Last, ging mit ihr die Straße entlang und brachte ihr gebackenes Hammelfleisch mit Kartoffeln sicher nach Hause. Man fand dies sehr exzentrisch und erwartete eigentlich, dass er am Montagvormittag eine Visitentour machen würde, um sich vor dem Cranforder Schicklichkeitssinn zu entschuldigen; aber es fiel ihm gar nicht ein, und nun entschied man, dass er sich schämte und sich nicht sehen lassen wollte. Mit liebevollem Mitleid begannen wir zu sagen: »Nun, schließlich zeigt die Begebenheit vom Sonntagmorgen, wie viel Herzensgüte er besitzt«, und es wurde beschlossen, dass er bei seinem nächsten Erscheinen in unserer Gesellschaft getröstet werden sollte; aber siehe da, er trat bei uns ein ohne das mindeste Gefühl von Scham, sprach so laut und volltönend wie nur je, sein Kopf war zurückgeworfen, seine Perücke so zierlich und wohlgelockt wie gewöhnlich, und wir mussten einsehen, dass er das ganze Erlebnis vom Sonntag vergessen hatte.
Miss Pole und Miss Jessie Brown waren durch die Shetlandwolle und neue Strickmuster näher bekannt geworden, und so kam es, dass ich bei einem längeren Besuch bei Miss Pole mehr von der Brown’schen Familie erfuhr als während meines ganzen Aufenthaltes bei Miss Jenkyns, die nie ganz über Hauptmann Browns nach ihrer Meinung herabsetzende Bemerkungen über Dr. Johnsons literarische Qualitäten hinwegkam. Ich fand, dass Miss Brown ernstlich krank war an einem unheilbaren chronischen Leiden, das ihr viele Schmerzen verursachte, die ihrem Gesicht den gezwungenen Ausdruck gaben, den ich für schlechte Laune gehalten hatte. Schlechter Laune war sie auch sicher bisweilen, wenn die durch ihr Leiden hervorgerufene Reizbarkeit sich bis ins Unerträgliche steigerte. Miss Jessie hatte in diesen Zeiten beinahe noch mehr Nachsicht und Geduld mit ihr als bei den unabänderlich darauf folgenden bitteren Selbstvorwürfen. Miss Brown pflegte sich dann nicht nur ihres heftigen und reizbaren Charakters wegen anzuklagen, sondern auch weil sie die Schuld trug, dass Vater und Schwester gezwungen waren, sich aufs Äußerste einzuschränken, um ihr all die kleinen Erleichterungen zu gestatten, die ihr Zustand verlangte.
So gern hätte sie für die beiden Opfer gebracht und ihre Sorgen erleichtert; und von Natur großmütig, empfand sie ihr Unvermögen mit tiefer Bitterkeit. Miss Jessie und ihr Vater ertrugen dies alles nicht nur mit Gelassenheit, sondern geradezu mit Zärtlichkeit. Ich vergab Miss Jessie ihr unreines Singen und ihre etwas zu jugendliche Kleidung, als ich sie zu Hause sah. Ich bemerkte auch, dass Hauptmann Browns dunkle Brutusperücke und der (ach, nur zu fadenscheinige) wattierte Rock Überbleibsel der militärischen Eleganz seiner Jugend waren, die er nun auftrug. Er wusste sich immer zu helfen und verstand sich auf allerlei Dinge, die er vom Kasernenleben her kannte. So behauptete er unter anderem, dass ihm niemand anderes die Stiefel gut genug putze. Aber er hielt sich auch nicht für zu gut, dem Dienstmädchen auf alle mögliche Art die Arbeit zu erleichtern – er wusste doch wahrscheinlich, dass die Krankheit seiner Tochter die Stelle sehr schwer machte.
Er versuchte bald nach dem denkwürdigen Streit, mit Miss Jenkyns Frieden zu schließen, indem er ihr eine hölzerne Kaminschaufel (eigener Arbeit) schenkte, da er sie hatte sagen hören, wie sehr das Kratzen einer eisernen sie ärgerte. Sie empfing das Geschenk kühl und dankte ihm sehr formell. Als er gegangen war, bat sie mich, es in die Rumpelkammer zu bringen, denn sie fühlte wahrscheinlich, dass ein Geschenk von einem Manne, der Boz dem Dr. Johnson vorzog, ihr nicht minder auf die Nerven fallen würde als eine eiserne Feuerschaufel.
So standen die Dinge, als ich Cranford verließ, um nach Drumble zu ziehen. Ich blieb jedoch mit mehreren Damen im Briefwechsel. Sie hielten mich über die Ereignisse in der lieben kleinen Stadt au fait. Da war zunächst Miss Pole, die jetzt ebenso im Häkeln aufging wie früher im Stricken und deren Briefe gewöhnlich als Hauptinhalt hatten: »aber vergessen Sie nicht das weiße Garn von Flint«; und nach jeder neuen Nachricht kam ein Auftrag für irgendeine Häkelarbeit, die ich ihr besorgen sollte. Miss Mathilda Jenkyns (die es nicht übel nahm, wenn man in Abwesenheit ihrer Schwester Miss Matty zu ihr sagte) schrieb nette freundliche Plauderbriefe; wagte hier und da eine eigene Meinung zu äußern, machte sich aber sogleich Vorwürfe darüber und bat mich entweder, nicht zu erwähnen, was sie gesagt, da Deborah anders darüber denke, wie sie sehr gut wisse; oder sie brachte ein Postskriptum an, des Inhalts, dass sie noch einmal mit Deborah über die Sache gesprochen habe, nachdem sie das Obige geschrieben, und ganz überzeugt sei, dass – und so weiter (hier folgte dann ein Widerruf aller im Briefe ausgesprochenen Ansichten). Dann schrieb mir auch Miss Jenkyns – Debórah, wie sie sich gern von Miss Matty nennen ließ, da ihr Vater einmal gesagt hatte, dass der hebräische Name so ausgesprochen werden müsste. Im stillen glaube ich, dass sie sich die hebräische Prophetin zum Vorbild nahm, und ihr Charakter hatte auch wirklich etwas von deren strengem Wesen, natürlich mit einigen Konzessionen an moderne Sitten und Kleidung. Miss Jenkyns trug eine Krawatte und ein kleines Hütchen wie eine Jockeimütze und hatte überhaupt etwas entschieden Männliches in ihrer Erscheinung, obwohl sie die moderne Idee von der Gleichberechtigung der Frauen verabscheut haben würde. Gleichheit – ja wahrhaftig, sie wusste, dass sie den Männern überlegen waren. Aber um auf ihre Briefe zurückzukommen, muss ich sagen, dass etwas von ihrer eigenen Stattlichkeit und Größe darinlag. Ich habe sie kürzlich wieder durchgesehen (die gute Miss Jenkyns, wie sehr habe ich sie verehrt!) und will hier einen kleinen Auszug daraus mitteilen, umso mehr, als es sich um unseren Freund, Hauptmann Brown, darin handelt. –
»Mrs. Jamieson hat mich soeben verlassen und teilte mir im Verlauf unserer Unterhaltung mit, dass sie gestern einen Besuch von dem ehemaligen Freunde ihres verehrungswürdigen Gatten, Lord Mauleverer, erhalten habe. Sie werden nicht leicht erraten, was Seine Lordschaft in den Bereich unserer kleinen Stadt führte. Er kam, um Hauptmann Brown zu besuchen, mit dem Seine Lordschaft, wie es scheint, in den afrikanischen Kriegen bekannt geworden war und der den Vorzug gehabt hatte, eine große Gefahr vom Haupte Seiner Lordschaft abzuwenden, fern am Kap der Guten Hoffnung, das seinen Namen zu Unrecht trägt. Sie wissen, wie sehr es unserer Freundin, Mrs. Jamieson, an harmloser Neugier mangelt, und werden daher nicht überrascht sein, dass sie mir nichts Näheres über die fragliche Gefahr mitteilen konnte. Ich muss gestehen, dass ich besorgt darum war, wie Hauptmann Brown einen so hochgestellten Gast in seinem beschränkten Haushalt aufnehmen könne, und es beruhigte mich, als ich hörte, dass Seine Lordschaft sich zur Ruhe und zu hoffentlich erquickendem Schlummer in den Gasthof ›Zum Engel‹ zurückzog, aber die Brown’schen Mahlzeiten während der zwei Tage teilte, an denen er Cranford durch seine erhabene Gegenwart beehrte. Mrs. Johnson, die Frau unseres Metzgers, teilte mir mit, dass Miss Jessie eine Lammkeule gekauft, aber von irgendeiner weiteren Vorbereitung zum Empfang eines so hochgestellten Besuches konnte ich nichts in Erfahrung bringen. Vielleicht bewirteten sie ihn mit ›Der Speise der Vernunft und dem Trank der Seele‹; und wir, die wir uns über Hauptmann Browns traurigen Mangel an Verständnis für die reinen, unverfälschten Quellen der englischen Sprache einig sind, können ihm gratulieren, dass ihm die Gelegenheit geboten wurde, seinen Geschmack durch die Unterhaltung mit einem eleganten und hochgebildeten Mitglied der britischen Aristokratie zu verbessern. Aber wer ist ganz frei von menschlichen Schwächen?«
Miss Pole und Miss Matty schrieben mir mit gleicher Post. Eine so große Neuigkeit wie Lord Mauleveres Besuch ließen sich die Cranforder Briefeschreiberinnen nicht entgehen, sondern nutzten die Gelegenheit weidlich aus. Miss Matty entschuldigte sich, dass sie zugleich mit ihrer Schwester schreibe, die so viel besser verstände, die Cranford zuteil gewordene Ehre zu schildern; aber trotz etwas mangelhafter Orthographie gab mir Miss Mattys Bericht den besten Eindruck von der Aufregung, die durch den Besuch des Lords hervorgerufen worden war; denn mit Ausnahme der Leute im »Engel«, der Familie Brown, Mrs. Jamiesons und eines kleinen Jungen, auf den Seine Lordschaft losgewettert hatte, weil er einen schmutzigen Reifen gegen seine aristokratischen Beine getrieben, konnte ich von niemandem hören, mit dem sich Seine Lordschaft unterhalten hätte.
Mein nächster Besuch in Cranford fand im Sommer statt. Es waren weder Geburten noch Todesfälle, noch Heiraten vorgefallen, seit ich zuletzt dort war. Jeder wohnte noch in demselben Hause und trug noch ziemlich dieselben gutgeschonten altmodischen Kleider. Das größte Ereignis war, dass Miss Jenkyns sich einen neuen Teppich für den Salon angeschafft hatte. Wie viel Arbeit machte es aber Miss Matty und mir, die Sonnenstrahlen zu verscheuchen, die nachmittags durch das Fenster, vor dem keine Rollladen waren, gerade auf den Teppich fielen! Wir breiteten Zeitungsblätter auf die Stellen aus und setzten uns mit Buch oder Handarbeit dazu; aber siehe, nach einer Viertelstunde war die Sonne weitergerückt und brannte auf eine neue Stelle, worauf wir wieder niederknieten, um die Zeitungen weiterzuschieben. Den ganzen Vormittag eines Tages, an dem Miss Jenkyns eine Gesellschaft gab, waren wir eifrig damit beschäftigt, nach ihren Angaben Stücke Papier auszuschneiden und zusammenzuheften, um kleine Fußwege nach den einzelnen für die Gäste bereitgestellten Stühlen zu bilden, damit ihre Schuhe nicht den Teppich beschmutzten oder verdarben. Legt man in London jemals für jeden Gast einen Papierweg?
Hauptmann Brown und Miss Jenkyns waren nicht sehr freundlich miteinander. Der literarische Streit, dessen Anfang ich miterlebt hatte, war ein wunder Punkt, dessen leiseste Berührung sie erregte. Es war die einzige Meinungsverschiedenheit, die sie je gehabt, aber sie genügte. Miss Jenkyns konnte es nicht lassen, auf Hauptmann Brown einzureden, und wenn er auch nicht darauf antwortete, so trommelte er doch mit den Fingern, was sie als Nichtachtung Dr. Johnsons übel nahm. Er übertrieb es ein wenig mit seiner Vorliebe für die Schriften von Boz; schritt ganz vertieft in sie durch die Straßen, so dass er einmal beinahe Miss Jenkyns umgerannt hätte; und obgleich er sich ernst und aufrichtig entschuldigte und schließlich ja nichts weiter getan hatte, als sie und sich selbst zu erschrecken, gestand sie mir doch, dass es ihr lieber gewesen wäre, er hätte sie umgestoßen, wenn er nur etwas literarisch Höherstehendes lesen wollte. Der arme wackere Hauptmann! Er sah älter und sorgenvoller aus, und seine Sachen waren sehr abgetragen. Aber er schien ebenso frisch und heiter zu sein wie sonst, solange man ihn nicht nach dem Befinden seiner Tochter fragte.
»Sie leidet sehr viel und wird noch mehr leiden müssen; wir tun, was wir können, um ihre Schmerzen zu lindern – nun, wie Gott will.« Bei diesen Worten nahm er seinen Hut ab. Ich erfuhr durch Miss Matty, dass wirklich alles geschehen war, was man nur tun konnte. Man hatte einen in der ganzen Gegend berühmten Arzt kommen lassen, und alle seine Vorschriften wurden ohne Rücksicht auf die Kosten befolgt. Miss Matty war überzeugt, dass Vater und Schwester sich vieles versagten, um es der Kranken angenehmer zu machen, aber sie sprachen nie darüber; und was Miss Jessie betraf! – »Ich halte sie für einen wahren Engel«, sagte Miss Matty ganz gerührt. »Es ist zu schön, zu sehen, wie sie Miss Browns schlechte Laune erträgt und was für ein heiteres Gesicht sie macht, nachdem sie die ganze Nacht aufgewesen und beinahe immerzu ausgeschimpft worden ist. Und doch sieht sie, wenn der Hauptmann zum Frühstück kommt, so nett und ordentlich aus, als ob sie die ganze Nacht im Bett der Königin geschlafen hätte. Meine Liebe, Sie würden nicht über ihre steifen Löckchen oder ihre rosa Schleifen lachen, wenn Sie sie so sehen könnten, wie ich sie gesehen habe.« Ich konnte nichts tun, als lebhafte Reue zu empfinden und Miss Jessie beim nächsten Wiedersehen doppelt achtungsvoll zu begrüßen. Sie sah blass und elend aus, und ihre Lippen zuckten, als ob sie sich sehr schwach fühlte, während wir von ihrer Schwester sprachen. Aber sie heiterte sich auf und unterdrückte die Tränen, die in ihren hübschen Augen schimmerten, als sie sagte: »Man kann gar nicht genug die Güte und Freundlichkeit in Cranford rühmen! Ich glaube, es kommt nicht vor, dass jemand einmal ein besseres Mittagessen als gewöhnlich hat, ohne dass meiner Schwester ein Schüsselchen vom Besten davon geschickt würde. Die ärmeren Leute bringen uns sogar ihr erstes Gemüse für sie. Dabei reden sie kurz und grob, als ob sie sich dessen schämten; aber es geht mir oft zu Herzen, wenn ich ihre Fürsorglichkeit sehe.«
Jetzt kamen die Tränen reichlich geflossen, aber nach ein paar Minuten schalt sie sich schon deshalb aus, und als sie fortging, war sie wieder die alte fröhliche Miss Jessie.
»Aber warum tut dieser Lord Mauleverer denn nicht etwas für den Mann, der ihm das Leben gerettet hat?«, fragte ich.
»Ja, sehen Sie, ohne Veranlassung spricht Hauptmann Brown nie von seiner Armut; er stolziert so vergnügt und glücklich wie ein Prinz mit Seiner Lordschaft umher; und da sie nie durch Entschuldigungen auf ihr Essen aufmerksam machten und Miss Brown sich in dieser Zeit besser fühlte und alles einen heiteren Anstrich hatte, so glaube ich, dass Seine Lordschaft gar nicht ahnte, wie viel Sorge im Hintergrunde schlummerte. Im Winter schickte er ihnen häufig Wildbret, aber jetzt ist er ins Ausland gereist.«
Ich hatte oft Gelegenheit, zu beobachten, wie in Cranford jeder Rest und jede Kleinigkeit ausgenutzt wurden. Man sammelte die Rosenblätter, bevor sie abfielen, um ein Potpourri für jemanden damit zu füllen, der keinen Garten besaß; kleine Büschel Lavendelblüten wurden an Bekannte in der Stadt geschickt, um sie in die Kommoden zu streuen oder in einer Krankenstube damit zu räuchern. Dinge, die manch einer verachtet hätte, und kleine Dienste, die kaum der Mühe wert erschienen, wurden in Cranford hochgehalten. Miss Jenkyns steckte einen Apfel voll Gewürznelken, der in Miss Browns Zimmer heiß gemacht werden und einen angenehmen Duft verbreiten sollte, und bei jeder Nelke, die sie hineinsteckte, äußerte sie einen Johnson’schen Ausspruch. Sie konnte überhaupt niemals an Browns denken, ohne von Johnson zu sprechen, und da sie ihr damals gerade selten aus dem Sinn kamen, so hörte ich manchen tönenden dreigipfligen Satz.
Hauptmann Browns besuchte uns eines Tages, um Miss Jenkyns für viele kleine Freundlichkeiten zu danken, von denen ich erst bei dieser Gelegenheit erfuhr. Er war plötzlich ein alter Mann geworden; seine tiefe Bassstimme zitterte ein wenig; seine Augen waren matt, das Gesicht tief gefurcht. Er sprach nicht hoffnungsfreudig vom Zustand seiner Tochter – das war unmöglich –, aber er sagte einige wenige Worte darüber mit männlicher, frommer Ergebung. Zweimal erwähnte er: »Was Jessie uns gewesen ist, weiß Gott allein!« Und nach dem zweiten Male stand er hastig auf, schüttelte uns allen stumm die Hand und verließ das Zimmer.
An jenem Nachmittag bemerkten wir kleine Gruppen von Leuten auf der Straße, die mit entsetzten Mienen einer Erzählung zu lauschen schienen. Miss Jenkyns wunderte sich eine Zeit lang, was wohl geschehen sein könnte, bis sie den würdelosen Schritt tat, Jenny hinauszuschicken, um sich zu erkundigen.
Jenny kam schreckensbleich zurück.
»Oh, Madame! Oh, Miss Jenkyns! Hauptmann Brown ist durch die abscheuliche Eisenbahn getötet worden!« Dabei brach sie in Tränen aus. Wie so viele andere hatte auch sie nur Freundlichkeiten von dem armen Hauptmann empfangen.
»Wie? Wo – wo? Großer Gott! Jenny, halte dich nicht mit Weinen auf, sondern erzähle uns, wie es zugegangen ist!«
Miss Matty stürzte sofort auf die Straße hinaus und kriegte den Mann zu fassen, der gerade die Geschichte erzählte.
»Kommen Sie herein – kommen Sie sofort zu meiner Schwester – Miss Jenkyns, des Pfarrers Tochter. Oh, Mann, Mann, sagen Sie, dass es nicht wahr ist«, rief sie und brachte den erschrockenen Fuhrmann, der sich das Haar glatt strich, in den Salon, wo er mit seinen nassen Stiefeln auf dem neuen Teppich stand; aber niemand achtete darauf.