
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Culpa-Mía-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Wenn der heißeste Bad Boy dein Stiefbruder ist – die TikTok-Sensation aus Spanien und Romanvorlage zur erfolgreichen Amazon-Verfilmung
Weil ihre Mutter wieder geheiratet hat, muss Noah nach Kalifornien ziehen und ihr ganzes Leben hinter sich lassen. Sie hasst alles dort: die protzige Villa, den stinkreichen Stiefvater und ganz besonders ihren neuen Stiefbruder Nicholas. Der sieht aus wie ein junger Gott, ist unglaublich arrogant und macht ihr das Leben zur Hölle. Bald entdeckt Noah, dass er ein geheimes Doppelleben führt, von dem sein Vater keine Ahnung hat: Gangs, illegale Autorennen und wilde Partys. Sie ist fest entschlossen, sich von Nick fernzuhalten, doch das gelingt ihr immer weniger, Stiefbruder hin oder her …
»Culpa mía – Meine Schuld«, Wattpad-Sensation und BookTok-Bestseller des Jahres 2025 (TikTok Award) mit hocherfolgreicher Amazon-Verfilmung, ist eine unwiderstehliche Enemies-to-Lovers-Romance über fatale verbotene Liebe und der Auftakt der Weltbestsellertrilogie »Culpables«, für alle Fans von Colleen Hoover, Anna Todd und Beth Reekles.
Die Culpa-Mía-Trilogie:
Culpa Mía – Meine Schuld (Band 1)
Culpa Tuya – Deine Schuld (Band 2)
Culpa Nuestra – Unsere Schuld (Band 3)
Enthaltene Tropes: Enemies to Lovers, Billionaire, Forbidden Love/Romance, Forced Proximity, Step Brother
Spice-Level: 2 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
MERCEDESRON
CULPA
MÍA
MEINE SCHULD
Aus dem Spanischen
von Ursula Bachhausen und Sabine Giersberg
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Erstmals als cbt Taschenbuch März 2024
© 2017 Mercedes Ron
Die Originalausgabe erschien erstmals 2017 unter dem Titel
»Culpa Mía« bei Penguin Random House Grupo Editorial,
S. A. U., Travessera de Gràcia, 47–49, Barcelona, Spanien.
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Spanischen von Ursula Bachhausen und Sabine Giersberg
Covergestaltung: Marie Graßhoff, unter Verwendung von Motiven von © Adobe Stock (Zamurovic Brothers, Glitter_Klo)
kk · Herstellung: UK
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-31869-7V008
www.cbj-verlag.de
Meiner Mutter gewidmet.
Danke, dass du meine Freundin und meine Vertraute bist,
du bist alles, was ich je gebraucht habe und mehr.
Danke, dass ich dank dir immer ein Buch zur Hand hatte.
PROLOG
»Lass mich in Ruhe!«, fauchte sie. Sie wollte sich an mir vorbeidrängeln. Ich nahm sie in den Arm und zwang sie, mich anzusehen.
»Kannst du mir mal erklären, was hier los ist?«, fragte ich wütend.
In ihrem Blick lag ein dunkles Geheimnis verborgen. Sie lächelte lustlos.
»Das ist deine Welt«, erklärte sie ruhig. »Ich lebe hier dein Leben, ich bin mit deinen Freunden zusammen und lasse es mir gut gehen. Das macht ihr so und das erwartet ihr auch von mir.« Sie trat einen Schritt zurück.
Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte.
»Du hast doch vollkommen den Verstand verloren«, fuhr ich sie an. Es störte mich, welche Wandlung sich mit dem Mädchen vollzog, das ich zu lieben glaubte. Obwohl, wenn ich darüber nachdachte … was sie tat und wie sie es tat … Das hatte ich auch alles selbst getan, bevor ich sie kennenlernte. Ich hatte sie in all das reingezogen. Ich war schuld daran, dass sie sich selbst zerstörte.
In gewisser Weise hatten wir die Rollen getauscht. Sie war in mein Leben getreten und hatte mich aus dem dunklen Loch geholt, in das ich mich manövriert hatte, und am Ende war sie selbst dort gelandet.
1
NOAH
Während ich die Scheibe im neuen Auto meiner Mutter hoch und runter fahren ließ, musste ich die ganze Zeit daran denken, was für ein höllisches Jahr vor mir lag. Ich fragte mich immer wieder, warum wir unser Zuhause in Kanada verlassen und das halbe Land durchquert hatten, um nach Kalifornien zu ziehen. Drei Monate waren seit dem Tag vergangen, an dem mich die Schreckensnachricht ereilt hatte, die mein ganzes Leben auf den Kopf stellen sollte. Ich hatte jede Nacht geweint, ich hatte gejammert und getobt wie ein kleines Kind, dabei war ich schon siebzehn.
Aber was sollte ich tun? Ich war noch nicht volljährig, bis zu meinem achtzehnten Geburtstag waren es noch elf Monate, drei Wochen und zwei Tage. Dann könnte ich endlich aufs College gehen, weg von meiner Mutter, die nur an sich dachte, weg von den Leuten, mit denen ich fortan mein Leben teilen sollte, zwei Menschen, die ich nicht kannte, und zu allem Überfluss auch noch Männern.
»Kannst du damit aufhören? Das nervt«, sagte meine Mutter und ließ den Motor an.
»Mich nervt auch vieles, was du machst, und ich muss es auch ertragen«, erwiderte ich patzig. Sie seufzte nur, wie immer. Mehr war von ihr nicht zu erwarten.
Wie konnte sie mich einfach so zwingen? Spielten meine Gefühle denn gar keine Rolle? »Doch, natürlich«, hatte sie geantwortet, als wir abreisten.
Vor sechs Jahren hatten meine Eltern sich getrennt und das Ganze hatte in einer Katastrophe geendet. Die Scheidung war absolut traumatisch für mich, aber inzwischen war ich einigermaßen darüber weg, oder zumindest auf dem besten Weg dahin.
Doch seitdem hatte ich Probleme mit Veränderungen, mir unbekannte Menschen machten mir Angst. Ich bin nicht schüchtern, aber meine Privatsphäre ist mir wichtig, und die Tatsache, dass ich jetzt vierundzwanzig Stunden am Tag mit zwei mehr oder weniger fremden Menschen verbringen sollte, erzeugte in mir eine Panik, dass ich am liebsten ausgestiegen wäre und mich übergeben hätte.
»Warum kann ich nicht zurück«, fragte ich in der Hoffnung, sie umzustimmen zu können. »Ich bin kein Kind mehr, ich kann auf mich selbst aufpassen … Außerdem gehe ich nächstes Jahr zum College und da werde ich auch auf mich gestellt sein, das ist doch das Gleiche«, argumentierte ich. Vielleicht konnte ich sie zur Vernunft bringen. Sie musste einfach einsehen, dass ich recht hatte.
»Ich möchte dein letztes Schuljahr nicht verpassen und die Zeit mit dir noch genießen, bevor du zum Studium wegziehst. Noah, ich habe es dir schon hundertmal gesagt, ich will, dass du Teil der neuen Familie wirst, du bist meine Tochter. Gütiger Gott! Glaubst du wirklich, ich lasse dich ohne einen Erwachsenen in einem anderen Land zurück?«, erwiderte sie und gestikulierte dabei mit der rechten Hand, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.
Meine Mutter kapierte einfach nicht, wie hart das Ganze für mich war. Sie begann mit ihrem frisch angetrauten Ehemann ein neues Leben, aber was war mit mir?
»Du verstehst es nicht, Mom. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass es auch für mich das letzte Schuljahr ist? Dass ich all meine Freundinnen zurücklasse, meinen Freund, meine Arbeit, meine Mannschaft? Mein ganzes Leben, Mom!«, schrie ich und kämpfte mit den Tränen. Die Situation machte mich fertig. Ich weine nie, wirklich nie in Gegenwart von anderen. Weinen ist was für Schwächlinge, für Leute, die ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben. Und es gibt Menschen wie mich, die in ihrem Leben schon so viel geweint haben, dass sie fest entschlossen sind, keine einzige Träne mehr zu vergießen.
Ich musste daran zurückdenken, wie alles begonnen hatte. Ich bereute, dass ich meine Mutter damals nicht zu der Kreuzfahrt auf die Fidschi-Inseln begleitet hatte. Denn dort, auf einem Schiff im südlichen Pazifik, hatte sie den ach so tollen William Leister kennengelernt.
Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich auf der Stelle Ja sagen, als meine Mutter Mitte April mit zwei Tickets für die Ferien vor mir stand. Es war ein Geschenk ihrer besten Freundin Alicia. Die Ärmste hatte sich bei einem Autounfall mehrere Knochenbrüche zugezogen. Logischerweise konnte sie die Reise mit ihrem Mann nicht antreten und schenkte meiner Mutter die Tickets. Aber damals war einfach eine Menge los gewesen: Ich steckte mitten in den Abschlussklausuren, zudem war die Volleyballsaison im vollen Gange. Meine Mannschaft stand endlich auf Platz eins, nachdem sie über Jahre den zweiten Platz für sich gepachtet zu haben schien: Das war einer der größten Glücksmomente meines Lebens. Doch jetzt, wo ich die Folgen meiner Absage zu spüren bekam, würde ich ohne Zögern den Pokal zurückgeben und die Mannschaft verlassen, und es wäre mir auch egal, ob ich in Literatur und Spanisch durchfiel. Hauptsache, die Hochzeit käme nicht zustande.
Eine Hochzeit auf einem Schiff! Meine Mutter war komplett irre! Außerdem hatte sie mir nichts davon gesagt, ich erfuhr es erst bei ihrer Rückkehr. Sie erzählte es so unaufgeregt, als wäre es das Normalste von der Welt, mitten auf dem Ozean einen Millionär zu ehelichen … Das Ganze war absolut surreal und dann noch der Umzug nach Kalifornien. In die Vereinigten Staaten! In ein anderes Land! Meine Mutter stammte zwar aus Texas und mein Vater aus Colorado, aber ich wurde in Kanada geboren, und es gefiel mir dort sehr, alles war mir vertraut …
»Noah, du weißt, dass ich nur das Beste für dich will«, holte mich meine Mutter in die Wirklichkeit zurück. »Du weißt, was ich durchgemacht habe, was wir durchgemacht haben, und endlich habe ich einen guten Mann gefunden, der mich liebt und respektiert. Ich war lange nicht mehr so glücklich. Ich brauche ihn, und ich weiß, du wirst ihn mögen. Außerdem kann er dir eine Zukunft bieten, die für uns allein unerreichbar wäre. Du kannst auf eine Elite-Uni gehen, Noah.«
»Da will ich gar nicht hin, erst recht nicht, wenn ein Fremder dafür zahlt«, gab ich zurück, und ich erschauderte bei dem Gedanken, dass ich in einem Monat in eine piekfeine Schule mit lauter reichen Kindern gehen würde.
»Er ist kein Fremder, er ist mein Mann, du solltest dich langsam daran gewöhnen«, fuhr sie mir über den Mund.
»Daran werde ich mich nie gewöhnen«, antwortete ich und schaute auf die Straße.
Meine Mutter seufzte wieder, und es wäre mir am liebsten gewesen, wenn das Gespräch an dieser Stelle beendet gewesen wäre, ich hatte keine Lust, weiterzureden.
»Ich verstehe, dass du deine Freunde und Dan vermissen wirst, Noah, aber sieh es doch mal von der positiven Seite: Du bekommst einen Bruder!«, sagte sie schwärmerisch.
Ich warf ihr einen müden Blick zu.
»Jetzt rede die Sache doch nicht schön.«
»Aber er wird dir gefallen: Nick ist ein Schatz«, sagte sie und lächelte dabei die Straße an. »Ein reifer, verantwortungsvoller Junge, der es bestimmt gar nicht abwarten kann, dir seine Freunde vorzustellen und dir die Stadt zu zeigen. Immer wenn ich ihn gesehen habe, saß er in seinem Zimmer und hat gelernt oder gelesen, vielleicht habt ihr ja in puncto Bücher denselben Geschmack.«
»Na, klar … er steht bestimmt auf Jane Austen«, erwiderte ich und verdrehte die Augen. »Wie alt war er doch gleich?« Ich wusste es bereits, meine Mutter hatte über nichts anderes gesprochen als über Will und seinen Sprössling. Und ich empfand es als Witz, dass er nicht mal die Zeit gefunden hatte, uns zu besuchen. Zu einer neuen Familie ziehen zu müssen, die man vorher nicht ein einziges Mal gesehen hat, setzte dem Ganzen wirklich die Krone auf.
»Er ist ein wenig älter als du, aber du bist reifer als die Mädchen in deinem Alter. Ihr werdet euch sicher wunderbar verstehen.«
Reif, aha. Jetzt wollte sie sich wohl einschmeicheln. Ich überlegte, ob das tatsächlich auf mich zutraf, aber reif hin oder her, ich bezweifelte, dass ein junger Mann von Anfang zwanzig Lust hatte, mir die Stadt zu zeigen oder mir seine Freunde vorzustellen. Außerdem: als ob ich irgendein Interesse daran hätte.
»Wir sind gleich da«, sagte meine Mutter kurz darauf.
Ich betrachtete die hohen Palmen und die Straßen zwischen den beeindruckenden Villen. Jedes Haus war mindestens so groß wie ein halber Block. Manche waren im englischen oder viktorianischen Stil gehalten, andere waren sehr modern mit viel Glas und riesigen Gärten. Ich wurde gefühlt immer kleiner auf meinem Sitz, als ich feststellte, dass die Häuser in der Straße immer größer wurden, je weiter wir fuhren.
Schließlich standen wir vor einem drei Meter hohen Tor. Meine Mutter holte wie selbstverständlich ein kleines Gerät aus dem Handschuhfach, drückte auf den Knopf und die Flügel öffneten sich. Wir fuhren einen leicht abschüssigen, von Beeten und Grünflächen gesäumten Weg entlang und die hohen Kiefern verströmten einen angenehmen Duft nach Sommer und Meer.
»Das Haus liegt tiefer als die anderen. Deshalb haben wir einen fantastischen Blick auf den Strand«, sagte meine Mutter und strahlte. Sie war nicht wiederzuerkennen. Merkte sie nicht, dass das alles eine Nummer zu groß für uns war?
Doch ich kam nicht dazu, meine Zweifel laut auszusprechen, denn wir erreichten unser Ziel. Mir kam nur ein »Wow!« über die Lippen.
Die Villa war weiß und hatte ein hohes sandfarbenes Dach; sie hatte mehrere Stockwerke, aber wie viele genau, das war bei all den vielen Fenstern und Terrassen schwer zu sagen. Vor uns lag eine beeindruckende Veranda, auf der die ersten Lichter brannten – es war inzwischen schon nach sieben – und dem Ort etwas Magisches verliehen. Die Sonne würde bald untergehen und das Farbspiel des Himmels bildete einen schönen Kontrast zu der makellosen Fassade.
Meine Mutter fuhr um den Brunnen herum und parkte das Auto vor der Treppe zum Haupteingang. Ich hatte das Gefühl, vor dem luxuriösesten Hotel Kaliforniens zu stehen, nur dass es kein Hotel war, sondern ein Wohnhaus, unser künftiges Zuhause, wenn es nach meiner Mutter ging.
Als ich ausstieg, erschien William Leister in der Tür. Und hinter ihm drei Männer, die in ihren Uniformen wie Pinguine aussahen.
Der neue Mann meiner Mutter war ganz anders gekleidet als auf den Fotos, die ich von ihm gesehen hatte: Bermudashorts und hellblaues Polohemd statt Anzug oder teurem Markensakko. Er trug Flipflops und das Haar war zerzaust und nicht wie sonst zurückgegelt. Ich musste zugeben, dass ich meine Mutter verstehen konnte: Er war ausgesprochen attraktiv. Er war deutlich größer als meine Mutter und hatte sich trotz der ein oder anderen Falte gut gehalten. Er hatte harmonische Gesichtszüge, und das schwarze Haar war von grauen Strähnen durchzogen, die ihn reif und interessant erscheinen ließen.
Meine Mutter rannte wie ein Schulmädchen auf ihn zu und umarmte ihn. Ich ließ mir Zeit und ging erst mal zum Kofferraum, um meine Sachen herauszuholen.
Wie aus dem Nichts tauchten zwei behandschuhte Hände auf und ich zuckte erschrocken zurück.
»Ich kümmere mich um Ihr Gepäck, Miss«, sagte einer der Pinguine.
»Danke, das kann ich schon selbst«, erwiderte ich. Die Situation war mir unangenehm.
Der Mann sah mich an, als wäre ich nicht ganz dicht.
»Lass Martin dir helfen, Noah«, hörte ich William Leister hinter mir sagen.
Zähneknirschend ließ ich meinen Koffer los.
»Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Noah«, begrüßte er mich und lächelte mir warmherzig zu. Meine Mutter gab mir ununterbrochen Zeichen, ich solle doch lächeln, irgendwas sagen.
»Das kann ich von mir nicht behaupten«, antwortete ich und streckte die Hand aus. Mir war klar, dass das ein Affront war, aber in dem Moment hielt ich es für angemessen, die Wahrheit auszusprechen.
Ich wollte klarstellen, was ich von dieser Veränderung in unser aller Leben hielt.
William war nicht gekränkt. Er hielt meine Hand länger als nötig und ich fühlte mich schlecht.
»Ich weiß, das ist ein harter Schnitt für dich, Noah, aber ich möchte, dass du dich hier wohlfühlst, dass du mit Freuden annehmen kannst, was ich zu bieten habe, aber vor allem wünsche ich mir, dass du mich als Teil deiner Familie akzeptieren kannst … irgendwann«, schob er nach, vermutlich weil er mein ungläubiges Gesicht sah. Die blauen Augen meiner Mutter blitzten vor Zorn.
Ich nickte und trat einen Schritt zurück, damit er endlich meine Hand losließ. Solche Gesten der Zuneigung waren mir unangenehm, erst recht bei Menschen, die ich so gut wie nicht kannte. Meine Mutter hatte geheiratet – schön für sie -, aber dieser Mann würde für mich weder ein Vater noch ein Stiefvater oder sonst was sein, was ihm vorschwebte. Ich hatte schon einen Vater und der hatte mir gereicht.
»Was hältst du von einer kleinen Führung durchs Haus?«, schlug er lächelnd vor, unbeeindruckt von meinem kalten und schroffen Auftreten.
»Na komm, Noah«, animierte mich meine Mutter und hakte sich bei mir unter. Mir blieb nichts anderes übrig, als mitzugehen.
Alle Lichter im Innenbereich brannten, und so konnte ich jedes noch so kleine Detail in dem riesigen Haus in Augenschein nehmen, das selbst für eine zwanzigköpfige Familie noch zu groß wäre. Die hohen Decken waren mit Holzbalken verziert und durch die großen Fenster hatte man einen wunderbaren Blick nach draußen. In der Mitte des riesigen Wohnzimmers erhob sich eine Treppe, die zu den beiden Flügeln des Obergeschosses führte. Meine Mutter und ihr Mann führten mich durchs ganze Haus, auch in die geräumige Küche, deren Blickfang die beeindruckende Kücheninsel war – für meine Mutter bestimmt eine der Hauptattraktionen. In dem Haus fehlte es an nichts: Es gab einen Fitnessraum, ein beheiztes Schwimmbad, einen Partykeller und eine große Bibliothek, die für mich das Highlight war.
»Deine Mutter hat mir erzählt, dass du gerne liest und auch selbst schreibst«, riss mich William aus meinen Gedanken.
»Wie Millionen andere auch«, antwortete ich schnippisch. Es störte mich, dass er so liebenswürdig zu mir war. So leicht würde ich es ihm nicht machen.
»Noah!« Meine Mutter sah mich tadelnd an. Mir war klar, dass sie meinetwegen litt, aber da musste sie durch. Auch ich hatte ein schreckliches Jahr vor mir und konnte nichts dagegen tun.
William ignorierte die angespannte Atmosphäre, er blieb die ganze Zeit freundlich und zugewandt.
Ich seufzte, aus Frust und Unbehagen. Das war alles too much. Ich wusste nicht, ob ich mich je daran gewöhnen würde, an einem derart extravaganten Ort zu leben.
Ich wollte allein sein, um das alles erst mal zu verarbeiten.
»Ich bin müde. Kann ich auf mein Zimmer gehen?«, fragte ich ein wenig versöhnlicher.
»Klar, dein Zimmer ist im rechten Flügel im zweiten Stock, wie das von Nicholas. Du kannst gerne Leute einladen, Nick stört das nicht. Außerdem werdet ihr euch ab jetzt das Spielzimmer teilen.«
»Das ›Spielzimmer‹? Ernsthaft?« Ich grinste und versuchte, nicht daran zu denken, dass ich von jetzt an auch mit Williams Sohn zusammenleben müsste. Ich wusste nur das, was meine Mutter über ihn erzählt hatte: Er war einundzwanzig und studierte an der UCLA.
Und er war bestimmt ein unerträglicher Snob.
Es war sechs Jahre her, dass wir mit einem Mann – meinem Vater – zusammengelebt hatten. Ich hatte mich an den reinen Frauenhaushalt gewöhnt. Mein Leben war kein Zuckerschlecken gewesen, vor allem nicht in den ersten elf Jahren: Die Probleme mit meinem Vater hatten mein Leben ebenso geprägt wie das meiner Mutter.
Nachdem mein Vater ausgezogen war, hatten meine Mutter und ich wieder Fuß gefasst, Schritt für Schritt war wieder Normalität in unser Leben eingekehrt, und mit der Zeit war meine Mutter zu einer meiner besten Freundinnen geworden. Sie ließ mir meine Freiheit, weil sie mir vertraute, und umgekehrt genauso … bis sie irgendwann beschlossen hatte, unser gemeinsames Leben über Bord zu werfen.
»Das ist dein Zimmer«, sagte sie und blieb vor einer Tür aus dunklem Holz stehen.
Ich schaute meine Mutter und William an. Sie warteten gespannt.
»Und? Darf ich auch reingehen?«, fragte ich spöttisch, weil wir wie die Ölgötzen dastanden.
»Das Zimmer ist mein besonderes Geschenk für dich, Noah«, verkündete meine Mutter mit glänzenden Augen.
Verhalten wartete ich, bis sie zur Seite trat, dann öffnete ich die Tür, unsicher, was mich erwartete.
Als Erstes nahm ich den wunderbaren Duft nach Margeriten und Meer wahr. Mein Blick wurde wie magisch von der Fensterfront angezogen, die der Tür gegenüberlag. Sie nahm die ganze Wand ein. Der Ausblick war so spektakulär, dass es mir die Sprache verschlug. Ich sah nichts als das weite Meer. Das Haus musste auf einem Felsvorsprung stehen, denn nichts versperrte den Blick auf den Ozean und den fantastischen Sonnenuntergang. Es war überwältigend.
»Wow!« Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mein Blick wanderte weiter durch den riesigen Raum: An der linken Seite stand ein Himmelbett mit unzähligen weißen Kissen, die perfekt zu den hellblauen Wänden passten. Und erst die anderen Möbel: ein Schreibtisch mit einem nagelneuen Computer, ein wunderschönes Sofa, ein Frisiertisch mit Spiegel und ein großes Regal mit meinen Büchern, alles in Blau und Weiß gehalten. Das war das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen hatte.
Ich war platt. All das sollte für mich sein?
»Gefällt es dir«, fragte meine Mutter, die hinter mir stand.
»Es ist fantastisch … Danke«, erwiderte ich. Ich war hin- und hergerissen. Einerseits empfand ich große Dankbarkeit, aber andererseits wollte ich mich nicht kaufen lassen, ich brauchte den ganzen Luxus nicht.
»Ich habe fast zwei Wochen mit einer Innenarchitektin an dem Zimmer gearbeitet. Es sollte alles haben, was du dir immer gewünscht hast und was ich dir nie geben konnte«, erklärte sie. Sie war sichtlich bewegt, und mir wurde klar, dass ich keinen Grund zur Klage hatte. Jedes junge Mädchen träumt von solch einem Zimmer und wohl auch jede Mutter.
Ich ging auf sie zu und umarmte sie. Das hatte ich seit drei Monaten nicht mehr getan, und ich spürte, wie wichtig ihr das war.
»Danke, Noah«, flüsterte sie mir ins Ohr. »Ich verspreche dir, ich werde alles tun, damit wir beide hier glücklich werden.«
»Es wird schon werden, Mom«, sagte ich in dem Wissen, dass das, was sie sagte, gar nicht in ihrer Hand lag.
Meine Mutter löste sich aus der Umarmung und wischte sich eine Träne von der Wange.
»Wir lassen dich jetzt erst mal ankommen«, meinte William.
Ich nickte, ohne mich zu bedanken. Das alles hatte ihn keinerlei Mühe gekostet, nur Geld.
Als ich die Tür schloss, fiel mir auf, dass es keine Möglichkeit gab, sie zu verriegeln. Auf dem Dielenboden aus edlem Holz lag ein flauschiger weißer Teppich, auf dem man hätte schlafen können. Das Bad war so groß wie mein altes Zimmer. Es gab eine Dusche mit Massagedüsen, eine Badewanne und zwei Waschbecken. Ich ging zum Fenster. Unter mir befand sich der hintere Garten mit Rabatten, Palmen und einem riesigen Pool.
Ich verließ das Bad und bemerkte erst jetzt den türlosen Rahmen an der gegenüberliegenden Wand. Oh mein Gott!
Ich eilte durch das Zimmer zu dem Traum einer jeden Frau: ein begehbarer Kleiderschrank! Und er war nicht etwa leer, sondern voll mit neuen Klamotten. Ich schnaubte und fuhr mit den Fingerspitzen über die edlen Teile. Die Etiketten waren noch dran, und ein Blick auf eines der Preisschilder genügte, um zu erkennen, wie sündhaft teuer sie waren. Meine Mutter war verrückt – oder derjenige, der sie überredet hatte, so viel Geld auszugeben.
Ich hatte Angst, ich würde jeden Moment aufwachen und mich in meinem alten Zimmer mit den üblichen Kleidern und dem schmalen Bett wiederfinden; andererseits wünschte ich mir genau das, denn ich wollte mein altes Leben zurück. Ich verspürte einen derartigen Druck auf der Brust, dass ich mich auf den Boden sinken ließ, den Kopf auf die Knie legte und tief durchatmete, bis der Wunsch, zu weinen, nachließ.
Als könnte sie Gedanken lesen, schrieb mir meine Freundin Beth genau in dem Moment eine Nachricht.
Bist du gut angekommen? Ich vermisse dich jetzt schon.
Ich lächelte in die Kamera und schickte ihr ein Selfie aus dem Kleiderschrank. Sekunden später kamen fünf Wow-Emojis.
Wie ich dich hasse!
Ich lachte und schrieb zurück.
Von mir aus kannst du den ganzen Kram gern haben. Ich würde sonst was dafür geben, wenn ich jetzt mit Dan ein Video schauen oder einfach nur mit dir auf deinem abgewetzten Sofa abhängen könnte.
Etwas mehr Begeisterung bitte! Freu dich doch, dass du jetzt Kohle hast.
Es war nicht meine, sondern Williams Kohle.
Ich legte das Handy auf den Boden, ging zu meinem Koffer und schnappte mir ein paar Shorts und ein einfaches T-Shirt. Ich dachte nicht daran, Markenklamotten zu tragen, ich wollte ich selbst bleiben.
Ich ging unter die Dusche, um mich von dem Schmutz und den Strapazen der langen Reise zu befreien. Ich war dankbar, dass ich nicht zu den Mädchen gehörte, die alles Mögliche anstellen mussten, um ihr Haar in Form zu bringen. Glücklicherweise hatte ich die pflegeleichten Locken meiner Mutter geerbt. Ich zog mich an und begab mich auf die Suche nach etwas zu essen.
Es war komisch, allein durch das Haus zu streifen. Ich fühlte mich wie ein Eindringling. Es würde dauern, bis ich mich eingelebt und an den ganzen Luxus gewöhnt hätte. Allein schon die Größe des Anwesens! In der alten Wohnung verstand man jedes Wort, sobald jemand im anderen Raum nur leicht die Stimme erhob. Das war hier völlig anders.
Ich steuerte die Küche an und betete, dass ich direkt den Weg fand. Ich hatte einen Mordshunger, mein Körper verlangte nach Junkfood.
Leider hatte jemand anderes offenbar dieselbe Idee.
Ein dunkelhaariger Typ, von dem ich nur den Hinterkopf sah, suchte etwas im Kühlschrank. Ich wollte gerade etwas sagen, da ertönte ein ohrenbetäubendes Gebell. Ich fing an zu kreischen wie ein kleines Kind.
Der Typ tauchte mit einem verwunderten Blick aus dem Kühlschrank auf.
Der schwarze Hund neben der Kücheninsel sah mich an, als wollte er mich am liebsten fressen. Es handelte sich wohl um einen Labrador, aber beschwören konnte ich das nicht. Mein Blick wanderte von dem Hund zu dem jungen Mann.
Ich betrachtete ihn voller Neugier: Das musste Nicholas Leister sein. Das Erste, was mir durch den Kopf schoss, war: Was für strahlend blaue Augen! Sie hatten dieselbe Farbe wie die Wände meines Zimmers und bildeten einen hübschen Kontrast zu der pechschwarzen Mähne. Anscheinend hatte er sich sportlich betätigt, denn er trug eine Sporthose und ein weites Tanktop. Mein Gott, er sah echt gut aus, das musste ich zugeben, aber ich vergaß nicht, wen ich vor mir hatte: Er war der neue Stiefbruder, mit dem ich zu meinem Leidwesen das nächste Jahr zusammenleben musste. Der Hund knurrte mich derweil weiter an, als würde er meine Gedanken erraten.
»Du bist Nicholas, nehme ich an?«, fragte ich und versuchte, meine Angst vor der Bestie unter Kontrolle zu bringen. Er sah den Hund an und grinste, was mich gleich auf die Palme brachte.
»Genau«, erwiderte er. »Und du musst die Tochter der neuen Frau meines Vaters sein«, sagte er kühl.
Ungläubig sah ich ihn an.
»Wie war doch gleich dein Name?«
Nicht zu fassen.
Er wusste nicht mal meinen Namen? Unsere Eltern hatten geheiratet, meine Mutter und ich mussten deswegen umziehen, und er wusste nicht mal, wie ich hieß?
2
NICK
»Noah«, erwiderte sie knapp. »Ich heiße Noah.«
Es amüsierte mich, wie sie mich mit zornigen Blicken durchbohrte. Meine neue Stiefschwester war offenbar beleidigt, weil es mir am Arsch vorbeiging, wie sie hieß. Das galt auch für ihre Mutter, auch wenn ich zugeben muss, dass ich deren Namen auf dem Schirm hatte. Wie auch nicht! In den letzten drei Monaten hatte Raffaella Morgan mehr Zeit in diesem Haus verbracht als ich. Sie war in mein Leben eingedrungen und zu allem Überfluss hatte sie jetzt auch noch ein Anhängsel mitgebracht.
»Ist das nicht ein Jungenname?«, fragte ich, um sie zu ärgern. »Nichts für ungut«, schob ich schnell nach, als ich den irritierten Blick in ihren honigfarbenen Augen sah.
»Nein, nicht nur«, gab sie zurück. Ihr Blick wanderte von mir zu Thor, meinem Hund. »Das Wort ›unisex‹ existiert in deinem beschränkten Wortschatz wohl nicht«, ergänzte sie. Thor knurrte sie weiterhin an und fletschte die Zähne. Es lag nicht an ihr. Wir hatten ihn darauf abgerichtet, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Nur ein Wort von mir und er würde sich sofort in den liebsten Hund der Welt verwandeln, aber es machte mir einfach großen Spaß, das angsterfüllte Gesicht meiner neuen Schwester zu sehen.
»Keine Sorge, mein Wortschatz ist alles andere als begrenzt«, konterte ich und schloss den Kühlschrank. Ich baute mich vor ihr auf. »Und es gibt ein Wort, das mein Hund besonders liebt. Es fängt mit F an und endet mit ASS.« Ich musste an mich halten, als ich die Panik in ihren Augen sah.
Sie war relativ groß, schlank und hatte zugegebenermaßen eine gute Figur, aber ihr Gesicht war so kindlich, dass sich jeglicher Gedanke daran, etwas mit ihr anzufangen, von selbst verbot. Wenn ich es richtig verstanden hatte, ging sie noch zur Schule, und das sah man ihr an. Sie hätte sich die Haare nur noch zu einem Zopf zurückbinden müssen, dann würde sie mit der kurzen Hose und den schwarzen Converse glatt als einer dieser Teenager durchgehen, die ungeduldig in einer ewig langen Schlange darauf warten, dass sich die Kaufhaustüren öffnen und sie die neueste CD ihres Schwarms erwerben können. Was mich faszinierte, war ihr Haar: Es hatte einen besonderen Farbton, dunkelblond mit rötlichem Schimmer.
»Sehr witzig!«, rief sie, immer noch in Panik. »Schaff ihn weg, bevor er mich noch anfällt.« Sie wich zurück und Thor schloss auf.
Guter Junge, dachte ich. Vielleicht sollte ich meiner neuen Stiefschwester eine Lektion erteilen und klarstellen, wer der Herr im Haus war und wie wenig sie hier willkommen war.
»Vorwärts, Thor«, befahl ich.
Thor schritt langsam und zähnefletschend auf sie zu, bis sie mit dem Rücken an der Wand stand. Das sah furchterregend aus, aber ich wusste, er würde ihr nichts tun … zumindest nicht, solange ich ihm nicht den entsprechenden Befehl erteilte.
»Was soll das? Das ist nicht lustig.«
Doch das war es.
»Mein Hund mag normalerweise alle Menschen. Komisch, dass er bei dir so angriffslustig ist«, bemerkte ich, während ich belustigt beobachtete, wie sie gegen ihre Angst ankämpfte.
»Gedenkst du vielleicht mal irgendwas zu tun?«, zischte sie und fixierte mich mit ihrem Blick.
Was tun? Zum Beispiel sagen: Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist?
»Du bist jetzt wie lange hier? Fünf Minuten? Und schon willst du mir sagen, wo’s langgeht?«, spottete ich. Während mein Hund unaufhörlich weiterknurrte, goss ich mir am Hahn seelenruhig ein Glas Wasser ein. »Vielleicht sollte ich euch zur Eingewöhnung ein Weilchen hier allein lassen.«
»Du tickst wohl nicht ganz sauber, du Idiot? Pfeif deine Töle zurück!«
Mit einer solchen Dreistigkeit hatte ich nicht gerechnet. Hatte sie mich da eben etwa beleidigt?
Das war wohl selbst meinem Hund aufgefallen, denn er rückte noch näher an sie heran, sodass sie sich kaum noch bewegen konnte. In Panik griff Noah nach dem Erstbesten, das ihr in die Hände kam, und das war eine Pfanne. Ich packte mit einer Hand Thor am Halsband und mit der anderen Noahs Arm.
»Was soll das, verdammt«, schrie ich, entriss ihr die Pfanne und legte sie wieder auf die Arbeitsplatte. Thor sprang wütend auf die Hinterbeine und Noah drückte sich mit einem erstickten Schrei an meine Brust.
Dass sie ausgerechnet bei mir Schutz suchte, überraschte mich. Schließlich war ich es, der sie bedrohte.
»Thor, sitz!« Er setzte sich und wedelte entspannt mit dem Schwanz.
Ich blickte feixend auf Noah, die sich mit beiden Händen an mein Tanktop geklammert hatte. Sie bemerkte mein Grinsen, ließ los und schubste mich weg.
»Hast du sie noch alle?«
»Erstens war das das letzte Mal, dass du meinen Hund angreifst, und zweitens« – ich sah ihr fest in die Augen und registrierte zugleich die kleinen Sommersprossen auf ihrer Nase und ihren Wangen – »wag es nie mehr, mich zu beleidigen, sonst haben wir ein Problem.«
Ich trat einen Schritt zurück. Mein Atem ging schneller, keine Ahnung, warum. Ich hatte jetzt schon genug von der Göre, dabei hatte ich sie erst vor fünf Minuten kennengelernt.
»Besser, wir versuchen, miteinander klarzukommen, Schwesterchen«, sagte ich. Ich wandte mich ab, nahm mir ein Sandwich von der Arbeitsplatte und ging zur Tür.
»Nenn mich nicht so, ich bin weder deine Schwester noch sonst was in der Art«, gab sie zurück. Das klang so hasserfüllt, dass ich mich noch einmal zu ihr umdrehte. Ihre Augen blitzten. Offenbar war sie von der Hochzeit unserer Eltern genauso begeistert wie ich.
»In dem Punkt sind wir uns einig, Schwesterchen«, sagte ich und beobachtete voller Genugtuung, wie sich ihre schmalen Hände zu Fäusten ballten.
In dem Moment hörte ich hinter mir ein Geräusch. Als ich mich umdrehte, standen mein Vater und seine neue Frau im Türrahmen.
»Wie ich sehe, habt ihr euch schon bekannt gemacht«, meinte er und betrat mit einem breiten Grinsen die Küche. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr so aufgekratzt erlebt und tief in meinem Innern freute ich mich darüber. Er hatte sein Leben wieder auf die Reihe gebracht. Auch wenn ich dabei auf der Strecke geblieben war.
Raffaella lächelte mir liebenswürdig zu, und auch ich rang mir ein Lächeln ab, das war das höchste der Gefühle. Dabei hatte ich im Grunde nichts gegen sie.
Auch wenn mein Vater und ich kein sonderlich inniges Verhältnis hatten, kam es mir doch sehr gelegen, dass er uns mit einer Mauer gegen die Außenwelt abschottete. Die Sache mit meiner Mutter war an uns beiden nicht spurlos vorübergegangen, vor allem an mir nicht. Ich hatte mit ansehen müssen, wie sie fortgegangen war, ohne sich auch nur einmal nach mir umzudrehen.
Seitdem hegte ich ein tiefes Misstrauen gegen Frauen. Sie interessierten mich allenfalls, um sie ins Bett zu kriegen oder mich mit ihnen auf Partys zu amüsieren. Was hatte ich schon von ihnen zu erwarten?
»Noah, hast du dich schon mit Thor bekannt gemacht?«, fragte Raffaella.
Jetzt geschah etwas, womit ich nicht gerechnet hatte: Noah ging in die Knie und sagte: »Süßer, komm mal her.«
Zugegeben, das war mutig. Eben noch hatte sie vor Angst gezittert.
Ich war überrascht, dass sie nicht gleich zu ihrer Mutter gelaufen war und mich verpetzt hatte.
Thor bewegte sich schwanzwedelnd auf sie zu. Dann schaute er zu mir und registrierte, dass etwas nicht stimmte.
Mit eingeklemmtem Schwanz trottete er auf mich zu und setzte sich neben mich. Meine Stiefschwester war baff.
»Guter Junge«, lobte ich ihn lächelnd.
Noah richtete sich rasch auf und sagte zu ihrer Mutter: »Ich gehe ins Bett.«
Ich würde auch gleich verschwinden. Am Strand war eine Party, die ich nicht verpassen wollte.
»Ich gehe aus, wartet nicht auf mich.« Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass ich den Plural verwendet hatte.
Mein Vater stellte sich uns in den Weg.
»Heute gehen wir vier zusammen essen«, sagte er und fixierte dabei vor allem mich.
Musste das sein?
»Sorry, Dad, aber ich bin verabredet und …«
»Ich bin hundemüde von der langen Fahrt, ich …«
»Es ist unser erster Abend als Familie, und ich möchte, dass ihr beide dabei seid«, fiel uns mein Vater ins Wort. Noah schnaubte.
»Können wir das nicht auf morgen verschieben?«, maulte sie.
»Es tut mir leid, Liebes, aber morgen haben wir eine Firmengala«, erwiderte mein Vater.
Wie er mit ihr sprach! Er kannte sie doch kaum! Ich ging schon aufs College, und ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Will sagen: Ich war erwachsen, aber Noah? Auf einen Teenager Rücksicht nehmen zu müssen, war der Albtraum eines jeden frisch vermählten Paares.
»Noah, wir werden heute zusammen essen, und damit basta. Ich will nichts mehr hören«, beendete Raffaella die Diskussion. Ihr Blick sprach Bände.
In dem Fall war es wohl besser, nachzugeben. Ich würde mit ihnen essen gehen und danach Anna, meine spezielle Freundin, für die Party abholen.
Noah brummelte irgendwas Unverständliches, schob sich zwischen den beiden durch und marschierte Richtung Treppe.
»Gebt mir eine halbe Stunde, ich will mich frisch machen«, bat ich und deutete auf meine verschwitzten Klamotten.
Mein Vater nickte zufrieden, seine Frau lächelte mir zu, und ich dachte, dass mir die Rolle des vernünftigen und verantwortungsbewussten Sohnes gar nicht schlecht stand.
3
NOAH
So ein VOLLIDIOT!
Während ich demonstrativ laut die Treppe hochstapfte, ging mir die Begegnung mit meinem bescheuerten neuen Stiefbruder nicht aus dem Kopf. Wie konnte man nur so ein krankes, aufgeblasenes Arschloch sein? Mein Gott! Das war ja nicht zum Aushalten. Ich konnte ihn allein schon deshalb nicht leiden, weil er der Sohn des neuen Mannes meiner Mutter war. Aber der Auftritt vorhin hatte meine Abneigung noch ins Unermessliche gesteigert.
Das sollte der perfekte, liebenswerte Junge sein, von dem meine Mutter gesprochen hatte?
Wie er redete und mich angesehen hatte. Ätzend. Als wäre er etwas Besseres, nur weil er Geld hat. Er hatte sich über mich lustig gemacht!
Ich ging in mein Zimmer und knallte die Tür hinter mir zu, auch wenn es bei der Größe des Hauses wahrscheinlich niemand hörte. Draußen war es bereits dunkel und durch das Fenster fiel nur schwaches Licht herein. Das Meer hatte sich schwarz gefärbt und war kaum vom Himmel zu unterscheiden.
Nervös machte ich das Licht an.
Ich warf mich aufs Bett und betrachtete die Balken an der Decke. Jetzt musste ich auch noch mit diesen Leuten zu Abend essen. Merkte meine Mutter denn nicht, dass dies das Letzte war, wonach mir gerade der Sinn stand? Ich wollte allein sein, mich ausruhen, die Veränderungen erst mal sacken lassen. Ich müsste lernen, mit ihnen zusammenzuleben, auch wenn ich tief in meinem Innern bereits wusste, dass es nicht passte.
Ich griff nach dem Handy und überlegte, ob ich meinen Freund Dan anrufen sollte. Ich war gerade erst in Kalifornien angekommen und vermisste ihn schon so sehr. Doch ich wollte nicht, dass er sich Sorgen machte, wenn er die Verbitterung in meiner Stimme hörte.
Zehn Minuten später kam meine Mutter herein. Immerhin hatte sie geklopft.
»Noah, wir müssen in einer Viertelstunde unten sein«, sagte sie geduldig.
»Du sagst das, als bräuchten wir eine Stunde für den Weg zur Haustür«, erwiderte ich und setzte mich auf. Meine Mutter trug ihr blondes Haar jetzt offen, aber elegant frisiert. Seit der Hochzeit achtete sie sehr auf ihr Äußeres.
»Ich sage das, weil du dich noch umziehen musst«, sagte sie, ohne auf meine schnippische Bemerkung einzugehen.
Ich blickte an mir herunter.
»Was gibt es denn an meinem Erscheinungsbild auszusetzen«, fragte ich vorsichtig.
»Das ist nicht dein Ernst, Noah. Heute Abend solltest du dich chic machen. Du willst doch nicht etwa mit kurzen Hosen und T-Shirt zum Essen gehen?«, fragte sie erbost.
Ich stand auf und starrte sie an. Mit meiner Geduld war es für diesen Tag vorbei.
»Wie oft denn noch, Mom? Ich will nicht mit dir und deinem Mann essen gehen. Ich hab kein Interesse, den missratenen Sohn kennenzulernen, und erst recht nicht, mich dafür aufzubrezeln«, fauchte ich sie an und versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, wie gern ich mir das Auto geschnappt hätte, um zurück nach Hause zu fahren.
»Führ dich nicht auf wie ein Kleinkind und zieh dich an«, sagte sie streng. Doch als sie meinen Gesichtsausdruck sah, fügte sie in sanfterem Ton hinzu: »So wird es ja nicht jeden Tag sein, nur heute. Bitte, tu’s für mich.«
Ich atmete ein paar Mal tief durch, schluckte all die Dinge herunter, die ich ihr am liebsten ins Gesicht geschrien hätte, und nickte.
»Na schön, aber nur heute Abend.«
Als meine Mutter gegangen war, begab ich mich zu dem begehbaren Kleiderschrank. Stinksauer auf alles und jeden, suchte ich ein Kleidungsstück, das mir gefiel und in dem ich mich wohlfühlte. Ich wollte zeigen, wie erwachsen ich sein konnte. Ich hatte noch immer Nicholas’ ungläubigen und amüsierten Blick vor Augen. Er hatte mich angesehen, als wäre ich ein kleines Kind, dem man gern einen Schrecken einjagt. Und das hatte er dann ja auch geschafft, als er den verdammten Köter auf mich hetzte.
Mein Koffer lag offen auf dem Boden. Ich kniete mich hin und kramte in meinen Sachen. Meine Mutter erwartete bestimmt, dass ich eins der neuen Teile anzog, aber das konnte sie vergessen. Wenn ich in dem Punkt nachgab, hatte ich verloren. Die Kleider anzunehmen, bedeutete, das neue Leben zu akzeptieren, und damit hätte ich meine Würde verloren.
Rasend vor Zorn, suchte ich das schwarze Kleid vom International Ramones Day aus. Wer würde behaupten, es sei nicht elegant? Jetzt brauchte ich nur noch die passenden Schuhe. Ich war keine Freundin von Pumps, aber wenn ich mit den Converse Chucks auftauchte, würde meine Mutter mit Sicherheit ausflippen und mich wieder hochschicken. Am Ende wählte ich ein paar dezente schwarze Sandalen mit kleinem Absatz aus, in denen ich mich ohne Probleme bewegen konnte.
Ich trat vor den riesigen Wandspiegel und betrachtete mich eingehend. Meine Freundin Beth würde es bestimmt gutheißen. Und wenn ich mich recht erinnerte, fand Dan das Kleid immer sehr sexy.
Ich löste den Dutt, strich mein Haar glatt und trug noch ein wenig Lippenbalsam auf. Zufrieden mit meinem Spiegelbild, schnappte ich mir eine kleine Handtasche und begab mich zur Tür.
Als ich sie öffnete, stieß ich auf Nicholas, der sogleich stehen blieb, um mich zu begutachten. Der verflixte Köter war natürlich an seiner Seite und ich wich zurück ins Zimmer.
Aus irgendeinem unerfindlichen Grund lächelte mein neuer Bruder.
Sein Blick blieb an meinem Kleid hängen.
»Hat man euch in eurem Kaff nicht beigebracht, wie man sich anständig anzieht?«, meinte er sarkastisch.
Ich setzte ein engelsgleiches Lächeln auf.
»Doch … aber der Lehrer war genauso ein Vollidiot wie du, deshalb hab ich auf seine Sprüche nichts gegeben.«
Damit hatte er nicht gerechnet! Ein Lächeln huschte über seine sinnlichen Lippen. Ich betrachtete ihn eingehend: Er war hochgewachsen und hatte eine sehr männliche Ausstrahlung. Er trug eine Anzughose und ein Hemd mit offenem Kragen. Der Blick aus seinen strahlend blauen Augen war durchdringend, aber ich ließ mich nicht einschüchtern.
Der Hund wedelte freudig mit dem Schwanz, keine Spur mehr von Angriffslust.
»Der ist ja wie ausgewechselt. Wirst du ihm gleich befehlen, auf mich loszugehen, oder wartest du damit bis nach dem Abendessen?«, forderte ich Nicholas mit aufgesetztem Lächeln heraus.
»Hängt ganz davon ab, wie du dich benimmst, Freckle«, erwiderte er. Ehe ich mich’s versah, drehte er sich um und eilte zur Treppe.
Das verschlug mir die Sprache vor Zorn. Freckle … Er hatte mich tatsächlich »Sommersprosse« genannt! Der Typ war wohl auf Ärger aus.
Ich folgte ihm und redete mir ein, dass es sich nicht lohnte, mich über ihn und seine dummen Bemerkungen aufzuregen. Er war bestimmt nicht der Einzige in dieser Stadt, der sich so benahm, also gewöhnte ich mich am besten gleich daran.
Im Erdgeschoss angekommen, war ich wieder von der Schönheit des Hauses überwältigt. Eine gekonnte Mischung aus alten und modernen Elementen. Während ich auf meine Mutter wartete und die Gesellschaft meines Stiefbruders geflissentlich ignorierte, betrachtete ich den beeindruckenden Deckenleuchter, der zwischen den Balken herabhing. Er bestand aus unzähligen Kristalltropfen, als wäre herabfallender Regen in der Luft gefroren.
Für einen Moment trafen sich unsere Blicke, und ich wartete, dass er als Erster wegschaute. Er sollte nicht denken, dass ich mich von ihm einschüchtern ließ und er mit mir machen konnte, was er wollte.
Doch er wandte seinen Blick nicht ab. Im Gegenteil. Unverwandt sah er mir in die Augen. Als ich es fast nicht mehr aushielt, kamen meine Mutter und William.
»Schön, dann sind wir bereit«, sagte William gut gelaunt. Ich sah ihn missmutig an. »Ich hab einen Tisch im Club reserviert, ich hoffe, ihr habt ordentlich Hunger«, fügte er hinzu und ging zur Tür.
Meine Mutter fiel aus allen Wolken, als sie mein Kleid sah.
»Was hast du dir denn dabei gedacht?«, flüsterte sie mir ins Ohr.
Ich tat, als hätte ich ihre Bemerkung nicht gehört, und eilte zur Tür.
Draußen wehte ein laues, erfrischendes Lüftchen und in der Ferne war das Geräusch der Wellen zu hören.
»Fährst du mit uns, Nick?«, fragte William.
Doch der war bereits auf dem Weg zu einem nagelneuen, riesigen schwarzen SUV. Ich verdrehte die Augen. Das war ja nicht anders zu erwarten!
»Ich fahr mit meinem«, erwiderte er. »Nach dem Essen bin ich noch mit Miles verabredet, wir wollen den Bericht über den Refford-Fall abschließen.«
»Alles klar«, sagte sein Vater. Ich verstand kein Wort. Er drehte sich zu mir um. »Willst du mit ihm zum Club fahren, Noah? Dann könnt ihr euch schon ein wenig kennenlernen.« Er hielt das wohl für eine geniale Idee.
Nick schaute mich fragend an, er schien die Situation zu genießen.
»Ich möchte ungern zu jemandem ins Auto steigen, von dem ich nicht weiß, wie er fährt«, sagte ich. Ich hoffte inständig, ihn in seiner männlichen Ehre gekränkt zu haben, indem ich seine Fahrkünste anzweifelte. Ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, stieg ich in den schwarzen Mercedes meines Stiefvaters.
Auf der Fahrt zum Club der Schönen und Reichen genoss ich den Moment des Alleinseins auf dem Rücksitz.
Ich wünschte mir sehnlichst, dass der Abend so schnell wie möglich vorüberging und die Farce der glücklichen Familie endete, die meine Mutter und ihr Mann herbeireden wollten. Ich wollte zurück in mein Zimmer und meine Ruhe haben.
Eine Viertelstunde später erreichten wir ein Areal, umgeben von gepflegten Rasenflächen. Ein hell erleuchteter Weg führte zum Jachtclub Mary Read. Doch bevor wir einfahren konnten, mussten wir eine Schranke passieren. Ein Angestellter trat aus dem eleganten Wachhäuschen, um zu überprüfen, wer in dem Auto saß. Mein Stiefvater wurde natürlich sofort erkannt.
»Ah, die Leisters! Guten Abend, Sir … Ma’am.«
Mein Stiefvater grüßte zurück und wir fuhren auf das Gelände des Clubs.
»Noah, deine Mitgliedskarte müsste nächste Woche kommen, solange kannst du dich auf meinen Namen berufen, damit sie dich reinlassen, oder auch Ellas«, sagte er und blickte zu meiner Mutter.
Das versetzte mir einen Stich. So hatte mein Vater sie immer genannt, und ich war mir absolut sicher, dass meine Mutter diese Koseform nicht ausstehen konnte … zu viele schlechte Erinnerungen waren damit verbunden, aber das konnte sie ihrem tollen neuen Mann natürlich nicht sagen.
Meine Mutter war sehr gut darin, schmerzliche und komplizierte Dinge zu vergessen. Ich hingegen trug alles ganz tief in mir drin, bis ich irgendwann explodierte und es hochkam.
William hielt direkt vor dem Eingang. Ein Page kam und öffnete meiner Mutter und mir die Tür. William drückte ihm ein paar Scheine in die Hand und er fuhr mit dem Wagen davon.
Das Restaurant war ein ringsherum verglaster Traum. In riesigen Aquarien tummelten sich Hummer, Fische und Tintenfische, die nur darauf warteten, verspeist zu werden. Noch bevor wir zu unserem Tisch geführt wurden, spürte ich, wie sich jemand direkt hinter mir postierte. Sein Atem streifte mein Ohr und ich erschauderte. Es war Nicholas. Er sah über mich hinweg.
»Ich habe reserviert, auf den Namen William Leister«, sagte mein neuer Stiefvater zu der Dame am Empfang. Ihr Gesicht zuckte leicht, als sie den Namen hörte, und sie brachte uns rasch zu unserem Tisch.
Es war einer der besten Plätze in dem einladenden, von warmem Kerzenlicht erleuchteten Raum. Hinter der Glasfront lag der Ozean, ein atemberaubendes Panorama, und ich fragte mich, ob in Kalifornien alle Wände transparent waren.
Ich muss gestehen, ich war hin und weg.
Kaum hatten wir uns hingesetzt, fingen William und meine Mutter an, zu turteln und zu plaudern. Mir fiel auf, dass die Kellnerin Nick irritiert ansah.
Der schien es nicht zu bemerken und ließ den Minisalzstreuer zwischen seinen Fingern kreisen. Einen Moment lang blieb mein Blick an den großen, sonnengebräunten, gepflegten Händen hängen. Dann ließ ich ihn weiterwandern über seinen Arm und weiter zu seinem Gesicht. Auch er musterte mich unverhohlen. Mir stockte der Atem.
»Was wollt ihr bestellen?«, fragte meine Mutter.
Ich ließ sie für mich wählen, mehr als die Hälfte der Gerichte auf der Speisekarte waren mir völlig unbekannt. Während wir auf unser Essen warteten und ich geistesabwesend mit dem Strohhalm in meinem Eistee herumrührte, startete William einen Versuch, seinen Sohn und mich in das Gespräch einzubinden.
»Ich habe Noah gerade von den Sportarten erzählt, die man hier im Club ausüben kann, Nick«, erklärte er. »Nicholas spielt Basketball und er ist ein ausgezeichneter Surfer, Noah.« Er ignorierte das gelangweilte Gesicht seines Sohnes und konzentrierte sich jetzt auf mich.
Ein Surfer … Dummerweise bemerkte Nicholas, wie ich die Augen verdrehte. Er fixierte mich, stützte die Arme auf den Tisch und rückte ein Stück an mich heran.
»Ist was, Noah?«, fragte er. Er bemühte sich, freundlich zu klingen, aber ich wusste, dass ihn mein wortloser Kommentar verärgert hatte. »Ist Surfen in deinen Augen etwa ein dummer Sport?«
Bevor meine Mutter sich einmischen konnte, beugte auch ich mich vor.
»Das hast jetzt du gesagt, nicht ich«, erwiderte ich mit einem unschuldigen Lächeln.
Ich mochte taktische Mannschaftssportarten, bei denen man einen guten Kapitän braucht und Ausdauer und Einsatz zeigen muss. Das hatte ich beim Volleyball gefunden, und ich war mir sicher, dass man Surfen damit nicht vergleichen konnte.
Noch bevor er darauf antworten konnte – was er bestimmt liebend gern getan hätte –, kam die Kellnerin an den Tisch, und wieder hatte ich den Eindruck, dass sie sich von irgendwoher kannten.
Sie servierte das Essen und berührte dabei Nick versehentlich an der Schulter.
»Tut mir leid, Nick«, entschuldigte sie sich und erschrak im selben Moment, als hätte sie einen unverzeihlichen Fehler begangen.
Irgendwas lief zwischen den beiden.
Ich nutzte die Gelegenheit, dass unsere Eltern durch ein Gespräch mit Bekannten abgelenkt waren, um nachzubohren.
»Kennst du sie?«, fragte ich, während er sich Wasser nachschenkte.
»Wen?«, fragte er. Er stellte sich dumm.
»Na, die Kellnerin«, erwiderte ich und beobachtete interessiert sein Gesicht. Keine Reaktion, er wirkte völlig entspannt. Offenbar gehörte er zu den Menschen, die sehr gut verbergen können, was in ihrem Kopf vorgeht.
»Ja, sie hat mich schon öfter bedient«, sagte er. Er sah mich herausfordernd an, als wartete er förmlich darauf, dass ich ihm widersprach. Na, sieh einer an … Unser Nick lügt wie gedruckt. Warum wunderte mich das nicht?
»Klar, bestimmt hat sie dich schon öfter bedient«, bemerkte ich spitz.
»Was willst du damit andeuten, Schwesterchen?«, fragte er, und diesmal musste ich bei der Bezeichnung schmunzeln.
»Reiche Typen wie du, ihr seid doch alle gleich; ihr glaubt, weil ihr Geld habt, gehört euch die Welt. Das Mädchen hat dich nicht aus den Augen gelassen, seit du den Raum betreten hast; es ist eindeutig, dass sie dich kennt«, erklärte ich wütend. »Und du hast dich nicht mal dazu herabgelassen, sie anzusehen. Das ist einfach nur widerlich.«
Er zögerte einen Moment, bevor er antwortete.
»Das ist eine interessante Theorie, und wie ich sehe, kannst du ›reiche Typen‹, wie du sie nennst, nicht ausstehen. Klar, deine Mutter und du, ihr lebt jetzt unter unserem Dach und genießt all die Annehmlichkeiten, die das Geld bietet, aber wenn du uns so abscheulich findest, warum sitzt du dann an diesem Tisch?« Er sah mich verächtlich an.
Ich versuchte krampfhaft, mich zu beherrschen. Der Kerl wusste genau, welche Knöpfe er drücken musste, um mich aus der Fassung zu bringen.
»Ich finde, deine Mutter und du, ihr seid schlimmer als die Kellnerin«, zischte er mir zu. »Ihr gebt vor, etwas zu sein, was ihr nicht seid, dabei habt ihr euch beide verkauft …«
Das war zu viel. Blind vor Wut, nahm ich mein Glas und wollte ihm den Inhalt in sein Gesicht schütten.
Blöd nur, dass es nahezu leer war.
4
NICK
Ihr Gesichtsausdruck war göttlich, als sie merkte, dass kaum noch was im Glas war. Sie konnte ihre Wut nicht mehr beherrschen.
Die Kleine war wirklich unberechenbar. Ich war überrascht, wie schnell sie ausflippte, und es gefiel mir, wie man sie mit wenigen Worten aus der Reserve locken konnte.
Ihre mit Sommersprossen gesprenkelten Wangen röteten sich, als ihr klar wurde, dass sie sich lächerlich gemacht hatte. Ihr Blick wanderte von dem leeren Glas zu mir und dann nach rechts und links, um sich zu vergewissern, dass keiner der Gäste ihre Blamage mitbekommen hatte.
Aber abgesehen von der Komik des Ganzen – und es war wirklich zum Schreien komisch – konnte ich nicht zulassen, dass sie so mit mir umging. Und wenn das Glas voll gewesen wäre? Wer war diese siebzehnjährige Göre, dass sie es wagte, mir ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten … Das kleine dumme Ding würde schon noch kapieren, was für eine Sorte großer Bruder ich war. Sie würde am eigenen Leib erfahren, was es für Folgen hat, wenn man es wagt, sich mit mir anzulegen.
Ich setzte ein zuckersüßes Lächeln auf. Verhalten beobachtete sie mich, und ich genoss es, einen Anflug von Angst in den von schönen langen Wimpern umrahmten Augen aufblitzen zu sehen.
»Mach das nie wieder«, sagte ich ruhig.
Sie sah mich einen Moment lang an und wandte sich dann, als wäre nichts geschehen, ihrer Mutter zu.
Der Abend verlief erst mal ohne weitere Zwischenfälle. Noah sprach kein weiteres Wort mit mir, und sie würdigte mich auch keines Blickes, was mich einerseits ärgerte und mir andererseits recht war. So konnte ich sie beobachten, während sie die Fragen meines Vaters beantwortete und sich lustlos mit ihrer Mutter unterhielt.
Sie war einfach gestrickt, und doch hatte ich das Gefühl, dass sie mir ordentlich Ärger machen würde. Was sie für ein Gesicht zog, als sie die Meeresfrüchte probierte! Sie pickte wie ein Vögelchen von den Leckereien auf dem Tisch, und ich dachte, wie zart sie in dem eng anliegenden Kleid wirkte. Als sie aus ihrer Zimmertür getreten war, hatte ich verblüfft ihre langen Beine, die schlanke Taille und ihre Brüste betrachtet. Sie hatte eine tolle Figur, und das ganz ohne Schönheits-OPs, anders als die meisten Mädchen in Kalifornien.
Ich musste mir eingestehen, dass sie hübscher war, als ich im ersten Moment gedacht hatte, und die nicht ganz jugendfreien Bilder, die mir daraufhin durch den Kopf gingen, schlugen mir auf die Laune. Das musste ich mir schleunigst aus dem Kopf schlagen, erst recht, wenn wir künftig unter einem Dach leben sollten.
Ich musterte erneut ihr Gesicht. Sie trug keinerlei Make-up. Es war seltsam … Alle Mädchen, die ich kannte, verwendeten mindestens eine Stunde darauf, sich zu schminken, bevor sie ausgingen, selbst solche, die tausendmal hübscher waren als Noah, aber sie hatte offenbar kein Problem damit, ohne Lippenstift in ein Luxusrestaurant zu gehen. Nicht dass sie es nötig gehabt hätte, sich zu schminken: Sie hatte eine schöne, glatte Haut ohne Unregelmäßigkeiten, von den Sommersprossen mal abgesehen, die ihr etwas Kindliches verliehen.
Plötzlich bemerkte Noah, dass ich sie beobachtete, und sie fragte mit dem ihr eigenen Sarkasmus:
»Hättest du gern ein Foto von mir?«
»Wenn es ein Nacktfoto ist, gerne«, erwiderte ich und genoss es, dass sie leicht errötete. Ihre Augen blitzten vor Zorn, und sie wandte sich wieder unseren Eltern zu, die nichts von den kleinen Scharmützeln in ihrer unmittelbaren Nähe mitbekamen.
Ich nippte an meinem Glas und schaute zu Claudia, der Kellnerin hinter der Theke, die mich die ganze Zeit über beobachtete. Ich stand auf und sagte, ich müsse zur Toilette. Noah beachtete ich nicht weiter. Ich hatte etwas Wichtigeres vor.
Entschlossen marschierte ich zur Theke und setzte mich auf den Hocker vor Claudia, mit der ich ab und an ins Bett ging und mit deren Cousin mich ein kompliziertes, aber höchst einträgliches Verhältnis verband.
Claudia lächelte ein wenig verbissen, stützte sich auf den Tresen und gewährte mir einen kleinen Einblick in ihren Ausschnitt, doch ihre Dienstkleidung war relativ züchtig.
»Wie ich sehe, hast du dir eine andere angelacht«, meinte sie.
Das amüsierte mich.
»Das ist meine Stiefschwester«, erklärte ich und schaute auf meine Armbanduhr. In vierzig Minuten war ich mit Anna verabredet. »Allerdings wüsste ich nicht, was dich das angeht«, sagte ich und stand auf. »Sag Ronnie, ich warte heute Abend an der Anlegestelle auf ihn, bei Kyles Party.«
Claudia verzog missmutig das Gesicht, weil ich ihr so wenig Aufmerksamkeit schenkte. Ich verstand nicht, warum sich die Frauen von einem wie mir was Ernstes erhofften. Hatte ich sie nicht gewarnt, dass ich nichts Festes wollte? Wurde ihnen das nicht von selbst klar, wenn sie mitbekamen, dass ich ins Bett stieg, mit wem ich wollte? Warum glaubte jede, sie hätte irgendetwas, weshalb ich mich ändern würde?
Aus ebendiesem Grund hatte ich mit Claudia Schluss gemacht und das hatte sie mir immer noch nicht verziehen.
»Gehst du zur Party?«, fragte sie mich mit einem Funken Hoffnung im Blick.
»Klar«, erwiderte ich. »Mit Anna. Ach, und noch was: Gib dir künftig mehr Mühe und lass dir nicht anmerken, dass du mich kennst. Meine Stiefschwester hat schon spitzgekriegt, dass wir was am Laufen hatten, und ich will nicht, dass mein Vater davon erfährt.«
Schmollend drehte sie sich um.
Als ich zum Tisch zurückkam, wurde gerade der Nachtisch serviert. Zehn Minuten später, in denen mein Vater und seine neue Frau allein die Konversation bestritten, befand ich, dass ich meine Rolle als Sohn für den Tag lange genug erfüllt hatte.
»Es tut mir leid, aber ich muss gehen«, entschuldigte ich mich mit einem Blick auf meinen Vater, der offensichtlich not amused war.
»Zu Miles?«, fragte er, und ich vermied es, auf die Uhr zu schauen. »Wie läuft’s mit dem Fall?«
Ich unterdrückte einen resignierten Seufzer und tischte ihm ein Märchen auf.
»Sein Vater lässt uns den ganzen Papierkram machen. Bis wir mal einen echten Fall für uns allein haben, werden vermutlich Jahre vergehen«, erwiderte ich.
»Was studierst du?«, fragte Noah, und ich bemerkte die Irritation in ihrem Blick.
»Jura«, antwortete ich, »überrascht dich das?«
»Ehrlich gesagt, ja. Ich dachte, für solch ein Studium muss man was im Kopf haben.«
»Noah!«, rief ihre Mutter entrüstet.
Die Kleine ging mir gehörig auf den Zeiger.
Noch bevor ich etwas erwidern konnte, platzte meinem Vater der Kragen.
»Das war alles andere als ein guter Start!« Er sah mich vorwurfsvoll an.
Für heute hatte ich genug von der albernen Nummer mit der glücklichen Familie; ich konnte nicht länger Interesse heucheln.
»Es tut mir leid, aber ich muss.« Ich stand auf und legte die Serviette auf den Tisch. Ich wollte nicht vor meinem Vater die Fassung verlieren.
In dem Moment sprang auch Noah auf und warf die Serviette auf den Tisch.
»Wenn er geht, gehe ich auch!«, erklärte sie bestimmt. Peinlich berührt sah ihre Mutter von einer Seite zur anderen; sie war sichtlich erregt.
»Setz dich sofort wieder hin«, zischte sie.
Verdammt, ich hatte keine Zeit für diesen Mist. Ich musste los.
»Schon gut. Ich nehme sie mit«, sagte ich schließlich zu aller Erstaunen.
Noah sah mich argwöhnisch an. Sie fragte sich bestimmt, ob ich einen Hintergedanken hatte. Aber ich konnte es kaum erwarten, sie loszuwerden, und wenn ich sie nach Hause brachte, schlug ich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn so schaffte ich mir sie und meinen Vater vom Hals.
»Mit dir fahr ich nicht mal bis zur nächsten Straßenecke«, entgegnete sie stolz, wobei sie jedes Wort genüsslich betonte.
Bevor noch jemand etwas sagen konnte, schnappte ich mir mein Jackett und erklärte: »Das ist mir zu dumm, wir sehen uns morgen.«
»Warte, Nicholas.« Mein Vater klang so bestimmt, dass ich innehielt. »Noah, fahr mit ihm und ruh dich aus. Wir kommen bald nach.«
Meine Stiefschwester überlegte kurz, ob sie mit mir die gleiche Luft atmen oder noch länger am Tisch ausharren sollte.
»Okay, ich komme mit«, sagte sie schließlich mit einem Seufzer.
5
NOAH
Dem Rüpel auch noch dankbar sein zu müssen, war so ziemlich das Letzte, was ich wollte, aber allein mit meiner Mutter und ihrem Mann zurückbleiben und mit ansehen zu müssen, wie sie ihm verliebte Blicke zuwarf und er mit seinem Geld und seinem Einfluss protzte, war mir erst recht zuwider.
Nicholas war schon auf dem Weg zum Ausgang.
Lustlos verabschiedete ich mich von meiner Mutter und eilte ihm nach. Draußen wartete ich mit verschränkten Armen darauf, dass uns das Auto gebracht wurde.
Er zog eine Zigarettenschachtel aus der Jackentasche und zündete sich eine an. Das passte zu ihm. Ich beobachtete, wie er die Kippe zum Mund führte und kurz darauf langsam den Rauch ausströmen ließ.
Ich hatte noch nie geraucht, noch nicht mal an einer Zigarette gezogen, wenn meine Freundinnen auf der Schultoilette pafften. Ich verstand nicht, welche Befriedigung die Leute darin fanden, krebserregenden Rauch einzuatmen, der alle möglichen Organe schädigte und zudem noch einen ekelhaften Gestank an den Haaren und auf den Klamotten hinterließ.
Als könnte er Gedanken lesen, hielt Nicholas mir mit einem sarkastischen Lächeln das Päckchen hin.
»Auch eine, Schwesterchen?«, fragte er und nahm einen tiefen Zug.
»Ich rauche nicht. Und ich an deiner Stelle würde das sein lassen, sonst stirbt die einzige Nervenzelle, die du hast, auch noch ab«, sagte ich und trat einen Schritt vor, um ihn nicht mehr sehen zu müssen.
Ich erschrak, als er mir plötzlich eine Rauchwolke in den Nacken blies.
»Vorsicht, sonst kannst du zu Fuß nach Hause laufen«, warnte er mich. In dem Moment wurde das Auto vorgefahren.
Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, stolzierte ich zu dem SUV. Das Auto war so hoch, dass ich mich beim Einsteigen in Acht nehmen musste, damit man mir nicht unter den Rock schauen konnte, und ich bedauerte es, dass ich nicht meine Converse Chucks angezogen hatte. All die angestaute Frustration, Wut und Traurigkeit und die Streitereien mit dem Idioten hatten dafür gesorgt, dass meine Stimmung im Keller war.
Ich schnallte mich an, während Nicholas den Wagen anließ, die Hand auf meine Kopfstütze legte, nach hinten blickte und zurücksetzte. Natürlich nutzte er zum Wenden nicht den dafür vorgesehenen Kreisel, sondern fuhr einfach entgegen der Fahrtrichtung.
Als wir die Straße erreichten, schnaubte ich empört. Außerhalb des Clubgeländes beschleunigte er auf hundertzwanzig, obwohl auf der Straße höchstens achtzig erlaubt waren.
Er drehte sich zu mir.
»Was hast du jetzt wieder für ein Problem?«, fragte er genervt, als könnte er meine Anwesenheit nicht eine Minute länger ertragen. Tja, da waren wir schon zu zweit.
»Ich habe keine Lust, wegen eines Größenwahnsinnigen, der offenbar keine Verkehrsschilder lesen kann, am nächsten Baum zu landen, das ist mein Problem«, giftete ich.
Das war typisch für mich. Eines der Dinge, die ich am meisten an mir hasste, war meine mangelnde Beherrschung. Wenn ich wütend war, ich fing an zu toben und vergriff mich im Ton.

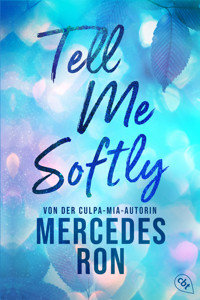
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










