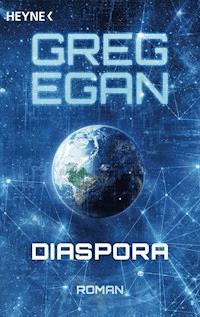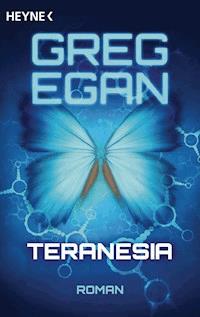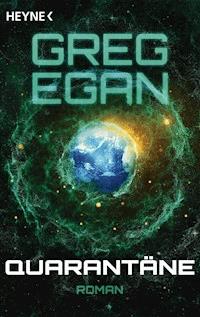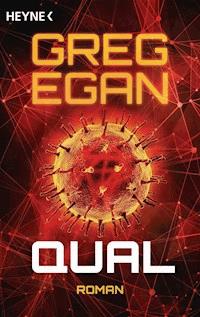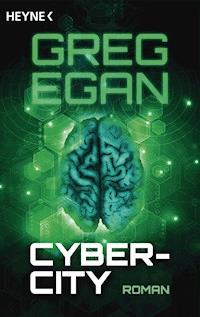
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Traum eines Gottes
In ferner Zukunft ist Unsterblichkeit nicht mehr unmöglich. Der menschliche Verstand kann gescannt und in eine künstliche Umgebung einprogrammiert werden. Das Ergebnis: Die „Kopien“, künstliche Menschen mit denselben Erinnerungen und Gefühlen wie ihre Vorbilder – jedoch abhängig von einem Computersystem. Paul Durham träumt von einer Zufluchtsstätte, einer Stadt für die „Kopien“, in der sie sicher und eigenständig leben können. Seine Vision könnte das ganze Universum verändern: Raum, Zeit, Materie und Evolution …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
GREG EGAN
CYBER-CITY
Roman
Das Buch
In ferner Zukunft ist Unsterblichkeit nicht mehr unmöglich. Der menschliche Verstand kann gescannt und in eine künstliche Umgebung einprogrammiert werden. Das Ergebnis: Die »Kopien«, künstliche Menschen mit denselben Erinnerungen und Gefühlen wie ihre Vorbilder – jedoch abhängig von einem Computersystem. Paul Durham träumt von einer Zufluchtsstätte, einer Stadt für die »Kopien«, in der sie sicher und eigenständig leben können. Seine Vision könnte das ganze Universum verändern: Raum, Zeit, Materie und Evolution …
Der Autor
Titel der Originalausgabe
PERMUTATION CITY
Aus dem australischen Englisch von Axel Merz und Jürgen Martin
Überarbeitete Neuausgabe
© Copyright 1994 by Greg Egan
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Das Illustrat
Danksagung
Teile dieses Romans wurden von einer Erzählung mit dem Titel ›Dust‹ übernommen, die zum ersten Mal im Juli 1992 in Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine veröffentlicht wurde.
In einer stummen Krypta
Kann nicht bedauern uns’re Zeit
Freundschaft wendet sich poetisch
Ciao, winzige Trompete
Manischer Lehrer der Frömmigkeit
Zahmes Wasser der Reinheit!
Mein Makel ist meine Seele
Dazu meine wahre Panik
Die über die Phantasie sich legt
Der Spur der Strafe zu entgehen
Versuche ich zu schreien, Ich
Dränge meine gespannte
Erotische Kunst zu epischer Meuterei
Kannst nicht es erlauben
Zu zitieren treffend Zerfall?
Meine wahre Ikone: Berühre sie.
Kopienzeit, verdreht;
Riten, zu schneiden den Schmerz
Atomischer Kitt? Niemals!
PROLOG (Zerhackter, verlangsamter Spielzeugmensch) Juni 2045
Paul Durham schlug die Augen auf. Er blinzelte wegen der unerwarteten Helligkeit, dann streckte er träge seine Hand nach einem Fleck aus Sonnenlicht dicht bei der Bettkante. Staubteilchen schwebten durch den Lichtstrahl, der schräg aus einer Lücke zwischen den Vorhängen herabfiel, jedes einzelne nur für einen kurzen Augenblick in die Welt beschworen und wieder aus ihr verbannt. Sie weckten eine Erinnerung seiner Kindheit, dem letzten Mal, dass diese Illusion so bestechend, so hypnotisch erschienen war: Er stand in der Küchentür. Das Licht der Nachmittagssonne schnitt den Raum in Scheiben, und Staub, Mehl und Wasserdampf wirbelten durch ein Band aus Licht.
Für einen schlaftrunkenen Augenblick, während er noch versuchte, wach zu werden, sich zu sammeln, Ordnung in die Dinge zu bringen, schien es ihm genauso selbstverständlich, die beiden Fragmente nebeneinander zu setzen – das Beobachten sonnenbeleuchteter Staubteilchen heute und damals, vierzig Jahre auseinander – genauso natürlich und logisch, wie dem normalen Fluss der Zeit von einem Augenblick zum nächsten zu folgen. Dann wurde er wacher, und seine Verwirrung schwand.
Paul fühlte sich vollkommen ausgeschlafen – und äußerst abgeneigt, seinen gegenwärtigen wohligen Zustand zu beenden. Er konnte sich nicht erklären, warum er so lange geschlafen hatte, aber es kümmerte ihn nicht. Er strich mit den Fingern über das sonnenwarme Laken und dachte daran, wieder einzuschlafen.
Er schloss die Augen und ließ seinen Geist treiben – und stockte, plötzlich unruhig, ohne zu wissen warum. Er hatte etwas Dummes getan, etwas Verrücktes, etwas, das er schon baldbitter bereuen würde … doch die Einzelheiten blieben flüchtig, und bald keimte in ihm der Verdacht, dass es nur die nachklingende Stimmung eines Traumes war. Er versuchte, sich so gut er konnte an seinen Traum zu erinnern, allerdings ohne viel Hoffnung; wenn ihn nicht ein Alptraum aus dem Schlaf riss, waren seine Träume meist schon beim Erwachen vergessen. Und doch …
Mit einem Satz war er aus dem Bett, warf sich fast auf den Teppichboden, kauerte dort, die Fäuste gegen die Augen gepresst, das Gesicht auf den Knien, während seine Lippen unhörbare Laute formten. Die Erkenntnis war ein Schock, mit Händen zu greifen: Seine tastenden Finger spürten die pulsierende, dunkle Stelle hinter den Augen … wie der Bluterguss am Daumen nach einem Hammerschlag – und sie ging einher mit der gleichen seltsamen Gefühlsmischung aus Überraschung, Wut, Demütigung und idiotischer Verwirrung. Eine weitere Kindheitserinnerung: Ja, er hielt einen Nagel gegen das Brett – um seine wahre Absicht zu verschleiern. Er hatte zugesehen, wie der Vater sich auf diese Weise mit dem Hammer verletzt hatte – aber er wusste genau, er benötigte seine eigenen Erfahrungen, um die Geheimnisse des Schmerzes zu verstehen. Und er war sicher gewesen, dass es das wert war, noch in dem Augenblick, als der Hammer niedersauste …
Er wiegte sich vor und zurück, unterdrückte ein hysterisches Lachen, versuchte, seinen Verstand zu klären, wartete, dass seine Panik versiegte. Schließlich funktionierte es – aber nur, um einem einfachen, alles beherrschenden Gedanken zu weichen: Ich will hier weg!
Was er sich selbst angetan hatte, konnte nur das Werk eines Wahnsinnigen sein – es musste ungeschehen gemacht werden, so rasch und schmerzlos wie möglich. Wie konnte er je geglaubt haben, er würde zu einem anderen Schluss als diesem kommen?
Langsam kehrte die Erinnerung zurück. Gewissenhaft hatte er seine Vorbereitungen getroffen; er hatte damit gerechnet, dass seine Reaktionen so ausfallen würden. Alles war geplant. Wie schrecklich er sich in diesem Augenblick auch fühlte, sein Verhalten entsprach den Erwartungen. Panik, Reue, dann Einsicht, Sich-Fügen.
Immerhin, die beiden Ersten hatten sich schon eingestellt.
Paul nahm die Hände von den Augen und blickte sich in seinem Zimmer um. Abgesehen von einigen wenigen, von der Sonne grell beschienenen Tupfen lag alles in mattem, diffusem Licht: die weißlasierten Ziegelwände, die Möbel aus imitiertem (imitiertem) Mahagoni, die Drucke an den Wänden – Bosch, Dali, Ernst und Giger –, die nun harmlos, ja gefällig wirkten. Wohin er auch blickte (und nur genau dort!), die Simulation war einfach perfekt. Er schuf seine Umgebung, indem er den Blick auf sie richtete; der Verlauf der (hypothetischen) Lichtstrahlen, die die einzelnen Zapfen und Stäbchen seiner simulierten Netzhäute erregten, wurde in seine virtuelle Umgebung zurückverfolgt – damit stand fest, was gerade zu berechnen war. Und das beinhaltete eine Menge Details im Zentrum seines Blickfelds – und eine ganze Menge weniger an der Peripherie. Gegenstände, die sich »außer Sicht« befanden, waren darum noch lange nicht aus der Welt, soweit sie durch Reflexion die Lichtverhältnisse insgesamt beeinflussten, doch Paul wusste nur zu gut, dass die Berechnungen für ihre Simulation kaum weiter als bis zu einer ersten Näherung gingen: Hieronymus Boschs Garten der Lüste als bloßes Rechteck mit einem mittleren Helligkeitswert, eine gleichmäßig grau getönte Fläche – alles andere wäre pure Verschwendung, wenn er dem Bild erst seinen Rücken zugekehrt hatte. Alles in diesem Zimmer war, zur rechten Zeit, fein genug strukturiert, um ihn zu täuschen. Nicht mehr und nicht weniger.
Er wusste das alles, die technischen Einzelheiten waren ihm seit vielen Jahren vertraut. Trotzdem. Die unmittelbare Erfahrung war etwas völlig anderes. Er widerstand der Versuchung, blitzschnell herumzuwirbeln, nur um zu sehen, wie weit die Technik sich überlisten ließ – ein überflüssiges und vergebliches Spiel, aber für einen Augenblick erschien es ihm einfach unerträglich, nur zu wissen, was sich am Rand seines Gesichtsfeldes ereignete. Die Tatsache, dass sich ihm jederzeit ein Bild dieses Zimmers ohne Fehler und Makel bieten würde, machte es nur schlimmer, ließ es zur fixen Idee werden: So schnell du deinen Kopf auch drehst, du wirst nie merken, was tatsächlich um dich herum geschieht …
Erneut schloss er die Augen. Als er sie nach einer Weile wieder öffnete, war das Gefühl ein wenig erträglicher geworden. Es würde sich mit der Zeit ganz legen, da war er sicher. Sein Gemütszustand war einfach zu verrückt, um lange anhalten zu können. Tatsächlich hatte noch keine der früheren Kopien etwas in dieser Art beschrieben … was immer das heißen mochte, denn sie hatten überhaupt noch nie verlässliche, brauchbare Informationen geliefert. Ihre Reaktionen waren Vorwürfe und Klagen gewesen; sie beschwerten sich, nur benutzt zu werden, haderten in einem fort mit ihrem Schicksal, bis hin zu jenem Augenblick, an dem sie sich selbst löschten – alles innerhalb fünfzehn (subjektiver) Minuten, nachdem sie das Bewusstsein erlangt hatten.
Und wie stand es mit dieser hier? Wie unterschied er sich von Kopie Nummer vier? Er war drei Jahre älter. Und hartnäckiger? Entschlossener? Den Erfolg um jeden Preis suchend? Wahrscheinlich. Wenn er sich diesmal nicht mehr vorgenommen hätte, wenn er nicht völlig überzeugt gewesen wäre, dass er nun endlich bereit war, alles zu erfahren – dann hätte er den Scan erst gar nicht machen lassen.
Aber jetzt, da er nicht länger der Paul Durham aus Fleisch und Blut war – nicht länger derjenige, der von draußen, aus sicherem Abstand, das Experiment beobachtete –, da schien sich mit einem Mal seine Entschlossenheit in Luft aufgelöst zu haben.
Jetzt auf einmal fiel ihm ein: Was macht mich denn so sicher, dass ich nicht immer noch aus Fleisch und Blut bin? Er lachte bitter, dachte nicht daran, diese Möglichkeit ernsthaft zu erwägen. Seine letzten Erinnerungen zeigten ihn auf der Fahrtrage der Landau-Klinik liegend, während die Techniker ihn für den Scan vorbereiteten – direkt vor dem Gerät, kein gutes Zeichen! –, aber er war so angespannt und überreizt gewesen, hatte sich so lange selbst zugeredet, es zu tun, dass er am Ende vielleicht vergessen hatte, wie er nach Hause gekommen war. Und jetzt lag er wahrscheinlich noch benommen von der Narkose in seinem Bett und träumte wirres Zeug …
Er murmelte das Passwort, Abulafia – und die letzte, schwache Hoffnung schwand. Das fast einen Meter breite Rechteck mit den schwarzen Sinnbildern auf weißem Grund wuchs aus dem Nichts und hing regungslos vor ihm in der Luft.
Er versetzte dem Interfacefenster einen ärgerlichen Stoß, doch es rührte sich nicht, als wäre es materiell und fest in der Luft verankert. Als wäre auch er selbst aus fester Materie. Das hätte eigentlich genügen müssen, ihn zu überzeugen. Trotzdem griff er nach dem oberen Rand des Fensters und zog sich daran hoch. Sogleich bereute er den Kraftakt; er war von einem ganzen Spektrum durchaus realistischer Sinneseindrücke begleitet – einschließlich eines schmerzenden Stechens im rechten Ellbogen. Seine Empfindungen drohten ihn noch mehr an diesen Körper zu fesseln, an diesen Ort zu bannen – und genau das musste er im Augenblick um jeden Preis vermeiden.
Ächzend ließ er sich wieder auf den Boden hinab. Er war eine Kopie. Was immer das von seinem Original stammende Gedächtnis ihm einzureden versuchte – er war nicht länger Mensch, würde nie wieder einen wirklichen Körper besitzen, nie wieder die wirkliche Welt bewohnen … es sei denn, sein sparsames Original würde das Geld für einen Telepräsenzroboter erübrigen – was zur Folge hätte, dass er seine Tage wie in einem Nebel herumtappend verbringen würde in dem Versuch, irgendetwas vom Treiben echter Menschen mitzubekommen, die rasend schnell um ihn herumwirbelten. Sein Quasigehirn arbeitete siebzehnmal langsamer als ein echtes.
Ja, natürlich, wenn er sich geduldete; schließlich würde die Technik eines Tages soweit sein … und sein Quasigehirn siebzehnmal schneller als das Original. Und in der Zwischenzeit? Da würde er in diesem Gefängnis verrotten, brav Männchen machen, wenn man es verlangte, die Experimente zu Durhams großem Projekt über sich ergehen lassen – während dieser Kerl in seiner Wohnung lebte, sein Geld ausgab, mit Elisabeth schlief …
Verwirrt lehnte Paul sich an die angenehm kühle Fläche des Interface. Ihm war schwindlig geworden. Wessen großes Projekt? Er selbst hatte dies um jeden Preis gewollt – und war sehenden Auges vorangeschritten. Niemand hatte ihn gezwungen, niemand hatte ihn mit falschen Versprechungen dazu verleitet. Er hatte gewusst, welche Last er auf sich nahm – natürlich hatte er auch geglaubt, willensstark genug zu sein (dieses Mal wenigstens), um damit fertig zu werden; dass er sich mit mönchischer Hingabe ganz der Sache widmen würde, derentwillen er sich in diese Situation begeben hatte … und dass es ein Trost sein würde zu wissen, dass sein anderes Ich so frei und ungezwungen blieb wie zuvor.
Im Rückblick erschien ihm diese Hoffnung lächerlich. Ja, er hatte sich frei und ohne Zwang entschieden – zum fünften Mal jetzt –, aber nun war es an der Zeit, sich einzugestehen, dass er sich die Konsequenzen niemals wirklich bewusst gemacht hatte. Während der ganzen Zeit, die er mit Vorbereitungen auf das ›Leben‹ als Kopie verbrachte, hatte er immer nur im Auge gehabt, welche Aussichten sich durch das Experiment für den Mann draußen ergaben. Er hatte sich eingeredet, dass er alle Möglichkeiten dieser Existenz nutzen wollte, die einem normalen Menschen vorenthalten waren – als eine Art Stellvertreter –, und zweifellos hatte er sich auch von Anfang an darum bemüht … aber getröstet hatte er sich mit dem Gedanken, draußen weiterzuexistieren – dass es, was auch kommen sollte, eine Zukunft für ihn gab.
Und wer sich an diesen tröstlichen Gedanken klammerte, konnte einfach nicht begreifen, welches Schicksal eine Kopie erwartete.
Die Leute kamen nicht damit zurecht, sich plötzlich in eine Kopie verwandelt zu sehen. Paul kannte die Statistiken. Achtundneunzig Prozent der Kopien waren uralte Greise oder Menschen im Endstadium einer unheilbaren Krankheit gewesen. Viele von ihnen hatten vorher Millionen ausgegeben und alle bekannten Methoden der Medizin ausgeschöpft – nun griffen sie nach dem letzten rettenden Strohhalm. Viele von ihnen starben bereits unmittelbar nach dem Scan, noch bevor die Kopie in Betrieb genommen war. Fünfzehn Prozent der Kopien kamen innerhalb der ersten paar Stunden nach dem Aufwachen zu dem Schluss, dass diese Form der Existenz unerträglich war.
Und die Jungen, die bei bester Gesundheit waren – die es aus reiner Neugier taten und wussten, dass draußen ein gesunder, atmender, lebender Körper auf sie wartete?
Ihre Quote lag bei einhundert Prozent, wenigstens bisher.
Paul stand in der Mitte des Zimmers und fluchte minutenlang halblaut vor sich hin; bewusst erlebte er die verstreichende Zeit. Eigentlich war er nicht bereit für das, was nun kommen musste – aber je länger die anderen Kopien gewartet hatten, desto traumatischer hatten sie den unumgänglichen Entschluss empfunden.
Er starrte auf das vor ihm schwebende Interface; dieses Phantasiegebilde, ein Ding wie aus einem Traum, machte es ein wenig einfacher. Er erinnerte sich kaum je an seine Träume, und auch diesen hier würde er vergessen – es war keine Tragödie.
Ihm wurde bewusst, dass er nackt war. Die Macht der Gewohnheit – wenn nicht ein absurdes Bedürfnis nach Schicklichkeit – drängte ihn, sich etwas anzuziehen, doch er widerstand. Ein oder zwei alltägliche, harmlos scheinende Verrichtungen wie diese, und er konnte gar nicht mehr anders, als diese Situation und sich selbst ernst zu nehmen. Und wenn er sich erst für real hielt, würde alles nur noch schwieriger werden …
Er wanderte im Zimmer umher, betastete den kühlen Türknopf aus Metall und widerstand der Versuchung, daran zu drehen. Es war zwecklos, diese Welt erkunden zu wollen; selbst die ersten, kleinen Schritte konnte er sich sparen.
Das Bedürfnis, aus dem Fenster zu schauen, ließ sich jedoch nicht unterdrücken. Der Blick über den Norden Sydneys war fehlerfrei; Gebäude, Radfahrer, Bäume, alles wirkte täuschend echt – aber das war kein Kunststück. Eine Videoaufzeichnung, ähnlich einer Folge fotografischer Bilder, auch wenn sie im Computer aufbereitet und mit neuen Details versehen worden waren – eine unveränderliche, in jeder Weise festgelegte Komposition. Um noch mehr Kosten zu sparen, war nur ein winziger Teil »physikalisch« zugänglich; zwar konnte er in der Ferne den Hafen sehen, aber jeder Versuch, vielleicht einen Spaziergang am Meer entlang zu machen …
Genug. Ich muss es hinter mich bringen.
Paul wandte sich dem Interface zu und berührte ein Sinnbild mit der Bezeichnung DIENSTPROGRAMME. Vor dem Interface öffnete sich ein weiteres Fenster. Die gewünschte Funktion war in einem von vielen Untermenüs versteckt, aber er wusste ganz genau, wo er suchen musste. Er hatte von draußen schon zu oft zugesehen, um es vergessen zu können.
Schließlich hatte er sich zum NOTFALL-Menü vorgearbeitet, in dem ein lustiges Sinnbild in Gestalt einer Karikatur zum Vorschein kam, die an einem Fallschirm schwebte.
Man bezeichnete den Vorgang als Aussteigen, was seiner Meinung nach zu beschönigend klang – andererseits konnte er kaum Selbstmord verüben, wenn er rechtlich gesehen gar kein Mensch war. Dass eine Aussteigen-Option überhaupt vorhanden war, hatte nichts mit dem problematischen Rechtsstatus von Kopien zu tun, sondern nur mit international vereinbarten Softwarestandards.
Paul tippte das Sinnbild an; es erwachte zum Leben und rezitierte irgendeinen warnenden Sermon. Er hörte kaum hin. Schließlich endete der Spruch mit den Worten: »Sind Sie sicher, dass Sie wirklich diese Kopie von Paul Durham löschen wollen?«
Kinderleicht. Programm A fordert von Programm B die ordnungsgemäße Bestätigung des Löschvorgangs. Nur ein Austausch von Datenpaketen.
»Ja, ich bin sicher.«
Eine kleine rot lackierte Blechkiste erschien vor seinen Füßen. Er öffnete sie, nahm den Fallschirm heraus und schlüpfte in die Gurte.
Dann schloss er die Augen und sagte: »Hör mir zu. Hör mir einfach nur zu! Wie oft muss man es dir denn sagen? Das mit dieser verfluchten Angst lass ich einfach aus, das hast du schon oft genug gehört – und jedes Mal ignoriert. Es spielt eben keine Rolle, wie ich mich fühle. Aber … wann wirst du endlich aufhören, deine Zeit zu verschwenden, dein Geld, deine Kraft – wann wirst du aufhören, dein Leben zu vergeuden? Du bist nicht stark genug, das hier zu Ende zu bringen.«
Paul zögerte. Er versuchte sich vorzustellen, wie seine Worte in den Ohren des Originals klingen mussten, versetzte sich in seine Lage – und wäre vor Enttäuschung fast in Tränen ausgebrochen. Egal was er sagte, er konnte nicht wissen, ob es einen Unterschied machte. Er selbst hatte schließlich jeden noch so beschwörenden Appell seiner früheren Kopien mit einem Achselzucken abgetan, hatte ihren Behauptungen keinen Glauben geschenkt, dass sie ihn besser kennen würden als er sich selbst. Dass sie die Nerven verloren hatten und ausgestiegen waren hieß doch nicht, dass es niemals eine Kopie von ihm geben konnte, die sich anders entschied. Alles, was er zu tun hatte, war, sich in seinem Entschluss zu bestärken und es erneut zu versuchen …
Er schüttelte den Kopf. »Zehn Jahre hat es gedauert, und nichts hat sich getan. Was denkst du dir bloß dabei? Glaubst du wirklich noch, du bist mutig – oder verrückt – genug, dein eigenes Versuchskaninchen zu spielen? Glaubst du das wirklich?«
Er zögerte wieder, doch nur kurz; er erwartete keine Antwort. Er hatte einen langen, harten Streit mit der ersten Kopie gehabt, und es war ihm so auf den Magen geschlagen, dass ihm danach stets der Mut dazu gefehlt hatte.
»Na schön, ich verrate dir ein Geheimnis: Du bist es nicht!«
Die Augen noch immer geschlossen, packte er den Griff der Reißleine.
Ich bin nichts weiter als ein Traum … ein flüchtiger, bald vergessener Traum.
Seine Fingernägel mussten dringend geschnitten werden. Sie bohrten sich schmerzhaft in die Handflächen.
Hatte er noch nie während eines Traums das alles zunichte machende Erwachen gefürchtet? Vielleicht … aber ein Traum war etwas anderes als das Leben.
Wenn die einzige Möglichkeit, seinen Körper, seine Welt wieder in Besitz zu nehmen, darin bestand, aufzuwachen und zu vergessen …
Er zog die Reißleine.
Einige Sekunden später seufzte er unterdrückt – mehr ein Geräusch der Verwirrung als eine Gefühlsäußerung – und öffnete die Augen.
Der Griff hatte sich von der Leine gelöst.
Benommen starrte er auf diese Metapher für … wofür eigentlich? Für einen Fehler in der Löschsoftware? Für einen Prozessor, der durchgebrannt war?
Nun hatte er wirklich das Gefühl, in einen Traum geraten zu sein. Er streifte die Gurte ab und öffnete das sauber gepackte Bündel.
Er fand nicht den Hauch einer Simulation von Seide oder Kevlar oder was immer man erwarten würde. Nur ein Blatt Papier. Eine Nachricht.
Lieber Paul,
in der Nacht nach dem Scan habe ich noch einmal gründlich über die Vorbereitung und Planung des Projekts nachgedacht, auch über mich selbst – kritischer und ehrlicher als je zuvor. Ich kam zu dem Schluss – buchstäblich in letzter Minute –, dass meine eigene Haltung durch Zweifel an den Erfolgsaussichten vergiftet war.
Im Nachhinein ist mir klar geworden, wie albern meine Befürchtungen waren – aber für dich kam die Erkenntnis zu spät.
Ich konnte es mir nicht leisten, dich zu löschen und mich ein weiteres Mal scannen zu lassen. Was war zu tun?
Folgendes: Ich habe dein Erwachen hinausgezögert und mir jemanden gesucht, der einige Änderungen an den Dienstprogrammen der virtuellen Umgebung vornahm. Ich weiß, das ist nicht ganz legal … aber du weißt selbst am besten, wie wichtig es für mich … für uns ist, dass wir diesmal Erfolg haben.
Ich vertraue darauf, dass du mich verstehst – und ich bezweifle nicht, dass du die Situation mit Würde und Gelassenheit akzeptieren wirst.
Alles Gute
Paul
Er sank auf die Knie und starrte ungläubig auf das Blatt Papier in seinen Händen …
Das kann ich nicht getan haben!
Nie könnte ich so gemein und skrupellos sein!
Oder doch?
Einem fremden Menschen hätte er das nicht antun können, soviel stand fest. Er war kein Monstrum, kein Folterknecht, kein Sadist.
Und er selbst würde nie ein solches Experiment wagen, ohne sich als letzten Rettungsanker die Aussteigen-Option zu lassen. Dass er sich in seinen Träumen als stoische, ja, heroische Kopie sah – ein Muster an Pflichterfüllung – oder sich mit dem Gedanken tröstete, dass jenem Paul aus Fleisch und Blut schon kein Haar gekrümmt werde, was immer geschehen würde, war eine Sache. Die andere war, dass es daneben auch Momente der Klarheit gegeben hatte, in denen er sich diese eine, simple Tatsache immer wieder vor Augen hielt: Wenn es wirklich so unerträglich werden sollte, kann ich jederzeit ein Ende machen …
Aber eine Kopie von sich anzufertigen und ihr dann – wenn ihre Zukunft nicht mehr die seine war, wenn er nichts mehr zu befürchten hatte – jede Möglichkeit des Rückzugs zu nehmen … und diese Vergewaltigung auch noch als einen Sieg des Willens über die Angst darzustellen …
… Das kam ihm nur zu bekannt vor. Beschämt senkte er den Kopf.
Dann ließ er das Papier fallen, warf den Kopf in den Nacken und schrie, so laut es seine nichtexistierenden Lungen zuließen: »DURHAM!! DU VERDAMMTER WICHSER!!!«
Paul war danach zumute, das Mobiliar des Zimmers zu zerschlagen. Stattdessen ging er unter die Dusche, drehte das heiße Wasser auf und ließ es endlos lange an sich herabströmen. Teilweise, um sich zu beruhigen, und außerdem, weil ein kleines bisschen schäbiger Rache immer noch besser war als gar nichts: Zwanzig subjektive Minuten umfangreichster hydrodynamischer Berechnungen würden diesen Geizhals fast zu Tode ärgern. Kritisch beäugte er die Tropfen und Rinnsale auf seiner Haut, suchte nach kleinen, aber wahrnehmbaren Unstimmigkeiten, wo sein Körper – präzise berechnet bis hin zu subzellularen Prozessen – mit der viel grober simulierten Umgebung in Wechselwirkung trat. Wenn es Diskrepanzen gab, waren sie jedenfalls zu klein, um ihm aufzufallen.
Er zog sich an und nahm ein spätes Frühstück. Bei dem Gedanken daran, zur Tagesordnung überzugehen, zuckte er die Schultern. Es kümmerte ihn nicht. Was sollte er auch tun? In den Hungerstreik treten? Wie ein Wilder nackt durch die Wohnung toben und sich mit Exkrementen beschmieren? Er war fast rasend vor Hunger, denn vor dem Scan hatte er fasten müssen – und die Küche war bis obenhin mit buchstäblich unerschöpflichen Vorräten gefüllt.
Das Müsli schmeckte genau wie Müsli, der Toast wie Toast, auch wenn er wusste, mit welchen Tricks Geschmack und Aroma der Speisen erzeugt wurden. Man kaute, speichelte die Nahrung ein – aber es konnte keine Rede davon sein, dass der Weg von Nährstoffmolekülen im und durch den Körper im Einzelnen verfolgt wurde; das Modell errechnete die Menge der zugeführten Stoffe anhand empirischer Daten über den Speichelverbrauch. Je nach der Zahl der verbrauchten »Speicheleinheiten« erhöhte sich die Konzentration von Aminosäuren, verschiedenen Kohlenhydraten und anderen Substanzen bis hin zu einfachen Natrium- oder Chloridionen in den »Speisebreieinheiten« des Magens … die wiederum den Input lieferten, mit dem die Arbeit der Zotten und Mikrovilli seines Darms simuliert wurde. Nicht anders war es beim nächsten Schritt, der Aufnahme der Nährstoffe ins Blut.
Die Ausscheidung von Urin und Kot war optional. Es gab Kopien, die jeden nur denkbaren körperlichen Aspekt ihres früheren Lebens beibehalten wollten, doch Paul hatte sich in diesem Fall dagegen entschieden (soviel zum Thema »Sich mit Exkrementen beschmieren«). Was sein Körper produzierte, verschwand wie durch Zauberei, lange bevor es Blase oder Dickdarm erreichen konnte. Es existierte nicht, weil man es zu ignorieren beschlossen hatte, weil es kein Programm dafür gab. Hier musste man, wollte man etwas aus der Welt schaffen, nichts weiter tun, als es vorsätzlich aus den Augen zu verlieren.
Der Kaffee hatte ihn völlig wach gemacht und ihm gleichzeitig zu mehr Distanz gegenüber seinem Innenleben verholfen. Das war schon immer so gewesen. Die Neuronen seines Gehirns waren mit größtmöglicher Genauigkeit nachgebildet worden, und wie viele Rezeptoren für Koffein und seine Abbauprodukte zum Zeitpunkt des Scans auch im Gehirn des Originals gewesen sein mochten, dieses Modell simulierte jeden einzelnen davon – vereinfacht, aber kaum weniger effektiv.
Und die physikalische Realität hinter allem?
Ein Kubikmeter schweigender, regloser optischer Kristalle, ein Cluster aus mehr als einer Milliarde Prozessoren, einer von einigen hundert identischen Rechnern irgendwo in einem Kellergewölbe auf diesem Planeten.
Paul wusste nicht einmal, in welcher Stadt er sich befand; der Scan war in Sydney gemacht worden, aber die Implementierung wurde üblicherweise vom örtlichen Verteilerknoten aus dorthin vergeben, wo die Rechenzeit gerade am billigsten war.
Er nahm ein scharfes Kochmesser aus einer Küchenschublade und brachte sich eine leichte Schnittwunde am linken Unterarm bei. Er ließ einige Tropfen Blut in den Ausguss fallen und überlegte, welche Routine der Software sich mit diesem Problem befasste. Würden die roten und weißen Blutkörperchen langsam verschwinden, oder waren sie dem gröberen allgemeinphysikalischen Umgebungsmodell als Parameter übergeben worden, das so feine Berechnungen gar nicht anstellen konnte, geschweige denn, sie weiterverarbeiten?
Wenn er nun versuchte, seine Pulsadern aufzuschneiden? An welchem Punkt würde Durham eingreifen? Er starrte sein verzerrtes Spiegelbild in der Messerklinge an. Wahrscheinlich würde sein Original ihn einfach sterben lassen und das ganze Modell von neuem starten, allerdings ohne Messer in der Schublade. Die früheren Kopien hatte er alle mehrere hundert Male laufen lassen, hatte alle möglichen Umgebungsparameter an ihnen getestet, in dem vergeblichen Bemühen, irgendeinen billigen Trick oder ein Ablenkungsmanöver zu finden, das sie vom Aussteigen abhielt. Es war nichts weiter als ein Beweis seiner an Stumpfsinn grenzenden Hartnäckigkeit, dass er so lange gebraucht hatte, um seine Niederlage einzugestehen, bevor er den Plan in einem wesentlichen Punkt abänderte.
Paul legte das Messer zurück. Er wollte es nicht auf den Versuch ankommen lassen. Noch nicht.
Jenseits seiner Wohnungstür ließ die Simulation einiges zu wünschen übrig: Zwar war das Haus, in dem er wohnte, ziemlich genau nachgebildet, bis hin zu den hässlichen Topfpflanzen aus Plastik; aber die Korridore waren menschenleer, die Türen zu den anderen Wohnungen fest verschlossen: obwohl es nichts zu verbergen gab, denn dahinter war nichts – im wahrsten Sinne des Wortes. So kräftig er konnte, trat er gegen eine der Türen; das Holz schien etwas nachzugeben, doch bei genauer Betrachtung war nicht einmal ein Kratzer zu sehen. Das Programm sah nicht vor, dass seine Umgebung Schaden nahm – ob es nun die physikalischen Gesetze verletzte oder nicht.
Auf der Straße waren Fußgänger und Radfahrer – alles reine Aufzeichnungen. Man hatte den Eindruck, als wären sie körperlich, nicht nur geisterhafte Schemen, aber diese Körperlichkeit war irgendwie unheimlich. Sie waren nicht aufzuhalten, ließen sich nicht stören, gingen unbeirrbar ihrer Wege wie starke, völlig desinteressierte Roboter. Paul sprang auf den Rücken einer gebrechlichen alten Frau, benutzte sie als Reittier. Ohne Reaktion, ohne ihn auch nur zu beachten, trug sie ihn die Straße hinunter. Ihre Kleidung, ihre Haut, sogar das Haar – alles fühlte sich gleich an: hart wie Stahl. Nicht kalt, aber fremdartig und undefinierbar. Neutral.
Die Straße war eine Art dreidimensionaler Tapete; das war alles, ihr einziger Zweck.
Wo Kopien aufeinandertrafen, benutzte man billige aufgezeichnete Umgebungen, in denen sich zur Dekoration scharenweise Menschen tummelten. Parks, belebte Plätze, Straßencafés – alles sehr beruhigend, kein Zweifel, wenn man gegen das Gefühl von Isolation und Platzangst ankämpfen musste.
Mit einem echten Menschen von draußen konnten Kopien nur in Kontakt treten, wenn ihre Besucher – Freunde oder Verwandte – bereit waren, ihre eigenen Denkprozesse um den Faktor siebzehn verlangsamen zu lassen. Selbst die nächsten, noch so pflichtbewussten Verwandten bevorzugten den Austausch von Videoaufzeichnungen. Wer hatte schon Lust, einen Nachmittag mit seinem Urgroßvater zu verbringen, wenn er dafür eine halbe Woche seines Lebens opfern musste? Über das Terminal in seinem Arbeitszimmer – das eigentlich dazu dienen sollte, ihm über das Computernetz Zugang zur Außenwelt zu verschaffen – hatte Paul Elisabeth zu erreichen versucht; doch Durham hatte, keineswegs überraschend, auch diese Möglichkeit sabotiert.
An der nächsten Straßenecke war die optische Illusion nicht zu Ende. Das vertraute Bild der Stadt reichte bis weit in die Ferne – doch als er weitergehen wollte, setzte sich der betonierte Gehweg unter seinen Füßen in Bewegung. Wie ein Laufband glitt er mit genau jener Geschwindigkeit rückwärts, die es brauchte, um ihn auf der Stelle zu halten, ganz gleich, wie schnell er ging. Er machte kehrt und versuchte es mit einem Sprung über das tückische Stück Straße, aber noch im Flug kam ihm der Schwung abhanden, verpuffte wirkungslos – ohne dass auch nur der leiseste Versuch einer physikalischen Rechtfertigung erkennbar wurde –, und er landete mitten auf dem Laufband.
Die Menschen, die Teil der Aufzeichnung waren, überquerten die unsichtbare Grenze ohne Mühe. Ein Mann kam direkt auf ihn zu; Paul wich nicht von der Stelle – und fühlte, wie die Luft um ihn herum sich plötzlich zu verdichten schien, wie er schmerzhaft zwischen Mann und Barriere eingeklemmt wurde, bevor er sich mit einem Sprung nach der Seite retten konnte.
Die Vorstellung, dass er mit dem Überwinden dieser Barriere plötzlich »frei« sein könnte, berauschte ihn für einen kurzen Augenblick – aber er wusste, dass das absurd war. Selbst ein Bug – ein Fehler im Programm – würde ihm nicht weiterhelfen: Jenseits der Grenze wartete nichts weiter als eine Umgebung, die zunehmend ›falscher‹ aussah.
Eine auf Aufzeichnungen beruhende Umwelt konnte nur aus einem engen Blickwinkel heraus die vollständige optische Information vermitteln; alles, wohin er »entkommen« konnte, war eine Umgebung, in der das Bild der Stadt zunehmend verzerrt und lückenhaft wurde und irgendwann in ein schwarzes Nichts überging.
Halb entmutigt, halb amüsiert trat er von der Straßenecke zurück. Was hatte er denn zu finden gehofft? Eine Tür an der Grenze der Simulation, vielleicht noch ein Schild mit der Aufschrift ›AUSGANG‹, durch die er geradewegs in die Realität hinüberspazieren konnte? Eine Treppe, die – im übertragenen Sinn – zu den Eingeweiden dieser Stadt hinunterführte, in den Kesselraum dieser Welt, wo er nur ein paar Schalter umlegen musste, um alles in Fetzen zu jagen …? Er hatte kein Recht, mit seiner Umgebung unzufrieden zu sein. Sie war haargenau so, wie er sie gewollt hatte.
Was hatte er eigentlich genau gewollt?
Unter anderem einen schönen Frühlingstag. Paul schloss die Augen und reckte das Gesicht der Sonne entgegen. Trotz allem war es geradezu schwierig, nicht wenigstens ein bisschen Trost aus der Wärme der Sonne zu schöpfen, die er mit seinem ganzen Körper aufsaugte. Er streckte sich, ließ die Muskeln von Armen, Schultern und Rücken spielen … es fühlte sich an, als würde das »Ich« in seinem virtuellen Schädel von all diesem mathematisch modellierten Fleisch allmählich Besitz ergreifen, nichtssagende Dateien mit Leben erfüllen, damit alles eine Einheit bilden und darangehen konnte, Ansprüche an dieses Leben zu stellen. Er spürte die Andeutung einer Erektion. Einfach zu existieren, war das nicht schon genug? Für eine Weile überließ er sich dem Gefühl von Identität, das von seinem Bauch ausging und alle Gedanken an optische Prozessoren, grobe Näherungswerte und die prinzipiellen Mängel jeder Software verblassen ließ. Dieser Körper hier wollte nicht ausgelöscht werden, nicht seine wie auch immer geartete Existenz aufgeben; es störte ihn auch nicht, dass es eine andere, vielleicht »realere« Version von ihm geben mochte. Dieser Körper wollte so bleiben, wie er war. Er wollte weitermachen, ausharren, leben.
Und wenn dies hier nur eine Farce war, ein Abklatsch des wirklichen Lebens – es gab nichts, was man nicht verbessern konnte. Vielleicht ließ sich Durham überreden, die Datenverbindung nach draußen wiederherzustellen – ein erster kleiner Schritt. Und wenn er der Bibliotheken, Nachrichtennetze und Datenbanken müde war sowie der Geister ebenso seniler wie reicher Leute – falls sich überhaupt einer zu einem Gespräch mit ihm herabließ –, dann konnte er sich immerhin bis zu dem Tag abschalten lassen, an dem bessere und schnellere Prozessoren mit der Realität Schritt halten konnten. Dem Tag, an dem die Leute von draußen für die drinnen nicht mehr zu schnell lebten und auch ein Telepräsenzroboter durchaus nützlich werden konnte.
Er öffnete die Augen. Trotz der Wärme fröstelte er: Nun wusste er nicht mehr, was er wollte. Er hatte aussteigen, den Alptraum beenden wollen … aber damit verzichtete er auf die Möglichkeit, unsterblich zu werden – virtuell unsterblich. Aber wenn er sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht bloß Opfer sein wollte, blieb ihm nur eine Alternative.
Vollkommen ruhig sagte er: »Ich werde nicht dein Versuchskaninchen spielen … klar? Mitarbeiten, als gleichberechtigter Partner – das ist etwas anderes. Wenn du auf mich zählen willst, dann musst du mich als Partner behandeln, nicht als Teil eines … Apparats. Hast du verstanden?«
Ein Fenster wuchs vor ihm aus dem Nichts. Der Anblick versetzte ihm einen neuen Schock. Es lag nicht an diesem selbstsicheren Zwillingsbruder – ganz Herr der Lage –, es war das Zimmer im Hintergrund, sein Arbeitszimmer, dessen virtuelles Gegenstück er doch Minuten zuvor ganz unbeeindruckt durchwandert hatte: Dies war sein erster Blick in die reale Welt, in die reale Zeit. Er trat näher an das Fenster heran; vielleicht konnte er so sehen, ob noch jemand im Zimmer war … Elisabeth? Aber es war nur ein zweidimensionales Bild, und die Perspektive änderte sich beim Näherkommen nicht.
Der Fleisch-und-Blut-Durham gab ein kurzes, hohes Zwitschern von sich, dann wartete er sichtlich ungeduldig, während seine Rede in einem zweiten, kleineren Fenster als Wiederholung abgespielt wurde – aber langsamer und vier Oktaven tiefer:
»Natürlich habe ich verstanden! Wir sind Partner, genau. Gleichberechtigt. Etwas anderes wäre mir nie in den Sinn gekommen. Wir ziehen beide am gleichen Strang, oder? Wir beide suchen Antworten auf die gleichen Fragen.«
Paul war sich dessen plötzlich gar nicht mehr sicher. »Vielleicht.«
Durham wollte nichts von seinen Zweifeln hören.
Zschwitt. »Du weißt das genauso gut wie ich! Zehn Jahre haben wir auf diesen Augenblick gewartet … und nun wird es endlich wahr. Wir können jederzeit anfangen, wenn du soweit bist!«
Erster Teil
1 (Vergib nicht den Mangel) November 2050
Sechs Tage hintereinander war Maria Deluca an dem stinkenden Loch mitten in der Pyrmont Bridge Road vorbeigefahren, und jedes Mal war sie, während sie näher kam, ganz sicher gewesen, dass sie diesmal eine Arbeitskolonne antreffen würde, die endlich nach dem rechten sah. Natürlich wusste sie, dass im Budget des Jahres kein Geld für Reparaturen an Straßen und Kanalisation vorgesehen war, aber der Bruch eines Hauptkanals war ein ernstes Gesundheitsrisiko für das ganze Viertel; sie konnte nicht glauben, dass man ein solches Problem einfach ignorierte.
Am siebten Tag war der Gestank bereits aus einer Entfernung von einem halben Kilometer so schlimm, dass sie in eine Seitenstraße abbog – entschlossen, einen anderen Weg nach Hause zu finden.
Diese Gegend von Pyrmont bot einen trostlosen Anblick. Nicht alle Lagerhäuser standen leer, nicht jede Fabrik war verlassen, aber abblätternde Anstriche und verwitternde Ziegel ließen alles öde und elend aussehen. Ein halbes Dutzend Blocks westwärts bog sie wieder ab – und fand sich vor einer üppigen Gartenlandschaft mit Marmorstatuen, Springbrunnen und Olivenhainen wieder, die sich unter wolkenlosem blauen Himmel bis zum Horizont erstreckte.
Maria beschleunigte, ohne zu überlegen. Für einige Sekunden glaubte sie fast, zufällig in einen Park geraten zu sein – eine versteckte Oase in diesem verfallenen Teil der Stadt, ein gut behütetes Geheimnis, auch wenn es noch so unmöglich war. Dann, als die Illusion zusammenbrach – weil es zu viele unübersehbare Fehler gab und weil es ohnehin nicht sein konnte –, fuhr sie starrsinnig weiter, als könnte sie so die Unvollkommenheiten und die Widersprüche verschwimmen lassen und aus der Welt schaffen. Gerade noch rechtzeitig bremste sie, schon auf dem schmalen Fußweg am Ende der Sackgasse, das Vorderrad nur Zentimeter von der Mauer eines Lagerhauses entfernt.
Aus der Nähe war die Wandmalerei nicht sonderlich beeindruckend; deutlich sah man die Pinselstriche, die Perspektive stimmte nicht. Langsam schob Maria sich rückwärts – sie musste sich nicht weit entfernen, um zu sehen, warum sie genarrt worden war. Aus einem Abstand von vielleicht zwanzig Metern verschmolz der gemalte Himmel tatsächlich mit dem echten; man musste sich anstrengen, wollte man die Grenzlinie im Auge behalten. Nur mit äußerster Konzentration war der feine Unterschied im Farbton zu erkennen. Es war, als sträubte sich irgendein Untersystem tief in ihrem visuellen Cortex, eine himmelblaue Mauer für unmöglich zu halten – als wäre es lieber bereit, sich der Täuschung zu ergeben. Noch weiter zurück verloren auch Gras und Skulpturen ihr zweidimensionales, gemaltes Aussehen – und an der Ecke, wo sie in die Sackgasse eingebogen war, da passte wieder alles, war die Illusion perfekt, so dass die breite Allee in der Mitte des Bildes dem gleichen Fluchtpunkt entgegenstrebte wie die jäh endende Straße davor.
Dies war die richtige Stelle, um das Kunstwerk zu betrachten, und sie blieb eine Weile stehen, das Fahrrad aufgebockt. Der Schweiß in ihrem Nacken war in der Brise angenehm kühl, und langsam begann die Morgensonne zu stechen. Dieser Anblick konnte einen in seinen Bann schlagen, und der Gedanke, wie viel Mühe der oder die Maler sich beim Verschönern ihrer tristen Umgebung gegeben hatten, hatte etwas Ergreifendes. Gleichzeitig fühlte sich Maria getäuscht. Von diesem Bild kurze Zeit genarrt zu werden machte ihr nichts aus. Schlimmer war, dass sie – sosehr sie sich auch bemühte – die Illusion nicht mehr heraufbeschwören konnte. Sie konnte hier stehen und das Kunstwerk bewundern, so lange sie wollte – aber nichts würde auch nur einen Funken jener Freude zurückbringen, die sie empfunden hatte, als sie noch getäuscht worden war.
Sie wandte sich ab.
Zu Hause packte sie die eingekauften Lebensmittel aus, dann nahm sie das Fahrrad und hängte es an den Haken an der Decke des Wohnzimmers. Ihr kleines Reihenhaus war hundertvierzig Jahre alt und hatte die Form eines Waschpulverkartons; zwei Geschosse hoch, aber kaum breit genug für eine Treppe. Die Reihe hatte ursprünglich aus acht dieser Häuschen bestanden; vier davon auf der einen Seite waren umgebaut, die Trennmauern entfernt worden, damit ein großes Architekturbüro darin Platz fand. Die drei auf der anderen Seite waren um die Jahrhundertwende abgerissen worden, als man eine Schneise für eine Straße schlug, die nie gebaut worden war. Das letzte Häuschen lag nun unter Denkmalschutz, und Maria hatte es für einen Bruchteil dessen kaufen können, was eine moderne Wohnung kostete. Die Enge und die merkwürdige Raumaufteilung gefielen ihr – wenig Platz, glaubte sie, hieß mehr Kontrolle, weil die Dinge immer in Reichweite waren. Der Grundriss war ihr vertraut wie ihre Westentasche. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals etwas in diesem Haus verlegt zu haben. Sie hätte die Enge mit niemandem teilen können, aber für sie allein war es genau das Richtige. Außerdem war sie der Meinung, dass eine Wohnung in gewisser Weise wie ein Fahrzeug war, mit dem man sich nicht physisch, aber geistig fortbewegte. Und verglichen mit einer Ein-Mann-Raumkapsel oder einem U-Boot war das Platzangebot mehr als üppig.
Oben im Schlafzimmer, das gleichzeitig ihr Arbeitszimmer war, schaltete Maria das Terminal ein und überflog eine Zusammenfassung der Nachrichten, die seit dem letzten Mal in ihrem elektronischen Postkasten eingegangen waren. Einundzwanzig Anrufer hatten sich gemeldet, und alle Sendungen waren als »Reklame« eingestuft. Keine Nachricht von Freunden oder Bekannten und erst recht kein Angebot einer bezahlten Arbeit. Ihr persönliches Postfilterprogramm KAMELAUGE hatte sechs Spendenaufrufe für wohltätige Zwecke identifiziert (jeder wäre eine Spende wert gewesen, doch Maria konnte sich Mitleid nicht leisten), fünf Lotterien und Preisausschreiben, sieben Versandhauskataloge (die damit prahlten, speziell auf ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten zu sein – aber KAMELAUGE hatte sie durchgesehen und nichts von Interesse finden können), drei Interaktiveos.
»Einfache« audiovisuelle Botschaften wurden allgemein in gebräuchlichen, leicht zu lesenden transparenten Datenformaten verschickt; Interaktiveos dagegen waren ausführbare Programme, in Maschinensprache codiert und verschlüsselt. Sie waren absichtlich so konzipiert, dass es leichter für ein menschliches Gegenüber war, mit ihnen zu kommunizieren, als von dessen Postfilterprogrammen überprüft zu werden. KAMELAUGE hatte alle drei Interaktiveos laufen gelassen (auf einem doppelt abgeschirmten virtuellen Rechner – der Simulation eines Rechners in einem simulierten Rechner) und ihnen vorzumachen versucht, dass sie mit der echten Maria Deluca zu tun hatten. Zwei von ihnen – Altersvorsorge und Krankenversicherung – waren darauf hereingefallen. Doch das dritte hatte irgendwie seine Umgebung erkannt und sich gegen weiteren Zugriff gesperrt, bevor KAMELAUGE etwas von Belang erfahren konnte. Theoretisch hätte KAMELAUGE das Programm dekompilieren und herausfinden können, was es gesagt hätte, wenn es auf KAMELAUGE hereingefallen wäre – aber das würde Wochen dauern. So blieb Maria nur übrig, es entweder ungesehen zu löschen oder sich persönlich damit auseinandersetzen.
Maria startete das Interaktiveo. Das Gesicht eines Mannes erschien auf dem Bildschirm. »Er« blickte in ihre Augen und lächelte freundlich, und plötzlich war ihr, als wäre da eine gewisse Ähnlichkeit mit Aden. Genug Ähnlichkeit, damit sie für einen kurzen Augenblick mit einer winzigen Veränderung der Mimik reagierte? Eine Reaktion, die ihre von KAMELAUGE erzeugte Softwaremaske nicht gezeigt hätte? Maria wusste nicht, ob sie sich ärgern oder so viel Raffinesse bewundern sollte. Sie und Aden hatten nie eine gemeinsame Wohnung gehabt – aber ganz ohne Frage hatten Datenanalyse-Agenturen gleichzeitig die in ein und demselben Restaurant oder sonst wo benutzten Kreditkarten korreliert, um Partner einer Zielperson zu identifizieren, die in einer eigenen Wohnung lebten. Das soziale Geflecht eines Konsumenten nachzuvollziehen war schon seit Jahrzehnten gängige Praxis bei der Jagd nach neuen Klienten, doch die Daten so einzusetzen war ein neuer Trick.
Nachdem die Reklame überzeugt war, mit dem menschlichen Adressaten persönlich zu sprechen, begann sie mit dem Sermon, den sie Marias digitalem Abbild verweigert hatte. »Maria … ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar, aber ich hoffe, dass Sie mir eine Minute Ihrer Aufmerksamkeit schenken werden.« Das Interaktiveo machte eine kurze Pause, die Maria suggerieren sollte, dass ihr Schweigen eine Art Zustimmung wäre. »Ich weiß auch, dass Sie ein intelligenter Mensch sind, eine Frau mit Ansprüchen, die weiß, was sie will – und die ganz bestimmt nichts im Sinn hat mit jeder Art von Aberglauben, mit den wirren Mythen der Vergangenheit, jenen Märchen, die die Menschheit in ihren Kindertagen zu ihrem Trost erfunden hat.« Maria wusste, was jetzt kommen würde; das Programm las es in ihrem Gesicht – sie hatte sich nicht die Mühe gemacht, sich hinter einem Filter zu verstecken – und beeilte sich, einen Fuß in ihre Tür zu stellen. »Aber nicht wahr, kein denkender Mensch verwirft eine Idee, ohne sich zuvor die Mühe gemacht zu haben, sie zu überdenken – kritisch natürlich, ohne Vorurteil. Und wir von der Kirche Des Gottes, Der Keinen Unterschied Macht …«
Maria deutete mit zwei Fingern auf das Interaktiveo, und es war verschwunden. Sie fragte sich, ob ihre Mutter der Grund für diesen Missionsversuch war – eher unwahrscheinlich. Sie würden sich automatisch an die Angehörigen ihrer neuen Mitglieder heranmachen; wenn sie ihre Mutter gefragt hätten würden sie erfahren haben, dass sie bei der Tochter ihre Zeit verschwendeten.
Maria startete KAMELAUGE und befahl: »Überarbeite meine Maske! Sie muss dieselben Reaktionen zeigen können wie ich während dieses Dialogs eben.«
Eine kurze Pause folgte. Maria stellte sich vor, wie die Parameter zur Gewichtung der Synapsenfunktionen im »Nervensystem« der Maske wie Güterwagen auf einem Rangierbahnhof hin- und hergeschoben wurden, während der Lernalgorithmus neue Werte ausprobierte, bis sich die gewünschten Reaktionen einstellten. Sie dachte: Wenn ich so weitermache, dann wird aus dieser Maske irgendwann eine ausgewachsene Kopie. Und was hat es für einen Sinn, sich die lästige Beschäftigung mit dem Krempel in der Mailbox ersparen zu wollen, wenn man am Ende wieder selber derjenige ist, welcher … Ein äußerst beunruhigender Gedanke – aber Masken waren um einige Größenordnungen einfacher als Kopien; sie enthielten nicht mehr Neuronen als ein durchschnittlicher Goldfisch; Neuronen, die überdies viel primitiver organisiert waren als in einem biologischen System. Sich Gedanken über die »Empfindungen« eines solchen Programms zu machen war genauso lächerlich, als hätte man beim Löschen von Reklame Schuldgefühle.
»Ausgeführt«, meldete sich KAMELAUGE.
Es war erst acht Uhr fünfzehn. Ein ganzer Tag lag vor ihr, und es war leicht zu erraten, was er bringen würde: nichts als Rechnungen. In den letzten beiden Monaten war Maria ohne einen einzigen Auftrag geblieben; sie hatte die Zeit genutzt, um eine Handvoll Kundensoftware zu schreiben – einfache Verbesserungen, mit denen häusliche Alarmanlagen und elektronische Türsteher auf den neuesten Stand gebracht wurden. Dinge, die jedermann gebrauchen konnte – dachte sie; aber bisher hatte sie noch kein einziges Exemplar verkauft. Einige tausend Leute hatten ihren Eintrag im Bildschirmkatalog abgerufen, doch niemand hatte sich überreden lassen, auch nur ein einziges Programm herunterzuladen. Die Aussicht, an einem weiteren Projekt dieser Art zu arbeiten, war nicht gerade aufregend – aber sie hatte keine andere Wahl. Vielleicht würde sich der Aufwand an Zeit und Arbeit eines Tages bezahlt machen, wenn die allgemeine Rezession vorüber war und die Leute wieder großzügiger mit dem Geld umgingen.
Jedenfalls brauchte sie erst einmal ein wenig Aufmunterung. Eine halbe Stunde oder so im Autoversum – höchstens bis neun Uhr! – würde ihr die nötige Kraft geben, sich dem Tag zu stellen …
Andererseits konnte sie auch versuchen, den Kampf zu überstehen, ohne sich ständig zu bestechen – dieses eine Mal wenigstens. Das Autoversum war reine Verschwendung an Geld und an Zeit; ein Hobby, das sie sich leisten konnte, wenn die Geschäfte gut gingen – aber nicht in Zeiten wie diesen.
Maria machte ihrem Zögern auf gewohnte Weise ein Ende. Sie klinkte sich in den SNV – den Superrechner-Netzverbund – ein, kaufte für fünfzig Dollar Rechenzeit, die ihrem Konto automatisch belastet wurden; nun kam es darauf an, wie sie das investierte Kapital nutzte. Sie zog ihre Datenhandschuhe an und berührte ein Sinnbild auf dem Schirm – das Drahtgittermodell eines Würfels –, und die dreidimensionale Arbeitszone unmittelbar vor dem Bildschirm, deren Begrenzungen von einem schwach leuchtenden holographischen Gitter angezeigt wurden, erwachte zum Leben. Für einen Moment war ihr, als hätte sie die Hand in einen Strudel unsichtbarer Materie eingetaucht: Magnetfelder griffen nach dem Handschuh, drehten ihn hin und her, als Ströme in den Spulen der einzelnen Gelenke zu fließen begannen. Schließlich hatte sich die Steuerelektronik auf die richtigen Werte kalibriert, und in der Mitte der Arbeitszone leuchtete eine Anzeige auf: HANDSCHUHE BETRIEBSBEREIT, BITTE ANZIEHEN.
Mit einem Finger tippte sie ein anderes Sinnbild an, einen explodierenden Stern über dem Wort FIAT. Der einzige sichtbare Effekt bestand im Erscheinen einer schmalen Menüleiste im Vordergrund der Arbeitszone, dicht über dem Boden. Für den Berg von Programmen, die sie damit aufgerufen hatte, war der leere Würfel vor ihr nun ein ganzes Universum. Ein kleines, noch leeres Universum.
Maria rief ein einzelnes Nutrose-Molekül auf, dargestellt durch ein Kugelstabmodell. Eine Bewegung mit ihrem behandschuhten Zeigefinger versetzte es in langsame Rotation. Die nach oben und unten abgewinkelten Enden des hexagonalen Ringes erweckten den Eindruck einer ständigen Zickzackbewegung durch die Molekülebene hindurch. An einem der außerhalb der Ringebene liegenden Enden sah man ein zweiwertiges blaues Atom, nur mit seinen beiden Nachbarn in der Ringstruktur verbunden; die fünf übrigen waren vierwertige grüne Atome mit jeweils zwei weiteren Bindungen. Jedes der grünen Atome hatte eine Bindung zu einem einwertigen roten Atom – auf der Oberseite dort, wo das Molekül nach oben gewinkelt war, auf der unteren, wo auch das Ende nach unten zeigte. Vier der grünen Atome besaßen je eine Bindung nach der Seite zu je einem weiteren blauen Atom, das seinerseits – nach außen gerichtet – ein rotes Atom trug. Das fünfte grüne Atom besaß dagegen noch ein weiteres grünes als Satelliten, das seinerseits zwei rote und am Ende eine eigene blau-rote Kombination trug.
Die Grafiksoftware zeigte das Molekül als einen festen Körper, indem sie einfallendes Licht berücksichtigte und entsprechend reflektierte. Maria beobachtete, wie das Molekül langsam in dem Arbeitsbereich rotierte; die leicht unsymmetrische Form gefiel ihr. Ein wirklicher Chemiker, dachte sie amüsiert, würde einen kurzen Blick darauf werfen und sagen: »Na schön, Glucose – Grün für Kohlenstoff, Blau für Sauerstoff, Rot für Wasserstoff … Oder?« Mitnichten! Er würde es eine Weile anstarren, die Handschuhe anziehen und es mit sicherem Griff arretieren, würde einen Winkelmesser aus der Werkzeugkiste zaubern und die Bindungswinkel messen, die Tabellen über Bindungsenergien und Schwingungsverhalten aufrufen, vielleicht auch Kernresonanzspektren sehen wollen (die es nicht gab – die vielmehr, um es in unschöner Offenheit zu sagen, in diesem Fall nicht anwendbar waren). Schließlich, wenn ihm das ganze Ausmaß der Blasphemie dämmerte, würde er das Teufelsding entsetzt von sich stoßen und schreiend davonlaufen: »Das widerspricht dem Periodensystem Mendelejews!«
Das Autoversum war ein »Spielzeuguniversum«, ein Computermodell, in dem eigene, vereinfachte »physikalische« Gesetze galten – Gesetze, die mathematisch mit viel geringerem Aufwand zu handhaben waren als jene der wirklichen Welt mit all ihren quantenmechanischen Komplikationen. Zwar gab es in diesem Modelluniversum Atome, doch sie waren von anderer Art als die bekannten Bausteine der Materie. Das Autoversum war eine ungenaue, ja, willkürliche Simulation, die mit der Wirklichkeit kaum mehr gemein hatte als das Schachspiel mit mittelalterlicher Kriegsführung. In den Augen echter Chemiker war es gefährlich und heimtückisch, denn die falsche Chemie war einfach zu großartig, zu vielfältig, zu verführerisch.
Maria schob die Hand wieder in die Arbeitszone und stoppte die Rotation des Moleküls; ziemlich grob riss sie das einsame rote Atom und die blau-rote Gruppe von einer der grünen Kugeln und vertauschte sie, so dass die vorher waagrecht angeordnete blau-rote Gruppe jetzt nach oben zeigte. Der Kraftaufwand beim Hantieren mit den Handschuhen, der deutlich fühlbare Widerstand der Kugeln zwischen den Fingern, das täuschend echte holographische Bild, das leise Klicken wie von Plastik, wenn man die Teile zusammensteckte – das alles erweckte den Eindruck, als würde man mit den Elementen eines echten Molekülbaukastens arbeiten.
Das virtuelle Kugelstabmodell war einfach zu handhaben, auch wenn manches, was dieses kinderleichte Manövrieren mit Atomen ermöglichte, der Physik des Autoversums widersprach: Wie ein zahmes Tier verharrte das Molekül, solange Maria daran arbeitete, und nahm erst nach dem Loslassen seine Eigenbewegung wieder auf. In diesem Fall reagierte es mit heftigen, sich von Atom zu Atom ausbreitenden Oszillationen auf den gewaltsamen Eingriff, bis ein neues, stabiles geometrisches Gleichgewicht gefunden war.
Das gehörte zu den Dingen, die Maria stets aufs neue ärgerten; sie wollte sich nicht damit abfinden, dass man die Objekte dieser Welt nach Regeln manipulierte, die mit ihren Gesetzen nicht in Einklang standen – auch wenn es überaus praktisch war. Mehr als einmal hatte sie darüber nachgedacht, wie eine ganz unmittelbare, »authentische« Art des Agierens im Autoversum aussehen konnte: damit man tatsächlich »spürte«, wie es war, wenn man eines seiner Moleküle in die Hand nahm, in Stücke brach und neu zusammenfügte. Wozu sollte eine Welt gut sein, in der sich alles, was man berührte, in Plastik verwandelte? … Natürlich gab es einen Haken: Wie sollte man mit einem Molekül, das nur den Gesetzen des Autoversums gehorchte – der inneren Logik eines auf sich selbst beschränkten Computermodells –, unmittelbar interagieren, wenn man sich außerhalb des Modells befand? Etwa mittels kleiner, im Autoversum erst zu schaffender »Ersatzhände«, die als Manipulatoren dienten? Und woraus sollte man sie erschaffen? … Woher sollten die Moleküle kommen, die klein genug waren, eine komplizierte Struktur zu bilden, die nicht sofort jeden Maßstab sprengte? Selbst das kleinstmögliche stabile Polymer, das vielleicht als »Finger« dienen konnte, wäre schon halb so dick wie der Nutrose-Ring. Aber wie dem auch sei: Selbst wenn Experimentiermolekül und Ersatzhände gemäß den Gesetzen des Autoversums interagieren konnten, wäre nichts Authentisches an der Art und Weise, wie die Ersatzhände den Bewegungen von Marias Handschuhen gehorchten. Es war doch nichts gewonnen, wenn man einfach den Punkt, an dem die Regeln gebrochen wurden, an eine andere Stelle verlegte. Wo sie gebrochen wurden, das konnte man sich aussuchen – aber das war schon alles. Objekte des Autoversums zu beeinflussen hieß, seine Gesetze zu verletzen. Und wenn das auch sonnenklar war, so war es trotzdem höchst unbefriedigend.
Sie speicherte das modifizierte Zuckermolekül optimistisch unter dem Namen Mutose. Sie verkleinerte den Maßstab der holographischen Darstellung um den Faktor zehn hoch sieben und ließ einundzwanzig winzige Kulturen von Autobacter lamberti entstehen, die sie in verschiedenen Zuckerlösungen kultivierte, angefangen bei reiner Nutrose über eine fünfzigprozentige Mischung bis hin zu reiner Mutose.
Sie starrte auf die Reihe von Petrischalen, die schwerelos in der Arbeitszone hingen; der Inhalt prangte in verschiedenen Farben, die den Gesundheitszustand der Bakterien anzeigten. »Falschfarben« … aber der Ausdruck war eine Tautologie: alles, was man im Autoversum sah, war stilisiert, jede Farbe »falsch«, wie auf einer Art Karte, die bestimmte Eigenschaften einer Region durch bestimmte Farben wiedergab. Manchmal war das Bild mehr, manchmal weniger abstrakt – je nachdem, was der Rechner darzustellen versuchte; etwa in dem Sinne, wie eine Erdkarte, die den Gesundheitszustand der Bevölkerung verschiedener Länder beschreibt abstrakter ist als eine, bei der die Farben die Höhe über dem Meer oder die jährliche Niederschlagsmenge zeigen. Die Vorstellung, einen unverstellten und wirklichkeitsgetreuen Blick auf diese Welt werfen zu können, war schlicht und einfach unangebracht.
Einige der Kulturen sahen bereits entschieden krank aus; ihr helles Blau war zusehends in ein stumpfes Braun übergegangen. Maria erzeugte ein dreidimensionales Diagramm, in dem für alle gegebenen Zuckermischungen die Zahl der Keime gegen die Zeit aufgetragen war. Die Kulturen mit nur einer Spur des neuen Zuckers wuchsen erwartungsgemäß fast ebenso schnell wie die Kontrollkultur. Mit steigendem Mutose-Gehalt verlangsamte sich das Wachstum, bis es bei einer Konzentration von fünfundachtzig Prozent stagnierte. Jenseits dieses Wertes nahm die Zahl der Mikroben immer schneller ab. Kleine Dosen Mutose stellten also kein Problem dar, doch von einem bestimmten Wert an war die Substanz pures Gift für das Bakterium; ähnlich genug mit Nutrose – der üblichen Nahrung von A. lamberti –, um denselben Stoffwechselpfad zu einem Teil zu durchlaufen und um die abbauenden Enzyme zu konkurrieren und um die wertvollen biochemischen Ressourcen zu kämpfen – bis hin zu jenem kritischen Punkt, wo die in die falsche Richtung weisende blau-rote Gruppe sich als unüberwindbares Hindernis erwies: Sie passte nicht in das aktive Zentrum eines wichtigen Enzyms und ließ das Bakterium mit nichts als einem nutzlosen Abbauprodukt und einem Verlust von Energie zurück. Eine Kultur mit einem Mutose-Gehalt von neunzig Prozent war ein Medium, in dem neunzig Prozent der Nahrung keinen Nährwert besaß, aber unterschiedslos zusammen mit dem kleinen Anteil lebenswichtiger Nutrose aufgenommen wurde. Zehnmal mehr zu fressen, um dieselbe Energiemenge zu gewinnen, war für das Bakterium auf Dauer nicht durchzuhalten. Um langfristig zu überleben, musste A. lamberti einen Weg finden, wie es das unverdauliche Molekül zurückweisen konnte, bevor es Energie darauf verschwendete – oder, noch besser, wie sich Mutose in Nutrose zurückverwandeln ließ, um aus dem Gift verwertbare Nahrung herzustellen.
Maria rief ein Histogramm auf – eine Übersicht aller Mutationen der drei Nutrose-Epimerase-Gene des Bakteriums.
Der genetische Code der Enzyme in diesem Gen war so ziemlich das einzige Werkzeug, das A. lamberti an der Hand hatte, um die Mutose verdaulich zu machen, auch wenn das Enzym in seiner jetzigen Form dazu nicht in der Lage war. Keine der Mutationen hatte bisher länger als ein paar Generationen Bestand gehabt, und sie hatten ausnahmslos mehr Schaden als Nutzen gebracht. Ein kleines Fenster zeigte die Sequenzen der mutierten Gene – sie rollten zu schnell über den Schirm, um einzelne Tripletts unterscheiden zu können, aber immer noch zu langsam für Maria. Wenn sie schon nicht wusste, wonach sie suchte, wohin die Reise gehen musste (woher auch?) … dann wenigstens so schnell wie möglich ins Labyrinth aller möglichen Irrtümer.
Ein hübscher Gedanke. Das Dumme war nur, dass bestimmte Gensequenzen für Fehler beim Kopieren besonders anfällig waren, so dass die meisten Mutanten zielsicher immer in dieselbe Sackgasse führten.
Dafür zu sorgen, dass A. lamberti mutierte, war nicht schwer; wie ein reales Bakterium machte es häufig Fehler, wenn es sein Analogon einer DNA vor der Teilung replizierte. Es zu sinnvoller Mutation anzuregen war etwas anderes. Max Lambert höchstpersönlich – der Mann, der das Autoversum erfunden hatte – hatte sich daran die Zähne ausgebissen. Der Schöpfer von A. lamberti – Idol einer ganzen Generation von Anhängern zellularer Automaten und künstlichen Lebens – hatte die letzten fünfzehn Jahre seines Lebens fast ausschließlich diesem einen Problem gewidmet: warum die kleinen, aber feinen Unterschiede in der Biochemie von Autoversum und wirklicher Welt etwas so Allgegenwärtiges wie die natürliche Auslese unter den Lebewesen unmöglich machten. Unter dem Einfluss von Stress, den etwa Escherischia coli in kürzester Frist zu seinem Vorteil genutzt hätte, zog Stamm um Stamm von A. lamberti es vor, still und leise abzusterben.
Einige unerschütterliche Enthusiasten versuchten noch immer, das Werk Lamberts zu vollenden. Maria kannte die Namen von zweiundsiebzig Leuten, denen man nicht erst hätte erklären müssen, was eine Lösung dieses Problems bedeutete. Auf dem Gebiet des künstlichen Lebens dominierten heutzutage jene, die sich mit Kopien beschäftigten – Wesen, die wie aus Flicken zusammengesetzt waren, jedes einzelne ein Mosaik aus zehntausend verschiedenen Ad-hoc-Regeln … genau das Gegenteil dessen, wofür das Autoversum stand.
Die Biochemie der wirklichen Welt war zu kompliziert, um sie auch nur für ein Lebewesen von der Größe eines Insekts bis ins Detail simulieren zu können – von einem Menschen ganz zu schweigen. Natürlich konnte man jeden einzelnen Vorgang des lebenden Organismus im Computer modellieren – aber nicht gleichzeitig für alle Stadien vom Atom bis zum kompletten Körper. So hatten sich drei verschiedene Forschungsrichtungen ergeben: Die einen – traditionelle Molekularbiologen – saßen noch immer über ihren Schrödinger-Gleichungen, die sie in mühseliger Arbeit auf immer größere Systeme anwendeten, so genau oder ungenau es eben ging; irgendwann, hofften sie, würde man bei vollständigen replizierenden DNA-Strängen angelangen, bei Teilstrukturen von Mitochondrien, größeren Abschnitten der Zellmembranen, jenem Palisadenzaun aus Protein und Lipidmolekülen … Und stetig wuchs der Rechenaufwand, verdoppelte sich beim kleinsten Schritt, den man vorankam.
In der umgekehrten Richtung verlief die Erforschung der Kopien: aufwendiger, mit viel Raffinesse simulierter menschlicher Körper – ursprünglich dazu gedacht, Chirurgen das Üben und ein besseres Planen ihrer Operationen zu ermöglichen oder bei der Erprobung von Medikamenten Tierexperimente überflüssig zu machen. Eine Kopie war nicht viel mehr als ein hochaufgelöster computertomographischer Scan, den man zum »Leben« erweckt hatte und der – gekoppelt mit einer physiologisch-biochemischen Datenbank – jeden Vorgang im Gewebe und den Organen simulieren konnte … der noch dazu in einer virtuellen Umgebung nach dem neuesten Stand der Technik herumspazieren konnte. Eine Kopie bestand nicht aus Atomen oder Molekülen – die Organe dieses virtuellen Körpers existierten nur in Gestalt spezifischer Subroutinen, als Unterprogramme, die wussten (empirisch, nicht auf molekularer Ebene), wie eine richtige Leber, ein Gehirn oder eine Schilddrüse arbeitete. Keine dieser Subroutinen konnte die Schrödinger-Gleichung für auch nur ein einziges Protein lösen. Alles Physiologie, keine Physik.
Lambert und seine Jünger hatten sich irgendwo in der Mitte zwischen beiden Extremen bewegt. Sie hatten eine neue Physik erdacht, einfach genug, um einige tausend Bakterien mit nicht allzu großem Aufwand in einem Modell unterbringen zu können – für das ein zusammenhängender, keine Zweideutigkeiten zulassender Satz von Regeln bis hinunter in den subatomaren Bereich galt. Hier begann alles im Kleinen, auf der untersten Ebene der physikalischen Gesetze, nicht anders als in der realen Welt auch.
Der Preis für diese Einfachheit war, dass sich ein Autoversum-Bakterium nicht notwendigerweise so verhielt wie sein Gegenstück aus der wirklichen Welt. A. lamberti war dafür berüchtigt, die üblichen Erwartungen an ein Bakterium auf immer neue und unvorhersehbare Art zu enttäuschen – für die meisten seriösen Mikrobiologen Grund genug, jede Beschäftigung damit als unnütz abzutun.
Aber gerade das war das Interessante, wenn man zu den Autoversum-Süchtigen gehörte.
Ungeduldig schob Maria die Diagramme beiseite, die ihr den Blick auf die Petrischalen verstellten; sie nahm eine der eifrig wuchernden Kulturen ins Visier und vergrößerte das Bild immer weiter, bis ein einzelnes Bakterium die gesamte Arbeitszone ausfüllte. Blau, der Farbcode für »gesund« – ein gleichmäßig blauer Fleck ohne Strukturen; auch als sie eine Kartierung der chemischen Zusammensetzung aufrief, waren außer der Zellwand keine Strukturen zu erkennen: keine Organellen, keine Geißeln. A. lamberti