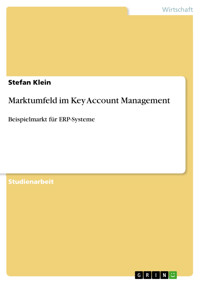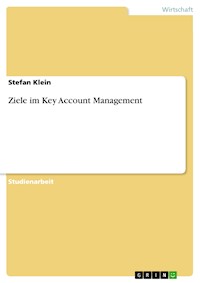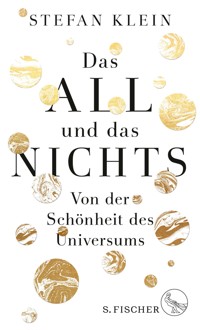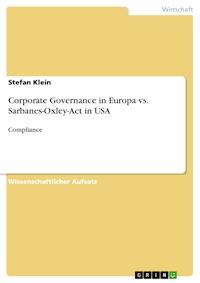9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Leonardo da Vinci war ein furchtloser Geist, der auf einzigartige Weise in der Lage war, Verbindungen zwischen zwei ganz verschiedenen Wissensgebieten zu ziehen. Er war ein Meister des "lateralen Denkens" und konnte deshalb virtuos den Schall in der Luft durch Wellen im Wasser, die Statik des Skeletts durch die eines Baukrans und die Augenlinse durch eine untergetauchte Glaskugel erklären. Stefan Klein nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise in Leonardos Welt und Wissenschaft, die zugleich eine durch unsere eigene Zeit und unser Wissen ist. Er erkundet mit uns die ausgefeilten Bewässerungssysteme der Po-Ebene, die auf Leonardos Entwürfen beruhen, beleuchtet das Geheimnis der Mona Lisa und erklärt, warum ein friedliebender Mann wie Leonardo, der nicht einmal Tiere aß, die blutrünstigsten Kriegsmaschinen seiner Zeit ersann. »Ein Buch für alle, die die Welt um sich herum mit Leonardos Hilfe besser sehen und verstehen wollen.« Michael Lange, Deutschlandradio
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Stefan Klein
Da Vincis Vermächtnis oder Wie Leonardo die Welt neu erfand
Über dieses Buch
Leonardo da Vinci war ein furchtloser Geist, der auf einzigartige Weise in der Lage war, Verbindungen zwischen zwei ganz verschiedenen Wissensgebieten zu ziehen. Er war ein Meister des „lateralen Denkens“ und konnte deshalb virtuos den Schall in der Luft durch Wellen im Wasser, die Statik des Skeletts durch die eines Baukrans und die Augenlinse durch eine untergetauchte Glaskugel erklären.
Stefan Klein nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise in Leonardos Welt und Wissenschaft, die zugleich eine durch unsere eigene Zeit und unser Wissen ist. Er erkundet mit uns die ausgefeilten Bewässerungssysteme der Po-Ebene, die auf Leonardos Entwürfen beruhen, beleuchtet das Geheimnis der Mona Lisa und erklärt, warum ein friedliebender Mann wie Leonardo, der nicht einmal Tiere aß, die blutrünstigsten Kriegsmaschinen seiner Zeit ersann.
»Ein Buch für alle, die die Welt um sich herum mit Leonardos Hilfe besser sehen und verstehen wollen.«
Michael Lange, Deutschlandradio
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Coverabbildung: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz / Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, Mailand / Scala
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2008 Stefan Klein
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2008
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403201-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Einleitung: Das Geheimnis der 10000 Seiten
Der Blick
Der Künstler als Hirnforscher
Nasen aus dem Baukasten
Das Gesetz der Pyramide
In der Bibliothek Ihrer Majestät
Wie das Funkeln der Sterne im Auge entsteht
Wasser
Relikte einer Schleuse
Bewerbung beim Tyrannen
Ein Liebesnest in der Mühle
Leonardo wird Schriftsteller
Wassermusik
Im Gänsemarsch durch eine Gasse
Krieg
Die Physik der Zerstörung
Amorra, Ilopanna
Der Pakt mit dem Teufel
Im Morgengrauen erdrosselt
Die Bestie im Menschen
Der Traum vom Fliegen
Allein gegen die Schwerkraft
»Verrammle den oberen Saal …«
»Der Meister dachte zu kompliziert«
Die tollkühne Judy Leden
Fliegen heißt nicht flattern
Roboter
Handtaschen und Badeöfen
Der Auftritt des mechanischen Löwen
Ein Leben für Leonardo
Der Glockenschläger
Leonardos Computer
Unter der Haut
In den Leichenkammern von Santa Maria Nuova
Sex im Röntgenblick
Der Mensch ist eine Maschine
Expeditionen ins schlagende Herz
»Lieber Philosoph als Christ …«
Letzte Fragen
Muscheln am Berghang
»Wie wunderbar ist deine Gerechtigkeit, erster Beweger …«
Die Seele des Fötus
Visionen vom Weltuntergang
Epilog: Leonardos Vermächtnis
Anhang
Tafelteil
Zeittafel
Vinci (1452 bis ca. 1482)
Erste Florentiner Zeit (ca. 1469 bis 1482)
Erste Mailänder Zeit (1482 bis 1499)
Zweite Florentiner Zeit (1500 bis 1506)
Zweite Mailänder Zeit (1506 bis 1515)
Französische Zeit (1517 bis 1519)
Literaturverzeichnis
Leonardos Handschriften
Auswahlbände und Kommentare
Sekundärliteratur
Abbildungsverzeichnis
Danksagung
Namen- und Sachregister
Für Irene
Leonardo, gesehen von Melzi
Einleitung: Das Geheimnis der 10000 Seiten
Im Jahr 1520 verließ ein Edelmann das Schloss des französischen Königs in Amboise. Er überquerte die Loire, ritt mit seinem Gefolge ein Stück weit den Flusslauf entlang und verschwand dann in den südlichen Wäldern. Mit sich führte er eine Kiste. Das Gepäckstück war nicht sonderlich groß, aber so schwer, dass zwei Männer anpacken mussten, um es zu bewegen. Dennoch ließ Francesco Melzi seine Kiste auf der wochenlangen Reise nach Italien keinen Moment lang aus den Augen. Endlich in Mailand angekommen, wandten sich die Gefährten nach Osten. Nach einer weiteren Tagesreise erreichten sie eine Anhöhe über dem Ort Vaprio d’Adda am Fuß der Alpen, wo der junge Mann vor einer imposanten Villa absatteln ließ. Es war der Landsitz seiner Familie. Man schaffte die Kiste in ein Obergeschoss. Dort sollte Melzi seinen Schatz während der nächsten 50 Jahre bewachen.
Oft besuchten ihn Abgesandte der Herrscherhäuser Italiens, zu denen es sich herumgesprochen hatte, welch einzigartigen Besitz Melzi hütete. Er schickte sie fort. Hatte er als Schüler seinem Meister über ein Jahrzehnt lang treu gedient, war er ihm bis an die Loire gefolgt, um jetzt sein Werk zu verhökern? Leonardo da Vinci war tot, am 2. Mai 1519 am Hof Franz’ I. von Frankreich gestorben, Melzis Zuneigung zu ihm aber lebendiger denn je. »Er war wie der beste aller Väter zu mir«, hatte er aus Amboise an Leonardos Halbbrüder geschrieben, »solange meine Glieder zusammenhalten, werde ich die Trauer empfinden. Jeder muss über den Tod eines solchen Mannes betrübt sein, denn einen wie ihn zu erschaffen hat die Natur nicht mehr die Macht.«[1]
Melzi begann, sein Erbe zu sichten. An die 10000 Blätter hatte ihm Leonardo vermacht – von den Gemälden abgesehen sein ganzes riesiges Werk. Das Vermögen des jungen Adeligen erlaubte es ihm, sich ganz der Hinterlassenschaft seines Lehrers zu widmen, doch schnell erkannte er, dass ein Leben nicht ausreichen würde, um Ordnung in diesen Nachlass zu bringen. Er stellte zwei Sekretäre ein und versuchte, ihnen wenigstens einen Bruchteil von Leonardos Ideen zu diktieren. Im Übrigen malte er, so, wie es ihm der Meister beigebracht hatte. Gästen, die schauen, nicht kaufen wollten, gewährte er bereitwillig Einlass in das Allerheiligste der Villa – das Zimmer, in dem Leonardo einst selbst gewohnt hatte und in das nun seine Schöpfungen zurückgekehrt waren.
Riesige Bögen stapelten sich da, aber auch Notizbücher kleiner als ein Handteller, von Leonardo selbst in Leder gebundene Kladden und vor allem eine unübersehbare Menge loser Papiere in allen Formaten. Sie zeigten weit mehr als nur die Entwürfe eines außergewöhnlichen Künstlers. Das Abbild eines ganzen Lebens war hier zu besichtigen – der beispiellose Aufstieg des unehelichen Sohnes einer Tagelöhnerin zu einem Mann, um dessen Gegenwart die Mächtigen Italiens warben und der sich schließlich im hohen Alter für die Freundschaft des Königs von Frankreich entschied. Der Weg eines Jungen, der nie eine höhere Schule besucht hatte, aber als berühmtester Maler aller Zeiten und zugleich als Wegbereiter der Wissenschaft in die Geschichte eingehen sollte. Ob je ein Besucher Melzis Sammlung so studierte, wie sie es verdiente, wissen wir nicht; Leonardos Spiegelschrift machte es niemandem leicht. Wer aber die Mühe auf sich nahm, die Zeilen von rechts nach links und die Hefte von hinten nach vorne zu lesen, der erfuhr von Leonardos Kriegszügen mit dem gefürchteten Feldherrn Cesare Borgia, von abenteuerlichen Fluchten, von Ärger mit dem Papst: Der Meister aus Vinci hatte Triumph und Scheitern erlebt, Existenzangst und grenzenlosen Luxus gekannt, er wurde verachtet und als göttlich verehrt.
Aber wer seine Skizzen betrachtete, tat auch einen Blick in eine ferne Zukunft: Er bekam einen Vorgeschmack auf eine Zeit, in der die Menschen die Kräfte der Natur verstehen und sich mit Maschinen umgeben würden. Zu sehen waren Flugapparate, fürchterliche Katapulte, Automaten von Menschengestalt, durchtunnelte Berge. Manchmal hätte der Besucher ein Blatt nur wenden müssen, und schon wäre er eingetaucht in eine ganz andere, aber nicht minder fantastische Welt: Mit Kreide und Tusche hatte Leonardo das Innere eines menschlichen Herzens gezeichnet, auch, wie ein Fötus im Mutterleib wächst. Andere Darstellungen zeigten Landschaften und Städte Italiens so, wie ein Betrachter aus dem Flugzeug sie sähe.
Nicht zuletzt offenbarte Leonardos Geist in Melzis Zimmer sich selbst. Da waren Gedanken und Träume niedergeschrieben; Prophezeiungen und eine Lebensphilosophie, Theorien über den Ursprung der Welt, Pläne für Bücher, selbst Einkaufslisten hatte Leonardo notiert. Vermutlich trug der Meister seine Notizbücher am Gürtel festgeschnallt, jedenfalls muss er sie ständig mit sich geführt haben, damit sich kein Gedanke verflüchtigen konnte. Selten hat ein Mensch so vollständig die Regungen seines Geistes erfasst. Wer Leonardos Aufzeichnungen verstand, konnte dem Verstand des Meisters auf seinen Höhenflügen folgen, wurde Mitwisser seiner Zweifel und Widersprüche. Denn die Aufzeichnungen dokumentierten auch das innere Selbstgespräch eines einsamen Mannes, seine Angst, den eigenen Ansprüchen nicht zu genügen, und sein Wissen um die Kosten des Ruhms: »Als der Feigenbaum ohne Frucht da stand, sah keiner ihn an. Im Wunsch, Früchte zu tragen und Lob zu bekommen, ließ er sich von Menschen verbiegen und brechen.«[2] Was Melzi in seiner Kiste aus Frankreich in seine Villa geschafft hatte, war nicht weniger als eine Innenansicht von Leonardos Gehirn.
Eine der 10000 Seiten: Überlegungen zum Vogelflug
Aber Melzis Schatz ist zerstört. Als Leonardos einstiger Lieblingsschüler im Jahr 1570 hochbetagt starb, bewies sein Sohn Orazio für die Leidenschaft seines Vaters nicht das geringste Verständnis. Er ließ die Plünderer zugreifen. Der Hauslehrer der Familie verschickte 13 gestohlene Bände an den Großherzog der Toskana. Ein riesiger Packen ging an einen Bildhauer namens Pompeo Leoni, der seinerseits versuchte, Ordnung in die Beute zu bringen, und dazu mit Schere und Leim über Leonardos Werke herfiel. Zeigte ein Blatt mehrere Skizzen, deren Zusammenhang Leoni nicht verstand, zerschnitt er es einfach. Er klebte die Fragmente auf Bögen, band diese zu Folianten zusammen und verkaufte sie. So begann Leonardos Nachlass zerfetzt und zerstreut wie Konfetti über die Bibliotheken Europas zu regnen. Ein großer Teil des Erbes ist verschollen. Von den wohl einst an die 10000 Seiten, die Melzi besaß, ging fast die Hälfte verloren. Wer den Rest studierte, konnte zwar spektakuläre Zeichnungen des Meisters bewundern, doch die Zusammenhänge waren zerstört. Der Geist Leonardos erschloss sich nicht mehr.
Und doch konnten die Plünderer Leonardos Nachruhm nicht schaden. Denn wo die Spuren verwischt sind, kann ein Mythos entstehen. An unzählige Künstler erinnern sich bald nach ihrem Tod nur noch ein paar Spezialisten, obwohl ihre Schöpfungen bestens erhalten und jedermann zugänglich sind. Leonardo hingegen, von dem man nicht einmal zwei Dutzend Werke öffentlich betrachten kann, fasziniert heute, ein halbes Jahrtausend nach seinem Tod, Millionen.
Sie fühlen sich angezogen von seinen Bildern, mehr noch aber von seiner Person: Wie konnte ein Mensch scheinbar das Wissen der ganzen Welt in sich vereinigen – und seine Kenntnisse in ein Werk ohnegleichen übersetzen? Wie vermochte er epochale Gemälde zu erschaffen – und zugleich intensiv über Flugmaschinen, Roboter, allerlei andere Apparate und eine große Bandbreite wissenschaftlicher Fragen nachzusinnen? Dass jemand in der Spanne eines Menschenlebens auf so vielen Gebieten zugleich tätig sein konnte, erscheint uns als ein Wunder.
Schon sein erster Biograph, der toskanische Maler und Architekt Giorgio Vasari, nannte diesen Mann »göttlich«. Das war 1550. Und je mehr Zeit verstrich, umso weniger war es begreiflich, wie ein Mensch des 15. Jahrhunderts all diese Werke hervorbringen konnte. Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Faksimiles von Leonardos verstreuten Skizzen der Öffentlichkeit zugänglich wurden, wuchs die Gestalt des Meisters aus Vinci ins schier Unermessliche; Leonardo wurde zum Inbegriff des »Universalgenies«. Selbst Sigmund Freud, der Schöpfer der Psychoanalyse, fand diese romantische Vorstellung plausibel: Leonardo habe einem Menschen geglichen, der in der Finsternis zu früh erwacht war, während alle anderen noch schliefen – so weit war er seiner Epoche voraus. Die wenigsten, die heute die Mona Lisa, das Abendmahl oder die selten zu sehenden Zeichnungen des Meisters bewundern, würden widersprechen.
Was im Übrigen von Leonardo, dem Sohn des Ser Piero aus Vinci, überliefert ist, nährte die Legenden erst recht. Seine Notizen sowie die Aussagen von Zeitgenossen zeichnen ihn als einen höchst widersprüchlichen, extravaganten Charakter. Er war stolz darauf, dass er als Maler, anders als die Bildhauer, sich bei der Arbeit nicht die Hände beschmutzen musste – aber sezierte Dutzende verwesender Leichen. Er bekundete eine hohe moralische Gesinnung als Vegetarier und Pazifist – und stellte sich zugleich in den Dienst blutrünstiger Tyrannen, für die er Massenvernichtungswaffen entwarf. Er zeigte sich gegenüber der Religion zeitlebens kritisch, wofür man ihn sogar einen Häretiker schimpfte – dennoch schuf Leonardo Gemälde, aus denen eine tiefe Gläubigkeit spricht. In hohem Alter schloss er sich sogar einer Ordensgemeinschaft an.
Während die Künstler seiner Zeit eine schlichte Handwerkerkluft trugen, kam er in einem knielangen, rosenfarbigen Mantel daher, trug mit Edelsteinen besetzte Ringe, und »sein schönes, wohlgepflegtes Haar fiel ihm bis zur Mitte auf die Brust«.[3] Ein wahrscheinlich von Melzi gezeichnetes Portrait zeigt Leonardo als einen Mann in den besten Jahren mit perfekt ebenmäßigen Zügen; in den Augenwinkeln stehen Lachfältchen (Seite 8). Er sei äußerst anziehend und weltgewandt gewesen, heißt es, habe aufs angenehmste gesungen und die Laute gespielt. Doch in seinen Aufzeichnungen finden sich Passagen, die auf große Einsamkeit schließen lassen.
Dass es Leonardo uns schwer macht, ihn zu begreifen, steigert freilich nur die Faszination, die er auf uns ausübt. Je rätselhafter ein Mensch uns erscheint, umso größer wird die Freiheit, die Leerstellen und Brüche in seiner Persönlichkeit mit Fantasien auszufüllen. Er lässt uns träumen. Wie frisch Verliebte in IHM oder IHR vor allem die eigenen Wunschbilder sehen, so ist auch Leonardo ein Spiegel unserer Sehnsüchte geworden. Wir verehren in ihm Geistesgröße, Erfolg – und Unsterblichkeit. Was von einem Menschen bleibe, seien die Träume, die wir mit seinem Namen verbinden, behauptete der französische Dichter Paul Valéry im Jahr 1894 über Leonardo da Vinci.
Doch Leonardo kann uns heute viel mehr geben als einen Traum. Die wahre Bedeutung seines Schaffens ist freilich erst in jüngster Zeit deutlich geworden, als Forscher sich die Blätter und Folianten aus Melzis Villa erneut vornahmen. In jahrzehntelanger Anstrengung haben sie die über Europa und Amerika verstreuten Bruchstücke aus Leonardos Notizbüchern wieder zusammengesetzt. Zudem warf der spektakuläre Fund eines verschollen geglaubten Codex neues Licht auf Leonardos Schaffen. Vor allem aber wird Leonardo nun endlich nicht mehr nur als Künstler, sondern auch als Erforscher der Welt ernst genommen. Seit einigen Jahren haben Experten auf allen möglichen Gebieten begonnen, sich mit dem Meister aus Vinci zu befassen. Während den Kunsthistorikern, die sich Leonardo bislang vornehmlich widmeten, viele Skizzen und Gedankengänge in den Notizbüchern unverständlich blieben, können Herzchirurgen, Physiker oder Ingenieure sie aus Sicht ihres Fachs nachvollziehen – und geraten ins Staunen.
Solche Forschungen waren der Ausgangspunkt für dieses Buch. Es will keine Künstlerbiographie sein, die von außen einen Blick auf das Leben des Meisters zu werfen versucht. Vielmehr geht es darum, einen der ungewöhnlichsten Menschen, den es je gab, gleichsam von innen her kennenzulernen – und die Welt durch seine Augen zu sehen. Denn das einzigartige Zeugnis seiner Notizbücher erlaubt es uns, Leonardos Gedanken zu folgen. Fast fünfhundert Jahre nach seinem Tod sind wir erstmals imstande, diese Aufzeichnungen systematisch zu lesen und zu verstehen – und von Leonardo zu lernen.
Denn als sein wertvollstes Vermächtnis stellen sich weder die 21 Gemälde noch die schätzungsweise 100000 Zeichnungen und Skizzen heraus, die er hinterließ. Vielmehr hat Leonardo eine neue Art zu denken erfunden, die uns mehr denn je Inspirationsquelle sein kann.
In seiner Herangehensweise fand er die Antwort auf eine Epoche, in der alte Gewissheiten plötzlich nicht mehr galten und in der sich die Menschen mit bis dahin ungeahnten Problemen auseinanderzusetzen hatten – nicht anders als wir heute. Leonardo war viel mehr als nur ein herausragender Künstler: Er erforschte die Welt und erfand sie neu.
Fußnoten
[1]
Zit. nach Richter 1970
[2]
CA 76 s-a (ex 280 r-a)
[3]
Anonimo Gaddiano, zit. nach Richter 1970
Das Antlitz der Mona Lisa
Der Blick
»Darshan« nennt die indische Philosophie den Anblick des Göttlichen auf Erden. Einen Guru zu treffen kann Darshan bedeuten, doch meist handelt es sich um die Begegnung mit einem besonderen Bildnis. Um Darshan zu erleben, nehmen gläubige Hindus weite Reisen auf sich. Am Ziel angelangt machen sie sich auf den Weg durch oft labyrinthische Tempel, drängen sich an Tausenden anderer Pilger vorbei ins enge, düstere Allerheiligste, wo sie endlich das Idol mit eigenen Augen erblicken.
An Darshan, das Ziel aller Pilgerreisen, musste ich denken, als ich bei den Recherchen zu diesem Buch den Louvre besuchte. Auch der Weg zur Mona Lisa führt durch verschlungene Gänge, durch die Unterwelt. In den Pyramiden des Louvre steigt man mit den Scharen der Museumsbesucher hinab in eine riesige Halle; dort saugen Rolltreppen die Menschenmassen an und befördern sie über allerlei Zwischengeschosse und Wandelgänge wieder nach oben. Dann gilt es eine lange Galerie abzuschreiten, vorbei an Dutzenden Meisterwerken der italienischen Kunst, von denen jedes einzelne einer langen Betrachtung wert wäre. Und doch streben fast alle Besucher, von Schildern in fünfzehn Sprachen geführt, schnurstracks zu ihrem Ziel.
Eigentlich war ich nach Paris gereist, weil im Louvre so viele Gemälde Leonardos hängen wie nirgendwo sonst auf der Welt. Die Mona Lisa lockte mich von allen am wenigsten; viel zu oft meinte ich ihr Gesicht schon gesehen zu haben – auf Drucken, auf Plakaten, auf Kaffeetassen, mit Schnurrbart und ohne. Aber ich konnte mich ihrem Sog nicht entziehen. Nur im Vorbeigehen nahm ich aus den Augenwinkeln wahr, dass ich die Felsgrottenmadonna, die Anna Selbdritt und Johannes den Täufer fast für mich allein haben konnte, denn vor diesen bedeutenden Werken Leonardos hielt kaum jemand inne.
Ohne weiter zu überlegen, reihte ich mich in den Strom der Menschen ein, der genau in der Mitte der Galerie abbiegt und sich dann in eine der größten Hallen des früheren Königspalasts ergießt. Einst ließ hier Napoleon III. seine Staatsversammlungen abhalten. Heute teilt eine riesige Wand den Saal in seinem hinteren Drittel; wer einmal eine orthodoxe Kathedrale besucht hat, fühlt sich sofort an die Ikonostasis erinnert, die mit Bildern geschmückte Barriere, welche die Sphäre der gemeinen Gläubigen vom Allerheiligsten trennt. Die Wand im Louvre allerdings, vor der sich bequem ein mittleres Mietshaus aufbauen ließe, trägt nur eine einzige Vitrine. Diese besteht aus kugelsicherem Glas. Davor erstreckt sich ein Eichentisch von den Dimensionen eines Altars.
In seine Nähe kommt niemand. Wer die Halle betritt, muss sich zunächst mit Hunderten anderer Besucher in eine trichterförmige Absperrung zwängen. Nur wenn einer der Glücklichen ganz vorne das Gehege verlässt, können andere nachrücken. Wer endlich am Trichtermund anlangt, den trennen noch immer knappe zehn Meter, zwei weitere, unüberwindliche Absperrungsringe und ein Kordon aus Sicherheitsleuten von der Vitrine. Immerhin ist nun hinter dem Glas ein lächelndes, ziemlich fülliges Frauengesicht auszumachen. Das Zweite, was ins Auge fällt, sind die hellen Hände, welche die Porträtierte vor ihrem schwarzen Kleid übereinandergelegt hat. Viele Touristen wollen diesen Anblick mit der Kamera festhalten, doch das dulden die Wachleute nicht. Sehen sie in der Menge ein Blitzlicht aufflackern, so stürzen sie sich, »no photo« brüllend, auf den Übeltäter und werfen ihn hinaus.
Vor der Mona Lisa
Ansonsten herrscht gespannte Stille im Saal; allenfalls flüsternd stellen die Besucher in allen erdenklichen Sprachen Europas und Asiens fest, dass Mona Lisa sie ansehe, dass ihr Lächeln bei längerer Betrachtung immer intensiver erscheine. Irgendwo hinter meinem Rücken murmelte jemand in breitem Fränkisch, dieses Museum sei doch sehr gut organisiert. Fremdenführer sind gehalten, über ein Funkgerät mit ihren Touristen zu sprechen, die Ohrhörer tragen.
Viele Besucher stehen ehrlich ergriffen vor der Vitrine. Auch ich hatte plötzlich das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu erleben. Aber warum? Unter normalen Lichtverhältnissen sehen die Schaulustigen im spiegelnden Panzerglas vor allem sich selbst. Nur wenn die Sonne am Pariser Himmel im richtigen Winkel über der Glasdecke steht, können sie einige Feinheiten in Mona Lisas Zügen erkennen. Wer aufmerksam hinschaut, mag immerhin erahnen, wie genau Leonardo jeden einzelnen Effekt in diesem Gemälde kalkuliert haben muss. Das Schattenspiel in den Augenhöhlen etwa, selbst aus großem Abstand noch gut auszumachen, lässt den Blick der jungen Frau besonders eindringlich wirken. Doch viel mehr gibt das entrückte Bildnis selbst bei bestem Lichteinfall nicht preis. Das Gesicht auf dem nur 76 Zentimeter hohen Gemälde erreicht nicht einmal Lebensgröße, und die Wunder der Landschaft im Hintergrund lassen sich aus der Entfernung nicht ansatzweise erfassen. Dennoch wirkt die Mona Lisa in ihrem Glaskasten unglaublich präsent.
Was macht dieses Bild so außergewöhnlich, dass es jährlich mehr als fünf Millionen Besucher anzieht? Weshalb wurde ausgerechnet das Gemälde mit der Inventarnummer 779 des Louvre, das Porträt einer durchschnittlich attraktiven Florentiner Hausfrau, zum berühmtesten Kunstwerk der Welt?
Die Scharen im Louvre können Leonardos Werk nicht wirklich studieren, es bei dem Gedränge noch nicht einmal in Ruhe anschauen; vielleicht wirkt die Pilgerfahrt zur Mona Lisa sehr viel direkter. Wer die Reise in die französische Hauptstadt, die Rolltreppen und die Schlangen im Museum hinter sich gebracht hat, sieht das bekannteste Gemälde der Welt, steht der leibhaftigen Mona Lisa gegenüber, wird Zeuge, dass zu all den Mona Lisas der Werbung, auf Postkarten und Bildschirmschonern tatsächlich ein Original existiert. Man hat die Tafel aus Pappelholz erblickt, die Leonardo selbst in den Händen hielt, die er über vier Jahre immer wieder bearbeitete und dann weitere zehn Jahre lang bis zu seinem Tod nicht weggeben mochte. Ist einem Objekt nahegekommen, das der Meister auf den Stationen seiner Wanderschaft mitgeführt hat: von Florenz nach Rom, von Rom nach Mailand, von dort an den französischen Hof. Da erscheint es belanglos, dass man die Feinheiten von Leonardos Malerei auf jedem ordentlichen Druck besser erkennt.
Darshan ist kein Kunstgenuss: Die heiligsten Statuen, für deren Anblick fromme Hindus tagelange Bahnfahrten ertragen, sind oft wenig mehr als grob behauene Steine. Und ihre wundertätigsten Ikonen bekommen orthodoxe Christen nie vollständig zu Gesicht, weil ein Überzug aus gehämmertem Silber die Körper Jesu und Mariae verdeckt. Aber gerade dadurch, dass der Gläubige die Anziehungskraft des Bildes nicht beschreiben kann, erscheint es ihm umso verehrungswürdiger. Darshan ist die Begegnung mit einem Geheimnis.
Mona Lisa ist eine Attraktion, weil sie Mona Lisa ist: Wir sind außerstande, dieses Gemälde nur als ein Bild zu betrachten. Jeder im Louvre hat schon vom unergründlichen Lächeln dieser Dame gehört – tatsächlich sieht sie in manchen Momenten so aus, als blicke sie etwas spöttisch auf den ganzen Betrieb hinab. Und je länger man sie betrachtet, umso mehr Fragen tauchen auf. Wenn sie nun lächelt: Warum? Wo sitzt sie? Und vor allem: Wer war sie? Um jedes einzelne Rätsel wiederum ranken sich so viele Mythen, dass am Ende die Erzählungen um die Mona Lisa noch fantastischer erscheinen als das Gemälde selbst.
Aber wie ist Mona Lisa die Mona Lisa geworden? Wer in die Literatur über dieses Gemälde eintaucht, meint bald, durch eine Traumwelt zu wandeln. Eine der ersten – und bis heute die eindrucksvollste – unter den vielen Beschwörungen ihrer Magie hat Walter Pater im Jahr 1869 geschrieben. Dieser englische Kunstkritiker sah in der Mona Lisa das Urbild alles Weiblichen, eine Kraft, welche der Schöpfung vorausging und sie überdauern wird. Freilich erscheinen Lisas Augenlider, wie Pater bemerkt, »ein wenig müde«. Aber kein Wunder:
»Sie ist älter als die Felsen, zwischen denen sie sitzt
Sie war schon viele Male tot
Wie der Vampir
Sie hat das Geheimnis des Grabes gelernt
Ist in die Tiefen des Ozeans getaucht (…)
Hat, wie Leda, die Helena von Troja geboren
Und war, wie die heilige Anna,
Die Mutter Marias …«[4]
Nüchternere Geister als Pater befassten sich mit der Frage, wessen Gesicht das Bild eigentlich zeigt. Sie sind sich bis heute nicht einig. Zwar stimmen die meisten Fachleute inzwischen Leonardos erstem Biographen Giorgio Vasari zu, dass eine Florentinerin namens Lisa Gherardini Modell saß. Bestellt hat das Werk wahrscheinlich Gherardinis Ehemann, der Seidenhändler Francesco del Giocondo, anlässlich der bevorstehenden Geburt des gemeinsamen Sohnes Andrea. Somit wäre die Mona Lisa das Bild einer Schwangeren.
Doch Leonardo gab sein Werk niemals heraus. Und niemand weiß, wie sich das Gemälde in jenen Jahren, in denen es Leonardo wieder und wieder überarbeitete, verwandelte. Manche Forscher meinen, dass Lisa Gherardini am Ende kaum mehr zu erkennen war und Leonardo sein Gemälde darum bei sich behielt. Dem italienischen Literaturwissenschaftler Carlo Vecce zufolge war die Mona Lisa, die wir heute sehen, eine Kurtisane: Isabella Gualanda, die zur Zeit von Leonardos Aufenthalt in Rom die höchsten Kreise der Gesellschaft dort erfreute. Als ein reicher Gönner ein Porträt dieser Dame bestellte, habe Leonardo kurzerhand das noch immer unfertige Gemälde der Lisa Gherardini recycelt. Möglich ist das durchaus, anderseits stützt sich die Vermutung, das viel bewunderte Gemälde der Mona Lisa zeige in Wahrheit eine Edelprostituierte, nur auf Indizien.[5] Vecce immerhin hält sich strikt an die historischen Belege; er ist der Autor der bis heute genauesten Leonardo-Biographie.[6]
Kühner war die New Yorker Künstlerin Lillian Schwartz, deren Forschungen der Zeitschrift »Scientific American« vor einigen Jahren eine Titelgeschichte wert waren.[7] Sie kam bei der Arbeit mit einem Bildbearbeitungsprogramm zu dem fantastischen Schluss, Leonardo und die Mona Lisa seien dieselbe Person. »Jeder Maler malt sich selber«, lautete immerhin ein toskanisches Sprichwort in Leonardos Epoche. Genau das habe der Meister getan. Als er jahrelang ohne Modell an dem unfertigen Bild arbeitete, habe er sein eigenes Gesicht zum Vorbild genommen.
Am Computer analysierte Schwartz das bekannteste aller Selbstporträts Leonardos, dessen mit Rötel gezeichnetes Original in Turin aufbewahrt wird. Es zeigt den Künstler als Greis. Wallende Haare und Bart umgeben ein Gesicht, aus dem tiefe Skepsis spricht, vielleicht auch eine Spur Spott. Die Mundwinkel sind heruntergezogen, die Wangenknochen treten hervor. Über die Stirn, von den Augenwinkeln und Nasenflügeln herab ziehen sich Falten. Die Oberlippe ist dünn, fast nur ein Strich, als fehlten die Schneidezähne unter ihr. Doch aus den tiefen Augenhöhlen dringt ein hellwacher Blick. Die Pupillen, gerade noch erkennbar, sehen die Betrachter nicht an. Sie zielen an ihm vorbei, fixieren einen Punkt irgendwo in der Ferne.
Turiner Selbstporträt
Der Ausdruck beider Bilder könnte kaum gegensätzlicher sein. Außerdem blickt die Mona Lisa nach links, der Greis aber nach rechts. Doch als Schwartz das Selbstporträt spiegelte und dann die beiden Bilder übereinanderlegte, stimmten sie genau überein. Die Augenabstände, die Größe des Mundes, selbst die Abstände der Backenknochen des alten Mannes und der jungen Frau sind identisch; die Abweichungen betragen weniger als zwei Prozent. Und in beiden Bildern findet sich exakt dieselbe markante Wölbung der Augenhöhlen. Dass Leonardo sich selbst darstellte, darauf habe er sogar einen verschlüsselten Hinweis gegeben, behauptet Schwartz: Am oberen Saum von Mona Lisas schwarzem Mieder zeichnete der Künstler zahllose Fadenknötchen, die an Korbflechtereien erinnern. Das italienische Wort für Korbweide unterscheidet sich nur in einem Buchstaben von Leonardos Geburtsort: vinco.
Leonardo war ein Meister des Versteckens, so viel ist gewiss. Er liebte es, Gesellschaften mit fantastischen Geschichten und Rätseln zu unterhalten; Dutzende seiner geistreichen Wortspiele, auch Bilderrätsel, sind uns in seinen Handschriften erhalten. Mitunter chiffrierte er auch Notizen über seine Erfindungen oder Zukunftspläne, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen. Am gründlichsten aber verbarg er vor seinen Mitmenschen sich selbst. Wenn er, selten genug, auf den 6000 erhaltenen Seiten seiner Tagebücher von seinen Gefühlen und Sehnsüchten berichtete, machte er sich dabei so gut es ging unkenntlich – etwa, indem er statt Menschen Tiere auftreten ließ und selbst die Rolle eines Fabelwesens einnahm.
Dennoch nennen Kunsthistoriker Lillian Schwartz’ Vermutung wenig plausibel: Der Gedanke, im Porträt der Mona Lisa verberge sich Leonardo selbst, sei schlichtweg absurd. Für diese Theorie gebe es keinerlei historischen Beleg; das Wortspiel um die Knoten beweise gar nichts. Und dass die Gesichter so gut zusammenpassen, liege schlicht an einer ähnlichen Darstellungsweise.
Vielleicht erfand Schwartz also nur ein amüsantes Vexierspiel um einen Maler und sein berühmtestes Modell – zwei in unserer Vorstellung übernatürlich große Gestalten, bei denen es uns gleichermaßen schwerfällt, Wirklichkeit und Erfindung voneinander zu trennen. Aber ebenso wenig wie ihre Kritiker vermag die New Yorker Künstlerin zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass bei Umfragen heute mehr als 85 Prozent der Menschen spontan »Mona Lisa« sagen, wenn sie ein bekanntes Kunstwerk nennen sollen.[8] (Das Werk auf Platz zwei, van Goghs Sonnenblumen, fällt gerade einmal vier Prozent der Befragten ein.) Bei religiösen Bildnissen geht der Verehrung stets eine Wundererzählung voraus. Dass aber die Mona Lisa Wunder gewirkt habe – zumindest dies hat noch nie jemand von dem Bild der Bilder behauptet. So kann einzig Leonardos besondere Weise zu malen für die außerordentliche Faszination verantwortlich sein, die gerade dieses Kunstwerk auf uns ausübt.
Fußnoten
[4]
Pater 1873. Der Zeilenfall stammt von dem irischen Dichter W.B. Yeats, die deutsche Übersetzung von mir.
[5]
Vecce 1990
[6]
Vecce 1998
[7]
Feldmann Schwartz 1995, Feldmann Schwartz 1988
[8]
Sassoon 2001
Der Künstler als Hirnforscher
Einer der Ersten, der die Mona Lisa bestaunte, war Raffael Santi. Dieser Maler, den wir heute vor allem mit lieblichen Madonnenbildern verbinden, muss in Florenz Zugang zu Leonardos Werkstatt gehabt haben. Jedenfalls besitzt der Louvre ein briefbogengroßes Blatt, auf dem Raffael mit schnellen Federstrichen die unfertige Mona Lisa abzeichnete. Die Frau darauf hat die Züge, wie wir sie heute kennen. Aber sie lächelt nicht. Ihr Gesicht wirkt schmaler, weiblicher und jünger, und die Landschaft im Hintergrund ist noch nicht ausgeführt: In diesem Zustand befand sich Leonardos Werk wohl um das Jahr 1504.
Raffael, Dame mit dem Einhorn
Seine Eindrücke aus Leonardos Atelier verarbeitete Raffael sofort zu zwei eigenen Gemälden: die »Dame mit dem Einhorn« und das Porträt der Maddalena Doni. Beide sitzen auf einem Balkon vor offener Landschaft, sehen ihren Betrachter mit dem Mona-Lisa-Blick an und drehen ihm die linke Schulter entgegen. Selbst die Hände halten sie so wie das Vorbild. (Die Pose war Leonardos Erfindung, man findet sie nirgends sonst in der Kunst dieser Zeit.[9]) Die Maltechnik ist perfekt; obwohl kaum über 20, galt Raffael schon damals als ein ganz großer Meister. Und im Gegensatz zur Mona Lisa ist die blonde Dame mit dem Einhorn auch für den heutigen Geschmack noch eine Schönheit. Könnte sie aus dem Bilderrahmen heraussteigen und sich auf der Straße davonmachen, wären ihr Männerblicke sicher.
Trotzdem hat es die Dame mit dem Fabeltier auf ihrem Schoß nie zu Weltruhm gebracht. Wer Raffaels Bild gegenübersteht, spürt, warum vom Original eine viel stärkere Anziehungskraft ausgeht, die sich nicht nur mit dem Zauber der Namen Mona Lisa und Leonardo erklären lässt. Die Einhorndame findet man unweigerlich schön, man bewundert auch das enorme Können ihres Schöpfers. Aber sie rührt uns nicht an.
Um hingegen die Wirkung der Mona Lisa zusammenzufassen, genügen zwei Worte: Sie lebt. Der englische Kunsthistoriker Martin Kemp, ein Leonardo-Experte, hat treffend beschrieben, wie dieses Gesicht mit seinem Betrachter eine Beziehung aufnimmt: »Sie reagiert auf uns, aber wir können nicht auf sie reagieren. Leonardo spielt mit einem der stärksten Instinkte des Menschen – unserer unwiderstehlichen Neigung, in jedem Gesicht, auf das wir treffen, die Zeichen seines Charakters zu lesen. Ganz gleich, wie oft uns die Gesichtszüge schon über eine Person getäuscht haben, wir können es einfach nicht lassen.«[10]
Beim Betrachter Gefühle auszulösen, nannte Leonardo selbst sein vornehmstes Ziel. Künstler seien »Gottes Enkel«, weil sie durch »höllische Phantasiegebilde« ganze Völker erschrecken könnten, wenn sie es wollten. Wie aber kann ein totes Stück Leinwand Emotionen erzeugen? Leonardo erklärte sich die Gefühle damit, dass sich der Betrachter unbewusst in die Figuren des Bildes hineinversetzt. Und dabei bediene er sich nicht etwa seines Verstandes – er erlebe vielmehr die Emotionen der gemalten Menschen am eigenen Körper. Lächeln und Gähnen stecken bekanntlich an, weil wir ungewollt die Regungen anderer imitieren; auch können wir innere Qualen erleben, wenn wir den schmerzverkrümmten Leib eines anderen nur sehen.
Dass der Maler diesen Effekt ausnutzen müsse, hatte schon 1435 Leon Battista Alberti, ein Vordenker der Renaissancekunst, in seinem einflussreichen Buch über die Malkunst gefordert. Und Leonardo schloss sich ihm an: »Die wichtigste Erwägung des Malers ist es, dass die Bewegung jeder Figur deren Geisteszustand ausdrückt, wie Sehnsucht, Hohn, Ärger, Mitleid und so fort (…) Sonst ist die Kunst nicht gut.«[11] Gelinge das Werk aber, so würden beim Betrachter ähnliche Regungen ausgelöst: »Wenn das Bild Schrecken, Furcht, Flucht, Trauer, Weinen und Klagen darstellt oder Lust, Freude, Lachen und ähnliche Zustände, soll bei denjenigen, die es betrachten, der Geist die Gliedmaßen veranlassen, sich so zu bewegen, dass sich die Betrachter in derselben Situation glauben wie die Figuren auf dem Bild.«[12] Gefühle übertragen sich demnach über den Körper.
Dass diese zunächst unplausibel klingende Vorstellung tatsächlich zutrifft, konnte die Hirnforschung in den letzten Jahren beweisen. Die Neurophysiologen fanden sogar spezielle Hirnzellen, die dazu dienen, dass wir uns in andere Menschen einfühlen können, indem wir sie beobachten. Weil diese Neuronen die Regungen des anderen Menschen im eigenen Körper spiegeln, nennt man sie Spiegelneuronen: Sie befehlen etwa den Gesichtsmuskeln zu lächeln, wenn wir einen glücklichen Menschen sehen. Das Gehirn deutet dann diese Muskelbewegungen als Ausdruck eigener Freude – und lässt uns tatsächlich gute Gefühle empfinden.[13]
Ohne diese Einsichten der modernen Neuropsychologie zu kennen, gestaltete Leonardo vor fast einem halben Jahrtausend seine Bilder nach ihr. »Die größten Künstler sind eigentlich Hirnforscher«, hat der Londoner Wissenschaftler Semir Zeki, ein Experte für die Neurobiologie des Sehens, einmal erklärt: »In ihren Werken experimentieren sie mit den Regeln der Wahrnehmung. Und ohne es selbst zu bemerken, finden sie dabei heraus, wie das Gehirn funktioniert.«
Fußnoten
[9]
Anregungen mag Leonardo aus Flandern erhalten haben. Jan van Eyck (um 1390–1441) zeigt Porträtierte in Dreivierteldrehung und mit Blick zum Betrachter. Doch es fehlt die Landschaft im Hintergrund ebenso wie die auf dem Bild der Mona Lisa so bedeutenden Hände. Dass Leonardo die flämischen Darstellungsweise kannte, ist wahrscheinlich: Der Maler Rogier van der Weyden etwa war in den Gemäldesammlungen des Hofes von Mantua vertreten; auch Drucke kursierten. Siehe z.B. Keele 1983
[10]
Kemp 1981 S. 266
[11]
TP 68 und B N 2038 20r, siehe auch Kemp 1971. Die Passage findet sich fast wortgleich bei Alberti in seinem Buch über die Malkunst: »Wir Maler wollen die Affekte des Gemüts durch die Bewegungen der Glieder ausdrücken.« -(Alberti 2000, S. 272)
[12]
TP 61 v
[13]
Genauer gesagt haben die vom italienischen Neurophysiologen Giacomo Rizzolatti und Mitarbeitern in den frühen 1990er-Jahren zuerst an Affen entdeckten Neuronen eine Doppelfunktion: Erstens steuern sie die Muskulatur des eigenen Körpers. Manche geben Impulse zum Heben des Arms, andere dazu, den Mundwinkel zu einem Lächeln nach oben zu ziehen, wieder andere erzeugen im Gesicht einen Ausdruck der Trauer. Zweitens aber geben die Spiegelneuronen genau dieselben Signale, wenn wir nur zusehen, wie ein anderer Mensch den Arm hebt, fröhlich oder bedrückt aussieht – sie machen uns dazu bereit, dasselbe zu tun. Die eigentliche Muskelbewegung wird dann auf einer späteren Stufe der Signalverarbeitung im Gehirn unterdrückt; dabei bleibt aber das Signal für die entsprechende Emotion erhalten. Rizzolatti, Fogassi, und Gallese 2006. Für eine leicht zugängliche Darstellung auf Deutsch siehe Bauer 2005
Nasen aus dem Baukasten
Wie hängen Gesichtsausdruck und menschliche Emotionen zusammen? Diese Frage hat Leonardo besonders beschäftigt. Denn nur ein Maler, der die feinsten Mienenspiele kennt, wäre imstande, sie so genau wiederzugeben, dass der Betrachter sich von ihnen mitreißen lässt.
In seinen Notizbüchern hat Leonardo Gesichter geradezu gesammelt. Kaum einen Menschentyp, kaum einen Ausdruck scheint er ausgelassen zu haben. Vasari berichtet, oft habe der Meister einen Menschen einen ganzen Tag lang auf der Straße verfolgt, wenn ein bestimmter Zug an ihm ihn interessierte. So wird das Studium der Notizbücher zu einer Reise durch die ganze Vielfalt des Menschlichen: Man begegnet jungen Frauen und alten Männern, blättert an Aristokratengesichtern und höchst grobschlächtigen Visagen vorbei, sieht Freude, Hingabe, Stolz und Verbitterung. Manche Köpfe sind mit Licht und Schatten naturalistisch gezeichnet, andere nur schnell mit ein paar Federstrichen skizziert. Wieder andere weisen auf das äußerste verzerrte Züge auf, wie Karikaturen, als hätte Leonardo in der Übersteigerung ausprobieren wollen, was genau ein bestimmtes Mienenspiel ausmacht.
An anderer Stelle findet sich ein ganzer Katalog verschiedener Ausprägungen der menschlichen Nase. Um unter all den Adlernasen, Kolbennasen und Hohlnasen Ordnung zu schaffen, führte Leonardo ein eigenes System ein: Die Organe seien erstens nach vier Grundtypen wie gerade oder knollig, zweitens danach zu unterscheiden, ob sie sich oberhalb und unterhalb ihres Zentrums konvex, konkav oder gar nicht wölbten. Anhand solcher Variablen könne sich der Maler ein unbekanntes Antlitz nicht nur leicht einprägen, sondern auch neue Gesichter wie aus einem Baukasten erschaffen.[14]
Groteske Köpfe
Vor allem wollte Leonardo wissen, wie die Mimik entsteht. So sezierte er die Köpfe von Leichen und legte die Gesichtsmuskulatur frei. Er erkannte, dass die Lippen eigentlich Muskeln sind, die den Mund zusammenziehen, während Seitenmuskeln ihn zum Lachen weiten. Er untersuchte, an welchen Schädelknochen diese Muskeln ansetzen und wie sich die Gesichtshaut unter ihrer Wirkung verformt. Und er ging sogar so weit, das Zusammenspiel dieser Muskeln mit dem Gehirn zu ergründen: Er entdeckte Nerven, welche die Muskelbewegungen steuern und so den Ausdruck der Gefühle bewirken.[15]
Kein Künstler seiner Zeit drang auch nur annähernd so tief in die Geheimnisse der menschlichen Natur ein. Und erst dieses Wissen versetzte Leonardo in die Lage, so virtuos mit den Zügen der Mona Lisa und den Gefühlen von uns Betrachtern zu jonglieren. Beispielsweise sind die Züge der jungen Frau nicht symmetrisch: Sie zieht den linken Mundwinkel höher als den rechten, und der Schatten in der linken Augenhöhle ist tiefer. So strahlen die beiden Seiten eine unterschiedliche Stimmung aus: Deckt man Mona Lisas linke Gesichtshälfte zu, erscheint sie ernster; lässt man hingegen die rechte Partie verschwinden, tritt das Lächeln stärker hervor.
Solch feine Asymmetrien verbergen sich häufig in den Mienen unserer Mitmenschen. Sie rühren daher, dass das Gehirn in zwei Hemisphären zerfällt, die jeweils spiegelverkehrt die beiden Hälften des Körpers ansprechen. Die linke Hirnhälfte steuert die Muskeln der rechten Gesichtshälfte, während die rechte Hirnhälfte für die Mimik links zuständig ist. Und weil sich diese rechte Hirnhälfte stärker als ihr Gegenüber mit dem Verarbeiten von Emotionen befasst, äußern sich Gefühle meist stärker auf der linken Seite des Gesichts. Nur nehmen wir diesen Unterschied normalerweise nicht wahr, weil wir Gesichter als Ganze betrachten. Erst in den letzten Jahren haben Experimente die Zusammenhänge deutlich gemacht.[16]
Leonardo aber wusste ganz offensichtlich von diesen subtilen Effekten – und er setzte sie ein, um das Antlitz der Mona Lisa so unergründlich erscheinen zu lassen. Er übersteigerte die natürlichen Unterschiede der beiden Gesichtshälften so sehr, dass der Betrachter nicht umhin kann zu rätseln, was die junge Dame wohl denkt oder fühlt. Denn wie der amerikanische Neuropsychologe Paul Ekman, ein Pionier der Erforschung der menschlichen Mimik, zeigte, wird das Gesicht besonders asymmetrisch, wenn jemand Gefühle nur vortäuscht – etwa, um Ärger mit einem künstlichen Lächeln zu maskieren. Was will uns die Mona Lisa verbergen?[17]
Kontsevichs Experimente: »What makes Mona Lisa smile?«
Leonardo tat alles, um die Irritation zu verstärken. Nicht einmal jede Gesichtshälfte für sich verrät ihren Ausdruck eindeutig. Nirgends gibt es eine scharfe Kontur, alle Übergänge zwischen den Partien, zwischen Licht und Schatten verschwimmen. Dort, wo wir die Haut der Mona Lisa erwarten, sehen wir in Wirklichkeit nur eine entgrenzte Farbfläche; vom Rot an den Wangen bis hin zum Olivgrün am Kinn gehen die Töne ineinander über, ohne dass wir es merken. Dieser »Sfumato« genannte Effekt lässt uns glauben, dass sich das Gesicht uns gegenüber bewege; tatsächlich ist es unser eigener Blick, der fortwährend wandert, weil Leonardo ihm keinerlei Anhaltspunkt bietet, um irgendwo zur Ruhe zu kommen.[18]
Leonardo muss gewusst haben, welch winzige Abweichungen schon einen ganz anderen Eindruck erwecken. Eine kleine Veränderung der Mundpartie kann genügen, um ein fröhliches Gesicht traurig aussehen zu lassen – und umgekehrt. Solche Metamorphosen hat der russisch-amerikanische Informatiker Leonid Kontsevich vorgeführt, indem er über Mona Lisas Mund am Computer eine »weißes Rauschen« genannte zufällige Unschärfe legte, so dass die Lippen und die angrenzenden Wangen- und Kinnpartien aussehen wie auf einem flimmernden Fernsehschirm. Und tatsächlich erscheint ihre Miene auf manchen der verrauschten Bilder dermaßen bitter, als quäle sich die Lisa Gherardini seit Wochen mit dem Verdauen einer furchtbaren Nachricht.[19] So stark reagieren wir beim Lesen von Gesichtern auf die geringsten Abwandlungen. Den Unschärfe-Effekt hatte Leonardo freilich schon in das Originalgemälde eingebaut; Kontsevich musste ihn nur noch verstärken. Darum bleibt der Ausdruck der Mona Lisa ein Rätsel, das der Betrachter nie auflösen kann. Und weil die Mimik auf einem fremden Gesicht bei dem, der es sieht, automatisch Emotionen auslöst, wird jede Begegnung mit diesem Bild zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle.
Fußnoten
[14]
TP 289, TP 290
[15]