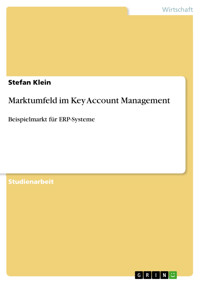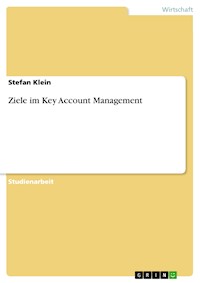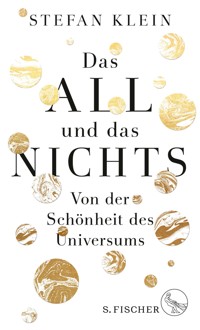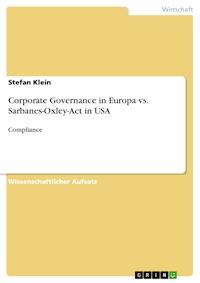9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Bestsellerautor Stefan Klein im Gespräch mit weltweit führenden Wissenschaftlern. Er diskutiert mit dem Astronomen des Papstes Guy Consolmagno über Gott und den Ursprung des Universums, spricht u.a. mit der Kognitionspsychologin Margret Boden über schöpferische künstliche Intelligenz, mit dem Botaniker Stefano Mancuso über die Intelligenz der Pflanzen – und selbst Sigmund Freud kommt noch einmal zu Wort. Glänzend geführte Unterhaltungen, die uns teilhaben lassen an den persönlichen Erfahrungen, Einsichten und aktuellsten Forschungen der derzeit klügsten Köpfe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Stefan Klein
Wir werden uns in Roboter verlieben
Gespräche mit Wissenschaftlern
Über dieses Buch
Der Bestsellerautor Stefan Klein im Gespräch mit weltweit führenden Wissenschaftlern. Er diskutiert mit dem Astronomen des Papstes Guy Consolmagno über Gott und den Ursprung des Universums, spricht u. a. mit der Kognitionspsychologin Margaret Boden über schöpferische künstliche Intelligenz, mit dem Botaniker Stefano Mancuso über die Intelligenz der Pflanzen – und selbst Sigmund Freud kommt noch einmal zu Wort.
Glänzend geführte Unterhaltungen, die uns teilhaben lassen an den persönlichen Erfahrungen, Einsichten und aktuellsten Forschungen der derzeit klügsten Köpfe.
»Klein versteht es, spannende Fragen zu stellen und die Konversation in die richtige Richtung zu lenken.«
Gehirn und Geist
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg
Coverabbildung: Getty Images/Westend61
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491034-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Die Freude, das Universum zu betrachten
Wir werden uns in Roboter verlieben
Die Intelligenz der Bohnen
Die Biene weiß, wer sie ist
Der Königsweg zur Seele
Die Armen kämpfen mit denselben Widersprüchen wie wir
Vom Eigensinn eines Einwanderers
Das Leben kam aus dem Weltraum
Die Aliens sind unter uns
Die Magie der Töne
Schönheit ist lebensnotwendig
Die Zeit lebt mehr in uns als wir in ihr
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Namen- und Sachregister
Vorwort
Fortschritt ist der Weg über einen reißenden Fluss. Menschen wollen ans andere Ufer gelangen, aber es fehlt eine Brücke. Also wirft einer einen Brocken ins Wasser, gerade so weit, dass er den Stein mit einem sicheren Schritt erreicht. Jetzt ist das Ziel einen Meter näher gerückt. Der Nächste steigt auf diesen Tritt und wirft von dort einen weiteren Stein in den Fluss. Und so geht es weiter, bis der letzte Brocken zum anderen Ufer hinführt. Ist das Wasser tief, genügen Trittsteine nicht, dann heißt es Pfeiler aufstellen und diese zu einer Brücke verbinden. Darum kann es Minuten dauern oder auch Jahre, bis die Reisenden das andere Ufer erreichen.
Genauso gelangen wir zur Erkenntnis. Von einem sicheren Standpunkt ausgehend, wagt man sich vor, Schritt für Schritt und der Basis vertrauend, die die Vorgänger schufen. So funktioniert Wissenschaft. Wer Forschung betreibt, misst, rechnet und denkt gewöhnlich dort weiter, wo andere aufgehört haben: wirft den nächsten Stein in den Fluss.
Gelegentlich allerdings treten Forscher in Erscheinung, die sich nicht mit kleinen Schritten begnügen, sondern unbekannte Ufer anstreben. Fast immer erscheinen die Ziele, die sie sich aussuchen, in den Augen der anderen zu weit, die Risiken zu groß. Darum müssen diese Forscher ihren Weg alleine antreten. Von solchen Menschen handelt dieses Buch.
So unterschiedlich die Forscher sind, mit denen ich die folgenden Gespräche führte – sie alle haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das bis dahin Unvorstellbare zu entdecken. Wer solches will, braucht Eigenschaften, die Außenstehende eher mit Künstlern und Abenteurern als mit Wissenschaftlern verbinden: Phantasie und Mut. Der spätere Physiknobelpreisträger Stefan Hell etwa hatte es sich in den Kopf gesetzt, die Naturgesetze der Optik auszuhebeln, um Atome sichtbar zu machen. Ob er dieses Ziel erreichen konnte, ob überhaupt Menschen jemals dorthin gelangen würden, wusste er nicht. Bekannt war nicht einmal, ob es auf der anderen Seite des Wassers, in das Hell sich vorgewagt hatte, eigentlich ein Ufer gab. Weil niemand bereit war, für seine Forschung zu zahlen, wandte er für seinen Lebensunterhalt die Ersparnisse seiner Großmutter auf.
Die Musikpsychologin Diana Deutsch brachte Jahrzehnte in ihrem Tonstudio mit der Entdeckung von akustischen Illusionen zu, die nicht minder verstörend als die bekannten optischen Täuschungen sind. Die Biologen Randolf Menzel und Stefano Mancuso fanden in Insekten und Pflanzen Fähigkeiten, die man diesen nie zugetraut hatte: Bienen beherrschen abstraktes Denken, Pflanzen sehen und ahmen einander nach. Guy Consolmagno schließlich, der Astronom des Papstes, denkt darüber nach, wie die Suche nach außerirdischem Leben die Gottesvorstellung der Menschen verändert. Der Physiker Carlo Rovelli, der in seiner Arbeit sogar die kosmische Herrschaft der Zeit hinterfragt, sieht Rebellion als ein Leitmotiv der Forschung. »Wissenschaft beruht auf der Weigerung, die gewohnte Ordnung der Dinge hinzunehmen.«
So handeln die in diesem Buch versammelten Gespräche davon, wie aus der Auflehnung gegen vermeintliche Gewissheiten Einsichten werden, die unser Leben verändern. Auch Künstler entwerfen Gegenwelten. Anders als deren Schöpfungen allerdings haben sich die Ideen der Wissenschaftler an der Wirklichkeit zu bewähren. Kunst ist allein der Kunst verpflichtet, darin liegt ihr Potential. Wissenschaft hingegen lebt vom systematischen Zweifel; gerade in Zeiten, in denen Fake News ein Millionenpublikum finden, ist diese Methode von unschätzbarem Wert. Eine wissenschaftliche Theorie ist tot, sobald sie den Beobachtungen widerspricht. Forscher, die neue Welterklärungen anbieten, setzen ihre eigene Zukunft aufs Spiel.
»Physiker sind die Pan Taus der menschlichen Rasse«, behauptete Isidor Isaac Rabi, ein Physiknobelpreisträger, dessen Forschung über den Magnetismus der Atomkerne wir die Kernspintomographen verdanken, die heute in jedem größeren Krankenhaus Patienten durchleuchten. »Sie werden niemals erwachsen. So können sie ihre Neugierde behalten. Denn sobald ein Mensch zu raffiniert wird, weiß er zu viel.« Wenigstens einen Funken von Pan Tau habe ich in jedem meiner Gesprächspartner entdeckt.
Berlin, im November 2018 Stefan Klein
Die Freude, das Universum zu betrachten
Der Astronom des Papstes, Guy Consolmagno, über Wissenschaft, Glauben und die Frage, ob Thunfische einen Gott haben
Wenn wir die Welt mit Naturgesetzen erklären können, wo ist dann Gott? Wer sich mit der Entstehung und dem Aufbau des Universums befasst, stößt zwangsläufig auf solche Fragen. In diesem schwierigen Grenzgebiet zwischen Wissen und Glauben bewegt der Astrophysiker Guy Consolmagno sich täglich. Er ist Jesuit und leitet die Sternwarte des Papstes in Castel Gandolfo bei Rom, wo eine weithin sichtbare Teleskopkuppel den Palast der päpstlichen Sommerresidenz krönt. Das Vatikanische Observatorium, in seiner heutigen Form im Jahr 1891 gegründet, um den Austausch zwischen Wissenschaft und Religion zu fördern, betreibt als internationale Forschungseinrichtung auch ein Großteleskop in der Wüste von Arizona. Consolmagno, 1952 in Detroit geboren, studierte Astrophysik und gilt als weltweit anerkannter Experte für Meteoriten und die Entstehung der Himmelskörper im Sonnensystem. 1993 trat er eine Stelle an der päpstlichen Sternwarte an, 2015 wurde er deren Direktor. Er erscheint im Sweatshirt und trägt einen langen weißen Bart, spricht schnell und lacht viel. Eher würde ich vermuten, einem Professor einer amerikanischen Universität des mittleren Westens begegnet zu sein als dem Astronomen des Papstes.
Herr Consolmagno, wir können heute mit Weltraumobservatorien das erste Licht des Universums nach dem Urknall einfangen, die kosmische Hintergrundstrahlung. Als der amerikanische Astrophysiker George Smoot vor einigen Jahren Darstellungen dieser Strahlung präsentierte, sagte er: »Wenn Sie religiös sind, dann ist es, als würden Sie in Gottes Antlitz schauen.« Stimmen Sie ihm zu?
Smoot hat die Erfahrung sehr genau beschrieben: Plötzlich sieht man etwas, von dem man nie dachte, es je sehen zu können. Dies ähnelt tatsächlich einem religiösen Erlebnis.
Was empfinden Sie, wenn Sie zum Sternenhimmel aufschauen?
Dasselbe Staunen, das ich als Kind fühlte, aber mit dem Vorteil, mehr zu wissen. Was ich weiß, lässt mich die Dinge, die ich wahrnehme, noch höher schätzen. Ich habe ein kleines privates Teleskop. Wer durch das Fernrohr den Orionnebel erblickt, sagt: wie wunderschön! Ich allerdings kann den Orionnebel betrachten und weiß: Dort werden Sterne geboren. Mit einem größeren Teleskop erkennt man sogar die Vorgänge, bei denen Planetensysteme entstehen. Es ist, wie Musik zu hören oder einen Sonnenuntergang zu bewundern. Die glutrote Sonne ist schön. Und die Maxwell’schen Gleichungen, die beschreiben, wie ihr Licht zu uns gelangt, sind schön. Diese Eleganz der Natur erfahren Sie aber nur, wenn Sie die Wissenschaft kennen.
Ich weiß, was Sie meinen: Ein fast ekstatisches Staunen darüber, dass sich die Schönheit der Welt uns auf so vielen Ebenen zeigt.
Das einfachste Wort dafür ist: Freude. Wenn es mir nicht gutgeht, schaue ich durch das Teleskop. Nachher bin ich viel glücklicher.
Würden Sie dieses Glück ein religiöses Gefühl nennen?
Ja. Mit der Betonung auf Gefühl. Religion ist mehr als Emotionen. Doch die Freude, die ich beim Blick durchs Teleskop oder auch dann empfinde, wenn ich Daten aus dem Computer ausgedruckt habe und plötzlich etwas verstehe, ist mit der Freude vergleichbar, die ich im Gebet erlebt habe.
Sie haben 20 Jahre als Wissenschaftler gearbeitet, bevor Sie Jesuit wurden. Wie kam es?
Ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe mich bei meiner irischen Mutter und meinem italienischen Vater sehr wohl gefühlt. Und ich bewunderte meine Lehrer, die Jesuiten waren. Religion war ein wichtiger Teil unseres Lebens, aber ich habe mich durch sie nie von Schuldgefühlen beladen oder unterdrückt gesehen. Im Gegenteil: Ich habe die Religion genossen. Ich erlebe noch immer große Befriedigung, wenn ich täglich die Messe besuche, und einen Verlust, wenn ich nicht hingehe.
Sie sind aus Hedonismus gläubig.
Würde ich dieses Wort verwenden? Aber ja, ich habe nie Dinge getan, die ich nicht mochte. Als wir 18 waren, tranken meine Freunde Scotch. Für mich schmeckte das wie Mundspülung. Warum sollte ich das Zeug trinken?
Man muss sich an den Whiskeygeschmack gewöhnen. Wie an die Messe.
Bei der Messe jedenfalls hat es für mich funktioniert. In die Wissenschaft kam ich, weil ich Science-Fiction-Fan bin und es schon als Jugendlicher war. Als ich die Bibliothek der Science-Fiction-Gesellschaft am MIT in Boston sah, wollte ich unbedingt dort studieren. Aus einer Laune heraus schrieb ich mich in Geowissenschaften ein. Es war großartig. Wir Studenten durften forschen, und ich schrieb meine Abschlussarbeit über Ozeane auf den Eismonden des Jupiter. Damals, in den siebziger Jahren, war das alles noch Spekulation. Die Raumsonden, die in vergangenen Jahren dort waren, haben meine Voraussagen über flüssiges Wasser unter den Eiskrusten bestätigt; meine Begründungen allerdings waren falsch. Doch als ich auf die Dreißig zuging, befriedigte mich die Forschung nicht mehr. Ich fragte mich: Was machst du eigentlich mit deinem Leben? Wie kannst du dir den Kopf über Jupitermonde zerbrechen, wenn Menschen auf der Erde verhungern?
Und zu welchem Schluss kamen Sie?
Ich kündigte meine Stelle am MIT und meldete mich zum Peace Corps, das amerikanische Fachkräfte in andere Länder schickt. Ich kam nach Nairobi, um Astronomie zu unterrichten. Ich hatte mir allerdings einen praktischeren Einsatz für die Armen vorgestellt. Am Wochenende zog ich mit meinem kleinen Teleskop durch abgelegene Dörfer. Und die Menschen dort, die kaum das Lebensnotwendige hatten, waren begeistert, wenn sie ihr Auge ans Okular legen durften. Sie empfanden natürlich genau die Freude, von der wir vorhin sprachen. Da begriff ich, dass diese Freude, das Universum zu sehen, alle Menschen vereint.
Weil wir spüren, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Ich vermute, dahinter steht eine tiefe Sehnsucht: Wir wollen erfahren, wer wir eigentlich sind, und woher wir kommen. Viele Menschen erhoffen sich in der Religion eine Antwort, andere suchen sie in der Wissenschaft.
Ein Freund von mir erklärt das mit der Größe unseres Gehirns. Offenbar gibt es darin Teile, die mehr wollen als nur, dass am nächsten Morgen genug zu essen da ist. Und ja, Sie können die Sehnsucht auf das Bewusstsein von uns selbst zurückführen – auf das, was die großen Philosophen die menschliche Seele nannten. Ich würde dieses Gefühl die Freude nennen, in der Nähe Gottes zu sein. Aber ich versuche nicht, es mir zu erklären. Ich beobachte die Freude nur und nehme sie ernst. Sie gehört zum menschlichen Leben. Dass wir so empfinden, unterscheidet uns von gut gefütterten Rindern.
Aber deswegen wurden Sie nicht Jesuit.
Nein. Als ich nach zwei Jahren aus Kenia zurückkam, unterrichtete ich einige Jahre an einem amerikanischen College. Ich war glücklich. Doch dann scheiterte eine Beziehung, und mir wurde klar, dass es nicht meiner Persönlichkeit entspricht, eine Familie zu haben. Da schien mir die Zeit reif, in den Orden einzutreten. Hier kann ich die Forschung betreiben, die ich immer machen wollte, und zugleich meinen Glauben leben.
Sahen Sie keinen Widerspruch darin, als Wissenschaftler das Ordensgelübde zu leisten?
Nein. Warum hätte ich?
Weil ein Wissenschaftler nur der Erkenntnis verpflichtet sein sollte. Als Jesuit haben Sie aber Ihrer Kirche bedingungslosen Gehorsam geschworen. »Was meinen Augen weiß erscheint, halte ich für schwarz, wenn die hierarchische Kirche so entscheidet«, hat Ignatius geschrieben, der Gründer Ihres Ordens. Nicht gerade eine sehr wissenschaftliche Haltung.
Eine Metapher. Hoffentlich.
Wie kommen Sie darauf, dass Ignatius es nicht so gemeint haben könnte?
Sie müssen den Satz im Kontext sehen. Wir Jesuiten hatten schon immer den Ruf, rebellisch zu sein. Aber Rebellion und Hingabe sind kein Widerspruch. Sie bedingen einander.
Manchmal.
Nun, in diesem Fall gibt es gar keinen Konflikt. Unsere Mission am Vatikanischen Observatorium ist ganz einfach, gute Wissenschaft zu machen. Niemand befiehlt uns, worüber und mit welchem Ergebnis. Wer zu uns kommt, bestimmt selbst, woran er forscht.
Im Jahr 1996 gingen Sie für die Sternwarte des Papstes in die Antarktis, um dort nach Meteoriten zu suchen.
Ja. Meteoriten geben Auskunft über die Geschichte des Sonnensystems. Aber die meisten Meteoriten, die auf die Erde fallen, werden niemals als solche erkannt. Die Menschen halten sie für ganz gewöhnliche Steine, und irgendwann werden sie verschüttet. Doch in der Antarktis fließt das Eis von der Mitte an den Rand des Kontinents, wo es sich auflöst. Dabei kommen die vor vielen Jahrtausenden eingefrorenen Meteoriten wieder zum Vorschein. Man muss nur die Augen offen halten: Die schwarzen Steine, die sich auf der blauen Eisoberfläche abzeichnen, sind Meteoriten.
Wie lange haben Sie im Eis gelebt?
Monatelang. Meistens waren wir zu sechst, jeweils zwei Forscher in einem Zelt. Jeden Morgen fuhren wir mit dem Schneemobil weiter in eine andere Gegend. Wenn Sie länger in solch einer kargen Umgebung sind, verändert sich die Wahrnehmung. Die Farben leuchten stärker, Gerüche werden intensiver. Man beginnt sogar die Luft zu schmecken. Obwohl man sich fremd fühlt in dieser Natur, geht einem doch auf, dass auch sie zu unserer Welt gehört. Und dass das Universum viel reicher und vielschichtiger ist, als wir es uns vorstellen.
Hat man noch ein Bedürfnis nach Religion, wenn man solch unmittelbare Naturerfahrungen macht?
Ich hatte es. Ich hatte geweihte Hostien in einer Tupperwaredose dabei. Jede Nacht um 2 Uhr nahm ich eine und sprach ein Gebet. Für mich war es in dieser völligen Isolation sogar noch wichtiger, mich zu verbinden. Mich daran zu erinnern, dass die Welt größer ist als unsere drei Zelte.
Warum mitten in der Nacht?
Weil ich um diese Zeit ohnehin aufwache. Und weil ich nicht wollte, dass meine Mitreisenden davon erfahren. Was ich tat, war zu wichtig und zu intim. Wer dermaßen aufeinander angewiesen ist, wie wir es waren, lässt am besten alles Persönliche außen vor.
Ihre Kollegen im Zelt hätten Sie wohl auch nicht verstanden. Die wenigsten mir bekannten Wissenschaftler sind religiös.
Das entspricht nicht meiner Erfahrung. Normalerweise scheuen sich Wissenschaftler, über Religion zu sprechen. Aber als ich in den Orden eintrat, erzählten mir viele Kollegen von ihrer Glaubenspraxis. Wissenschaftler sind religiös wie andere Menschen auch.
Erhebungen kommen zu einem anderen Schluss. In den USA etwa glauben fast 90 Prozent der Bevölkerung, aber nur 30 Prozent der Hochschullehrer an Gott. Und unter den Forschern, die aufgrund besonderer Leistungen in die amerikanische Akademie der Wissenschaften gewählt worden sind, sind sogar nur sieben Prozent religiös.
Ich vermute, dass die Wissenschaftler die Frage bei solchen Erhebungen anders verstehen als andere Menschen. Die Wissenschaftler geben nicht über ihren Glauben, sondern darüber Auskunft, ob sie regelmäßig beten und in die Kirche gehen. Damit kommen sie natürlich auf geringere Quoten. Und die Akademie ist eine Versammlung älterer weißer Männer. Wer in solch ein Gremium gewählt wird, hat außer seiner Forschung nie ein Leben gehabt.
Für mich gibt es eine viel näherliegende Begründung für diese Daten: Die Wissenschaftler sind nicht gläubig, weil die Religion ihnen unplausibel erscheint. Die Kirche vertritt eine Lehre, die vor mehr als zweitausend Jahren entstand, in einer ganz anderen Welt. Und sie tut es noch dazu in einer Sprache, die kein Mensch mehr begreift. Als das Alte Testament geschrieben wurde, dachte man, die Erde sei flach. Und man konnte sich gar nichts anderes vorstellen, als dass ein höheres Wesen den Menschen in die Welt gesetzt hat. Heute verfügen wir über bessere Erklärungen.
Aber auch über eine reichere Theologie. In Babylon, wo die Schöpfungsgeschichte des Buchs Genesis ihren Ursprung hat, meinten die Menschen, dass die Erdscheibe von Gebirgen begrenzt und darüber ein Himmelszelt aufgespannt ist. Man fragte sich, was dahinter liegt. Heute wissen wir, der Horizont, hinter den wir nicht schauen können, ist Milliarden Lichtjahre entfernt.
Einen solchen Horizont gibt es, weil das Licht aus noch weiter entlegenen Gebieten des Weltraums seit dem Urknall nicht Zeit genug hatte, um uns zu erreichen. Aber dahinter geht das Weltall weiter. Nur können wir nicht wissen, wie es dort aussieht.
Wir mussten Astronomie treiben, um das zu erfahren. Jedenfalls beschäftigt uns die Frage, was jenseits des Horizonts sein mag, noch immer. Sie hat an Faszination nur gewonnen. Oft heißt es, wir Astronomen würden mit unseren Teleskopen nach den letzten Antworten suchen. Das ist nicht wahr. In Wirklichkeit regen wir dazu an, philosophische Fragen zu stellen.
Andererseits leben wir heute in einem goldenen Zeitalter der Kosmologie. Wir sind heute imstande, die Geschichte des Universums und damit unsere eigene Herkunft bis auf einen winzigen Sekundenbruchteil nach dem Urknall zurückzuverfolgen. Damit können wir nicht nur Antworten geben, die den Menschen vor drei Jahrzehnten oder gar zu Jesu Lebzeiten noch unbekannt waren. Wir können auch viel genauere Fragen stellen als sie.
Ja, wir haben viele neue Glieder in der Kette von Ursachen und Folgen kennengelernt. Wir wissen, wie die frühesten Galaxien aussahen. Neuerdings können wir sogar Gravitationswellen aus einer noch früheren Epoche einfangen, in der es noch nicht einmal Licht gab. Wir wissen tatsächlich erstaunlich viel über den Anfang des Universums. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Anfang des Universums und dem Ursprung des Anfangs des Universums.
Sie meinen die Frage, warum es das Weltall überhaupt gibt.
Genau. Dies ist keine wissenschaftliche, sondern eine metaphysische Frage. Darum werden wir sie auch nicht mit Physik beantworten können. Aber wie wir diese Frage angehen, hängt natürlich davon ab, was wir über die Geschichte des Universums wissen.
Wie hilfreich sind da Glaubensvorstellungen aus einer Zeit, in der Menschen dachten, die Welt wurde in sieben Tagen geschaffen?
Ich glaube nicht, dass wir es mit neuen Fragen zu tun haben. Wir sehen die alten Fragen nur auf eine neue Weise. Das Buch Genesis erzählt nicht von Wissenschaft. Eine solche gab es damals noch nicht. In allen Schöpfungsberichten der Bibel finden Sie aber ein gemeinsames Thema: Das Universum ist das Werk eines übernatürlichen Gottes, der diese Welt wollte und liebt. Das ist eine tiefsinnige Überlegung, die gültig bleibt, auch wenn sich unser kosmologisches Wissen erweitert.
Einverstanden. In einer weltlichen Sprache würde ich diesen Gedanken so ausdrücken: Das Universum ist grundsätzlich gut. Allerdings hat ein solcher Glaube nicht das mindeste mit dem zu tun, was wir über die Entstehung des Kosmos herausfinden können.
Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel: In der Antike vermutete man Monster auf den unbekannten Kontinenten jenseits der Ozeane. Natürlich wissen wir heute, dass es diese Monster nicht gibt. Allerdings wurden im Lauf der vergangenen Jahre gut tausend Planeten in anderen Sonnensystemen entdeckt. Und es wäre sehr, sehr merkwürdig, wenn nicht einige dieser Exoplaneten von intelligenten Wesen bewohnt wären. Wie denken diese Geschöpfe über die großen Fragen? Welche Vorstellungen haben sie darüber, warum es sie gibt, und wie das Universum entstand? Da schaue ich auf meine Religion und erkenne, dass die Welt eben nicht nur aus der Menschheit besteht.
Wenn ich mich richtig erinnere, spielen andere Geschöpfe der Natur in der Bibel kaum eine Rolle.
Die Christen im Mittelalter glaubten jedenfalls keineswegs daran, dass die Menschheit im Mittelpunkt von allem steht. Diesen Fehler haben erst die Humanisten gemacht.
Im Mittelalter glaubte man an Engel. Die werden Sie doch nicht mit Außerirdischen gleichsetzen wollen?
Wer sich Engel vorstellen kann, hat keine Schwierigkeit mit außerirdischer Intelligenz.
Aber die Kirche hatte Schwierigkeiten damit. Die Inquisition ließ Giordano Bruno im Jahr 1600 auf dem Scheiterhaufen verbrennen, nachdem er über einen unendlichen Kosmos und Leben auf fernen Planeten spekuliert hatte.
Das war Unrecht. Aber Bruno war ein Spinner, und er wurde nicht für seinen Glauben an Außerirdische getötet. Nikolaus von Kues, der Bischof von Brixen, hatte ähnliche Theorien ungestraft mehr als ein Jahrhundert vor Bruno vertreten.
Ich würde Bruno gewiss nicht als einen Spinner bezeichnen. Wie auch immer: Die christliche Lehre behauptet, dass das Heilsgeschehen hier auf der Erde stattfand. Wie also finden Außerirdische Platz in der Theologie?
Nehmen wir einmal die Jupitermonde, die ich erforscht habe. Wir wissen heute, dass unter deren Eiskruste tatsächlich Ozeane liegen. Dass sich dort Leben herumtreibt, ist nicht sehr wahrscheinlich, doch möglich. Vielleicht tummeln sich intelligente Thunfische dort.
Meinen Sie, Jesus hat mit seinem Leiden auch diese Geschöpfe erlöst? Oder haben die Thunfische auf dem Jupitermond Io ihren eigenen Jesus?
Ich weiß es nicht, bin ja kein Thunfisch. Aber ich weiß: Jesus hat es gegeben. Und wenn eine Heilsgeschichte auf der Erde möglich ist, kann sie auch anderswo geschehen. Ich denke, noch mehr lässt sich aus der Wissenschaft schließen: Wenn auf einem anderen Planeten dieselben Naturgesetze herrschen wie auf der Erde, und dort Leben existiert, dann muss dieses Leben dem irdischen ähneln. Und wenn es ein Geschöpf gibt, das sich seiner selbst und anderer bewusst ist und sich entscheiden kann, diese anderen zu lieben oder nicht, dann steht dieses Geschöpf vor denselben Fragen wie wir. Etwa wird es sich fragen, warum es das Böse gibt auf der Welt.
Mag sein. Aber ich sehe keinen Grund, warum der Thunfisch an Gott glauben sollte.
Weil es überhaupt keinen Grund gibt, der einen solchen Glauben zwingend erfordert. Auch für uns nicht. Gott ist kein Schluss, zu dem Sie am Ende einer Gedankenkette gelangen. Dass es ihn gibt, oder nicht, ist vielmehr eine Annahme, von der Sie ausgehen, wenn Sie das Universum betrachten. Beide Prämissen sind möglich. Es gibt kein richtig oder falsch. Sie müssen sich entscheiden.
Leider weiß ich nicht, wofür. Ich habe nie wirklich verstanden, was das Wort »Gott« eigentlich meint.