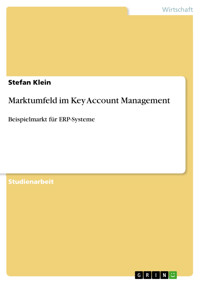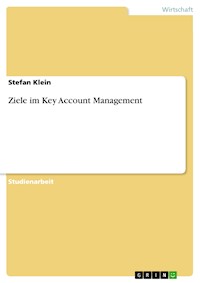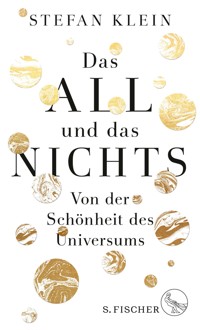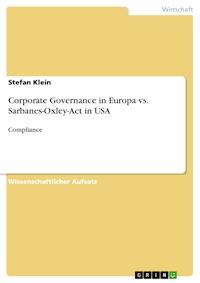16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autor Stefan Klein nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte des schöpferischen Denkens. Von den Innovationen der Steinzeit wie Malerei über die Erfindung der Schrift bis hin zu den Leistungen der Computer von morgen zeigt Stefan Klein anschaulich und unterhaltsam, wie der Geist immer wieder neu die Welt verändert hat. Wir begegnen Neandertalern und Steve Jobs, Leonardo da Vinci und Ada Lovelace, Archimedes und AlphaZero. Dabei wird deutlich: Innovation und Fortschritt verdanken wir nicht den Einfällen einsamer Genies – sie entwickeln sich im geistigen Austausch. Denn Kreativität, Phantasie und Innovation sind keine individuellen Talente, sondern entstehen zwischen den Menschen. Wie wurde unsere Welt die, in der wir leben? Wie wurden wir, was wir sind? Und wie geht es weiter? Jede Veränderung beginnt mit einer neuen Idee! Packend erzählt der renommierte Wissenschaftsautor von der Macht der Gemeinschaft, der Zukunft des Denkens und den unbegrenzten Möglichkeiten unserer Kreativität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Stefan Klein
Wie wir die Welt verändern
Eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes
Biografie
Über den Autor und die Illustratorin
Stefan Klein, geboren 1965, ist der erfolgreichste Wissenschaftsautor deutscher Sprache. Er studierte Physik und analytische Philosophie in München, Grenoble und Freiburg. Er wandte sich dem Schreiben zu, weil er »die Menschen begeistern wollte für eine Wirklichkeit, die aufregender ist als jeder Krimi«. Sein Buch ›Die Glücksformel‹ (2002) stand über ein Jahr auf allen deutschen Bestsellerlisten und machte den Autor auch international bekannt. In den folgenden Jahren erschienen weitere hoch gelobte Bestseller: ›Alles Zufall‹, ›Zeit‹, ›Da Vincis Vermächtnis‹ und ›Der Sinn des Gebens‹, das Wissenschaftsbuch des Jahres 2011 wurde. Zuletzt erschien ›Träume: Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit«, ausgezeichnet mit dem Deutschen Lesepreis 2016, und ›Das All und das Nichts. Von der Schönheit des Universums‹ (2017). Stefan Klein lebt als freier Schriftsteller in Berlin.
Stefanie Harjes, 1967 in Bremen geboren, studierte an der Fachhochschule Hamburg und an der Hochschule für Angewandte Künste in Prag. 36 Bücher und zahlreiche Anthologien hat sie bisher illustriert, etliche davon wurden im Ausland veröffentlicht. Seit 24 Jahren arbeitet sie als Illustratorin und Buchkünstlerin in ihrem Atelier „Überm Wind“. Auch eine Künstlertassen-Kollektion und ein Legetrickfilm sind dort entstanden. Für Ihr Werk wurde Stefanie Harjes mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen dekoriert, u. a. dem Österreichischen Staatspreis für Illustration, dem Sonderpreis des Troisdorfer Bilderbuchpreises, dem Steirischen Literaturpreis und dem 2. Preis der Stiftung Buchkunst. 2009 erhielt sie als erste Frau den Hamburger Lehrpreis. 2010 und 2015 wurde sie für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Weltweit unterrichtet sie, leitet Workshops und Seminare und hält Vorträge vor Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Ihre Arbeiten werden auf internationaler Ebene in Einzel- und Gruppenausstellungen präsentiert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Grafiken: Peter Palm, Berlin
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung und Illustrationen: Stefanie Harjes
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403715-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Einleitung Prometheus sind wir
Teil I Das Erwachen
1 Die Botschaft der Steine
2 Explosion der Schaffenskraft
3 Das kollektive Gehirn
Teil II Die Zeit der Symbole
4 Die Macht der Zeichen
5 Sehen ist erfinden
6 Geistesblitze
Teil III Die Zeit der Vernetzung
7 Schwarz auf weiß
8 Reise durch den Möglichkeitsraum
9 Wie man die Welt aus den Angeln hebt
Teil IV Die Zukunft der Intelligenz
10 Adas Vermächtnis
11 Wie wir die Welt verändern
Danksagung
Bibliographie
Nachweise
Personen- und Sachregister
Für Dora, Irene und Elias
EinleitungPrometheus sind wir
Was heute unvorstellbar ist, kann morgen Wirklichkeit sein. Als Glanzleistungen menschlicher Schaffenskraft gelten gewöhnlich spektakuläre Werke – wie die Pyramiden oder der Eiffelturm, Mozarts Symphonien oder Leonardos »Mona Lisa«, Shakespeares Sonette oder Technikwunder vom Rang der Mondraketen. Aber das schöpferische Denken manifestiert sich ebenso und vielleicht noch eindrucksvoller in den kleinen, vermeintlich alltäglichen Dingen. Die Tatsache, dass wir uns an einem Wintertag unter eine heiße Dusche stellen können, ist kein geringerer Triumph des menschlichen Einfallsreichtums als die Entdeckung der Relativitätstheorie.
Jeder, der einmal versucht hat, ein Lagerfeuer zu entfachen, weiß, was für eine Herausforderung eine solch elementare Tätigkeit darstellen kann – erst recht, wenn das Holz feucht ist. Und dabei müssen wir heute nur Streichhölzer aus der Tasche ziehen, um eine Flamme zu entzünden. Unsere Vorfahren hatten es schwerer. Einfach Feuersteine gegeneinanderzuschlagen, wie es spielende Kinder tun, bringt nicht das kleinste Flämmchen zum Lodern.
Bevor unsere Ahnen ihr erstes Feuer entfachen konnten, bedurfte es vielmehr einer ganzen Reihe von höchst unwahrscheinlichen Ideen. Zudem mussten die frühen Menschen diese Einfälle miteinander verketten: Die Lösung lag darin, Feuerstein mit einem weicheren Mineral wie Katzengold und leicht brennbarem Zunder zu paaren. Schlägt man mit dem Feuerstein in einem spitzen Winkel auf das Katzengold, erzeugt man durch Reibung glühende Späne. Gelingt es, diese Funken mit dem Zunder aufzufangen, entsteht ein kaum sichtbares Glutnest, dessen Wärme sich schließlich durch genau dosierte Atemstöße auf ein Bündel Gras übertragen lässt.
Der Zunder wurde gewöhnlich aus einem Baumpilz gewonnen, was wiederum erstaunliche Einfälle voraussetzt. So, wie man den harten Zunderschwamm von der Rinde eines sterbenden Baums ablöst, brennt er nämlich gar nicht. Wie erkannten unsere Vorfahren, dass sie das Hutfleisch, eine dünne Schicht unter der Pilzhaut, freilegen und weichklopfen mussten? Und woher kam die Einsicht, dass der Zunder leichter Feuer fängt, wenn man das Hutfleisch erst in einer Mischung aus Wasser und Asche auskocht und dann drei Wochen lang in Urin einlegt?
Mit diesem Wissen überlebten unsere Ahnen Winter, die viel kälter waren als heute. Das bezeugt der Mann, der vor 5300 Jahren das Tiroler Tisenjoch überquerte, auf dem Gletscher mit einem Pfeilschuss ermordet wurde und dessen tiefgefrorene Mumie heute als »Ötzi« im Bozener Landesmuseum ausgestellt ist.[1] In seiner Gürteltasche führte Ötzi eine schwarze Masse mit sich, die Forscher als bearbeitetes Hutfleisch eines Zunderpilzes identifizierten. In dem Zunder glitzerte Katzengoldstaub.
Unser Denken wurzelt tief in der Vergangenheit. Schon Ötzi griff auf die Erfahrung Zehntausender Generationen zurück. Mit Sicherheit die Neandertaler, höchstwahrscheinlich auch schon weit frühere Menschen schlugen mit Zunder und Katzengold Feuer.[2] Wir wissen nicht, wann genau es unseren ersten Vorfahren gelang, erstmals eine Flamme zu entzünden. Aber wir wissen, dass kein Ereignis die Geschichte der Menschheit auch nur annähernd so geprägt hat wie dieser Moment. Denn mit dem Feuer, das sie nun kontrollierten, veränderten die Menschen nicht nur die Welt, sondern zudem sich selbst. Indem sie ihre Nahrung kochten, machten sie deren Inhaltsstoffe besser verwertbar. Mehr Energie erlaubte das Wachstum immer größerer Gehirne, bis diese Dimensionen erreichten, die in der Natur einmalig waren.[3] Der Weg zu Computern und Raumfahrt begann am Kochtopf. Doch dass Menschen sich auf diesen Weg begeben konnten, verdankten sie ihrem Einfallsreichtum.
Erst unsere Ideen haben uns zu denen gemacht, die wir sind. Unsere Vorstellungskraft formt unser Wesen. Darin unterscheiden wir uns von jedem anderen Geschöpf der Natur. Über beeindruckende Technik verfügen zwar auch Tiere. Die Kunst, mit der zum Beispiel Termiten ihre gewaltigen, klimatisierten Bauten für Hunderttausende Artgenossen errichten, steht menschlichen Errungenschaften keineswegs nach. Die in der Luft schwebenden Architekturen von Fangnetzen, Wohnkammern, Baldachinen, Klebefäden, Signalschnüren und Brückenleinen, die Spinnen aus ihrer Seide weben, ringen jedem Ingenieur Bewunderung ab. Und die Jagdstrategien, mit denen manche Krokodile trotz ihrer winzigen Gehirne viel intelligentere, auch wendigere Vögel erlegen, erscheinen kaum minder raffiniert als die Kontrolle des Feuers.[4]
Aber Termiten wissen nicht, wie sie ihre Bauten erstellen, Spinnen ist unbekannt, wie man Netze aufspannt. Sie haben ihre Kunst weder selbst erfunden noch von anderen gelernt. Sie mussten es nicht, denn sie kamen als Baumeister auf die Welt. Die Pläne und die richtige Ausführung ihrer Konstruktionen sind in ihre Gene geschrieben. Auch Krokodile führen nur aus, was die Natur ihnen einprogrammiert hat.
Bei uns Menschen ist das ganz anders. Die Natur hat uns nicht beigebracht, Feuer zu schlagen. Jeder Städter, der ohne Feuerzeug und Daunenschlafsack in einer kalten Wildnis ausgesetzt wird, würde erfrieren. Selbst wenn es ihm gelänge, Feuersteine zu finden: Woher sollte er wissen, dass Funken aus Feuerstein niemals heiß genug werden, um einen Brand anzufachen? Dass er Späne von weicherem Katzengold abschlagen muss? Und wer würde denken, dass ein Pilz brennt?
Den unscheinbaren Termiten und Spinnen genügt ihr Instinkt, um sich Städte zu bauen und Luftschlösser zu weben. Der Mensch hingegen braucht eine Serie von Geistesblitzen, bevor er auch nur eine Flamme anstecken kann.
Woher kommen diese Einfälle? Die längste Zeit vermutete man, dass göttliche Kräfte dem Menschen seine Ideen eingeben. Und weil keine Erfindung so lebenspendend war wie die Zähmung des Feuers, erzählt jede Kultur ihren Mythos, nach dem ein höheres Wesen das Feuer auf die Erde gebracht hat. In der griechischen Sage muss Prometheus dafür büßen, dass er dem Göttervater Zeus die Flammen geraubt hat. Niemand konnte sich seinerzeit vorstellen, dass die Menschen aus eigener Geisteskraft Herrschaft über das Feuer erlangt hatten.
Heute sind wir weniger geneigt, übernatürliche Mächte für unsere Einfälle verantwortlich zu machen. Und doch wird das schöpferische Denken der Menschen noch immer als eines der größten Rätsel überhaupt angesehen. Gemeinsam mit dem Mysterium des Bewusstseins markiere es »den Rand unseres Wissens«, schreibt der Neurowissenschaftler Eric Kandel, der für die Entdeckung grundlegender Mechanismen des Lernens im Jahr 2000 den Nobelpreis erhielt.[5]
Das schöpferische Denken erscheint geheimnisvoll, weil es unberechenbar ist. Ideen gehen, oft zu unserem Leidwesen, ihre eigenen Wege. Wenn ein Problem neue Lösungen erfordert und wir um Einfälle ringen, wollen sie sich nicht einstellen, sosehr wir uns auch um sie bemühen – oder gerade deswegen? Dann aber überfallen sie uns, wenn wir am wenigsten mit ihnen rechnen: Während wir unter der Dusche stehen, mit dem Fahrrad auf einer vielbefahrenen Kreuzung abbiegen, manchmal sogar in einem Traum fängt der Verstand plötzlich an, Funken zu schlagen.
Wohl weil Menschen sie so lange göttlichen Mächten zuschrieben, hat die Fähigkeit, Ideen hervorzubringen und umzusetzen, erst seit 150 Jahren einen Namen. Genauso lange ist ungeklärt, was Kreativität – das Vermögen, Neues und Wertvolles zu schaffen – eigentlich ausmacht.
Handelt es sich um eine Gabe, die lediglich den größten Geistern der Menschheit, den Mozarts, Picassos und Einsteins zukommt? Die Verehrung von Genies erscheint nur zu verständlich: Unbestritten sind die letzten Takte der Jupitersymphonie ein Wunder, eröffneten die »Demoiselles d’Avignon« ein neues Kapitel der Malerei. Zweifellos fiel mit der Relativitätstheorie ein Schleier von unserem Bild des Universums. Menschen, die solche Werke schaffen, für Auserwählte zu halten, liegt aus demselben Grund nahe, aus dem Mythen das Feuer als göttliche Gabe beschreiben – man konnte sich die schöpferische Leistung nicht anders erklären.
Doch sowenig Prometheus eine historische Gestalt ist, so wirklichkeitsfremd ist der Geniekult. Jüngste Erkenntnisse der Hirnforschung zeigen, dass Kreativität kein besonderes Talent ist, mit dem einige Auserwählte beschenkt wurden und der sogenannte Durchschnittsmensch nicht. Die folgenden Seiten wollen Sie davon überzeugen, dass Kreativität zugleich grundlegender und viel interessanter ist: Schöpferisches Denken ergibt sich aus den elementaren Funktionen des Verstands, über die jeder Mensch verfügt.
Mehr noch: Welche Früchte unser Verstand trägt, hängt weniger von den persönlichen Anlagen ab als vielmehr davon, wie wir uns mit anderen Menschen austauschen können. Denn Kreativität entfaltet sich nicht so sehr im Kopf eines Einzelnen, sondern in der fruchtbaren Auseinandersetzung mit anderen Personen und ihren Gedanken. Und weil das so ist, lässt Kreativität sich entfesseln.
Nur nach einer romantischen Vorstellung schöpfen Genies große Ideen aus sich selbst. Das Gegenteil trifft zu: Jedes schöpferische Denken entspringt dem Zusammenspiel vieler Menschen. Ideen entwickeln sich als Antworten auf Fragen, die andere Individuen oder die Umwelt uns stellen. Ohne diese Anregungen von außen wäre die stärkste Vorstellungskraft machtlos. Um Antworten zu finden, benötigt der Verstand geistige Werkzeuge und geeignetes Material – so, wie selbst der beste Zimmermann ohne Holz und Säge keinen Dachstuhl richten kann. Diese geistigen Werkzeuge und das Material, aus denen die Vorstellungskraft neue Einfälle formt, nennt man Kultur.
In der Geschichte der Menschheit erlebte das Denken drei Revolutionen. Diese Zäsuren formten den menschlichen Geist. Mit den Werkzeugen und aus dem Material, die in diesen Zeiten des Umbruchs entstanden, bringen wir heute unsere Ideen hervor. Eine vierte Revolution erschüttert die Welt heute. Alle diese Umwälzungen gehen auf eine gemeinsame Ursache zurück: Die Menschen entwickelten einen neuen Umgang mit Information.
Die erste Revolution vollzog sich vor mehr als 3,3 Millionen Jahren, als unsere Vorfahren lernten, wie man Steine zu Klingen behaut. Diese Werkzeuge verliehen ihren Körpern übermenschliche Kräfte, so dass die frühen Menschen sich ein Stück weit aus der Natur lösten. Die Kapitel eins bis drei dieses Buchs erzählen davon, wie unsere Urahnen begannen, ihre Welt zu gestalten. Weil bereits sie darauf angewiesen waren, voneinander zu lernen, benötigten sie einen neuen Weg der Verständigung. Darum entstand wohl schon in dieser ersten Wendezeit die Sprache.
Im Zuge der zweiten Revolution entdeckte der Mensch das symbolische Denken. Wann und wie genau dieser Umbruch einsetzte, wissen wir nicht. Fest steht, dass unsere Ahnen sich vor mindestens 100000 Jahren ein neues Verständnis der Welt aneigneten. Sie erkannten ihre Freiheit, den Dingen ihrer Umgebung eine Bedeutung zu geben. Plötzlich war eine Muschel nicht mehr nur der Überrest eines Meerestiers – sie konnte ein Schmuckstück sein, das seinem Besitzer Ansehen verlieh. Ein geschwungener Strich, mit einem verkohlten Ast auf eine Felswand gezogen, stand für den Rücken eines Tieres. Der farbige Abdruck einer Hand erinnerte an die Person, die ihn angebracht hatte. Zum ersten Mal speicherten Menschen Information außerhalb ihres Gehirns.
Symbole sind Werkzeuge für den Verstand. Wie wir in den Kapiteln vier bis sechs sehen werden, ermöglichten sie den Menschen das Zusammenleben in größeren Gruppen, später die Sesshaftwerdung. Aus einfachen Bildsymbolen entwickelten sich Zahlen und Schrift, die immer abstraktere Vorstellungen erlaubten. Durch den Gebrauch von Symbolen potenzierte der Mensch die Möglichkeiten seines Gehirns.
Die dritte Revolution entfesselte Information, sie führte die Menschheit in ein Zeitalter, in dem sich Gehirne auf der ganzen Welt miteinander vernetzten. Den Beginn der Massenkommunikation können wir bis auf ein paar Monate genau datieren: Um das Jahr 1450 nach Christus nahm der Goldschmied Johannes Gutenberg in Mainz ein neuartiges Gerät in Betrieb. Seine Druckerpresse mit beweglichen Lettern aus Zinn erlaubte es, Informationen schnell und massenhaft zu verbreiten. Innerhalb weniger Jahre strömten Millionen Blätter aus den Druckereien. Die Kapitel sieben bis neun untersuchen, wie Wissen zunehmend den Glauben als Orientierung ersetzte. Wissenschaft wurde eine Macht in der Welt, entfesselte die verborgenen Kräfte der Natur und verschaffte Milliarden Menschen einen nie gekannten Lebensstandard.
Die vierte Revolution wühlt uns derzeit auf. Menschen haben Maschinen geschaffen, die ihrem Verstand immer mehr Aufgaben abnehmen und selbständig lernen. In kürzester Zeit sind wir von unseren Computern abhängig geworden. Die Geschwindigkeit, mit der dieser Übergang sich vollzieht, hat viele Menschen überrascht, auch erschreckt. Die Kapitel zehn und elf analysieren das Dilemma, in dem wir stecken: Einerseits werden Maschinen auf immer mehr Gebieten unsere Intelligenz übertreffen und für uns Entscheidungen fällen. Andererseits werden wir mit Hilfe der sogenannten künstlichen Intelligenz unser eigenes Denken besser verstehen – und können es dadurch weiterentwickeln.
Der Aufstieg des Menschen stelle sich als »ein ständiges Wachsen und Erweitern der menschlichen Vorstellungskraft« dar, bemerkte der britische Mathematiker und Biologe Jacob Bronowski. Der Weg unserer Art zum Herrscher über die Erde war nicht so sehr ein Triumph der Intelligenz – sondern einer der Phantasie.
Die erstaunlichste Fähigkeit des menschlichen Geistes ist, dass er immer wieder sich selbst übertrifft. Aber jede Revolution, die ihn auf eine neue Stufe hob, brachte auch eine Krise mit sich, in der eine alte Ordnung zerbrach. So beschäftigen uns heute die Fragen, die der rasante Siegeszug von Computern, Internet und künstlicher Intelligenz aufwirft. Vielleicht hilft uns ein Blick auf die Geschichte des menschlichen Geistes, sinnvolle Antworten zu finden.
Teil IDas Erwachen
Steinwerkzeug aus Lomekwi, 3,3 Millionen Jahre vor unserer Zeit
1Die Botschaft der Steine
Es ist umstritten, ob die menschliche Hand das menschliche Gehirn oder das Gehirn die Hand geschaffen hat. Sicherlich ist die Verbindung intim und wechselseitig.
Alfred North Whitehead[1]
Wir würden eine Reise durch die Wüste nach Norden antreten, kündigte der Fahrer uns an, das genaue Ziel dürfe er uns nicht nennen. So fuhren wir durch die Dunkelheit, während jedes Schlagloch uns gegen die Wände des Landcruisers prallen ließ. Als die Sonne aufging, zeigte sich eine Landschaft von eigenartiger Schönheit. Links der Fahrbahn erstreckten sich endlose Schotterflächen, aus denen sich in der Ferne ein Gebirge erhob. Auf dem Geröll wuchsen ein paar Akazien, wir sahen eine Ziegenherde und ein Kamel. Im Übrigen schien die Gegend verlassen. Zu unserer Rechten aber schimmerte tiefblau und bis zum Horizont Wasser. Am Ufer wuchsen Palmen so üppig, dass ein Foto als Werbung für einen Karibikstrand hätte durchgehen können, nur die Nilkrokodile, die sich im Sand sonnten, störten. Dies war der Turkana-See, der größte Wüstensee der Welt, dessen Salzwasser auf 250 Kilometern Länge das weite Tal des afrikanischen Grabenbruchs füllt.
Gegen Mittag näherten wir uns der äthiopischen Grenze. Wir passierten ein paar aus Palmwedeln geflochtene Hütten, vor denen Menschen saßen, die es irgendwie schafften, in dieser Ödnis zu überleben. Dann bog der Fahrer plötzlich ab und steuerte, die Piste hinter uns lassend, in ein ausgetrocknetes Flussbett hinein. Über das Geröll und durch die Felsen dirigierte er den Geländewagen, bis wir schließlich auf einem Hügel ankamen, wo er uns auszusteigen bat. Das Panorama war überwältigend. Zu unseren Füßen lag ein natürliches Amphitheater, vom Wasser der Regenzeit aus dem roten und gelben Tuff gewaschen. In Richtung See zog sich das Flusstal, durch das wir gekommen waren. Die senkrechten Wände des Tals leuchteten in allen Erdfarben und trugen Gesteinssäulen, wie das Gemäuer einer Kathedrale.
Lange standen wir, der Fahrer, die Archäologin Sonia Harmand, ein Fotograf und ich selbst, auf dem Hügel, schauten in die Ferne und schwiegen. Dies sei der Ort, an dem sie die Entdeckung ihres Lebens gemacht habe, sagte endlich Harmand, eine zierliche Französin mittleren Alters. Sie deutete auf einen Haufen bräunlicher Steine vielleicht zwanzig Schritte vor uns. Hier, zu unseren Füßen liege das erste Zeichen vom Erwachen der Menschheit.
Am 9. Juli 2011 habe es sie zufällig hierherverschlagen, das Datum werde sie niemals vergessen. Mit ihrem Mann, Archäologe auch er, habe sie sich in der Wüste verirrt. Um sich zu orientieren, waren sie in der Mittagshitze auf den Hügel gestiegen, auf dem wir jetzt standen. Es war ihr fünfzehnter Sommer in dieser Wüste am Äquator, der man nachsagt, die heißeste Gegend der Erde zu sein, und in der 45 Grad im Schatten normal sind – wenn man denn Schatten findet. »Na und?«, fragte Harmand. Dies sei ihr Land.
Nach ihrem Abitur in Paris war sie nach Ostafrika gereist, angezogen von nichts weiter als einer Sehnsucht. Und dort angekommen habe sich tatsächlich eine unerklärliche und überwältigende Vertrautheit mit diesem Kontinent eingestellt, der vor Millionen von Jahren die Menschheit hervorgebracht hat. In den Savannen des großen Grabenbruchs fühlte sich Sonia Harmand nicht in der Fremde, sondern heimgekommen an einen Ort, an dem sie schon einmal, lange Zeit vor ihrer Erinnerung, war. Da sei ihr klar gewesen, sie würde zurückkehren. Harmand studierte Archäologie in Paris, trat eine Professur in New York an und brach zu den Ufern des Turkana-Sees auf, wo so viele Hinterlassenschaften der frühesten Menschen und Vormenschen entdeckt worden waren wie nirgends sonst auf der Erde.
Als sich die Verirrten an diesem heißen Julitag verorteten, stellten sie überrascht fest, dass sie die Gegend schon mehrmals besucht hatten. Nur wenige hundert Meter entfernt war zehn Jahre zuvor ein rätselhaftes Fossil aufgetaucht – der vollständige Schädel eines Hominiden. Die Knochen waren 3,5 Millionen Jahre alt, stammten also aus einer Zeit, lange bevor Homo sapiens die Erde betrat. Jeder solche Fund ist sensationell, dieser Schädel aber sah noch dazu mehr als ungewöhnlich aus: Das Gesicht des Verstorbenen besaß keine tiefen Augenhöhlen, kein fliehendes Kinn, wie man sie sonst von Vormenschen kannte. Vielmehr wirkte es so flach und ebenmäßig, dass es auf einem Gruppenfoto in heutiger Gesellschaft kaum auffallen würde. Auch sonst erinnerte wenig an die bekannten Fossilien aus dieser Epoche. Nachdem die Paläontologin Louise Leakey den Schädel untersucht hatte, kam sie zu dem Schluss, dass der Tote Vertreter einer bislang unbekannten Art Mensch gewesen sein müsse, die sie Kenyanthropus platyops, »flachgesichtigen Keniamensch« nannte. Und ein Wort aus der Familie Leakey hat Gewicht. Louise ist die Enkelin des legendären Paares Louis und Mary Leakey, deren Fossilienfunden wir die Einsicht verdanken, dass der Mensch aus Afrika stammt. Als Kind war Louise dann zugegen, als ihre Eltern Richard und Meave Leakey in den 1970er Jahren am Turkana-See die ältesten Knochen der Gattung Homo ausgruben.
Barg der unscheinbare Hügel im Ödland des Turkana-Sees noch ein Geheimnis? Harmand funkte ihre Helfer herbei. Zwei Dutzend Männer schwärmten aus. In Ketten einer neben dem anderen durchkämmten sie das Gelände, darauf geschult, mit überscharfen Augen die kleinsten Auffälligkeiten am Boden wahrzunehmen. Das Land an den Ufern des Turkana-Sees ist so trocken, dass kein Humus die Fossilien längst ausgestorbener Geschöpfe bedeckt; sobald ein kräftiger Guss in der Regenzeit eine Schicht Schotter wegwäscht, liegen die Überreste aus Jahrmillionen frei.
Noch am selben Nachmittag dieses 9. Juli 2011 meldete Sammy Lokorodi, ein Fossilienjäger aus dem Volk der Turkana, über Walkie-Talkie Erfolg. An einem Abhang hatte er gut faustgroße Basaltsteine mit ungewöhnlich scharfen Kanten entdeckt. Dies konnte unmöglich Naturbruch sein, jemand musste mit großer Kraft auf die Steine eingewirkt haben. Zu erkennen waren sogar die Schlagmale, wo dieser Jemand immer wieder angesetzt hatte, um die Steine zu spalten und Schneidkanten herauszubrechen.
Die Forscher markierten die Fundstelle mit farbigen Fähnchen, blau für einen behauenen Stein, gelb für Fossilien. Nach einer halben Stunde steckten 50 Fähnchen im Boden auf einer Fläche so groß wie ein Zimmer.
Harmand ließ graben. Anhand der Lage der Gesteinsschichten konnte sie das Alter der Funde datieren. Die Steinwerkzeuge waren fast eine Million Jahre älter als alle bis dahin bekannten Artefakte von Menschen oder auch Tieren. Sie entstanden vor mindestens 3,3 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als Kenyathropus platyops, das Flachgesicht, noch auf der Erde weilte. Harmand hielt den Ort ihrer Entdeckung geheim. Kein Plünderer und kein Konkurrent sollte sich der Lagerstätte bemächtigen können, weshalb auch wir nicht erfahren durften, wo genau wir eigentlich waren. Der Weiler aus Palmwedelhütten, den wir passiert hatten, heiße Lomekwi, sagte Harmand. Mehr wollte sie nicht preisgeben.
Ihre Männer gruben vier Sommer lang, denn das Sediment war hart wie Zement und musste vorsichtig aufgebrochen werden. Schließlich hatten die Archäologen fast 150 bearbeitete Steine beisammen. Spektakulärer noch als die Schneidgeräte waren Fundstücke, die als Spitzhämmer und Ambosse zur Herstellung der Klingen gedient haben mussten. Die größten Werkzeuge wogen 15 Kilo, und viele steckten so tief im Boden, dass sie unmöglich später an diese Stelle geraten sein konnten. Zweifellos hatte hier nicht bloß ein einzelner Handwerker Steine behauen: Dies waren die Überreste einer Industrie, so nennen Paläontologen eine Tradition der Werkzeugherstellung. Und die Industrie musste sehr lange in Betrieb gewesen sein, wie die vielen Artefakte in mehreren Geröllschichten verrieten. Jahrhunderte-, wenn nicht jahrtausendelang hatte Generation um Generation intelligenter Wesen hier Werkzeuge hergestellt. An diesem Hügel vor unseren Augen hatten menschenähnliche Wesen voneinander gelernt, Ideen entwickelt und weitergegeben. Die Schöpfer der Klingen, wer immer sie waren, hatten eine Kultur.
Als Harmand endlich im Jahr 2015, kurz vor meinem Besuch, in einer Fachzeitschrift über ihre Grabungen berichtete, feierten die Kollegen ihre Entdeckung als »die wichtigste der letzten 50 Jahre«. Die Funde von Lomekwi sind das Zeugnis der ältesten bekannten Kultur überhaupt, ein Schlüssel, um das Erwachen der Menschheit zu verstehen. Sie erzählen vom Aufstieg einer neuen Macht auf der Erde – einer Spezies, die mit ihrer Intelligenz ihr eigenes Schicksal zu lenken und die Welt nach ihren Vorstellungen zu verändern begann. Ideen, nicht mehr allein die Natur, bestimmten fortan das Geschehen auf dem Planeten. Und die Steine von Lomekwi geben auch Aufschluss darüber, was diese schöpferische Intelligenz auszeichnet und wie sie entstand.
Bis zu Harmands Funden vermutete man, schöpferisches Denken erfordere ein großes Gehirn. Man erzählte die Geschichte ungefähr so: Als Homo, dem Vorfahren des modernen Menschen, durch einen Klimawandel vor gut zwei Millionen Jahren die Nahrung knapp wurde, wurde er kreativ. Er nutzte seine damals schon überragende Intelligenz, um Werkzeuge herzustellen, mit denen er neue Nahrungsquellen erschloss. Aus Steinen machte er Waffen und Messer, um Fleisch zu zerteilen. So verwandelte Homo, ein von Natur aus schwächliches Geschöpf, sich in einen Jäger, der es mit den größten Tieren der Savanne aufnehmen konnte. Das Fleisch wiederum bot ihm so hochwertige Nahrung, dass Homo es sich leisten konnte, ein noch größeres Gehirn zu versorgen. Und je intelligenter er wurde, umso effizienter konnte er jagen: Homo wurde zum erfolgreichsten Raubtier auf dem Planeten, der Beherrscher der Welt. Und irgendwann, viel später, begann er zu sprechen.
Aber so kann die Geschichte unmöglich stimmen. Erstens ging die Industrie von Lomekwi schon lange vor jenem Klimawandel in Betrieb. Mindestens eine halbe Million Jahre bevor die globale Erwärmung den Urwald verdorren ließ und die afrikanische Savanne entstand, wurden hier schon Steine zu Werkzeugen behauen.[2] Zweitens waren die Werkzeuge, die Sonia Harmand und ihre Helfer entdeckten, weder Fleischmesser noch Waffen. Nirgends im Gelände waren Tierknochen mit Schneidkerben zu finden. Und die Spuren auf den Klingen selbst deuten darauf hin, dass damit Pflanzen bearbeitet wurden. Die Geräte dienten offenbar dazu, Nüsse zu knacken, Wurzelknollen zu teilen oder Insekten aus Baumstämmen zu lösen. Und drittens besaßen die Schöpfer der Artefakte kein großes Gehirn. Das Flachgesicht Kenyanthropus platyops verfügte, seinem modernen Aussehen zum Trotz, gerade einmal über ein Drittel des Schädelvolumens heutiger Menschen. Zwar existierten vor drei Millionen Jahren auch andere Arten von Menschen. Aber keines dieser Geschöpfe hatte ein Gehirn größer als das eines modernen Schimpansen. Und doch waren sie sichtlich dazu imstande, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.
Was also, wenn nicht ein großes Gehirn, beflügelte ihre Vorstellungskraft? Auf den Fähigkeiten, die sich in unseren Vorfahren entwickelten, beruht unser schöpferisches Denken bis heute. Um unsere Kreativität zu verstehen, müssen wir also den Hintergrund kennen, vor dem sich die erste Revolution des menschlichen Denkens vollzog.
Intelligenz kam nicht erst mit dem Homo sapiens auf die Welt. Als Paläontologen in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zum ersten Mal auf Fossilien von Hominiden, menschenartigen Wesen, stießen, die älter als eine Million Jahre waren und kleine Gehirne besaßen, verwischte sich die bis dahin scharfe Grenze zwischen Mensch und Tier. Man versuchte sie neu zu definieren, indem man erklärte, Menschen zeichneten sich durch ihre Gabe aus, Werkzeuge zu benutzen. Um diese Behauptung zu prüfen, beauftragte der Fossilienjäger Louis Leakey eine junge Frau, die keine andere Qualifikation vorweisen konnte, als dass sie wilde Tiere beobachten wollte, in den Urwald zu gehen und genau das zu tun. Jane Goodall erwies sich als überragende Verhaltensforscherin. Schon 1964 filmte sie in Tansania, wie Schimpansen Stöcke einsetzen, um Termiten zu jagen. Als sie Leakey aufgeregt von ihrer Entdeckung telegraphierte, antwortete dieser: »Wir müssen jetzt neu festlegen, was ein Mensch ist … oder Schimpansen als Menschen akzeptieren.«
Heute sind viele Beispiele für den Werkzeuggebrauch bei Tieren bekannt. Gorillas verwenden Stöcke als Krücken, wenn sie Flüsse durchqueren; Orang-Utans gebrauchen Blätter als Handschuhe bei der Suche nach Früchten in Dornengestrüpp; Kapuzineraffen graben mit flachen Steinen nach essbaren Wurzeln. Elefanten klemmen sich belaubte Zweige in den Rüssel und vertreiben so Fliegen. Delfine stülpen sich Schwämme über die Schnauze, um sich beim Stöbern auf steinigem Grund vor Verletzungen zu schützen. Und selbst weniger hoch entwickelte Tiere behelfen sich mit Instrumenten: Krokodile balancieren Zweige auf der Schnauze, um Vögel zu schnappen, die nach Nistmaterial suchen; Oktopusse legen sich Muschelschalen als Verstecke zurecht.[3]
Eine der schönsten Beobachtungen dieser Art stammt ebenfalls von Jane Goodall. Sie beschreibt den rasanten Aufstieg eines jungen Schimpansen, den sie Mike nannte, zum Anführer der Horde. Bemerkenswert erschien Mikes Karriere, weil normalerweise viel ältere Männchen die Alpha-Rolle einnehmen. Noch erstaunlicher war, wie Mike seinen Weg gemacht hatte – er errang seine Position ohne einen einzigen Kampf, sondern dank eines brillanten Einfalls: Mike hatte zwei leere Benzinkanister entdeckt, sich ihrer bemächtigt und gelernt, die Blechbehälter mit solchem Karacho gegeneinanderzuschlagen, dass jeder Gegner Reißaus nahm.[4]
Kreativität nennt man die Fähigkeit, neue, überraschende und wertvolle Lösungen zu finden. Jedes einzelne der gerade genannten Verhalten entspricht dieser weithin anerkannten Definition: Kreativität ist kein Alleinstellungsmerkmal von Menschen. Auch Tiere sind kreativ. Und dabei müssen sie nicht einmal über ein im Verhältnis zu ihrem Körper großes Gehirn verfügen.[5] All das legt nahe, dass Kreativität entstanden sein muss, lange bevor die Evolution den Menschen hervorgebracht hat. Tatsächlich werden wir in Kapitel fünf erkennen, wie tief schöpferisches Denken in jeder Tätigkeit unseres Verstandes verankert ist.
Als die Vorläufer des Homo sapiens vor mehr als drei Millionen Jahren die ersten Steinwerkzeuge herstellten, war schöpferische Intelligenz also schon lange nichts Neues mehr. Aber die Handwerker von Lomekwi leisteten etwas, wozu die wenigsten Tiere imstande sind. Wenn Kapuzineraffen Wurzeln, Elefanten Zweige, Oktopusse Muscheln als Werkzeug gebrauchen, verwenden sie die Dinge nur so, wie sie diese zufällig finden. Sie verwandeln sie nicht. Sich aber ein Werkzeug herzustellen, das man später für einen bestimmten Zweck einsetzt, erfordert sehr viel mehr Einsicht, Planung und Vorstellungskraft. Erst nach vielen Arbeitsgängen ist aus einem rohen Stein eine Klinge geformt. Jeder einzelne Schritt verlangt eine präzise Idee von dem, was noch nicht ist, aber sein soll.
Nur Menschenaffen und einige Vögel bringen die zur Werkzeugherstellung nötigen geistigen Voraussetzungen mit. Kaledonische Gelbschnabelkrähen, die als die intelligentesten Vögel überhaupt gelten, biegen sich Zweige und Palmenblätter zu Haken, mit denen sie dann Larven und ausgewachsene Insekten aus Baumritzen angeln; auf diese Weise decken diese Krähen einen Großteil ihres Nahrungsbedarfs.[6]
Schimpansen wurden in Ostafrika dabei beobachtet, wie sie Stöcke mit ihren Zähnen zuspitzten. Und in Westafrika fertigen die Menschenaffen regelrechte Waffen. Aus der Savanne von Fongoli im südöstlichen Senegal, aber nur dorther, wurden folgende Szenen berichtet: Die Schimpansen brechen junge Zweige von Bäumen, befreien sie von allem Bewuchs und spitzen die Enden mit ihren Zähnen an. Mit den so entstandenen Spießen jagen sie Buschbabys, kleine Feuchtnasenaffen, die sich in Baumhöhlen verstecken. Interessanterweise scheint die Jagd mit Waffen im Senegal Frauensache zu sein. Weit mehr weibliche als männliche Schimpansen führen die Lanzen.[7] Vielleicht haben unsere Vorfahren so ähnlich gejagt.
Und doch haben es nur Menschen so weit gebracht, Gene zu entschlüsseln, Symphonien zu komponieren und ihre Zeit in Videokonferenzen zu verbringen. Warum beherrschen heute wir die Erde, nicht ein anderer Vertreter der Menschenaffen oder die Krähen? Was also ist das Eigentümliche am menschlichen Geist?
Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir noch einmal zurück an die Anfänge gehen. Die Industrie von Lomekwi nährt einen Verdacht: Vielleicht erfordert es mehr als schöpferische Intelligenz, um aus seinen Einfällen nachhaltig Nutzen zu ziehen. Und vielleicht hat dieses »mehr« unseren Ahnen den entscheidenden Startvorteil verschafft.
Einen Zweig in einen Speer oder auch einen Krummhaken zu verwandeln, ist zwar eine beachtliche geistige Leistung, doch ist die Sache in wenigen Minuten erledigt. Für solch einfache Holzarbeiten benötigt man weder besondere Anleitung noch Übung: Man findet durch Versuch und Irrtum heraus, wie es geht.
Wie viel schwieriger es dagegen ist, aus einem harten Stein eine Klinge zu fertigen, weiß ich aus eigener Erfahrung. Nachdem wir von den Fundstätten bei Lomekwi in das Camp der Forscher zurückgekehrt waren, drückte Sonia Harmand einer Gruppe von Studenten und mir Basaltbrocken in die Hand. Dann bat sie uns, daraus ein paar der angeblich so primitiven ersten Werkzeuge herzustellen. Sie führte uns einmal vor, wie es funktioniert, und ließ uns mit unserer Aufgabe allein. Wir klopften einen ganzen Nachmittag lang. Die Steine spalteten sich, aber nie so, wie sie sollten. Wir versuchten, unsere Werkstücke hochkant zu stellen und quer, überlegten, ob wir mit einer Wurftechnik größere Wucht auf sie ausüben könnten oder ob wir Hammer und Amboss vertauschen sollten. Nichts half. Alles, was uns gelang, waren ein paar jämmerliche Splitter, die nicht einmal als Buttermesser hätten durchgehen können. Selten habe ich so viel Respekt vor den Fähigkeiten meiner Vorfahren empfunden.
Zum Trost ließ Harmand uns am Abend wissen, dass die meisten Menschen wochenlang üben müssen, bis sie die Technik beherrschen. Zwischen 150 und 300 Trainingsstunden quälen sich Studenten der Archäologie, bevor ihnen die Herstellung eines ansehnlichen Werkzeugs gelingt – Hunderte Stunden, in denen sie alle erdenklichen Irrwege gehen, bis sie endlich den nötigen Erfahrungsschatz aufgebaut haben.[8]
Mit solchen Basaltbrocken sei sie in den Zoo gefahren, erzählte Harmand. Dort setzte sie sich ins Affenhaus und zeigte den Tieren, wie man scharfkantige Abschläge erzeugt – so, wie sie es auch uns vorgeführt hatte. Sie demonstrierte den Menschenaffen auch, was man alles mit einem Messer anstellen kann.
Die Schimpansen beobachteten sie höchst interessiert und fingen sofort selbst an, Steine gegeneinanderzuschlagen. Es mangelte ihnen keineswegs an Geschicklichkeit, das war zu erwarten. Selbst die kleinen Kapuzineraffen im Nordosten Brasiliens hämmern so erfolgreich auf allerdings weicheren Steinen herum, dass dabei scharfe Kanten abbrechen.[9] Aber statt damit etwas zu schneiden, lecken diese Äffchen nur an den Trümmern, denn der Gesteinsstaub enthält nahrhafte Mineralien. Viele große Entdeckungen gehen auf eine Wirkung des Zufalls zurück; aber man muss imstande sein, den Wert seiner Früchte zu sehen. So klug sind Kapuzineraffen nicht.
Die Schimpansen dagegen begriffen die Vorteile eines Messers sehr schnell. Sie sprühten geradezu vor Ideen. Als ihre ersten Versuche scheiterten, erprobten sie immer wieder neue Schlagtechniken. Aber es ging den Affen nicht besser als mir: Entweder klopften sie zu schwach oder zu heftig, oder sie hielten ihre Werkstücke nicht im richtigen Winkel, jedenfalls trafen die Basaltsteine nie so aufeinander, dass Bruchstücke mit scharfen Kanten entstanden. Und dann gaben die Tiere auf, verloren ihr Interesse an der Messerfabrikation und wandten sich einer anderen Beschäftigung zu.
Wäre Kreativität bloß eine Frage von Einsicht und Einfallsreichtum, hätten Menschenaffen Messer herstellen können, lange bevor unsere Ahnen es taten. Möglicherweise würden dann sie heute uns in ihren Zoologischen Gärten bestaunen. Aber nur der Mythos behauptet, dass sich Kreativität einzig einem spontanen Geistesblitz verdankt. Selbst wenn es nur darum geht, einen Stein in ein Schneidwerkzeug zu verwandeln:
Schöpferisches Denken verlangt mehr als Ideen. Es setzt Praxis und die Bereitschaft voraus, immer wieder Rückschläge einzustecken und trotz unsicherer Belohnung weiter sein Ziel zu verfolgen.[10] Jeder, der eine komplexe schöpferische Leistung vollbringt, begibt sich für längere Zeit auf unbekanntes Terrain. An zu wenig Selbstkontrolle und langfristiger Planung, nicht an mangelnder Intelligenz, waren die Schimpansen gescheitert. Und daran, wenn wir ehrlich sind, scheitern allzu häufig auch wir.
In einem faszinierenden Experiment filmten Forscher Szenen, wie sie sich vermutlich unter den frühen Menschen vor mehr als drei Millionen Jahren zugetragen haben. Die Versuchspersonen – Zwergschimpansen – kamen unseren fernen Vorfahren so nahe, wie ein Lebewesen heute ihnen überhaupt ähnlich sein kann: Bonobos verfügen über Gehirne, die so groß und so aufgebaut sind, wie es wohl jene der Handwerker waren, die das Geröll am Turkana-See bearbeiteten. Auch in Körperbau und Größe unterscheiden sie sich kaum. Das Genom von Zwergschimpansen gleicht dem menschlichen bis auf einen Anteil von nur 0,3 Prozent.[11]