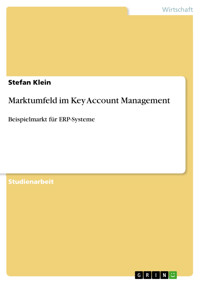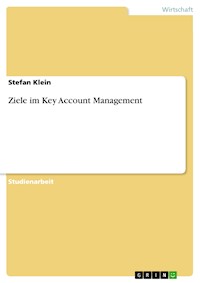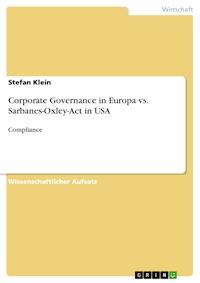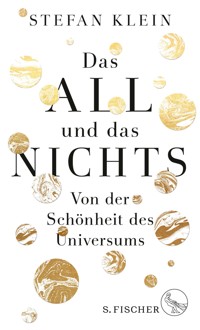
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller-Autor Stefan Klein erzählt in seinem mitreißenden und zugleich poetischen Buch »Das All und das Nichts. Von der Schönheit des Universums« erstaunliche Geschichten über Raum und Zeit. Gibt es das Nichts? Sind Raum und Zeit nur Illusionen? Reicht unser Verstand aus, um das All zu verstehen? Und warum sind wir auf der Welt? Die Physik des 21. Jahrhunderts verändert unsere Sicht auf die Welt und uns selbst. Ausgehend von der Blüte einer Rose spürt er der Schönheit des Unbekannten nach, beim Betrachten des Wetters erklärt er die Unberechenbarkeit der Welt, und mittels einer Kriminalgeschichte führt er uns die wahre Gestalt des Raumes vor Augen. Mit großem literarischem Gespür versetzt uns Stefan Klein ins Staunen und nimmt uns mit auf eine Reise in unsere Wirklichkeit, die ganz anders ist, als sie uns scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dr. Stefan Klein
Das All und das Nichts
Von der Schönheit des Universums
Über dieses Buch
Gibt es das Nichts? Sind Raum und Zeit nur Illusionen? Reicht unser Verstand aus, um das All zu verstehen? Und warum sind wir auf der Welt? Die Physik des 21. Jahrhunderts verändert unsere Sicht auf die Welt und uns selbst. Davon erzählt Bestsellerautor Stefan Klein in seinem mitreißenden und zugleich poetischen Buch. Ausgehend von der Blüte einer Rose spürt er der Schönheit des Unbekannten nach, beim Betrachten des Wetters erklärt er die Unberechenbarkeit der Welt, und mittels einer Kriminalgeschichte führt er uns die wahre Gestalt des Raumes vor Augen. Mit großem literarischem Gespür versetzt uns Stefan Klein in Staunen und nimmt uns mit auf eine Reise in unsere Wirklichkeit, die ganz anders ist, als sie uns scheint.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Stefan Klein, geboren 1965 in München, ist der erfolgreichste Wissenschaftsautor deutscher Sprache. Er studierte Physik und analytische Philosophie in München, Grenoble und Freiburg. Er wandte sich dem Schreiben zu, weil er »die Menschen begeistern wollte für eine Wirklichkeit, die aufregender ist als jeder Krimi«. Sein Buch »Die Glücksformel« (2002) stand über ein Jahr auf allen deutschen Bestsellerlisten und machte den Autor auch international bekannt. In den folgenden Jahren erschienen weitere hoch gelobte Bestseller: »Alles Zufall«, »Zeit«, »Da Vincis Vermächtnis« und »Der Sinn des Gebens«, das Wissenschaftsbuch des Jahres 2011 wurde. Zuletzt erschien »Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit«, ausgezeichnet mit dem Deutschen Lesepreis 2016.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt
Coverabbildung: Shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490337-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
1 Die Poesie der Wirklichkeit
Je mehr wir [...]
2 Eine Murmel im All
… denn alles [...]
3 Ritt auf dem Lichtstrahl
Als ich zehn [...]
4 Der Weltgeist scheitert
Wir telefonieren mit [...]
5 Eine Kriminalgeschichte
Natürlich waren wir [...]
6 Ist die Welt echt?
Sage ich das [...]
7 Wer hat das bestellt?
Ich sehe mir [...]
8 Wie die Zeit vergeht
Es ist nicht [...]
9 Hinter dem Horizont
Warum ist die [...]
10 Warum es uns gibt
Eine Verkettung außergewöhnlicher [...]
Anmerkungen
Dank
Dem Andenken meines Vaters der mir zeigte
1Die Poesie der Wirklichkeit
Eine Rose führt uns vor Augen, dass nichts und niemand für sich alleine steht. Je mehr wir aber über die Beziehungen im Universum erfahren, umso geheimnisvoller erscheint uns die Welt.
Je mehr wir über die Wirklichkeit wissen, umso geheimnisvoller erscheint sie uns. Erstaunlicherweise sind es gerade empfindsame Menschen, die das bestreiten. Ein bekannter deutscher Lyriker hielt mir auf einer Podiumsdiskussion einmal entgegen, die immer genauere Kenntnis der Gene widere ihn an, weil der entschlüsselte Mensch ein Langweiler sei. Und Edgar Allan Poe, der amerikanische Meister der Mysteryliteratur, nannte die Wissenschaft Fressfeindin der Poesie:
»Warum lauerst Du auf das Herz des Dichters,
Geier, dessen Flügel dröge Wirklichkeit sind?«
Was für ein Irrtum! Zu Recht fürchten sich Dichter vor einem entzauberten Dasein. Aber wer diese Angst hat, verwechselt die Erforschung der Welt mit einer Ostereiersuche, bei der irgendwann alle Verstecke ausgeräumt sind. Echte Erkenntnis dagegen wirft regelmäßig mehr Fragen auf, als sie beantworten kann.
Der große amerikanische Physiker Richard Feynman wurde einmal von einem befreundeten Künstler gefragt, ob ein Wissenschaftler nicht die Schönheit einer Rose zerstöre, wenn er sie untersuchte. Feynman antwortete, er empfinde die Schönheit, die der Künstler empfinde, sehr wohl. Aber er sehe auch eine tiefere Schönheit, die sich erst durch das Verstehen erschließe: zum Beispiel darin, dass Blumen in der Evolution Farbe annahmen, um Insekten anzulocken. Dieses Wissen wiederum führe zu neuen Fragen wie der, ob Insekten so etwas wie Ästhetik erlebten. Das genauere Kennenlernen nehme der Blume nichts von ihrer Schönheit – es füge im Gegenteil Schönheit hinzu, lasse die Rose nur noch eindrücklicher, geheimnisvoller dastehen.
Feynman hätte fortfahren können, dass der scharfe Blick des Forschers eine Schönheit selbst in dem offenbare, was uns zunächst hässlich oder gar abstoßend vorkommt. Das Verblühen der Rose ist ein Zeichen eines Niedergangs, doch wer genau hinsieht, bemerkt das Wachsen der Hagebutte im Boden der welkenden Blüte. Jedes der Samenkörner in der Frucht ist ein Wunder für sich. Denn in jedem Nüsschen wartet schon der vollständige Embryo einer Rose auf den Moment, in dem er sich mit Wasser vollsaugen, sich ausdehnen, die Samenhülle sprengen und die Keimblätter der Sonne entgegenstrecken wird.
Um heranzuwachsen, braucht die keimende Rose Licht, Wasser und Sauerstoff. Die Atemluft haben ihr Lebewesen vor sehr langer Zeit hinterlassen. Sie ist ein Erbe von Einzellern, die vor gut drei Milliarden Jahren in dicken, blaugrünen Matten den Meeresboden bedeckten und bis heute dort leben. Damals gab es in der Erdatmosphäre fast keinen Sauerstoff, alles höhere Leben wäre erstickt. Die Einzeller maßen nur ein paar tausendstel Millimeter. Im Vergleich zur Rose erscheinen uns diese Cyanobakterien genannten Geschöpfe überaus primitiv, und doch waren sie schon Meisterwerke der Natur. Manche Cyanobakterien können sogar sehen! Ihr Körper enthält eine winzige Linse, ein einfaches Kameraauge, das sie hell und dunkel unterscheiden lässt. Sie meiden die Dunkelheit und bewegen sich zum Licht. Das Sonnenlicht nutzen sie, um wie heutige Pflanzen durch Photosynthese Energie zu gewinnen. Nachdem die Cyanobakterien den Urozean besiedelt hatten, setzten sie das im Ozeanwasser gelöste Kohlendioxid zu Sauerstoff um. Eine Milliarde Jahre lang perlte der Sauerstoff aus den Meerestiefen nach oben. So schufen die sehenden Cyanobakterien die Luft, die die Rose zum Keimen braucht. Sie machten die Erde für höheres Leben bewohnbar.
Die Cyanobakterien wiederum bildeten sich aus früherem, noch einfacherem Leben, das ebenfalls ohne Sauerstoff auskommen konnte. Diese unbekannten Organismen besiedelten die Erde vor 3,8 Milliarden Jahren. Ohne sie hätten wir nie eine Chance gehabt, eine Rose zu sehen. Woher nun kam dieses Leben? Wir wissen es nicht.
Und woher bekommt die Rose ihr Wasser? Auch das Wasser hat seine Geschichte, und diese reicht noch weiter zurück als die Geschichte der Luft. Lange begnügte man sich mit der Feststellung, dass in der Frühzeit unseres Planeten Dampf aus dem Erdinneren ausgegast sei. Aber wie sollte das Wasser ins Erdinnere gekommen sein? Es hätte dort nur eingeschlossen werden können, als die Erde entstand: Vor 4,5 Milliarden Jahren zogen sich Gesteinsbrocken und Staub, die um die Sonne kreisten, zu den Planeten zusammen; die Erde bildete sich aus Material, das sich in geringem Abstand zur Sonne bewegte. Dass diese Trümmer allerdings feucht genug waren, um aus der Erde den blauen Planeten zu machen, ist so gut wie unmöglich – die Hitze der nahen Sonne muss sie ausgedörrt haben.
Also war die Erde wohl ursprünglich trocken, ein Wüstenplanet. Wie sie sich in eine Welt der Ozeane verwandelte, wissen wir nicht genau. Ausgerechnet das Szenario, das unter allen möglichen Erklärungen am phantastischsten klingt, ist tatsächlich das wahrscheinlichste: Das Wasser kam aus dem Weltraum zu uns. Es reiste mit Kometen oder Asteroiden an, die, geboren in kälteren Teilen des Sonnensystems, wie riesige Schneebälle auf dem Wüstenplaneten Erde einschlugen. So füllten sich die Seen, die Flüsse, die Ozeane mit dem geschmolzenen Eis der Kometen. Es sind Tautropfen aus dem Kosmos, die die Blätter der Rose benetzen.
Das Licht schließlich verdankt die Rose der starken Kraft. Der Name für diese Elementarkraft ist eigentlich zu bescheiden, denn die starke Kraft ist, mit riesigem Abstand, die stärkste in der Natur. Sie hält die Atomkerne zusammen. Im Inneren der Sonne wird sie entfesselt: Dort verschmelzen die Atomkerne von Wasserstoff zu Helium. Dabei wird eine ungeheure Energie frei, die in den Weltraum abstrahlt. Das Brennmaterial Wasserstoff ist die älteste aller Substanzen. Schon seit der ersten Minute nach dem Urknall treibt sich der Wasserstoff im Kosmos herum. Aus ihm wurden in der Glut der Sterne, wiederum durch die starke Kraft, sämtliche Elemente zusammengebacken. Alles, was uns auf der Erde umgibt, war einmal Asche der Sterne. Ihr entstammt auch der Kohlenstoff, aus dem der Keimling besteht. Die Rose ist verwandelter Sternenstaub.
Die Sterne aber, die die Rose hervorbrachten, wurden aus Wasserstoffwolken geboren. Diese Wolken haben sich unter der Wirkung ihrer eigenen Schwerkraft im Weltraum so sehr verdichtet, dass sie irgendwann zündeten: Das erste Sternenlicht schien. Haben die Sterne sich also selbst zur Welt gebracht? Lange Zeit dachte man so. Heute wissen wir: Auch die Sterne brauchten Hilfe von außen. Um sich mittels seiner eigenen Schwerkraft zu Wolken zusammenzuballen, reichte nämlich der Wasserstoff im Universum nicht aus. Sich selbst überlassen, hätte er sich einfach nur gleichmäßig im Weltall verteilt, wie Zucker im Tee. Nie hätten sich die Gase verdichtet, nie auch nur ein einziger Stern am Himmel geschienen. Das Universum wäre gestaltlos geblieben.
Etwas Schweres muss also den Anfang gemacht und den Wasserstoff angezogen haben, so dass dieser Wolken bildete – etwas, das wir nicht kennen. Weil dieses Etwas nicht aufleuchtete und auch sonst unsichtbar blieb, nennt man es »dunkle Materie«. Woraus die dunkle Materie besteht, welche Eigenschaften sie hat, wissen wir nicht.
Richard Feynman, der über die Schönheit der Rose nachdachte, waren viele dieser Zusammenhänge noch unbekannt. Er starb im Jahr 1988 als einer der bedeutendsten Forscher des 20. Jahrhunderts. Doch in den letzten Jahren hat sich unser Wissen über den Aufbau der Welt dramatisch erweitert. Wir sind inzwischen imstande, die Geschichte des Universums zumindest in groben Zügen bis auf die erste Milliardstel Sekunde nach seiner Geburt zurückzuverfolgen. Wir kennen bewohnbare Planeten außerhalb des Sonnensystems, haben in 40 Lichtjahren Entfernung ein System mit sieben erdähnlichen Planeten entdeckt, müssen annehmen, dass sich am Nachthimmel weitaus mehr Planeten verbergen, als Sterne leuchten. Wir wissen um physikalische Vorgänge, die sich unseren Vorstellungen von Raum und Zeit widersetzen.
Dass Erkenntnisse dieser Art überhaupt möglich sein könnten, war vor kurzem noch kühne Spekulation. Heute handelt es sich um Fakten, die durch Messungen bis auf Nachkommastellen belegt sind.
Doch unser Wissen bildet nur eine Insel in einem Ozean der Unkenntnis. Und wann immer es uns gelingt, die Insel zu vergrößern, verlängern wir auch die Küstenlinie, an der wir unserem Unwissen begegnen. So sind, bei allen spektakulären Einsichten, die Fragen nicht weniger und schon gar nicht einfacher geworden. Man wüsste gern, was sich innerhalb der ersten Milliardstel Sekunde nach der Geburt des Universums abgespielt hat. Und ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was noch früher, vor dem Urknall geschah? Existiert tatsächlich Leben auch woanders im All? Sind Raum und Zeit nur Illusionen? Von solchen Fragen handelt dieses Buch. Es beschreibt, wie die Physik des 21. Jahrhunderts unser Denken, unser Weltbild verändert. Seine Lektüre erfordert keinerlei Vorwissen, sondern nur den Mut, hinter den Schleier dessen zu blicken, was uns heute noch als selbstverständlich erscheint. Dann offenbart sich uns eine Welt, die »nicht nur verrückter ist, als wir es uns vorstellen, sondern verrückter, als wir es uns vorstellen können«, wie es der britische Biologe John Haldane ausgedrückt hat. So sind die folgenden Seiten eine Einladung, sich von der Wirklichkeit, in der wir leben, bezaubern zu lassen. Denn eine Rose ist viel mehr als nur eine Rose. Sie ist eine Zeugin der Entstehung der Welt.
2Eine Murmel im All
Die Erde geht über dem Mond auf, und wir sehen das Universum bei seiner Geburt. Hinter dem sichtbaren Weltall verbergen sich viel größere Räume. Die Wirklichkeit ist ganz anders, als sie uns scheint.
… denn alles Wissen und Wundern
ist ein Ausdruck reinster Freude.
Francis Bacon
In einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen trägt mein Vater einen großen Karton ins Haus. Rückwärts schiebt er sich durch die Tür, dann erscheint die Schachtel, schließlich ein Freund meines Vaters, der am anderen Ende mit angefasst hat. »Was ist das?«, fragt meine Mutter. »Ich habe uns einen Fernseher gekauft«, antwortet er. Die Mutter ist wütend, sie will solch ein hässliches Gerät nicht herumstehen haben. Der Vater rechtfertigt sich: »Sie fliegen zum Mond.«
Mein Vater holt eine Säge. Er öffnet die Flügeltüren des dunklen Schrankes im Wohnzimmer, die wir Kinder nicht anfassen dürfen, weil das Möbel alt und wertvoll ist. Außerdem enthält es die Hausbar. Mein Vater stellt die Flaschen heraus und macht sich mit der Säge im Inneren des Schrankes zu schaffen. Er schneidet aus dem kostbaren Schrank Bretter heraus, bis dort Platz genug für den Fernseher ist. Wenn die Türen geschlossen sind, ist er verschwunden.
Die Stimmen der Astronauten kamen also aus dem Schrank. Eingeprägt hat sich mir der metallische Ton, in dem sie, für mich unverständlich, ihre Kommandos schnarrten. Auch erinnere ich mich an zwei Bilder. In der einen Szene huschen zwei Gestalten über den Bildschirm. Sie leuchten geisterhaft weiß, statt eines Gesichts haben sie vor dem Kopf eine Scheibe. Im Grau hinter ihnen hängt eine Fahne. Die Geister tragen enorme Tornister, aber sie tänzeln und springen, als hätten sie gar kein Gewicht. Die Eltern reden etwas von sechsmal geringerer Schwerkraft auf dem Mond; ich möchte das auch ausprobieren. Ich bin vier Jahre alt.
Die andere Szene zeigt eine Murmel, die genau im Zentrum des Bildes, halb beleuchtet, in völliger Dunkelheit schwebt. Auch wenn wir damals einen Schwarzweißfernseher hatten, erinnere ich sie so tiefblau, dass die Intensität ihrer Farbe beinahe schmerzt. Offenbar haben Fotos, die ich später in Illustrierten und Büchern sah, sich mit den Fernsehbildern in meinem Gedächtnis überlagert und diesen Farbe verliehen. Auf dem Blau schimmern weiße Wirbel, und auf der linken Seite der Kugel zeichnet sich ein großer brauner Fleck mit scharfen Umrissen ab. Den gesamten Vordergrund des Bildes aber füllt eine Wüste in eintönigem Ocker. Hügel und Krater ziehen sich bis zum Horizont einer Bergkette hin, über der die Murmel steht. Unmöglich kann man sich vorstellen, dass in dieser ockerfarbenen Ödnis je etwas gelebt hat, je etwas leben wird.
So funkte die Apollo 11 den Erdaufgang über dem Mond in unseren zweihundert Jahre alten Wohnzimmerschrank. Ich weiß nicht mehr, wie ich reagierte, als diese Bilder im Juli 1969 über unsere Mattscheibe flimmerten, doch jedes Mal, wenn ich ihnen seither wieder begegnete, wurden meine Empfindungen stärker. Dies ist also unsere Heimat im Kosmos – eine winzige Kugel, allein in unermesslicher Nacht, zerbrechlich und schön. Bei sehr genauem Hinsehen lässt sich sogar die Lufthülle erkennen, ein hauchdünner Halo, der im Sonnenlicht schimmert: Der einzige uns bekannte Wohnort des Lebens, der einzige Ort, an dem wir uns aufhalten können.
Dabei ist auf der blauen Kugel nichts Menschliches zu erkennen, erinnert nichts an die Dinge, die uns vertraut sind. Der Blick vom Mond zeigt unseren Lebensraum so, wie wir ihn normalerweise nie wahrnehmen, von außen. Und doch spüren wir sofort: Hier geht es um uns. Gerade die fremde Sicht verleiht den Bildern vom Erdaufgang ihre Kraft. Wer sie einmal gesehen hat, kann das eigene Dasein nie mehr für eine Selbstverständlichkeit halten. Solange wir uns in das tägliche Einerlei verstrickt fühlen, mag uns das Leben banal erscheinen. Aber kann es etwas Erstaunlicheres geben als dieses Leben, wenn man erkennt, dass wir weit und breit ohne Gesellschaft sind, einsame Passagiere auf einem Staubkorn in der Kälte des Alls? Um zu einer tieferen Einsicht der eigenen Situation zu gelangen, muss man die gewohnte Perspektive verlassen.
Die Menschen haben immer wieder erfahren, dass die Wirklichkeit ganz anders ist, als sie uns erscheint. Die Erde ist weder flach, noch wird sie von der Sonne umkreist. Der Mond ist kein Himmelslicht, sondern ein Spiegel, der die Strahlen der Sonne zurückwirft. Die Wolken, die man im Teleskop zwischen den Sternen sieht, sind keine Nebel, sondern Galaxien wie die unsere. Die Tiere und Menschen betraten nicht in ihrer heutigen Gestalt den Planeten, sie entwickelten sich im langen Lauf der Evolution. Jede dieser Erkenntnisse war einmal ungeheuerlich. Sie widersprachen allem, was man sich ausmalen konnte und wollte. Heute kommen uns diese Ungeheuerlichkeiten selbstverständlich vor. Auf ihnen beruht unser heutiges Weltbild.
Ich fand diese Suche nach einer neuen, umfassenderen Sicht auf die Wirklichkeit selten so einprägsam dargestellt wie in einem rätselhaften Holzstich, der im Jahr 1888 in einem Werk des französischen Astronomen Camille Flammarion erschien. Das Bild, dessen Ursprung wir nicht kennen, wird gewöhnlich »Wanderer am Weltenrand« genannt. Es zeigt einen Reisenden, der seine vertraute Umgebung hinter sich lässt, um einen Kosmos von seltsamer Schönheit zu bestaunen. Im Rücken des Mannes sehen wir die Welt so, wie wir sie kennen, so, wie wir sie gewohnt sind: Auf sanften Hügeln wachsen Büsche und Bäume, im Hintergrund schmiegt sich ein Dorf an einen See, der von der untergehenden Sonne beschienen wird. Im Vordergrund ist es schon Abend, am Himmel funkeln die Sterne. Und genau diesen Sternenhimmel, der sich bis zur Erde hinabzieht, hat der Reisende mit seinem Oberkörper durchbrochen. Sein Kopf steckt schon in einer anderen Welt, einer Welt jenseits der bekannten Erscheinungen. Dort funkeln phantastische Wirbel, Wolken, Feuerräder, Strahlen, Lichter; der Mann streckt eine Hand nach den wundersamen Phänomenen aus, die ihm begegnen. Aber hat der Wanderer die Welt, die ihm vertraut ist, wirklich verlassen? Ein üppig dekorierter Rahmen hält beide Teile des Bildes zusammen, und vielleicht nicht zufällig erinnern die Wirbellinien hinter dem Firmament an die Linien elektromagnetischer Felder. Zwei Jahrzehnte bevor der »Wanderer am Weltenrand« veröffentlicht wurde, hatten Physiker diese unsichtbaren Kraftlinien entdeckt.
Mit verwunderten Augen blickt der Wanderer in eine andere Dimension unseres Daseins. Er betrachtet die Phänomene hinter den gewohnten Erscheinungen – aber keine fremde, sondern unsere alltägliche Welt. Das verbindet ihn mit uns, wenn wir die blaue Erde über dem Mond aufgehen sehen.
Müsste ich mich für ein Bild der großen Entdeckungen im 21. Jahrhundert entscheiden, so würde ich ebenfalls eines aus dem Weltraum auswählen. Zugegeben, die Himmelskarte, die uns die europäische Raumsonde Planck gesendet hat und die im Jahr 2013 veröffentlicht wurde, ist etwas schwerer zu lesen als die Bilder des Wanderers und der blauen Murmel. Auf den ersten Blick erinnert sie, darin den Wirbellinien des Weltenwanderers ähnlich, an ein abstraktes Gemälde. Man erkennt farbige Punkte, die sich zu einem zusammenhängenden Muster verbinden: Kontinente vielleicht?
Dargestellt ist der ganze von der Erde aus sichtbare Himmel. Dass wir uns in dieser Darstellung erst orientieren müssen, ist kein Wunder, zeigt sie doch ein den meisten Menschen noch unbekanntes Weltbild. Zu sehen ist eine Geburt: die Geburt des Universums. Die Farben stehen für eine Strahlung, die vor mehr als 13 Milliarden Jahren kurz nach dem Urknall freigesetzt wurde – das erste Licht der Welt. Es kommt von überall her, erfüllt den ganzen Kosmos. Im Lauf der Zeit hat sich das Licht in eine Wärmestrahlung verwandelt. Jede Farbe in der Himmelskarte bezeichnet also eine Temperatur: das Nachglühen des Urknalls. Dieses verhindert, dass der Weltraum je völlig auskühlen kann. Selbst in der Leere zwischen den Galaxien herrscht ein letzter Rest Wärme. Auch wenn unsere Augen die Hintergrundstrahlung nicht wahrnehmen, lässt sie sich doch mit einer gewöhnlichen Fernseh-Satellitenschüssel empfangen.
Die Hintergrundstrahlung wurde zufällig entdeckt, als die Physiker Arno Penzias und Robert Wilson 1964 in New Jersey mit einer der ersten Satellitenantennen experimentierten. Dabei bemerkten sie ein Störsignal, das fast gleichmäßig aus allen Richtungen eintraf. Es konnte also nicht aus dem benachbarten New York kommen, war offenbar überhaupt nicht irdischen Ursprungs. Doch ebenso wenig war seine Quelle in der Milchstraße oder in einer anderen Galaxie auszumachen. Penzias, der aus einem jüdischen Elternhaus in München stammte und sechsjährig nur in Begleitung seines Bruders mit einem der Kindertransporte den Nazis entkommen war, erklärte sich die Störung mit einer »weißen dielektrischen Substanz« auf der Antenne, vulgo Vogeldreck. In der Antennenschüssel hatte sich ein Taubenpaar eingenistet. Penzias und Wilson besorgten eine Taubenfalle, luden die überlisteten Tiere in einen Lastwagen und ließen sie 50 Kilometer von der Antenne entfernt frei. Die beiden Tauben kamen zurück. Schließlich wusste sich Penzias nicht mehr anders zu helfen, als die Vögel im Namen der Wissenschaft zu erschießen. Die Antenne wurde gereinigt, das Signal aus dem Nirgendwo blieb. Die Forscher waren ratlos.
Da fiel Penzias die Big Bang Theory ein. Dass das Universum in einem großen Knall entstanden sein sollte, dass dieser Knall sogar eine Strahlung hinterlassen haben könnte, galt damals als eine wüste Spekulation. Sich mit solcher Science-Fiction zu befassen, hieß seine Karriere zu gefährden. Man dachte sich den Kosmos als ewig. Aber die Strahlung, die die Urknall-Theorie voraussagte, entsprach genau dem Signal der Antenne. So erwies sich die vermeintliche Störung durch Taubendreck als triumphaler Beweis der Idee, dass das Universum einen Anfang hatte; Penzias und Wilson bekamen im Jahr 1978 den Nobelpreis.
Der Empfänger, mit dem die beiden Wissenschaftler als erste Menschen die Signale des Urknalls auffingen, ist heute übrigens im Deutschen Museum in München zu bewundern. Penzias schenkte ihn seiner Heimatstadt, die er als Kind verlassen musste, um sein Leben zu retten, aus Anerkennung dafür, dass Deutschland seine Vergangenheit nicht verleugnet, sondern aufgeklärt hat. »Ich will Teil dieser Gemeinschaft sein, die das Wissen um ihre Vergangenheit mit künftigen Generationen teilt«, erklärte er.
Ein halbes Jahrhundert nach seiner Entdeckung durch Penzias und Wilson vermaß die europäische Raumsonde Planck das erste Licht des Kosmos erneut. In alle Richtungen streckte das Weltraumteleskop seine mit flüssigem Helium gekühlten Antennen, um die Temperatur der dort eintreffenden Hintergrundstrahlung bis auf das Millionstel Grad genau zu bestimmen. Aus Tausenden von Einzelaufnahmen puzzelten die Astronomen vieler europäischen Universitäten dann ein Panorama zusammen – die Himmelskarte der Hintergrundstrahlung.
Die Karte auf Seite 29 zeigt den Beginn der Geschichte. Die Erde ist noch lange nicht entstanden, aber die Flecken, die an Kontinente erinnern, verraten bereits, wo sich die Materie verdichtet hat, um Gaswolken, Galaxien, Sterne und später Planeten zu bilden. Wie wir auf Ultraschallbildern das Werden eines Menschen im Mutterleib bewundern, den Herzschlag ablesen, verfolgen, wie die Organe wachsen, wir schließlich die Gesichtszüge des ungeborenen Kindes erkennen – so offenbart sich die Entwicklung des Universums in den Aufnahmen der Hintergrundstrahlung.
Ihre Muster enthalten einen geradezu unglaublichen Schatz an Informationen. Wenn man die Strahlung analysiert, gibt sie etwa preis, dass der Weltraum sich seit seiner Entstehung immer mehr ausdehnt.
Einst muss also dieser ganze Kosmos, den wir heute sehen können, in einem winzigen Volumen Platz gefunden haben. Je weiter man in der Zeit zurückgeht, umso kleiner muss er gewesen sein: kleiner als der Mond, kleiner als ein Fußball, kleiner als ein Atom. Irgendwann muss ein Anfang gewesen sein. Den Anfang nennen wir Urknall. Im Urknall entstand ein winziges Universum, das aber schon alles enthielt. Seit diesem Anfang kam nichts mehr hinzu. Das Universum hat sich nur ausgedehnt und verwandelt.
Wir können uns das nicht vorstellen. Aber wir können uns auch das heutige Weltall nicht vorstellen. Seine Dimensionen, die sich ebenfalls aus den Mustern der Hintergrundstrahlung errechnen lassen, liegen jenseits von allem, was der menschliche Verstand zu fassen fähig ist. Die Weiten, in die wir am Nachthimmel blicken, können Ehrfurcht erwecken; doch hinter dem Horizont der fernsten Galaxien verbirgt sich ein mindestens zweihundertfünfzigmmal größerer Kosmos. Und das ist eine überaus vorsichtige Schätzung. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass der Teil des Universums, der sich unseren Blicken entzieht, viele Milliarden Mal größer ist als der Ausschnitt, den wir sehen. Das 9. Kapitel wird mehr davon erzählen.