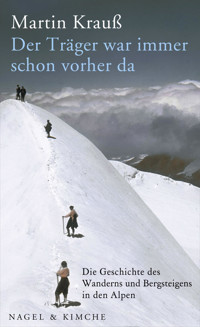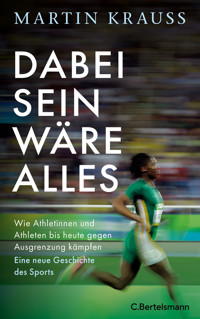
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine neue Geschichte des Sports – aus der Sicht all derjenigen, die bis heute ausgegrenzt werden
Was wir heute Sport nennen, wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einer weißen männlichen Elite erfunden: Gentlemen gründeten Clubs und Ligen, Leistungen wurden in Zentimeter oder Sekunden gemessen. Die Olympischen Spiele feierten das Motto »Dabei sein ist alles« und schlossen doch viele Gruppen aus. Sie mussten in den vergangenen hundert Jahren um ihr Mitmachen hart kämpfen, zum Teil müssen sie es bis heute: Frauen, Schwarze Menschen und andere People of Color, Juden oder Muslime, Menschen mit Behinderung oder Queere. Martin Krauss erzählt die Geschichte des Sports aus ihrer Perspektive: etwa vom ersten afrikanischen Boxweltmeister Battling Siki; von Alfonsina Strada, der einzigen Frau, die jemals den Giro d’Italia mitfuhren durfte; oder vom Kampf der Südafrikanerin Caster Semenya, der intersexuellen Olympiasiegerin, gegen ihre Diskriminierung 2023. Ein ebenso augenöffnendes wie aufrüttelndes Buch, das unser Bild vom Sport nachhaltig verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Was wir heute Sport nennen, wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einer weißen männlichen Elite erfunden: Gentlemen gründeten Clubs und Ligen, Leistungen wurden in Zentimetern oder Sekunden gemessen. Die Olympischen Spiele feierten das Motto »Dabei sein ist alles« und schlossen doch viele Gruppen aus. Sie mussten in den vergangenen hundert Jahren um ihr Mitmachen hart kämpfen, zum Teil müssen sie es bis heute: Frauen, Schwarze und andere People of Color, Juden oder Muslime, Menschen mit Behinderung oder Queere. Martin Krauß erzählt die Geschichte des Sports aus ihrer Perspektive: etwa vom ersten afrikanischen Boxweltmeister Battling Siki; von Alfonsina Strada, der einzigen Frau, die jemals den Giro d’Italia mitfahren durfte; oder vom Kampf der Südafrikanerin Caster Semenya, der intersexuellen Olympiasiegerin, gegen ihre Diskriminierung 2023. Ein ebenso augenöffnendes wie aufrüttelndes Buch, das unser Bild vom Sport nachhaltig verändern wird.
Autor
Martin Krauß, geboren 1964 in Koblenz, war Leistungsschwimmer und Schwimmtrainer. Er studierte Politikwissenschaft in Berlin. Seit 1990 arbeitet er als Journalist, unter anderem bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der taz und der Jüdischen Allgemeinen. Er schreibt Artikel und Bücher über Fußball, Schwimmsport, Boxen und Doping, zuletzt erschien eine Geschichte des Bergsteigens. Martin Krauß lebt in Berlin.
MARTIN KRAUSS
DABEI SEIN WÄRE ALLES
Wie Athletinnen und Athleten bis heute gegen Ausgrenzung kämpfen
Eine neue Geschichte des Sports
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 C.Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © picture alliance / AP Photo / Jae C. Hong
Lektorat: Ludger Ikas
Bildredaktion: Annette Baur
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29268-3V001
www.cbertelsmann.de
INHALT
Vorwort
TEIL A Klasse und Politik
KAPITEL 1 »Ich würde gerne nach Athen gehen«
Warum Carlo Airoldi 1896 nicht zu Olympia durfte. Und was der griechische Kronprinz damit zu tun hat.
KAPITEL 2 Metzger und Brauweiber, aber kaum Adlige
Mit der Französischen Revolution und der Glorious Revolution in England begann die Demokratie – und der Sport. Damals waren Wettkämpfe noch für viele Menschen offen.
KAPITEL 3 1196 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad
Schon im 18. und 19. Jahrhundert gab es sensationelle Leistungen. Sie wurden von den Gentlemen bloß nicht als »Sport« anerkannt. Die frühen Helden sind vergessen.
KAPITEL 4 Ein Rauswurf in ganz großem Stil
Mit dem Amateurstatut wurden Arbeiter von den Wettkämpfen vertrieben. Der moderne Sport sollte nur etwas für Gentlemen sein. Die Regeln haben noch lange nachgewirkt.
KAPITEL 5 Ein neuer Sport entsteht – für eine doch nicht so neue Zeit
Weil sie in bürgerlichen Vereinen nicht erwünscht waren, gründeten Arbeiter eigene Clubs. Nicht nur in Deutschland und der Sowjetunion sollte eine völlig neue Körperkultur entstehen. Ganz verschwunden ist sie bis heute nicht.
KAPITEL 6 Mit der antrainierten Kraft wird Widerstand geleistet
Kuriere, Fluchthelfer, Gefangenenbefreier. Gerade Arbeitersportler standen für die militante Opposition gegen das NS-Regime. Sogar während der Olympischen Spiele 1936 kam es zu Aktionen.
KAPITEL 7 Athleten nehmen sich ihre Rechte
Proteste bei Siegerehrungen, Gründung von Spielergewerkschaften, Organisieren von Streiks. Sportlerinnen und Sportler mischen sich in die Politik ein – für eine bessere Gesellschaft und einen besseren Sport.
TEIL B Race und Herkunft
KAPITEL 1 »Weiße wurden nicht lange genug gekocht«
Wie der senegalesische Profiboxer Battling Siki als erster Afrikaner Weltmeister wurde. Und wie er starb.
KAPITEL 2 Die Vermessung der Sportwelt in Schwarz und Weiß
Der Rassismus kam in den Sport, als die Schwarzen den Weißen zu erfolgreich wurden. Eine Geschichte von anthropologischer Pseudowissenschaft, ersten Stars und unglaublichem Talent.
KAPITEL 3 Bis sich die schweren Knochen endlich in Wasser auflösen
Noch heute gibt es kaum Schwarze Weltklasseschwimmer. Dabei wurde über Jahrhunderte nirgends so gut geschwommen wie in Afrika. Kolonialismus und Sklaverei bereiteten dem ein Ende.
KAPITEL 4 Eine Minderheit mit Weltstars, die lieber nicht darüber sprechen
Sinti und Roma sind im Sport häufiger vertreten, als es bekannt ist. Mit Ressentiments haben vor allem die Athletinnen und Athleten zu kämpfen, die sich zu ihrer Herkunft bekennen.
KAPITEL 5 »Schwarze Perlen« und »heißblütige Südländer«
Rassismus ist Teil des europäischen Fußballs. Dieser Hass findet sich bei Funktionären, Fans, Journalisten und Spielern – und in jeder Liga.
KAPITEL 6 Hoch die Fäuste, runter auf die Knie
Muhammad Ali und Serena Williams, Tommie Smith, Colin Kaepernick und die »Negro Leagues«: US-Sportler setzen Zeichen. Schwarzes Selbstbewusstsein und militante Proteste gehören zusammen.
KAPITEL 7 Dann spielen wir halt gegen uns selbst
»Ausländerklauseln« sorgten in Deutschland lange Zeit für den Ausschluss von Jugendlichen, die aus Zuwandererfamilien stammten. Mit eigenen Teams und sogar in eigenen Ligen kämpften sie für ihr Recht auf Sport.
TEIL C Damen und Frauen
KAPITEL 1 »Nein, nein, ich steige nicht ab«
Warum Alfonsina Strada 1924 beim Giro d’Italia mitfahren durfte. Als einzige Frau bis heute.
KAPITEL 2 Wo Frauen die Besten sind
Im Schwimmen oder im Fechten, im Schießen und auch beim Triathlon: Oft waren – und sind – Sportlerinnen besser als die besten Männer. Meist folgt auf den Erfolg aber der Ausschluss.
KAPITEL 3 Wir hatten unsere eigene Olympiade
Autonome Frauenvereine, -verbände, -ligen und sogar eigene Olympische Spiele, die nur nicht so heißen durften: Unabhängigkeit macht Frauensport stark.
KAPITEL 4 Und unsere eigene Fußball-WM hatten wir früher auch
Ob in Schottland oder Nigeria, in Deutschland oder Chile: Überall auf der Welt kicken Frauen, seit es den Fußballsport gibt. Doch sich von der Männerdominanz zu befreien, war, ist und bleibt eine Herausforderung.
KAPITEL 5 Die ganz Großen
Auch weibliche Sportidole müssen sich mühsam den Respekt erkämpfen, der ihnen zusteht. Wenn sie es aber schaffen, dann haben sie wirklich Geschichte geschrieben.
KAPITEL 6 Der Präsident verteilt Küsse
Sexualisierte Gewalt, demütigende Übergriffe und noch mehr Formen von Sexismus sind im Leistungssport verbreitet. Doch viele Sportlerinnen wehren sich.
KAPITEL 7 Aus den Zwängen hinausradeln, ihnen einfach weglaufen
Gerade der Radsport und das Langstreckenlaufen eröffneten vielen Frauen die Möglichkeit, sich zu emanzipieren. Hier wie da ließen und lassen sich öffentliche Räume am besten erobern.
TEIL D Behindert sein, behindert werden
KAPITEL 1 »Er bewies uns, was ein ganzer Kerl ist«
Wie der einbeinige Otto Margulies das Behindertenklettern erfand. Und doch scheiterte.
KAPITEL 2 Ohne Perfektion in die Weltklasse
Der Parasport hat seine Wurzeln in den Verletzungen und Verstümmelungen der Weltkriege. Diese Tradition konnte er hinter sich lassen und so zum globalen Event werden. Doch Kriegsversehrte gibt es immer noch.
KAPITEL 3 Menschen wie ihr
Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen fordern mit ihren Leistungen die Verbände heraus. Vor allem der olympische Sport sperrt sich gegen ihre Teilhabe. Dabei gibt es Weltklasseathletinnen und -athleten mit körperlicher Beeinträchtigung.
KAPITEL 4 Sehr speziell, kaum gehört
Die Special Olympics und die Deaflympics haben für sich Gründe gefunden, nicht beim paralympischen Sport mitmachen zu wollen. Gleichwohl werden hier beeindruckende Leistungen erbracht.
TEIL E Religion und Hass
KAPITEL 1 »Und nach den Spielen verbietet ein Schild ›Hunden und Juden‹ den Eintritt«
Warum die 17-jährige Schwimmerin Judith Deutsch 1936 ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen absagte. Und was dann passierte.
KAPITEL 2 Alles ist am Kreuz ausgerichtet
Kirchen und die YMCA haben den Sport von Anfang an in hohem Maße geprägt. Bis heute ist der Weltsport christlich ausgerichtet. Wer anders glaubt, wird respektiert, muss sich aber arrangieren.
KAPITEL 3 Auf einmal gelten Menschen als Fremdkörper
Trotz Antisemitismus waren Juden immer dabei, weil der Sport weltoffen ist. Ab der Wende zum 20. Jahrhundert wurden sie jedoch diskriminiert und terrorisiert. Auch nach dem Olympiamassaker 1972 ging die Ausgrenzung weiter.
KAPITEL 4 Sehr normal und doch ein bisschen besonders
Ob als Makkabi, als Hapoel oder ganz radikal als Morgnshtern: Jüdischer Sport hat sich seit über 100 Jahren überall dort besonders stark entwickelt, wo er auf seine eigene Kraft vertraut.
KAPITEL 5 Doch nicht mit Turban oder Kopftuch!
Alle Weltreligionen sind im Sport vertreten, auch der Islam und der Sikhismus. Wenn aber Musliminnen ihren Hidschab oder Sikhs ihren Dastar tragen, gibt es Streit.
TEIL F Queer und Gender
KAPITEL 1 »Mein schwuler Bruder ist ein Outcast«
Wie die Fußballprofis Heinz Bonn und Justin Fashanu in den Tod getrieben wurden.
KAPITEL 2 Manipulierte Quasimänner, die nur betrügen wollen
Mit demütigenden Geschlechtstests und viel falscher Fürsorglichkeit werden intersexuelle Frauen vom Sport ferngehalten. Gerade gute Leistungen sind Grund für Diffamierungen.
KAPITEL 3 Solche Profis müssen sich bis heute verstecken
Nirgends gilt Homosexualität so sehr als Makel wie im Männerfußball. »Schwul« ist dort eine der schlimmsten Beschimpfungen. Doch immer mehr Spieler wagen ein Coming-out.
KAPITEL 4 Wir sind etwas Eigenes, wir brauchen eigene Spiele
In queeren Vereinen findet Sport statt wie überall sonst, die Gay Games sind ein Weltereignis erster Güte, und doch stößt autonomer Sport der LGBTQ+-Community auf große Widerstände.
KAPITEL 5 Diverse Transsportunternehmungen
Manchen Athlet*innen sagt man nach, sie hätten kein klar zuzuordnendes Geschlecht, obwohl die Regeln dies verlangen. Doch auch trans Sportler*innen kämpfen um ihr Recht auf Teilhabe.
KAPITEL 6 Zwei, die ihren Sport revolutioniert haben
Wie Billie Jean King und Martina Navratilova das Frauentennis neu erfunden haben: als ernst zu nehmenden Sport, als großen Wirtschaftsfaktor und als Politikum.
TEIL G Kolonien und Nationen
KAPITEL 1 »Er hat Hillary über die verwirrenden Pfade geführt«
Warum Tenzing Norgay Sherpa im Himalaja als der wirkliche Erstbesteiger des Mount Everest gilt.
KAPITEL 2 In und aus aller Herren Länder
Aus Europa kam der Sport in die Welt. In den Kolonien sollte er für loyale Untertanen sorgen. Doch er wurde zum Mittel, um sich gegen die europäischen Mächte zu wehren.
KAPITEL 3 Vom Wankdorfstadion über Algerien auf die Färöer
Erst Fußballerfolge verhelfen Staaten zu Unabhängigkeit, internationaler Anerkennung und manchmal sogar zum UNO-Beitritt. Es ist nicht selten der Sport, der uns die Politik erklärt.
KAPITEL 4 Balleroberung
Der Fußballplatz ist noch heute ein guter Ort, um koloniale Mächte zu ärgern. Schließlich haben die den Sport doch mitgebracht. Nur das deutsche Turnen konnte sich in der Fremde nicht durchsetzen.
KAPITEL 5 Ohne das IOC kriegen wir es besser hin
Schon die Asienspiele und die Panarabischen Spiele sollten den Westen schwächen. Doch 1963 forderten Indonesien und die Volksrepublik China das IOC so richtig heraus: mit einer Gegenolympiade.
KAPITEL 6 Rumble in the Jungle und die Hand Gottes
Einige Sportler und Sportlerinnen haben eine enorme politische Wirkung. Sie hat nicht unbedingt mit dem zu tun, was sie sagen, sondern vielmehr damit, wie sie ihren Sport inszenieren.
TEIL H Ein besserer Sport
FAZIT Und jetzt alle zusammen
Der Kampf um Teilhabe prägt den Sport bis heute. Dabei kann dieser nur besser werden, sofern er demokratischer und diverser wird.
DANKSAGUNG
BILDNACHWEIS
ZITATNACHWEIS
REGISTER
VORWORT
Sport gehört zum Leben. Zu meinem auf jeden Fall, aber vermutlich stehe ich damit nicht alleine da. Ich bin Sportjournalist, war früher Leistungssportler und sogar Trainer, auch wenn es keine Erfolge gibt, mit denen ich angeben sollte. Immer noch jogge ich gerne, gehe wandern und bergsteigen, fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt, und wenn ich eine Badestelle sehe, springe ich gerne ins Wasser. Sport hat das Potenzial, das Leben der Menschen zu bereichern oder gar zu verbessern. Das gilt nicht nur, wenn man ihn selbst betreibt, denn auch zuzuschauen, wie andere Sport treiben, ist anregend und schön: Ein Nachmittag im Fußballstadion, am Straßenrand einen Marathon zu beklatschen – ich genieße das sehr. Und doch ist Sport etwas, über das wir uns recht selten tiefere Gedanken machen. Er ist halt immer da, so wie die Wespen auf dem Zwetschgenkuchen oder die Meisterschale in der Vitrine des FC Bayern München.
Aber warum eigentlich? Wenn wir von Sport sprechen, meinen wir das große gesellschaftliche Phänomen, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem in England entstanden ist. Gentlemen gründeten Clubs, sie riefen Meisterschaften und Ligen aus, Leistungen wurden in Zentimetern, Gramm oder Sekunden gemessen und global vergleichbar, Weltrekorde konnten registriert werden. Dass Sport weltumfassend war, bewiesen bald die Olympischen Spiele der Neuzeit, 1896 in Athen erstmals ausgetragen. Die »Jugend der Welt« sollte sich zum sportlichen Wettstreit treffen. Doch wenn man genau hinschaut, war diese Jugend der Welt, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Griechenland pilgerte, eine sehr kleine Gruppe. Frauen und Mädchen etwa durften nicht mitmachen, denn das galt als unschicklich. Arbeiter wurden zumeist ausgeschlossen, mit dem Argument, ihre körperliche Arbeit sei ja tägliches Training, für das sie bezahlt würden – folglich seien sie keine Amateure. Schwarze Menschen und andere People of Color waren nicht zugelassen, denn ihnen wollten die Herren des Sports nicht auf Augenhöhe begegnen. Juden, Muslime, Buddhisten, Sikhs und sonstige Angehörige anderer Weltreligionen waren, wenn überhaupt, nur als Minderheit dabei und wurden, wie etwa die deutsch-jüdischen Olympiasieger Alfred und Gustav Felix Flatow erleben mussten, obendrein massiv angefeindet. Ebenso wenig willkommen waren Vertreter afrikanischer oder asiatischer Länder, wurde diesen doch nachgesagt, sie würden den wahren Geist des Sports bestimmt nicht verstehen. An Menschen mit Behinderung hatten die Herren Olympias gar nicht erst gedacht, denn dass die sich körperlich messen könnten, kam niemandem in den Sinn. Und Queere waren ohnehin verboten, das regelte damals das Strafgesetzbuch.
All diese ausgeschlossenen sozialen Gruppen mussten sich ihre Teilhabe am Sport im Lauf der Zeit erkämpfen, gegen massive Widerstände. Wie aber konnte es überhaupt dazu kommen, dass ein eigentlich für alle offenes System wie Sport so viele Menschen ausschloss und zum Teil auch heute noch ausschließt? Wie kann es sein, dass sich die Organisatoren dieser geschlossenen Veranstaltung dennoch für ihr angeblich weltoffenes Spektakel feiern ließen und lassen? Welche Gruppen mussten und müssen welche Kämpfe führen, um den Sport zu öffnen?
Meine Recherche führte mich nicht nur in Randsportarten und Nischen. Sie fand auch in der Welt des absoluten Spitzensports statt. Namen wie Muhammad Ali, Billie Jean King, Diego Maradona oder Serena Williams begegnen uns da, in Vergessenheit geratene Weltklassesportler wie der Boxer Jack Johnson, der erste Schwarze Schwergewichtsweltmeister der Geschichte. Oder beinahe unbekannte Sportlerinnen wie Alfonsina Strada, die einzige Frau, die jemals an einer großen Männer-Radrundfahrt teilnahm, nämlich am Giro d’Italia 1924, vor genau 100 Jahren. Und wir stoßen auf heutige Sportlerinnen und Sportler: auf Colin Kaepernick etwa, den Footballprofi, der sich bei der amerikanischen Hymne hingekniet hat, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, auf Megan Rapinoe, die frühere Fußballweltmeisterin, die sich mutig in fast jeden politischen Kampf wirft, auf Fußballerinnen aus Afghanistan, die sich des Terrors der Taliban erwehren müssen, und auf viele mehr.
Würde ich die Geschichte des Sports chronologisch erzählen, erschiene sie vermutlich wie eine Erfolgsgeschichte – es wurde immer besser, es gab immer weniger Diskriminierung. Doch das würde verdecken, dass der Sport bis heute so funktioniert, wie er Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hat, nämlich als eine elitäre soziale Veranstaltung, zu der sich bis zum heutigen Tag soziale Gruppen Zutritt erkämpfen müssen. Statt auf eine Chronologie zu setzen, habe ich dieses Buch daher lieber entlang der großen Themenfelder gegliedert, in denen seit vielen Jahren über Ausschluss und Teilhabe, über Diskriminierung und Akzeptanz diskutiert wird: Fragen der Klassen, des Rassismus, der Situation von Frauensport, der Menschen mit Behinderung, Fragen zu Antisemitismus, Islamophobie und anderem, Debatten um Gender Studies und auch um Postkolonialismus.
Die von mir gewählte Gliederung bedeutet für Leserinnen und Leser, dass sie mein Buch nicht unbedingt linear von vorne nach hinten lesen müssen. Wer mag, kann sich irgendeinen der vielen Aspekte herauspicken und dort mit der Lektüre loslegen. Jeder Teil, ja, jedes Kapitel steht, so gesehen, für sich.
Dass ich für das vorliegende Buch eine Vielzahl teils sehr verschiedener Quellen gesichtet, ausgewertet und analysiert habe, wird man mir hoffentlich glauben, auch wenn ich sie in der vorliegenden Buchausgabe nicht ausgewiesen habe. Der Verlag und ich haben gemeinsam beschlossen, Leser und Leserinnen nicht mit Fußnoten abschrecken zu wollen. Dennoch sind Quellen, Anmerkungen, Erläuterungen und Ergänzungen sowie das gesamte Verzeichnis der benutzten Literatur nachlesbar. Sie finden sich auf meiner Website: www.martinkrauss.de/dabeisein-literatur bzw. www.martinkrauss.de/dabeisein-anmerkungen.
Ein paar Hinweise zur Sprache. In diesem Buch wird das Wort »schwarz« dort, wo es nicht um die Farbe, sondern um die soziale Gruppe geht, großgeschrieben, auch als Adjektiv: Schwarze Menschen, Schwarze Clubs, Schwarze Ligen et cetera. Der Grund liegt auf der Hand: Es ist ja nicht die Rede von der Farbe, sondern von sozialen Verhältnissen, in denen bestimmte Menschen bestimmte andere Menschen diskriminieren.
Hasswörter, für deren Kennzeichnung mittlerweile oft die Konstruktionen »N-Wort«, »Z-Wort« oder Ähnliches verwendet werden, finden sich nicht in Sätzen, die ich selbst formuliert habe. Gleichwohl habe ich diese Begriffe in Zitaten und Eigennamen stehen lassen, denn an historischer Authentizität darf nicht gerüttelt werden, auch wenn sie schmerzhaft ist. Ich hoffe, die dafür erforderliche historische Einordnung findet in ausreichendem Maße statt.
Zitate werden in der Regel in der aktuellen Rechtschreibung wiedergegeben, Ausnahmen mache ich nur, wo die originale Rechtschreibung sinnvoll ist. Zitate fremdsprachiger Texte habe ich selbst übersetzt, teils mithilfe von künstlicher Intelligenz.
Meist verwende ich in diesem Buch das generische Maskulinum. Das hat mit besserer Lesbarkeit zu tun, aber nicht nur. Es ist auch durch einen Befund begründet, der durchaus massiv zu kritisieren ist: Sport is a man’s world. Tatsächlich sind Männer und Jungen im sozialen System Sport deutlich überrepräsentiert. In den wenigen Bereichen, in denen es mehr Frauen und Mädchen gibt, wird der generische Spieß konsequenterweise umgedreht: Es wäre ja ziemlich unsinnig, von Rhythmischen Sportgymnasten oder von Synchronschwimmern zu sprechen. Mit Sternchen gegendert wird in diesem Buch gelegentlich auch, und zwar dort, wo es evident sinnvoll ist: wenn von intersexuellen und trans Sportler*innen die Rede ist.
Damit genug der Vorrede. Ich wünsche mir sehr, dass dieses Buch dazu beiträgt, den Sport, den ich liebe, demokratischer, gerechter, offener, diverser und letztlich besser zu machen. Wir können nur gewinnen.
Martin Krauß, Berlin im Februar 2024
TEIL A Klasse und Politik
Aus den zermürbenden Kämpfen um das Notwendigste
Für wenige Stunden
Findet ihr euch zusammen
Um gemeinsam zu kämpfen
Und lernt zu siegen!
aus: Bertolt Brecht, »Sportlied«
KAPITEL 1 »Ich würde gerne nach Athen gehen«
Warum Carlo Airoldi 1896 nicht zu Olympia durfte. Und was der griechische Kronprinz damit zu tun hat.
Den ersten olympischen Marathonlauf 1896 in Athen konnte Carlo Airoldi nicht gewinnen, weil er ihn nicht gewinnen durfte. Der Italiener war zwar einer der besten Langstreckenläufer und -geher seiner Zeit, aber die Veranstalter in Athen hatten ihm die Teilnahme verboten. Er sei Profi.
Der Sport, den Airoldi betrieb, nannte sich Pedestrianismus. Diese Mischung aus Langstreckengehen und -laufen war damals sehr populär. Dass der erste als Wettkampf ausgetragene Marathonlauf der Geschichte für einen professionellen Pedestrianisten attraktiv war, hatte Carlo Airoldi schnell bemerkt. Geboren 1869 als Sohn einer Kleinbauernfamilie in Origlio, einem Dorf in der Lombardei, bestritt er als 22-Jähriger sein erstes Rennen. Daneben trat er auch als Ringer und Gewichtheber bei Dorffesten auf. Je größer seine sportlichen Erfolge wurden, desto mehr konnte er auf seinen Job in einer Schokoladenfabrik verzichten. Als er 1895 das Zwölf-Etappen-Rennen Turin/Mailand–Barcelona gewann, erhielt er eine Prämie, die nach heutigem Wert etwa 100000 Euro entsprochen haben soll.
Um zu den Olympischen Spielen 1896 zu gelangen, war Airoldi sogar zu Fuß von Mailand nach Athen gegangen, gesponsert von der italienischen Zeitung La Bicicletta – 1338 Kilometer in 28 Tagen. Als er Anfang April in der griechischen Hauptstadt eintraf, nahm man ihn wie einen prominenten Spitzensportler in Empfang, freundlich und mit Respekt. Zwei Herren des Organisationskomitees geleiteten ihn sogar zum Kronprinzen Konstantin, dem Präsidenten des Komitees. Der Prinz fragte Airoldi nach seinen Erfolgen und ob er dafür Geld erhalten habe. Airoldi antwortete ehrlich. Daraufhin eröffnete ihm Konstantin, er gelte deshalb als Profi und dürfe nicht an den Spielen teilnehmen.
Vielleicht störte sich Konstantin aber auch an der großen Popularität und dem Selbstbewusstsein Airoldis. Im Jahr zuvor, 1895, hatte dieser etwa den amerikanischen Bisonjäger William Frederick Cody, besser bekannt als Buffalo Bill, herausgefordert. Der war gerade mit seinem Westernzirkus in Italien auf Tournee, und Airoldi schlug ein 500-Kilometer-Rennen vor, er selbst zu Fuß, Buffalo Bill zu Pferde. Der Amerikaner sagte leider ab. Er wollte es nur mit zwei Pferden riskieren.
Es war nicht zuletzt der Popularität der Pedestrianisten zu verdanken, dass es bei diesen ersten Olympischen Spielen der Neuzeit ein Wettrennen vom Dorf Marathon nach Athen gab. Und gerade weil dieser Marathonlauf modernen Sport mit dem antiken Mythos verknüpfte – dem Lauf eines athenischen Soldaten, der eine Siegesmeldung überbrachte und danach tot zusammenbrach –, trug er wesentlich dazu bei, dass sich die Olympischen Spiele der Neuzeit gegen viele konkurrierende Sportveranstaltungen durchsetzen konnten. Der Begründer der Spiele, Baron Pierre de Coubertin, hatte gezögert, einen Lauf, der an den Marathon-Athen-Mythos erinnert, in das olympische Programm zu nehmen. Die Idee stammte von seinem Freund Michel Bréal, einem Pariser Philologen. So ein Lauf von Marathon auf den Athener Hügel Pnyx, hatte Bréal an Coubertin geschrieben, würde den »antiken Charakter unterstreichen«. Weil Coubertin nicht überzeugt war, erhielt der Marathonsieger am Ende keine olympische Medaille, sondern nur einen Pokal, den Bréal persönlich gestiftet hatte.
Lediglich 17 Läufer versammelten sich an jenem sonnigen Nachmittag des 10. April 1896 um 14 Uhr im Dorf Marathon – und nur vier von ihnen kamen nicht aus Griechenland. Nach dem Start vor Hunderten von Zuschauern lief das Feld mehr oder weniger die Küste entlang über ungepflasterte Straßen und Wege. Als Spyridon Louis als Erster ins Stadion einbog, war gerade der Stabhochsprung in vollem Gange, aber er wurde sogleich unterbrochen. Kronprinz Konstantin und König Georg höchstpersönlich stürmten auf Louis zu und begleiteten ihn auf den letzten Metern. Als Königin Olga erfuhr, dass der Sieger Spyridon Louis nur ein einfacher Arbeiter war, soll sie ihm spontan den Schmuck, den sie an ihren Fingern trug, geschenkt haben.
Im Jahr 1873 in der Kleinstadt Marousi nahe Athen geboren, hatte Louis bis dahin als Tagelöhner gearbeitet und mit seinem Vater zusammen täglich Wasserfässer von nahe gelegenen Quellen in die Hauptstadt transportiert. Nach seinem Sieg wurde er reichlich beschenkt: Neben einem Siegerpokal soll er vom König ein Pferd und einen Wagen erhalten haben, damit er die Wasserfässer zukünftig leichter transportieren könne. Zudem bekam er, in heutige Währung und Kaufkraft umgerechnet, etwa 75000 Euro. Dem als Helden geehrten Louis erging es später nicht mehr so gut. 1926 musste er als Fälscher ins Gefängnis, ehe er doch freigesprochen wurde. Einen zweifelhaften Auftritt hatte er 1936, als die Nationalsozialisten ihn als Ehrengast zu ihren Olympischen Spielen nach Berlin einluden. In Nationaltracht überreichte er Adolf Hitler einen Lorbeerkranz aus Olympia. Louis starb 1940 im Alter von 67 Jahren.
Der in Athen ausgebootete Carlo Airoldi durchschaute das nationalistische Kalkül schnell: »Hier wollten sie um jeden Preis, dass der Sieger des Marathon-Athen-Rennens ein Grieche ist.« Nur aus diesem Grund habe man ihn ausgeschlossen, »weil sie befürchteten, ich könnte ein zu starker Konkurrent sein«. Die Tatsache, dass er den ersten olympischen Marathonlauf nicht hatte mitlaufen dürfen, war für Airoldi die Enttäuschung seines Lebens. In der Folge forderte er den Sieger Spyridon Louis immer wieder heraus. Vergeblich. Überall erzählte er, dass er wesentlich schneller gelaufen wäre als der Grieche, der für die 40 Kilometer 2:58:20 Stunden gebraucht hatte. Airoldi blieb weiter aktiv, durchaus mit Erfolg, aber die ganz große Sensation sollte ihm nicht mehr gelingen, weder in Europa noch in Brasilien, wo er eine Zeitlang sein Glück versuchte. 1929 starb er in Mailand.
KAPITEL 2 Metzger und Brauweiber, aber kaum Adlige
Mit der Französischen Revolution und der Glorious Revolution in England begann die Demokratie – und der Sport. Damals waren Wettkämpfe noch für viele Menschen offen.
Ein großartiges Fest war das, was am 28. Juli 1796 auf dem Pariser Marsfeld stattfand, nach dem damaligen Revolutionskalender am 11. Thermidor. An die 300000 Menschen sahen Pferderennen, Laufwettbewerbe und Ringkämpfe. Die Menge soll so begeistert gewesen sein, dass sie das Marsfeld stürmte. Der Sieger des Pferderennens, ein Mann namens Vilate-Carbonel auf Le Veneur, erhielt als Preis ein neues Pferd, und der schnellste Läufer bekam einen Säbel.
Die großen bürgerlichen Revolutionen in England, in Amerika und keineswegs zuletzt in Frankreich hatten auch die ersten Formen von Sport hervorgebracht. Aus den schon im europäischen Mittelalter beliebten Wettläufen, Rauffesten und von Dorf gegen Dorf gespielten Fußballjagden entstanden Wettkämpfe, die im besten demokratischen Sinne für alle – jedenfalls für fast alle – offen waren.
Solche Revolutionsfeste gab es oft, in Paris meist im Stadion auf dem Marsfeld, in etwa an der Stelle, wo heute der Eiffelturm steht. Dabei handelte es sich nicht um ein Stadion, wie wir es heute kennen. Die Laufbahn war etwa 300 Meter lang und führte von der École militaire bis zum Fuße eines Hügels in der Stadionmitte. Für die Pferderennen gab es eine ovale Strecke um den Hügel herum, etwa 1800 Meter lang. Die auf den großen nationalen Sportfesten im Jahr 1798 und 1800 erbrachten Leistungen berechnete der berühmte Astronom Alexis Bouvard. Die Laufstrecke 1798 betrug 251,5 Meter, der Finalsieger Michel Villemereux, ein Unteroffizier, schaffte sie in 32,7 Sekunden. Auch fürs Pferderennen und fürs Wagenrennen wurden Strecke und Zeit berechnet. Doch war die Laufbahn eben? Wurde mit Schuhen gelaufen? Mit welcher Kleidung? Wie wurde gestartet? All das wissen wir nicht. Was wir immerhin wissen, ist, dass bei dem Wettkampf 1798 in jedem der zehn Vorläufe 15 Läufer am Start waren, von denen es jeweils die besten drei ins Finale schafften. Dort konkurrierten also vermutlich 30 Läufer um den Sieg.
Ganz neu waren metrische Messungen zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Im englischen Pferdesport wurden bereits 1721 mithilfe von Stoppuhren Rennzeiten in Sekunden gemessen. Schon ab 1757 wurden in England Zeiten auf eine halbe Sekunde genau registriert. Ähnliches galt für Wettläufe: 1733 wurde bei einem solchen Lauf in England die Zeit in Sekunden gemessen. Diese Wettbewerbe waren im Übrigen offen, heute würde man divers sagen. Unter anderem gibt es Berichte über Wettläufe von Brauweibern, sogenannten Krüppeln und besonders dicken Menschen.
Auch in Frankreich gab es weitere Festivals. Ihr Erfolg lag sowohl am demokratischen Zugang – wer wollte, durfte mitmachen – als auch an der Qualität der Wettkämpfe selbst. 1797 wurde erstmals ein großer Ringerwettkampf ausgetragen: 16 Männer nahmen daran teil. Die Sieger aus den ersten acht Kämpfen traten anschließend gegeneinander an, dann wiederum die vier Sieger und zuletzt die übrig gebliebenen zwei: Am Ende gewann Charles-Pierre Oriot, ein 33-jähriger Metzger aus Paris, der den 34-jährigen Hutmacher Digot bezwingen konnte.
Für Begeisterung sorgten zudem Konzerte, Feuerwerke und auch Heißluftballone, die etwa 1000 Meter hochstiegen und von denen Menschen mit einem Fallschirm absprangen. All das waren recht neue Spektakel: Die erste Ballonfahrt der Gebrüder Montgolfier fand 1783 statt, den ersten Fallschirmsprung aus einem Ballonkorb wagte André-Jacques Garner 1797, und seine Ehefrau Jeanne-Geneviève Labrosse war 1799 die weltweit erste Fallschirmspringerin.
Doch zurück zum eingangs erwähnten großen Fest am 28. Juli 1796. Solche Feste seien einer Revolution nicht würdig, mäkelte der Schriftsteller Marie-Joseph Chénier. Er hoffe, dass am 22. September, dem 1. Vendémiaire, also dem Neujahrstag des Revolutionskalenders, ein würdevolleres Nationalfest stattfinden werde. Chénier verwendete dafür den Begriff der »Olympiade de la République« und erinnerte an das antike Griechenland, das »Geburtsland von Kunst und Freiheit«. Zwei Monate später, am von Chénier vorgeschlagenen 22. September 1796, wurde die Idee tatsächlich realisiert. Das Ergebnis wird von einigen Sporthistorikern als »Republikanische Olympiade« bezeichnet. Ihrer Meinung nach ist dieses spezielle Fest als eine Art Vorläufer der Olympischen Spiele der Neuzeit zu verstehen, die exakt 100 Jahre später, 1896 in Athen, erstmals stattfinden sollten. Für den britischen Historiker Hugh Farey ist die Rede von einer Republikanischen Olympiade jedoch »kurz gesagt, ein moderner Mythos«. Nationale Feste seien damals üblich gewesen, Sport habe da eine gewichtige Rolle gespielt, und auch der Wunsch nach einer Internationalisierung dieser Feste lasse sich feststellen. Aber alle – ohnehin sehr spärlichen – Vorschläge, die Spiele, die mal »Sansculottides«, mal »Franciades« genannt wurden, mit olympischen Symbolen aufzuladen, seien früh gescheitert. Vielmehr hätten neben antiken griechischen Einflüssen auf die Kultur der Französischen Revolution auch Obelisken, ägyptische Pyramiden, chinesische Tempel, christliche Engel und weitere Symbole anderer Kulturen gedient. Zudem habe das nachträglich zum Olympia-Vorläufer ausgerufene Fest am 1. Vendémiaire, das doch vor allem »würdevoller« sein sollte als die wilden Volksfeste im Sommer, nicht annähernd so viel Begeisterung ausgelöst.
Was sich entlang der französischen Revolutionsfeste zeigen lässt, gilt auch für das England nach der Glorious Revolution, dem bürgerlichen Aufstand gegen den königlichen Absolutismus. Und es gilt für die frühen USA nach der amerikanischen Revolution. »Wir sind alle verrückt nach Vergnügen«, schrieb schon 1774 Gouverneur Morris, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Die frühe Sportkultur, die sich in all diesen Ländern mit dem Aufstieg des Bürgertums entwickelte, war pluralistisch und oft klassen- und ständeübergreifend.
Dass am Anfang des Sports alle mitmachen durften, wird besonders klar, wenn man sich die Volksfeste genauer anschaut. Zu den ersten gehören die »Cotswold Games« in der südwestenglischen Grafschaft Gloucestershire, genauer: in Chipping Campden im Distrikt Cotswold. Sie sind ab 1612 nachgewiesen, und ihr Gründer Robert Dover nannte sie »Olimpick Games«. Den Beinamen »Olimpick« soll er gewählt haben, weil dieser sein Fest nicht mit der Kirche in Verbindung brachte, die ansonsten alles dominierte. So konnte ein weltliches Fest begründet werden, das weit über die Dorf- und Kleinstadtgrenzen hinaus strahlen konnte. Hier war für alle etwas dabei: Die Landbevölkerung maß sich in Laufwettbewerben, Springen, Ringewerfen (was man sich wie Diskuswurf vorstellen kann), Hammerwerfen oder in dem bemerkenswerten Sport Schienbeintreten. Bürger und niedere Stände der Stadtbevölkerung traten etwa im Football oder im Ringen an. Und der Landadel wurde zum Pferderennen oder zur Jagd geladen.
Gerade die Tatsache, dass die Cotswold Games ziemlich divers waren, dass sie säkular an zwei Tagen vor Pfingsten ausgetragen wurden und dass an ihnen nicht nur Einheimische teilnehmen durften, machte sie so populär. Bis zu 50000 Zuschauer kamen, darunter viele Frauen. 1652 sollen mehr Besucher gekommen sein, als es Platz gab – Ausschreitungen und Gewalt seien die Folge gewesen. Ab 1660 wurden die Cotswold Games als »Dover’s Meeting« veranstaltet. Und zumindest ab diesem Zeitpunkt gibt es auch Berichte über die aktive Teilnahme von Frauen. Die Cotswold Olimpicks gibt es heute immer noch, und ihr Alleinstellungsmerkmal sind die Weltmeisterschaften im schon erwähnten Schienbeintreten.
Ähnliche Feste entstanden später auch andernorts. Ab 1850 fanden beispielsweise die »Much Wenlock Games« in der gleichnamigen englischen Kleinstadt nahe der Grenze zu Wales statt, die später in »Much Wenlock Olympics« umbenannt wurden. Im Jahr 1860 wurden die »Shropshire Olympian Games« ins Leben gerufen, ein Wettbewerb zwischen fünf Städten. 1862 fand in Liverpool das »Grand Olympic Festival« statt, dem aber bald das Geld ausging. Erfolgreicher waren die »Morpeth Wrestling and Athletic Games«, die es ab 1873 in der englischen Grafschaft Northumberland gab, später in »Morpeth Olympic Games« umbenannt. Sie fanden mit Unterbrechungen bis 1958 statt.
Auch in Deutschland finden sich schon früh solche Volksfeste mit Wettkämpfen. Am berühmtesten ist das Oktoberfest in München, begründet 1810 mit einem großen Pferderennen aus Anlass der Hochzeit von Kronprinz Ludwig mit Therese von Sachsen-Hildburghausen. Das aristokratische Vergnügen am Pferdesport war nur die eine Seite, und sogar dafür soll die Idee von dem Unteroffizier Franz Baumgartner stammen, der ursprünglich als Lohnkutscher arbeitete. Die andere Seite bestand aus einem zweitägigen Volksfest an vier öffentlichen Plätzen der Stadt, bei dem kostenlos Essen ausgegeben wurde und wo es unter anderem Wettbewerbe im Preisschießen gab. Das Oktoberfest stand in einer Reihe mit anderen süddeutschen Volksfesten, die, so eine Oeconomische Encyclopädie aus dem Jahr 1795, »Zusammenkünfte gewisser Menschen aus den boyden Volks-Classen« waren. Schon ab 1819 wurde das Pferderennen in der Regie der Stadtverwaltung ausgetragen. Bald kamen Sacklaufen, Baumsteigen und im Jahr 1820 ein Gasballonflug der »Madame Reichard« hinzu. In späteren Jahren nutzten auch die Turner das Oktoberfest, um »Gymnastische Spiele« vorzuführen. 1883 wurde auf der Theresienwiese schließlich sogar eine 500 Meter lange Radrennbahn errichtet – mit eingebautem Hügel als Hindernis. Sie hatte bis 1898 Bestand.
Was für die französischen Revolutionsfeste, das Oktoberfest und die verschiedenen englischen Spiele gilt – dass ihnen nämlich erst im Nachhinein ein antiker Olympiabezug angedichtet wurde –, gilt etwa auch für die Drehbergfeste bei Wörlitz, die zwischen 1776 und 1799 in Sachsen-Anhalt stattfanden. Gestiftet und initiiert von Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, war es ein patriotisches Fest, bei dem traditionelle Volkswettkämpfe ausgetragen wurden. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts gab es immer mehr Feste, die sich den Beinamen Olympia gaben. Die Antike-Begeisterung hing dabei mit einer Parteinahme für die Griechen in ihrem Befreiungskampf gegen das Osmanische Reich zusammen.
Auch Griechenland selbst hatte schon früh seine »Olympischen Spiele«: Ursprünglich bereits für 1838 geplant, fanden die »Olympien« dann erst 1859 statt, heute als »Zappas-Spiele« bekannt, benannt nach dem Kaufmann Evangelos Zappas, der sie finanzierte. Der Auftakt war ein großer Erfolg: Die Disziplinen waren in antiker Tradition Laufen, Wagenrennen, Diskus- und Speerwerfen, daneben – als Zugeständnis an die Vergnügungen anderer Volksfeste – Klettern an einer schmierigen Stange. Eröffnet wurden die Spiele vom Königspaar vor 30000 Zuschauern, es gab einen Eid und eine Hymne. Einen großen sportlichen Wert sollen die Spiele allerdings nicht gehabt haben – wichtiger war ihre Funktion als Landwirtschafts- und Industriemesse. Die geplante Wiederholung vier Jahre später, 1863, fiel, wie es heißt, politischen Gründen zum Opfer, und als 1870 die Zappas-Spiele zum zweiten Mal stattfanden, rebellierten die Aristokraten gegen die Teilnahme von Arbeitern. Die einfachen Leute verstünden doch die neuen Sportarten gar nicht, hieß es, und die noble Idee des Sports sei gefährdet, wenn da Berufssportler anträten. Die »noble Idee«, die keine Proleten bei sich haben wollte, setzte sich durch: Ab 1875 waren die Zappas-Spiele nur noch für »junge Männer von kulturbeflissenen Klassen« offen, die »höheren sozialen Rängen« entstammten. Arbeiter blieben außen vor. Die letzten Zappas-Spiele wurden 1889 ausgetragen. Die griechische Regierung und Kronprinz Konstantin deklarierten später die 1896 ausgetragenen Olympischen Spiele der Neuzeit als Nachfolger der Zappas-Spiele.
Der mit der »noblen Idee« verbundene Verdrängungsprozess lässt sich auch in Nordamerika zeigen. Die sogenannten niederen Klassen waren dort im frühen Sport noch stark vertreten, anfangs durch Wettkämpfe zwischen Nachbarschaften in den wachsenden Städten wie Brooklyn, Newark oder Jersey City, später auch bei frühen Ballspielen oder bei Pferderennen, auch wenn die Organisation oft bei den Ober- und Mittelschichten lag. Nach dem Bürgerkrieg wurden die »lower classes« zunehmend und immer gezielter von der Teilnahme ausgeschlossen.
Ende des 19. Jahrhunderts hatten offene Spiele des Weltsports, ob mit oder ohne Namenszusatz »Olympia«, keine Zukunft mehr. Nur wenige hatten weiterhin Bestand: die Much Wenlock Games etwa oder die Cotswold Olimpicks. Dafür dominierten nun ab 1896 die »Olympischen Spiele der Neuzeit« unter der Obhut des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Dass diese Spiele sich durchgesetzt hätten, weil ihre Idee oder ihre Organisation so überzeugend gewesen wäre, lässt sich nicht ernsthaft behaupten. Im Gegenteil: Sie waren schlecht organisiert, es kamen kaum ausländische Teilnehmer (und wenn, dann im Wesentlichen nur aus Europa und den USA), Frauen waren nicht zugelassen, und die dort ausgetragenen Sportarten wirkten oft bizarr: Crocket oder Motorbootrennen gehörten in den Anfangsjahren zum Programm. Die Olympischen Spiele setzten sich in Wahrheit vor allem deshalb durch, weil sie für den Sport der Eliten standen. Die sozialen Gruppen jedoch, für die dieses IOC-Olympia nicht gedacht war, kümmerten sich teils schon bald, teils erst wesentlich später um eigene Weltsportfeste: Arbeiterolympiaden, Frauenweltspiele, die zunächst auch Olympiade hießen, eigene Wettkämpfe für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung (Paralympics, Special Olympics), Gay Games zunächst für schwule Sportler, bald für die gesamte LGBTQ+-Community, Makkabiaden und Hapoel-Spiele für jüdischen Sport und vieles mehr. Dass hier großer Sport stattfand, das hatte schon die zum Sport hinführende Geschichte gezeigt.
KAPITEL 3 1196 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad
Schon im 18. und 19. Jahrhundert gab es sensationelle Leistungen. Sie wurden von den Gentlemen bloß nicht als »Sport« anerkannt. Die frühen Helden sind vergessen.
Roger Bannister war’s gar nicht! Dennoch glauben seit 70 Jahren Sportfans und -historiker zu wissen, welcher Mensch als Erster die Meile unter vier Minuten gelaufen ist: Roger Bannister am 6. Mai 1954 auf der Anlage der University of Oxford. Die BBC hatte den Rekordversuch des englischen Mittelstrecklers damals live übertragen, zwei Tempomacher waren verpflichtet worden, und am Ende stand die sensationelle Zeit von 3:59,4 Minuten. Geschichte wurde gemacht, mit Ansage. Doch dieses sichere Wissen ist vermutlich falsch. Es gibt Berichte, wonach ein Mann namens James Parrot diese Marke schon im Jahr 1770 in London unterboten hat. Oder 1777 ein Läufer namens Powell. Oder 1796 ein Läufer namens Weller.
Dieser Mr. Weller war einer von drei Brüdern, die ihr Geld als Profiläufer verdienten. Im Oktober 1796 trat er in Oxford an, um die Vier-Minuten-Marke zu knacken. Das Sporting Magazine berichtete damals, Weller habe sie um zwei Sekunden unterboten, das entspräche einer Zeit von 3:58 Minuten. Der Zweite, Powell, war ein Arbeiter aus Birmingham. Dass er die Meile in vier Minuten laufen könne, war etlichen Wettern hohe Einsätze wert. Überliefert ist, dass er schon bei einem Trainingslauf 4:03 Minuten gelaufen sei; die Zeit seines Wettkampfs 1777 ist hingegen nicht dokumentiert. Und der Dritte, Parrott, war ein Straßenhändler in London. Er lief am 9. Mai 1770 im Londoner Stadtteil Shoreditch, nachdem er vorher gewettet hatte, er könne eine Meile in weniger als viereinhalb Minuten zurücklegen. Laut zeitgenössischen Quellen kam er ziemlich genau nach vier Minuten ins Ziel. Ob nach 3:59 oder 4:01 Minuten, das weiß man nicht.
Mindestens drei mögliche Rekordler vor Bannister also, aber sicher ist das natürlich alles nicht. Wir wissen weder, wie genau die Zeitnahme damals funktionierte, noch, wie eben oder abschüssig die Strecke war. Und ebenso wenig, ob die Meile wirklich so genau ausgemessen wurde, wie es Ende des 19. Jahrhunderts bei Sportwettkämpfen üblich wurde. Zudem kursierten immer wieder schlichte Falschmeldungen wie beispielsweise die, dass der deutsche Spitzenläufer Fritz Käpernick 1881 in England die Meile »einige Secunden unter drei Minuten« gelaufen sei. Immerhin gab es aber Zeitungen, die solche Fantasiemeldungen sofort korrigierten.
Nachweislich war Pedestrianismus in Form professionell durchgeführter Geh- und Laufwettbewerbe in England und in den USA bis in das 19. Jahrhundert sehr beliebt. Das bedeutet auch, dass die Profis, die diesen Sport betrieben, gut trainiert waren und man sich deshalb über gute Leistungen wie die eben erwähnten nicht wundern muss. Der britische Sportwissenschaftler Peter Radford – als Aktiver 1960 in Rom Bronzemedaillengewinner im olympischen 100-Meter-Lauf, Erster wurde Armin Hary– berechnete aufgrund der bei Buchmachern registrierten Daten das Leistungsniveau männlicher britischer Spitzenläufer für die Jahre 1700 bis 2000. Trotz aller denkbaren Ungenauigkeiten und Fehler geht er davon aus, dass 1775 eine Zeit über die Meile um die 4:00,65 Minuten prinzipiell möglich gewesen sei. Die Vorstellung, dass die Vier-Minuten-Grenze schon damals geknackt wurde, ist Radford zufolge also nicht völlig abwegig.
Der entscheidende Punkt, warum wir eher Roger Bannisters Lauf als sporthistorisch wahrnehmen, dürfte jedoch nichts mit den technischen Bedingungen – Zeitmessung, Schuhwerk, Streckenzustand etc. – zu tun haben, sondern damit, dass die Profiläufer von damals den Verwaltern des Sports ab dem 19. Jahrhundert schlicht nicht als Gentlemen galten, die einer noblen Sache wie dem Sport würdig wären.
Laufen als eine der frühesten Profisportarten war nicht nur in England und Amerika sehr populär, sondern auch im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Wie die Historiker Herbert Bauch und Michael Birkmann allerdings schreiben: »In der Sportgeschichtsschreibung wurden die Schnell- und Kunstläufe lange Zeit überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, sondern dem Berufssport und damit der Schaustellerei zugeordnet.« Eine Berühmtheit in seiner Zeit war der Norweger Mensen Ernst, der buchstäblich durch die ganze Welt lief. Paris-Moskau schaffte er 1836 in 14 Tagen, und für Konstantinopel-Kalkutta benötigte er nur 59 Tage. Da lief er einen Schnitt von 142 Kilometern pro Tag. Doch sogar Mensen Ernst geriet nach seinem Tod bald in Vergessenheit.
Erst recht längst vergessen ist, dass auch Frauen im Schnelllauf unterwegs waren: Über Auguste von Lerchenstein, die um die 1820er- und 1830er-Jahre mindestens ein Jahrzehnt lang öffentliche Läufe absolviert hat, weiß man kaum etwas. In einer Zeitung wurde 1828 »einem hohen Adel und verehrungswürdigen Publikum« mitgeteilt, »die berühmte Schnell-Läuferin Auguste Lerchenstein« werde in der Berliner Hasenheide, »in einem geschmackvollen Anzuge, unter Begleitung einer angenehmen Musik, einen Schnell-Lauf von 30000 Fuß, oder 1 1/14 deutsche Meile mit angenehmer Abwechslung im Laufen, in der Zeit von 35 Minuten vollenden«. Lerchenstein war nicht die einzige Berufsläuferin. Läuferinnen wie K. F. Roosen aus Hamm, Johanna Schultz aus Hamburg, Mademoiselle Thielmann aus Amsterdam oder Carolina Pauckert aus Sankt Petersburg sorgten mit ihren öffentlichen Auftritten für Furore. In den USA wurde Madame Anderson berühmt mit ihren Vorführungen. Ebenso die deutsche Einwanderin Bertha von Berg, die 1879 im New Yorker »Gilmore Garden« nach absolvierten 372 Meilen siegte. Erst als dort eine Empore zusammenbrach, musste sie den Lauf abbrechen.
Gehwettkämpfe waren in den USA auch als Sport der oft noch versklavten Schwarzen Bevölkerung verbreitet. In den 1830er-Jahren mussten Sklaven gegeneinander antreten, und der jeweilige Besitzer des Siegers strich dann das Preisgeld ein. Nach dem Verbot der Sklaverei 1865 blieben Schwarze weiterhin als Läufer präsent. Der afroamerikanische Profigeher Frank Hart aus Boston stellte 1880 mit 565 Meilen in sechs Tagen einen Weltrekord auf. Zudem war Laufen ein Sport der amerikanischen Ureinwohner, die oft als sehr gute Läufer galten, vor allem über die langen Strecken. Ein Star war Lewis Bennett, besser bekannt als »Deerfoot«, der 1856 auf einem Jahrmarkt im Bundesstaat New York fünf Meilen in 25 Minuten gelaufen sein soll.
Will man etwas über die Leistungen wissen, die in noch wesentlich länger zurückliegenden Kulturen und Gesellschaften erbracht wurden, bedarf es fast schon archäologischen Freilegens von Schichten, um Vergleiche zu heutigen Sportrekorden ziehen zu können. Etwa 20000 Jahre alte Fußabdrücke im heutigen New South Wales in Australien sollen beispielsweise aufgrund ihrer Schrittlänge darauf hindeuten, dass Läufer damals eine Geschwindigkeit von etwa 37 km/h, ja sogar bis zu 45 km/h erreicht haben könnten. Usain Bolt erreichte 2009 bei seinem 100-Meter-Weltrekord von 9,59 Sekunden eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,5 km/h, in der schnellsten Phase des Laufes etwa 42 km/h.
Zweifel an der Einzigartigkeit heutiger Rekorde gibt es auch in anderen Disziplinen, etwa dem Bogenschießen oder dem Hochsprung. So sollen männliche Tutsi im heutigen Ruanda zu Kolonialzeiten vielfach 2,50 Meter und mehr übersprungen haben. Zur gleichen Zeit und ebenfalls in Ruanda wurde laut Berichten deutscher Kolonialoffiziere ein Speer etwa 250 Meter weit geworfen; der Speer sei 1,28 Meter lang und so dick wie ein Finger gewesen. Sicheres Wissen ist das allerdings leider nicht. Bei diesen frühen Beispielen für Laufen, Springen oder Werfen handelte es sich jedenfalls nicht um Sport, sondern um eine Körperkultur ohne Leistungsvergleich, ohne Vermessung, ohne Champions.
Genauso wenig wissen wir, wie schnell und wie ausdauernd bis zum 19. Jahrhundert geschwommen wurde. Frühe Handelsreisende aus Portugal, Italien und Deutschland, die im 15. Jahrhundert an der Westküste Afrikas ankamen, berichteten von einer hoch entwickelten Badekultur: Schwimmen im Meer und durch wilde Flüsse sei für alle üblich gewesen, ja die Menschen dort galten als beste Schwimmer der Welt. Ob sie besser kraulten als die Wettkampfschwimmer im 20. und 21. Jahrhundert, werden wir nie herausfinden.
Der Radsport wiederum gilt – gerade im Vergleich zum Laufen und Schwimmen – als moderne Sportart, doch nicht einmal hier lässt sich bestimmen, ob heutige Weltklasseleistungen wirklich besser sind als solche, die in früherer Zeit erbracht wurden. Im Jahr 1891 gingen beispielsweise bei dem Wettkampf Paris-Brest-Paris 206 Fahrer an den Start. Das Rennen ging über 1196 Kilometer und bestand nur aus einer Etappe. Der Sieger, der Franzose Charles Terront, fuhr auf einem 20 Kilogramm schweren Rad ohne Gangschaltung. Nach 71 Stunden und 37 Minuten konnte er das Preisgeld von 25000 Francs in Empfang nehmen. Mit welcher radsportlichen Leistung seither ist das zu vergleichen? Lässt sich ernsthaft behaupten, dass Eddy Merckx oder Fausto Coppi bessere oder schlechtere Radsportler waren als Charles Terront?
Früherer Spitzensport steht, was seine Qualität und seine Popularität angeht, heutigem in nichts nach. Und diese Stärke des frühen Sports hat soziale Gründe.
Im Boxen gilt Daniel Mendoza, der 1794/95 Champion of England war, als erster Weltmeister, inoffiziell natürlich. Er war Arbeiter, Kaufmannsgehilfe, Schauspieler – und Jude. Das englische Boxen des 18. Jahrhunderts war eine Veranstaltung von sozialen und ethnischen Außenseitern: Schwarzen, Iren, Juden. Zwischen 1760 und 1820 gab es in Großbritannien mindestens 30 jüdische Boxer, darunter zwei Frauen, die allesamt ihren Lebensunterhalt damit bestritten. Mendoza, der mit seinem Buch The Art of Boxing (1789) das Boxen vom Ruf des Rohen und Brutalen befreien wollte, vermarktete sich auch sehr bewusst als »The Jew Boxer«.
In England boxten auch Männer wie Bill Richmond und Tom Molineaux, die als Pioniere des amerikanischen Boxens gelten, wenngleich die beiden befreiten Sklaven zu ihrer aktiven Zeit in ihrer Heimat kaum bekannt waren. Gerade Molineaux lieferte sich zwischen 1809 und 1815 große Kämpfe in England, bei denen er sich als »Champion of America« vorstellte. Dreimal kämpfte er gegen Tom Cribb, einen weißen Engländer, der trotz aller Rohheit und sozialen Offenheit des frühen Boxens eher als Repräsentant des Establishments galt. 1814 wurde er sogar anlässlich des Wiener Kongresses zu einem Schauboxen eingeladen. Molineaux hingegen tauchte in den Boxannalen sehr lange Zeit überhaupt nicht auf.
Auch Frauen waren im frühen Boxen von Beginn an präsent. Der erste historisch dokumentierte Kampf fand 1728 statt: Elisabeth Wilkinson und Ann Hyfield boxten dabei angeblich sogar um den Titel der »European Championess«. Weder boxende Schwarze Männer noch boxende Frauen stellten seinerzeit also eine Sensation dar.
Der Ausschluss des größten Teils der arbeitenden Bevölkerung aus den Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden Verbänden und Clubs gelang durch das Amateurstatut. Da durfte als Sport plötzlich nur noch gelten, was zweckfreie Liebhaberei war, betrieben von Gentlemen in ihrer Freizeit, ohne jedes ökonomische Interesse.
KAPITEL 4 Ein Rauswurf in ganz großem Stil
Mit dem Amateurstatut wurden Arbeiter von den Wettkämpfen vertrieben. Der moderne Sport sollte nur etwas für Gentlemen sein. Die Regeln haben noch lange nachgewirkt.
Die Regel war eindeutig und wurde auch verstanden: »Mechaniker, Handwerker oder Arbeiter« durften nicht Mitglieder werden. Deswegen stand ja das »Amateur« im Namen. In England war der Amateur Athletic Club (AAC) 1866 der erste Verein, der sich mit dieser Regel von Leuten abgrenzte, die einfach als »Professionals« definiert wurden. Ähnliche Regeln hatten noch andere Verbände, die sich etwa zu dieser Zeit gründeten und ebenfalls den Begriff »Amateur« verwendeten. Die Ruderer, sowohl die der englischen Amateur Rowing Association als auch die des 1883 gegründeten Deutschen Ruderverbands, formulierten die Ausschlusskriterien noch schärfer: »Amateur ist jeder, der das Rudern nur aus Liebhaberei mit eigenen Mitteln betreibt oder betrieben hat und dafür keinerlei Vermögensvorteile in Aussicht hat oder hatte, weder als Arbeiter durch seiner Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient, noch in irgendeiner Weise beim Bootsbau beschäftigt ist.«
Der Sport, der nach ordentlichen Regeln betrieben wurde, war Gentleman-Sport, eine Angelegenheit der hohen Herren, und nicht mehr das anarchische Volksfest, wie es nach der Revolution gefeiert wurde. Sports, das war nichts für Arbeiter, nichts für Frauen, nichts für Angehörige ethnischer oder anderer Minderheiten. »Fairplay«, schreibt der französische Soziologe Pierre Bourdieu, »ist die Spielweise derer, die sich vom Spiel nicht derart hinreißen lassen, zu vergessen, dass es sich um Spiel handelt, die Spielweise derer, die die den späteren Rollen der künftigen Führungskräfte inhärente ›Rollendistanz‹ zu wahren wissen.« Dieses elitäre Selbstverständnis der sportelnden Gentlemen setzte sich seit etwa den 1860er-Jahren zunächst in England durch, doch auch die in Frankreich entstehende, sich auf die Antike berufende olympische Bewegung verschrieb sich dem Amateurgedanken.
Der Amateurismus war der Versuch, sich »den Proleten vom Halse zu halten«, wie der Sozialwissenschaftler Christian Graf von Krockow prägnant formuliert hat. Die Herausbildung eines Amateurethos, das den Profi-Proletariern entgegengesetzt wurde, speiste sich aus der bürgerlichen Verachtung für diejenigen, die um jeden Preis siegen wollten, nicht zuletzt, um ihre materielle Situation zu verbessern. Ein Fußballverein, die Corinthians London, lebte das feine Amateurideal so: Bei Elfmetern gegen sich nahmen sie den Torwart raus – es sollte doch eine Strafe sein. Dem ersten Fußballverein der Welt beispielsweise, dem 1857 gegründeten FC Sheffield, gehörten zunächst 29 Mitglieder an, elf von ihnen waren Fabrikanten. In einem solchen sozialen Milieu gründete sich 1863 die FA, die noch heute mächtige englische Football Association. Die Mittel- und Oberklassen hatten sich den Sport einfach genommen. Und sie wollten, dass sich ihre Regeln und Werte durchsetzten.
Erst etwas später taten sich proletarische Fußballer im industriellen Norden Englands zusammen und drängten auf Teilhabe. Ab 1877 gründeten sich die ersten Arbeiter- und Werksteams. Möglich wurde das auch deshalb, weil durch Streiks Zehnstundentag und freier Samstagnachmittag erkämpft worden waren. 1879 konnte mit Nottingham Forest erstmals ein proletarischer Club ins Halbfinale des FA Cups vordringen. Vier Jahre später, 1883, gewann mit den Blackburn Olympics ein aus Arbeitern bestehender Midlands-Verein den FA Cup: eine Fußballrevolution und zugleich erfolgreicher Klassenkampf. Vier Textilarbeiter, drei Metallarbeiter, ein Angestellter, ein Klempner, ein Wirt und ein Zahnarzthelfer hatten die großbürgerlichen Old Etonians, Absolventen des renommierten Eton College, mit 2:1 bezwungen. Nach dem Triumph der Blackburn Olympics zogen sich die Gentleman-Clubs jedoch aus dem Cup-Wettbewerb zurück. Sie hatten insbesondere Einwände gegen einen Ligabetrieb in Stadien mit großen Zuschauermengen. De facto fürchteten sie die Macht der Masse, wie sie sich auch in den immer erfolgreicher werdenden Aktionen von Gewerkschaften und Labour Party in den 1890er-Jahren zeigen sollte.
Angesichts der anhaltenden Zurückweisung durch die FA gründeten die Arbeitervereine 1884 einen eigenen Verband, die British Football Association, und 1888 sogar eine eigene Liga. Das Experiment währte zwar nicht lange, als Machtdemonstration aber war es erfolgreich. Die Clubs aus dem Norden kehrten gestärkt in den Ligabetrieb der FA zurück.
Ähnliche Kämpfe um Teilhabe wurden auch in Deutschland geführt. Am 4. Mai 1904 beispielsweise taten sich etliche Arbeiterjungen, alle um die 14 Jahre alt, in Gelsenkirchen zusammen, um einen Fußballverein zu gründen: Westfalia Schalke. Der Westdeutsche Spielverband (WSV) weigerte sich, ein solch unseriöses Konstrukt aufzunehmen. Das änderte sich auch nicht, als die Jugendlichen 1909 mit Heinrich Hilgert einen Steiger und Wiegemeister der nahen Zeche Consolidation zum 1. Vorsitzenden benannten. 1912 traten dann die Schalker Kicker, alle mittlerweile volljährig, dem Schalker Turnverein 1877 bei und konnten in der C-Klasse, das war die dritte Liga, in den Spielbetrieb einsteigen. Vollmitglied im WSV wurden die Fußballer jedoch erst 1915, elf Jahre nach der Gründung. So lange hatten die Jungs gegen andere »wilde Vereine«, also aus der Sicht des Fußballverbands illegale Teams, spielen müssen: Urania Gelsenkirchen, Westfalia Bismarck, Germania Ückendorf. Einen Platz zu finden, auf dem trainiert und gespielt werden konnte, war schier unmöglich. Kommunale Plätze gab es kaum, und auf den wenigen verfügbaren durfte man kein Eintrittsgeld nehmen.
Doch Schalke ließ sich nicht aufhalten: Aus den anfänglich 16 Mitgliedern bei Westfalia Schalke wurden bis 1930 über 1100. Aus dem Verein wurde am 5. Januar 1924 der »Fußballklub Schalke 04 e. V.«. Dieser neue Verein professionalisierte sich schnell: 1925 holte Schalke auf WSV-Ebene die ersten Titel und verpflichtete den ersten bezahlten Trainer; schon 1927 kam mit Gustav Wieser ein österreichischer Spitzentrainer. Der Verein baute 1927/28 aus eigener Kraft ein Stadion auf einem Gelände der Zeche Consolidation, die Glückauf-Kampfbahn für 34000 Zuschauer. 1931 sollen einmal sogar 70000 gekommen sein. Von 1927 an gehörte Schalke zu den deutschen Spitzenclubs. Und wie die anderen guten Vereine damals drängte es auf Zulassung des Berufsspielertums.
Auch bürgerlich-liberale Vereine wie Bayern München und Tennis Borussia Berlin wollten einen weltoffenen und auch professionellen Fußball. Oft war in diesen Vereinen eine Tradition liberalen Judentums präsent, das eine Hinwendung zum englischen Fußball attraktiver fand als zu den deutschnationalen Turnern. Noch deutlicher wird diese Weltoffenheit, wenn man einen Blick ins Ausland wirft, etwa nach Österreich, wo es im Wiener Fußball offiziell schon ab 1924 ein Berufsspielertum gab, das auch nach internationalen Kontakten suchte. Einer der besten Vereine des österreichischen Fußballs – und damit Europas – war der SC Hakoah Wien. Ab 1920 spielte der jüdische Verein in der ersten Liga, 1922 wurde er Vizemeister, und die erste Profisaison, 1924/25, konnte Hakoah als österreichischer Meister abschließen. Dass sich Hakoah auch mit den englischen Clubs messen konnte, bewies es 1923: In Wien spielte es vor 40000 Zuschauern 1:1 gegen West Ham United, und das Rückspiel in London konnte Hakoah sensationell 5:0 gewinnen – die allererste Niederlage eines englischen Proficlubs gegen ein Team vom Kontinent überhaupt. Solche Gastspielreisen unternahm Hakoah häufiger, waren sie doch finanziell einträglich. 1924 war Hakoah auch zweimal in Berlin, einmal spielte es 3:3 gegen Tennis Borussia, ein andermal verlor es 3:4 gegen Hertha. Doch schon 1925 verschärfte der DFB seine Amateurregeln, indem er seinen Vereinen verbot, gegen ausländische Profiteams anzutreten.
Die Olympischen Spiele der Neuzeit waren für die Durchsetzung des Amateurismus von enormer Bedeutung. Gleichwohl galt auch hier, dass zwar Sportler unter Hinweis auf Amateurbestimmungen in bestimmten Sportarten ausgeschlossen wurden, dass man zugleich aber woanders Berufssportler akzeptierte: Im Segeln etwa wurden professionelle Crew-Mitglieder geduldet, solange das Boot einen Amateur-Skipper hatte. Beim Fechten waren die bezahlten Fechtmeister auch als Olympioniken zugelassen. Der Hockeyverband wiederum lehnte es ab, Lehrer oder Trainer als Profis zu betrachten, und im Boxen galten Sportler, die schon gegen Profis angetreten waren, vorerst weiterhin als Amateure. In Australien und Neuseeland sah man solche Amateur-gegen-Profi-Wettkämpfe ganz allgemein nicht als Verstoß gegen die Statuten. Dänemark erlaubte es Seglern, Reitern und Schützen, Geldpreise anzunehmen, und verstand das Amateurstatut so, dass »schlechtes Benehmen« bestraft werden müsse.
Einigkeit herrschte bei Fachverbänden, den Nationalen Olympischen Komitees und dem IOC aber darin, dass die Olympischen Spiele nur einer männlichen, möglichst weißen Elite vorbehalten sein sollten. Frauen waren demnach weitgehend ausgeschlossen und nichtweiße Sportler, vor allem Schwarze und Asiaten, mehr oder weniger marginalisiert. Kurzum: Das übergreifende Verständnis von Amateurismus war exklusiv, elitär, sexistisch und rassistisch.
Aufgebrochen wurde es allenfalls dann, wenn einzelne Länder zur Verbesserung ihrer Medaillenchancen mit Sportlern anreisen wollten, die eigentlich als Profis galten oder die als People of Color nicht gern gesehen waren. 1908 gab es Streit um den kanadischen Marathonläufer Tom Longboat, einen Angehörigen der indigenen Onondaga Nation. Die USA warfen Longboat vor, Profi zu sein, doch das kanadische Olympische Komitee hielt die Attacke für politisch motiviert und setzte Longboats Teilnahme durch. Der Athlet, der zu seiner Zeit als einer der besten Langstreckenläufer der Welt galt, gab dann allerdings während des olympischen Rennens auf. Neben dem US-Leichtathleten John Taylor, der Gold in der Sprintstaffel gewann, zählt Longboat zu den ersten Men of Color bei Olympischen Spielen. Wie rassistisch die Debatte um ihn motiviert war, erkennt man auch daran, dass es 1896 und 1904, als die Marathonsieger Spyridon Louis und Tom Hicks sogar Geldpreise für ihre Leistungen erhielten, nicht einmal eine Diskussion um deren Profistatus gab.
Ein anderer indigener Amerikaner stand 1912 nach den Spielen in Stockholm im Mittelpunkt des ersten richtig großen olympischen Skandals: Jim Thorpe. Sein ursprünglicher Name war Wa-tho-Huck, »Leuchtender Pfad«. Thorpe gewann im Zehn- und Fünfkampf, obwohl er mit einigen Sportarten gar nicht vertraut war. So warf er etwa den Speer aus dem Stand, aber er gewann mit Leistungen, die auch in den jeweiligen Einzeldisziplinen für eine Medaille gereicht hätten. Zehn Monate später wurde er jedoch nachträglich disqualifiziert, als sich herausstellte, dass er im Sommer 1911 einmal gegen Bezahlung Baseball gespielt hatte. Der US-Sportverband AAU teilte den schwedischen Olympiaorganisatoren daraufhin mit: »Mr. Thorpe ist ein Indianer von begrenzter Bildung«, daher habe er falsch gehandelt.
In den Fällen Thorpe und Longboat war der Ausschluss vor allem rassistisch begründet, aber der Amateursport konnte durchaus auch auf andere Weise diskriminieren: John Brendan Kelly Sr., genannt Jack, aus Philadelphia, war einer der besten Ruderer seiner Zeit. 1920 wurde er Olympiasieger im Einer und im Zweier, 1924 erneut im Einer. 1929 wurde Kelly Vater einer Tochter namens Grace Patricia, die zunächst als Schauspielerin in Hollywood, später als Fürstin Gracia Patricia von Monaco berühmt werden sollte. Schon 1908 hatte sich die New York Times darüber beschwert, dass amerikanische Ruderer bei Olympia diskriminiert würden, weil sie aus der Arbeiterklasse stammten, auch wenn sie sich an die Amateurregeln hielten. Bei Olympia erhielten sie letztlich die Startberechtigung, doch als Jack Kelly 1920 in England an der berühmten »Henley Royal Regatta« teilnehmen wollte, wurde er abgewiesen – mit Verweis auf die Amateurregeln, denn Kelly war gelernter Maurer, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon Inhaber einer großen Baufirma war. Als er zwei Monate später bei den Olympischen Spielen in Antwerpen gewann und dabei den Henley-Gewinner Jack Beresford hinter sich ließ, soll er anschließend König George I. eine Kappe mit der Aufschrift »Grüße von einem Maurer« geschickt haben.
In den 1920er-Jahren, in denen Jack Kelly vom rudernden Maurer zum Multimillionär aufstieg, veränderte sich vieles. In den meisten europäischen Staaten wurde das allgemeine Wahlrecht eingeführt, Parteien der Arbeiterbewegung erlangten politische Macht, der Achtstundentag wurde erkämpft, und das, was in den Sozialwissenschaften mittlerweile Fordismus genannt wird, setzte sich durch. Für den Sport hieß das: Die Mitgliederzahlen in den Vereinen schnellten genauso in die Höhe wie die Zuschauerzahlen in den entstehenden großen Sportarenen.
Auch die ersten Stars traten in Erscheinung, Idole, die aus dem Sport oder dem populären Stummfilm kamen – oder aus beiden Welten. Der Schwimmer Johnny Weissmuller (USA) beispielsweise, fünffacher Olympiasieger, erster Mensch, der 100 Meter Kraul unter einer Minute bewältigte, wurde später als Tarzan-Darsteller weltberühmt. Die Liste der Sportlerinnen und Sportler, die damals dank Massenmedien weltweite Berühmtheit erlangten, ist lang. Zu ihnen zählen etwa die Schwimmerin Gertrude Ederle (USA), der leichtathletische Sprinter Charley Paddock (USA), die Langstreckenläufer Paavo Nurmi und Ville Ritola (Finnland), der Marathonläufer Abdel Baghinel El Ouafi (Frankreich/Algerien), die Tennisspielerinnen Helen Wills (USA) und Suzanne Lenglen (Frankreich) sowie die Eiskunstläuferin Sonja Henie (Norwegen). Die Liste ließe sich beliebig verlängern, zumal es auch Sportler gab, die zwar nur nationale Bedeutung hatten, in ihrem Land aber sehr wohl als Stars und – auch das ein neues Phänomen – als Sexsymbole gehandelt wurden. In Deutschland galt das etwa für den Boxer Hans Breitensträter.
Nicht wenige dieser Stars gerieten in Konflikt mit den strengen Amateurregeln. Ein besonders prominenter Fall war Paavo Nurmi, der finnische Wunderläufer, der von 1920 bis 1928 neunmal olympisches Gold gewann. Finnische Gönner unterstützten ihn und seinen ähnlich begabten Kollegen Ville Ritola, die »Flying Finns«, finanziell. Als Nurmi 1931 Werbung für ein Medikament machte, wurde er für die Olympischen Spiele 1932 in Los Angeles, wo er den Marathon laufen wollte, gesperrt. Finnland drohte daraufhin mit dem Olympiaboykott, nahm aber dann doch teil – ohne Nurmi.
Ab 1932 in Los Angeles, spätestens aber ab 1936 in Berlin waren die Olympischen Spiele als globales Spektakel für nationalstaatliche Repräsentation interessant geworden. Die Ideologie des Amateurethos und Gentleman-Sports wurde zunehmend anachronistisch. Immerhin aber war die mit diesem Ethos einhergehende Sakralisierung des Sports der Hebel gewesen, mit dessen Hilfe die Olympischen Spiele zum Weltereignis geworden waren. Wie sich die olympische Bewegung entwickeln sollte und ob sie überhaupt eine Zukunft hatte, war in den 1920er-Jahren jedenfalls durchaus umstritten. Schon der Wunsch des IOC, dass Athleten aus Nordafrika, Asien und Osteuropa stärker integriert werden sollten, erforderte eine Lockerung der Ausschlusskriterien. Schließlich basierten die Amateurregeln auf den kulturellen Codes der mitteleuropäischen Oberklasse.
Die Weltverbände der Sportarten legten sich deswegen mit dem IOC an. Die Reiter, Modernen Fünfkämpfer, Schützen und Segler erlaubten ihren Amateuren zwar die Annahme von Preisgeldern, aber zugleich sorgten sie dafür, dass die Hürden für die Teilnahme von Sportlern aus der Arbeiterklasse weiterhin hoch blieben. Britische Fußballer boykottierten die Olympischen Spiele 1924 in Paris, weil aus ihrer Sicht fragwürdige Amateure aus Uruguay teilnahmen, die das Turnier dann frecherweise auch noch souverän gewannen.
Weil sich die Pariser Olympischen Spiele 1924 über drei Monate erstreckten, kritisierten die Olympischen Komitees der Niederlande und Norwegens die »undemokratischen Regeln« des Amateurstatuts, die dafür sorgten, dass viele Sportler dort nicht so lange verweilen konnten. Der Radsportweltverband UCI ging in seinem Clinch mit dem IOC sogar so weit, dass er seine Straßen-WM für Amateure und Profis während der Spiele veranstaltete.
Den offenen Bruch mit dem IOC vollzog die International Lawn Tennis Federation (ILTF) im Jahr 1925. Sie sorgte dafür, dass ab 1928 kein Tennis mehr bei Olympischen Spielen stattfand. Als das IOC die ILTF verbannte, setzte der Verband sein damals schon renommiertes Wimbledon-Turnier bewusst während der Olympischen Spiele an.
Eine weitere Konkurrenz für das IOC, das seinen Spagat zwischen Welt- und Elitensportereignis hinbekommen wollte, kam aus Frankreich. In den 1920er-Jahren gründete sich hier das »International Sports Committee«, unter dessen Dach Amateur- und Profisport vereint waren. Es stellte ein demokratisches Gegenmodell zum IOC dar. Ohne die Verlierermächte des Ersten Weltkriegs, also vor allem ohne Deutschland, das auch bei Olympia fehlen musste, sollte unter Federführung des französischen Staates dem Weltsport eine neue Struktur gegeben werden. Massiv bedroht wurden die Olympischen Spiele des IOC auch von der Féderation Sportive Féminine Internationale (FSFI) und vom internationalen Arbeitersport: Die FSFI veranstaltete Frauenolympiaden. Und die Sozialistische Arbeiter-Sport-Internationale (SASI) organisierte Arbeiterolympiaden.
Zu einem besonders mächtigen Widerpart des IOC wuchs der Weltfußballverband FIFA heran. Hier musste das IOC klein beigeben, denn das olympische Fußballturnier garantierte große Einnahmen: Im Unterschied zu anderen Wettkämpfen war es meist ausverkauft. 1926 hatte die FIFA, entgegen den IOC