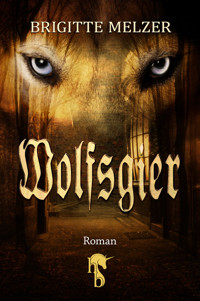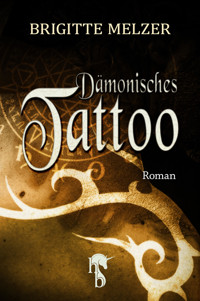
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit seine Frau das Opfer eines Serienkillers wurde, ist FBI-Agent Frank Cassell jedes Mittel recht, den Mann endlich zur Strecke zu bringen. Das findet sein Partner, Chase Ryan, am eigenen Leib heraus, als Frank ihm eine Falle stellt. Unter Drogen gesetzt und mit einer Waffe bedroht, ist Chase gezwungen, an einem indianischen Ritual teilzunehmen, in dessen Verlauf ihm ein Tattoo gestochen wird. Ein Tattoo, das eine Verbindung zwischen Chase und dem Killer schaffen soll: Wenn einer der beiden stirbt, stirbt auch der andere. Mit Hilfe der Journalistin Kate nimmt Chase den Kampf gegen den unberechenbaren Killer auf – und gegen ein immer mächtiger werdendes Tattoo …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brigitte Melzer
Dämonisches Tattoo
Roman
Alexandria – Vorort von Washington D. C.
Es war leicht gewesen, ins Haus zu gelangen.
Wenn man bedachte, wer hier wohnte, war das beinahe eine Enttäuschung. Von einem Mann wie Frank Cassell hatte er mehr erwartet. Doch alles, was Cassell zu bieten hatte, waren eine verriegelte Vorder- und Hintertür und ein paar Bolzen, die die Fenster im Erdgeschoss sicherten. Nichts, was einen entschlossenen Eindringling abhalten konnte – schon gar nicht, wenn das Schlafzimmerfenster im ersten Stock offen stand. Er hatte lediglich über das Geländer auf das Vordach der Veranda klettern und durch das offene Fenster steigen müssen.
Cassell war nicht dumm, aber sichtlich arrogant genug, um sich in Sicherheit zu wähnen. Damit war heute Nacht Schluss. Künftig würde es keinen Ort mehr geben, an dem Cassell sich noch sicher fühlen konnte.
Ein dicker weißer Teppich dämpfte seine Schritte, als er den Raum durchquerte. Lächelnd nahm er den mannshohen Standspiegel hinter der Tür wahr, in dem sich seine Silhouette vor dem Mondlicht abzeichnete. Das war perfekt! Er liebte es, sich bei der Arbeit zu beobachten.
Am Fußende des Bettes angekommen, stellte er seine Tasche auf dem Boden ab und zog seine Latex-Handschuhe zurecht. Die Frau schlief, und wie so oft während der letzten Monate war der Platz neben ihr verlassen. Ihr Mann verbrachte einmal mehr die Nacht im Büro, trank literweise wässrigen Kaffee und studierte Zeugenaussagen, Obduktionsberichte und Fotos der Tatorte und Leichen, nicht ahnend, dass der, nach dem er suchte, in seinem Schlafzimmer stand.
Für einen Moment dachte er daran, auf die Betäubung zu verzichten, doch ihm war bewusst, dass sie aufwachen würde, sobald er mit seiner Arbeit begann. Sie würde schreien, und wenn er etwas nicht ausstehen konnte, dann das. Es störte ihn in seiner Konzentration und ließ ihn nachlässig werden. Er hasste schlampige Arbeit.
Entschlossen bückte er sich nach seiner Sporttasche, zog den Reißverschluss auf und öffnete das Lederetui, das gleich oben lag. Cassells Frau würde ihm gehören, so wie all die anderen davor. Er war es, der über ihr Leben und ihren Tod bestimmte, und sie konnten nichts weiter tun, als ihm dabei die Aufmerksamkeit zu schenken, die ihm gebührte.
Er zog eine Spritze auf und bereitete die chirurgische Nadel und den Faden vor. Die ersten Male hatte er Sekundenkleber benutzt, damit es schneller ging, doch er hatte es gehasst, denn es war nichts anderes als Stümperei. Wie Fast Food für einen Gourmet.
Im Laufe der Zeit war er sicherer geworden und hatte gelernt, sein Werk in vollen Zügen auszukosten.
Nur um den Teppich war es schade.
Prolog
Als Special Agent Chase Ryan in die Jefferson Lane in Alexandria einbog, war der Polizeiapparat bereits voll angelaufen. Streifenwagen der D. C. Metro Police blockierten mit eingeschalteten Blaulichtern die Straße und hinderten die Fernsehteams daran, mit ihren Minivans näher heranzufahren. Das Grundstück und ein Teil des Bürgersteigs waren mit gelbem Absperrband abgeriegelt, dahinter stand ein Notarztwagen in der Garageneinfahrt. Vor dem weißen Jägerzaun parkte das Auto des Gerichtsmediziners und erstickte den Anflug von Hoffnung im Keim, den Chase beim Anblick des Krankenwagens verspürt hatte. Hier gab es für den Notarzt nichts mehr zu tun.
Chase parkte seinen Sebring neben einem der Streifenwagen und stellte den Motor ab. Er lehnte sich im Sitz zurück, schloss die Augen und versuchte sich darauf vorzubereiten, was ihn im Haus erwarten würde. Aber ganz gleich, wie lange er hier sitzen bliebe, eines war klar: Es würde nicht leichter werden. Nichtsdestotrotz – es war ein Tatort wie jeder andere. Er atmete einmal tief durch, zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und stieg aus.
Sein Atem dampfte in der kalten Februarluft. Der eisige Ostwind fuhr unter die Aufschläge seines Sakkos und ließ ihn frösteln, trotzdem machte er sich nicht die Mühe, seinen Mantel von der Rücksitzbank zu nehmen. Der Mantel würde die Kälte nicht vertreiben, die sich beim Anblick des Hauses zunehmend in ihm ausbreitete.
Chase ging an den Streifenwagen vorbei auf das Haus zu. Ein Stück außerhalb der Absperrung hatten sich die Fernsehteams mit ihren Kameras, Mikrofonen und Diktiergeräten um Lieutenant Murphy, den Leiter der Mordkommission, geschart und bombardierten ihn mit Fragen. Die meisten davon kannte Chase in- und auswendig. Reporter platzten nicht gerade vor Erfindungsreichtum, wenn es um Fragen ging.
Was können Sie über den Mord sagen? War es der Schlitzer? Wie lange wird es noch dauern, bis die Polizei dieses Monster endlich erwischt? Alles schon tausendmal gehört und von Lieutenant Murphy ebenso oft beantwortet. Es gab nur eine Frage, die heute herausstach – auch wenn die Reporter das noch nicht wissen konnten: Was können Sie uns über das Opfer sagen? Wer ist es?
Ohne die Antwort des Lieutenants abzuwarten, eilte Chase an den Reportern vorbei. Da die Meute den Zugang zum Gartentor blockierte, schlug er einen Bogen und hielt auf den Seiteneingang bei der Garageneinfahrt zu.
»Agent Ryan.«
Er unterdrückte einen Fluch und gab vor, die Reporterin nicht gehört zu haben, doch sie hatte sich bereits an seine Fersen geheftet. Mit schnellen Schritten, bei denen ihre hohen Absätze auf dem Asphalt klapperten, schloss sie zu ihm auf.
»Agent Ryan«, rief sie noch einmal und klang dabei ein wenig außer Atem, was ihm jedoch nur geringe Befriedigung verschaffte. Die kleine Klette war schneller, als er gedacht hatte, und hielt ihm jetzt ihr Diktiergerät unter die Nase. »Ein Statement, bitte.«
Von allen Reportern, die er kannte, war sie die größte Plage.
Kate Lombardi arbeitete erst seit ein paar Monaten für die Evening Post, trotzdem hatte er sich ihren Namen gemerkt, was nicht allein an ihrer Gewohnheit lag, sich aufreizend zu kleiden. Heute trug sie hohe schwarze Lederstiefel und einen Rock, der nicht nur für diese Jahreszeit zu kurz war. Darüber hatte sie eine taillierte Jacke angezogen, die ebenso wenig wie der Rest ihrer Kleidung dazu geschaffen schien, die Kälte abzuhalten. Lombardi gehörte zu den Frauen, die so etwas tragen konnten. Chase hingegen gehörte nicht zu den Männern, die sich davon beeinflussen ließen. Vermutlich gab es unter seinen Kollegen und bei der Polizei einige, denen sie in diesem Aufzug, gepaart mit ihrem Lächeln und einem verführerischen Augenaufschlag, nicht nur ein Sabbern, sondern auch Informationen entlocken konnte. Chase erinnerte ihr Auftreten jedes Mal daran, dass hinter ihrem Lächeln lediglich Berechnung steckte.
Lombardi war ein Frischling, der vorgab, ein alter Hase zu sein. Das war ihm schnell klar geworden, als sie vor einigen Wochen ein Interview mit ihm geführt hatte. Ihre Fragen waren professionell und präzise, sogar klug und geschickt gewesen, trotzdem war ihm weder das leichte Vibrieren ihrer Stimme entgangen noch die ständige Bewegung ihrer Hände, als wisse sie nicht, was sie damit anstellen sollte. Den meisten wäre das nicht aufgefallen. Chase jedoch, dessen Beruf darin bestand, andere zu beobachten und sich ein umfassendes Bild von ihnen zu machen, war ihre Nervosität nicht verborgen geblieben.
Was sie trotz allem so gefährlich machte, war ihr Talent, die richtigen Fragen zu stellen, und ihr erstaunliches Gespür für den richtigen Augenblick: Sie gehörte jedes Mal zu den ersten Reportern, die am Tatort auftauchten, was ihr regelmäßig die Gelegenheit gab, mit den anwesenden Polizisten zu sprechen, ehe die Meute ihrer Kollegen einfiel.
Für gewöhnlich zog Chase es vor, derjenige zu sein, der ihr Informationen gab, sofern er vor Ort war. So war zumindest sichergestellt, dass sie nicht zu viel erfuhr. Im Augenblick jedoch stand ihm nicht der Sinn danach, sich mit ihr auseinanderzusetzen.
Nicht heute.
Es war der zwölfte Mord in einer außergewöhnlich grausamen Mordserie, die sich nun schon über drei Jahre hinzog, doch dieses Mal hatte der Täter sein Opfer nicht willkürlich ausgewählt. Dieses Mal war es etwas Persönliches.
Chase schob das Diktiergerät zur Seite, das Lombardi noch immer auf ihn gerichtet hielt. Sie lief neben ihm her, bis sie die Absperrung erreichten. Sofort war ein Polizist auf ihrer Höhe.
»Kommen Sie, Ryan«, drängte sie, bevor er sich an den Polizisten wenden konnte. Der Wind zerrte an ihrem schulterlangen Bob und trieb ihr die blonden Locken ins Gesicht. Mit einer unwilligen Geste strich sie sich das Haar zurück. »Lassen Sie mich nicht im Regen stehen. Geben Sie wenigstens einen kurzen Kommentar ab.«
»Sie wissen, dass das gegen die Vorschriften ist.«
»Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, was in ihrer Stadt vor sich geht.«
»Und sie werden es erfahren«, erwiderte Chase. »Von einer Stelle, die offiziell autorisiert ist, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu geben.« Er hielt dem Officer seinen Dienstausweis hin. Ein kurzer Blick, dann nickte der Uniformierte und hob das Absperrband. Chase duckte sich darunter hindurch und betrat das Grundstück. Ehe Lombardi auch nur einen Schritt machen konnte, ließ der Polizist das Band wieder fallen und blieb vor ihr stehen; bereit, sie aufzuhalten, falls sie versuchen sollte, Chase hinter die Absperrung zu folgen.
»Stimmt es, dass das Opfer die Frau eines FBI-Agenten ist?«, rief sie ihm hinterher.
Ihre Worte erwischten ihn kalt. Woher wusste sie davon? Weder an der Tür noch am Briefkasten stand ein Name, ebenso wenig warfen die Suchmaschinen im Internet einen Namen aus, wenn man die Adresse eingab. Es sah ganz so aus, als hätte sie bereits Gelegenheit gehabt, mit einem der Polizisten zu sprechen, oder sie hatte eine Unterhaltung mitgehört.
Chase blieb stehen und drehte sich noch einmal zu ihr um. »Verschwinden Sie oder ich lasse Sie entfernen.« Er gab dem Officer, der immer noch neben ihr stand, ein Zeichen. Als dieser nach ihrem Arm griff, um sie wegzuführen, befreite sie sich mit einem Ruck und ging in Richtung ihrer Kollegen davon. Chase wandte sich ab und hielt auf das Haus zu.
Es war einer jener alten viktorianischen Bauten, wie sie in dieser Gegend überall zu finden waren, gelegen in einer ruhigen Nachbarschaft, in der die Menschen einander grüßten und die Kinder in den Vorgärten und auf den Bürgersteigen spielten. Man kannte sich und half einander. Vermutlich sperrte die Hälfte der Leute nicht einmal ihre Haustür ab. Es war die perfekte Vorstadtidylle, in der niemand um seine Sicherheit fürchtete.
Damit dürfte es jetzt vorbei sein.
Er erreichte den rot gepflasterten Weg, der vom Gartentor zum Haus führte, und ging an zwei Männern der Spurensicherung vorbei, die systematisch den Garten durchkämmten. Überall auf dem Grundstück waren Polizisten und Mitarbeiter der Forensik bei der Arbeit, doch nirgendwo war auch nur ein einziger FBI-Agent zu sehen.
Vor ihm erhob sich das Haus mit seiner weiß getäfelten Fassade in den blassblauen Februarhimmel. Der Wind trieb vereinzelte Wolken vor sich her, deren Schatten über das Dach und die Fassade krochen und die Schnitzereien, die die spitzen Giebel zierten, zum Leben erweckten. Vier Stufen führten auf eine überdachte Veranda, über deren Vordach sich ein pittoreskes Türmchen erhob.
Chase lief die Stufen hinauf auf die offene Haustür zu. Für gewöhnlich kam er erst an den Tatort, wenn die Spurensicherung bereits abgezogen war und er sich frei bewegen konnte. Sein Job verlangte nicht einmal, dass er sich die Tatorte überhaupt ansah, den meisten seiner Kollegen genügten die Berichte und Fotos. Chase fiel es jedoch leichter, sich in einen Täter hineinzuversetzen, wenn er vor Ort gewesen war. Dinge zu sehen, die der Täter gesehen hatte, seine Schritte und Bewegungen nachzuvollziehen, half ihm, in die Haut des Gesuchten zu schlüpfen und sich ein besseres Bild von ihm zu machen.
Seit Detective Munarez ihn angerufen und gebeten hatte, sofort zu kommen, wusste er, was ihn erwartete. Draußen hatte er sich vielleicht noch einreden können, dass es ein Fall wie jeder andere war, auch wenn ihm das Grimmen in seiner Magengrube etwas anderes sagte. In dem Augenblick jedoch, in dem er das Haus betrat, das ihm von seinen Besuchen beinahe so vertraut war wie sein eigenes Apartment, erfasste ihn ein Gefühl der Beklemmung. Die Realität war dabei, ihn einzuholen, und machte jeden Versuch zunichte, sich einzureden, dass er nur hier war, um seinen Job zu machen.
Im Gang stand ein Beamter der Mordkommission und telefonierte. Als er Chase sah, winkte er ihm kurz zu und deutete in Richtung der Treppe. Chase folgte den knarrenden Holzstufen nach oben. Aus dem Obergeschoss waren Stimmen zu hören, die lauter wurden, je näher er kam, immer wieder durchbrochen vom Auslösen einer Kamera und dem Sirren des Blitzes, der sich nach jedem Foto neu auflud. Am Ende der Treppe angekommen, wandte sich Chase nach rechts. Vor dem Schlafzimmer waren Greg Anderson und Anita Munarez, die zuständigen Detectives der Mordkommission, in ein Gespräch vertieft.
»Nirgendwo sonst im Haus sind Spuren zu finden. Er muss also durch das Fenster gekommen sein«, spekulierte Anderson. Er war ein erfahrener Detective, den nur noch wenige Jahre von seiner Pensionierung trennten. Wie sehr ihn dieser Fall beanspruchte, zeigten die tiefen Falten, die sich während der letzten Monate in seine Züge gegraben hatten. Seit drei Jahren leitete er die Suche nach dem, den die Presse den Schlitzer nannte, ohne dass sie ihm auch nur ein Stück näher gekommen wären. Es gab keine Fingerabdrücke, keine Beschreibungen von Zeugen, die mehr als einen dunklen, nicht näher identifizierbaren Schatten gesehen hatten – und die wenigen DNA-Spuren, die sie gefunden hatten, halfen ihnen nicht weiter, da sie keinen Treffer in einer der Datenbanken ergaben. So wie es aussah, war die Person, nach der sie suchten, anderweitig noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Der einzig greifbare Beweis, den der Täter je zurückgelassen hatte, war der Abdruck eines Männerturnschuhs Größe 10. In Anbetracht der Beliebtheit und Verbreitung dieses Schuhs grenzte das den Kreis der Verdächtigen auf zwei bis drei Millionen ein. Großartig.
Anita Munarez’ dunkle Augen sprühten Feuer. Die junge Polizistin war das genaue Gegenteil von ihrem Partner. Groß, kurvig und selbst im Winter so braun gebrannt, als würde sie ihrem mexikanischen Teint im Sonnenstudio auf die Sprünge helfen. Abgesehen davon hatte sie eine Vorliebe für Gossensprache, die sie auch jetzt sofort wieder unter Beweis stellte. »Wenn ich dieses Arschloch in die Finger bekomme, reiße ich ihm die Cojones ab, bevor ich ihm Handschellen anlege!«
Anderson nickte. »Ob mit oder ohne Eier, der gehört endlich aus dem Verkehr gezogen.«
Munarez brummte etwas Unverständliches, das sowohl Zustimmung, wie auch ein mexikanischer Fluch sein konnte, dann entdeckte sie Chase. »Wird auch Zeit.« Sie deutete in Richtung des Schlafzimmers. »Da drin.«
Chase ging an ihr vorbei und trat auf die Schwelle zum Schlafzimmer. Ein beißender Geruch schlug ihm entgegen, eine Mischung aus Blut, Schweiß und Urin. Sein Blick schoss in den Raum. Jemand hatte das Fenster geschlossen, damit der Wind nicht hereinfahren und Spuren verändern oder verwischen konnte – Spuren, von denen Chase wusste, dass der Killer sie ohnehin nicht hinterlassen hatte.
Vom Fenster wanderte sein Blick weiter über den weißen Wandschrank mit den Lamellentüren hinüber zur Kommode und schließlich zum Bett. Die hellen Laken waren zerwühlt, eines der Kissen herausgefallen, doch nichts im Raum deutete darauf hin, dass es einen Kampf gegeben hätte. Das war sein Modus Operandi. Er wartete, bis seine Opfer schliefen, und betäubte sie dann, damit sie keinen Widerstand leisten konnten. Auch wenn es dafür keine Belege in den Berichten des Gerichtsmediziners gab, war Chase davon überzeugt, dass er – nachdem der erste Teil seines scheußlichen Tuns erledigt war – wartete, bis die Frauen zu sich kamen. Sie sollten ihn beobachten, wenn er sein Werk vollendete, so wie er sich auch selbst dabei beobachtete. An jedem der Tatorte waren große Spiegel in der Nähe der Leichen gefunden worden, manche aus anderen Räumen herübergetragen, andere lediglich zurechtgerückt. Dieses narzisstische Schwein! Er fühlte sich vollkommen sicher und schien nicht zu fürchten, von einem heimkehrenden Ehemann überrascht zu werden. Ein deutliches Zeichen dafür, dass er seine Opfer zuvor ausgespäht und deren Gewohnheiten eingehend studiert hatte.
Chase’ Blick glitt über den Standspiegel und richtete sich dann auf das Zentrum des Raums, jenen Ort, den er am wenigsten von allem sehen wollte. Ein Rücken versperrte ihm den Blick auf den Leichnam, sodass er kaum mehr als die Beine des Stuhls sehen konnte, die sich in den dicken, mit Blut vollgesogenen Teppich gruben. Es war Ben Summers, der Tatortfotograf, der ihm die Sicht verstellte, doch kaum hatte er zwei weitere Bilder geschossen, trat er zur Seite, um seine Arbeit aus einem anderen Blickwinkel fortzusetzen. Obwohl Chase gewusst hatte, was ihn erwartete, und er geglaubt hatte, dagegen gewappnet zu sein, traf ihn der Anblick mit voller Härte.
Wie oft war er in diesem Haus zu Gast gewesen? Unzählige Abendessen und Grillpartys, zu denen Frank und Diana ihn eingeladen hatten. Diana, die strahlende rothaarige Schönheit mit einer Haut, die so makellos und hell wie Porzellan war. Diana mit dem herzlichen Wesen, deren Lachen selbst die kältesten Räume mit Wärme erfüllte. Jetzt war dieses Lachen verstummt. Ihr Mund blutig und ausgefranst vom Kampf gegen die dicken blauen Fäden, mit denen ihre Lippen zusammengenäht worden waren. Selbst im Tod hatte sie ihre aufrechte Haltung nicht verloren, auch wenn diese von den Fesseln herrührte, die sie auf dem Stuhl in Position hielten. Ihre Züge waren geprägt von dem Entsetzen und den Qualen, die sie in den letzten Minuten – oder waren es Stunden? – ihres Lebens durchgemacht haben musste. Auch wenn ihr Blick längst gebrochen war, spiegelte sich das Grauen noch immer in ihren aufgerissenen Augen wider. Doch Furcht allein war nicht der Grund für ihre offenen Augen, sondern derselbe blaue Faden, der auch ihre Lippen versiegelte. Ihr Mörder hatte ihr die Lider festgenäht, sodass sie ihren Peiniger hatte ansehen müssen, während der ihr das Leben durch unzählige kleine Schnitte und eine punktierte Halsvene aus dem Leib rinnen ließ.
Chase atmete tief durch, zwang die Luft in seine Lungen und hatte trotzdem das Gefühl, nicht genug davon zu bekommen. Es war dasselbe Bild wie an jedem Tatort, doch ganz gleich, wie oft er es auch zu sehen bekam, es verlor niemals etwas von seinem Schrecken. Besonders nicht heute.
Was er hier sah, war das Ergebnis von Franks Starrsinn. Chase und alle anderen hatten ihm nach dem letzten Mord dringend davon abgeraten, mit einer Erklärung vor die Presse zu treten, die den Täter als kranken Perversen bezeichnete, den seine eigene Dummheit bald zu Fall bringen würde. Frank jedoch hatte sich nicht beirren lassen. Er war sicher gewesen, den Schlitzer mit dieser Aussage dazu zu bewegen, etwas Unüberlegtes zu tun. »Dann haben wir ihn!«, hatte er mit leuchtenden Augen gesagt und kurz darauf die Erklärung verlesen, deren Veröffentlichung ihm von seinem Vorgesetzten untersagt worden war. Er war so besessen davon, diesen Mann endlich zu fassen zu bekommen, dass er sich auch von einem Disziplinarverfahren und einem Eintrag in seiner Personalakte nicht abhalten lassen wollte.
Scheiße, Frank! Warum hast du nicht auf mich gehört?
»Zu viele Fotos dieser Art«, brummte Ben und fuhr sich mit der Hand durch das halblange braune Haar. »Das häuft sich in der letzten Zeit viel zu sehr.«
»Damit will er uns seine Überlegenheit zeigen.«
Ben sah auf. Seine braunen Augen wirkten im Gegenlicht beinahe schwarz, zwei dunkle Tümpel voller Skepsis. »Sie denken, das soll eine Nachricht an die Cops sein?«
»An die Cops und jeden, der bereit ist, sie zu sehen.« Und ganz besonders an den, der ihn herausgefordert hat.
»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.« Er ließ seine Kamera sinken und starrte Chase an, als hätte er einen Geist gesehen. »Sie glauben tatsächlich, dass ich diese Scheiße wieder und wieder fotografieren muss, weil dieser Kerl nicht weiß, wie man einen Notizzettel benutzt?«
»So ähnlich.« Summers’ Fragen und Kommentare glichen sich an jedem Tatort, als versuche der Fotograf herauszufinden, was diesen Mann antrieb. Für ihn schien das ein Ventil zu sein, um mit dem fertigzuwerden, was er mit seiner Kamera festhalten musste. Ben Summers war ein Fotograf, der zu einer kleinen Gruppe von Freiberuflern gehörte, die für die Polizei arbeiteten und täglich an die Tatorte gerufen wurden, um dort die notwendigen Fotos zu schießen. Es mochte ein Weg sein, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, doch es war auch ein immer wiederkehrender Kampf mit Anblicken wie diesem.
»Er zieht eine gewisse Befriedigung aus seinen Taten«, fuhr Chase fort, »was die Spiegel beweisen, aber wichtiger als das ist ihm vermutlich das Spiel mit der Polizei. Die Sorgfalt, die er bei jedem seiner Morde walten lässt, ebenso wie die Zeit, die er sich nimmt, sollen uns zeigen, wie sicher er sich fühlt. Jede Leiche ist gleichzeitig eine Nachricht an uns, die uns sagen soll, dass wir keine Gegner für ihn sind. Er fühlt sich uns überlegen.«
»Wenn ich bedenke, wie oft ich schon die Sauerei fotografieren musste, die er uns hinterlassen hat, ist er das wohl auch.«
»Irgendwann macht er einen Fehler«, mischte sich Doug Edwards ein, der hinter Chase in den Raum gekommen war. »Dann haben wir ihn.« Wie seine Kollegen auch, trug der Gerichtsmediziner einen weißen Schutzanzug.
Chase wandte sich dem Arzt zu. »Die übliche Vorgehensweise?«
Dr. Edwards nickte bedächtig. Er zog die Schutzbrille von den Augen und ließ sie am Gummiband um seinen Hals baumeln, eine Strähne seines vorzeitig ergrauten Haars lugte unter der Kapuze seines Schutzanzugs hervor. »Punktierte Venen an zwei Stellen. Unzählige weitere Schnitte, nicht tief genug, um tödlich zu sein, und zwei Einstiche am Hals – vermutlich wieder einer für das Betäubungsmittel, der andere für das Antigerinnungsmittel.«
Er verletzte niemals lebenswichtige Arterien, sondern hielt sich stattdessen an die danebenliegenden Venen. Das, in Kombination mit dem Gerinnungshemmer, führte binnen weniger Stunden zum Tod, während die kleinen Schnitte, die er mit einem Rasiermesser machte, ihm eher zum Zeitvertreib zu dienen schienen, da sie sich zu schnell wieder schlossen, um tödlich zu sein.
»Wie sieht es aus, Ben?«, erkundigte sich der Mediziner und machte sich daran, seine Ausrüstung in den dazugehörigen Metallkoffer zu packen, bei dessen Anblick sich Chase jedes Mal wunderte, dass ein derart hagerer Mann dieses sperrige Ding überhaupt heben konnte, ohne dass ihn das Gewicht des Koffers von den Beinen riss. »Wann können wir den Leichnam in die Pathologie bringen?«
»Geben Sie mir noch zehn Minuten, Doc.«
Da es für Chase hier weder etwas zu tun noch etwas zu sehen gab, das er länger sehen wollte, kehrte er zu Munarez und Anderson auf den Gang zurück.
»Weiß Frank es schon?«
Anderson schüttelte den Kopf. »Wir wollten es noch ein wenig hinausschieben.«
Zweifelsohne um den Tatort und die Beweise in Ruhe sichern zu können, ungestört von einem trauernden, aufgebrachten Ehemann, der gleichzeitig jemand war, mit dem sie zusammenarbeiteten. Dieses Hinausschieben erklärte auch die Abwesenheit jeglicher FBI-Agenten: In dem Moment, in dem sie das Field Office informierten, würde auch Frank davon erfahren. Dass Munarez Chase angerufen hatte, lag sicher nicht nur daran, dass sein Büro fernab des Field Offices lag. Vermutlich baute sie darauf, dass er ihr die unangenehme Aufgabe abnehmen und Frank informieren würde. Frank war sein Freund. Während ihrer Ausbildung waren sie im selben Jahrgang gewesen, danach Partner im Washington Field Office, bis Chase nach Quantico zur Spezialeinheit für Serienverbrechen gegangen war. Auch wenn ihr Kontakt seitdem nicht mehr so eng war, hatten sie sich von Zeit zu Zeit getroffen, und seit Chase zu diesem Fall hinzugezogen worden war, auch wieder enger zusammengearbeitet. Wäre er an Franks Stelle, er würde sich wünschen, eine derart einschneidende Nachricht nicht von einem nahezu Fremden überbracht zu bekommen.
Er wandte sich wieder dem Schlafzimmer zu. »Wie lange brauchen Sie noch, Dr. Edwards?«
»Sobald der Junge hier die letzten Bilder geschossen hat, können wir sie eintüten.«
»Edwards!«, rief Anderson so scharf, dass der Gerichtsmediziner zusammenzuckte.
In einer beinahe hilflosen Geste hob der Mediziner die Hände. »Entschuldigung, Agent. Es macht den Job leichter, meine Kunden als ein Stück Fleisch zu betrachten. Dabei habe ich wohl aus den Augen verloren, dass Sie sie kannten.«
Chase nickte. »Schon gut. Also noch ein paar Minuten?«
»Zumindest, bis wir die Leiche fortbringen können«, sagte der Doktor. »Die Spurensicherung wird noch einige Stunden beschäftigt sein.«
Die Spurensicherung interessierte Chase nicht. Ihm war nur wichtig, dass Diana nicht mehr hier war, wenn Frank nach Hause kam. »Dann fahre ich jetzt zu ihm und –«
»Detective Anderson!«, rief jemand von unten, ehe Chase seinen Satz vollenden konnte. »Cassell fährt gerade vor.«
Chase schluckte einen Fluch herunter. »Seht zu, dass ihr hier fertig werdet. Ich versuche ihn aufzuhalten.«
Er lief die Treppen nach unten, durchquerte den Flur und rannte aus dem Haus. Auf der Veranda stieß er um ein Haar mit Frank zusammen, der die Stufen heraufhetzte. Schweiß stand ihm auf der Stirn und sein kurzes blondes Haar klebte ihm in feuchten Strähnen am Kopf. Frank machte einen Schritt zur Seite und wollte an ihm vorbei ins Haus, doch Chase verstellte ihm den Weg.
»Geh zur Seite, Ryan!«
Chase schüttelte den Kopf. »Lass uns hierbleiben, ich erkläre dir alles.«
»Erklären!«, fuhr Frank ihn an, bebend vor Zorn und einer Trauer, von der Chase wusste, dass sie in seinem ehemaligen Partner steckte, er sie aber nicht herauslassen konnte – noch nicht. »Was willst du mir erklären, was ich nicht längst aus den Nachrichten wüsste? Warum habt ihr mich nicht angerufen, ihr verdammten Penner! Ihr hättet es mir sagen müssen. Sofort!«
Chase griff nach dem Arm seines Kollegen. Seine Finger bohrten sich in den Stoff des dicken Wollmantels, als er versuchte, Frank von der Tür wegzuführen, in den Garten hinaus, doch Frank streifte seine Hand ab und drängte sich an ihm vorbei.
»Frank, warte! Tu dir das nicht an!« Er eilte hinter dem Agenten her die Treppen hinauf, doch Frank war bereits oben angekommen. Als Chase hinter ihm auf den Gang trat, sah er Frank im Schlafzimmer verschwinden. Anderson und Munarez standen da wie angewurzelt und starrten ihm hinterher. Aus dem Schlafzimmer drang nicht der geringste Laut. Kein Atmen, keine Stimmen, keine Schreie. Selbst das Klicken des Fotoapparats und das Sirren des Blitzes waren verstummt.
Für einen Moment überkam Chase die irrationale Hoffnung, dass es Dr. Edwards gelungen war, Diana in den Leichensack zu legen, bevor Frank in den Raum gestürmt war. Doch er wusste, dass er Frank nicht lange genug aufgehalten hatte. Ein Blick zu den Detectives genügte ihm, um zu erkennen, dass die beiden ihm keine Hilfe sein würden. Sie standen nur da und glotzten.
Chase schob sich an den beiden vorbei und trat in den Türrahmen. Kein Leichensack. Alles war noch so, wie er es bereits gesehen hatte – nur dass jetzt der Ehemann des Opfers mitten im Raum stand, nicht in der Lage, den Blick vom geschundenen Leichnam seiner Frau zu lösen.
»Frank?«
Als er nicht reagierte, kam Chase langsam näher. Franks Schultern bebten. Ohne den Blick von seiner Frau zu nehmen, ballte er die Fäuste.
»Du weißt es seit Stunden und hast mir nichts gesagt.« Seine Stimme war so kalt und leer wie seine Miene. »Was bist du für ein Freund? Macht es dir Spaß, mich zu belügen?« Ehe Chase etwas erwidern konnte, fuhr Frank im selben ausdruckslosen Tonfall fort: »Wie lange ist es her, dass du dieses Scheißprofil erstellt hast? Eineinhalb Jahre? Zwei? Wie kann es sein, dass wir ihn immer noch nicht erwischt haben, wenn wir doch alles über ihn wissen? Wie ist es möglich, dass er – statt auf seine Hinrichtung zu warten – weiter mordet? Dass er meine Frau …« Seine Stimme erstarb in einem Keuchen.
»Du weißt, dass es nicht so einfach ist.« Chase legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Komm, lass uns nach unten gehen, dort können wir in Ruhe über alles sprechen.« Und Dr. Edwards konnte seine Arbeit ungestört zu Ende bringen.
»Worüber willst du mit mir sprechen?«, schnappte Frank und schlug Chase’ Hand zur Seite. »Willst du mir schonend beibringen, was meiner Frau zugestoßen ist? Dafür ist es wohl ein bisschen zu spät.«
»Ich kann verstehen, dass du wütend auf mich bist.«
»Einen Scheiß verstehst du! Deinen Psychomüll kannst du dir sparen, ich bin keiner von diesen Idioten, bei denen du damit landen kannst!«
»Ich weiß, dass du kein Idiot bist, Frank. Aber wir müssen darüber reden – wenn nicht jetzt, dann später –, aber …« Bevor er seinen Satz vollenden konnte, fuhr Frank herum.
»Halt endlich dein verdammtes Maul!«, schrie er und drosch ihm die Faust ins Gesicht. Chase’ Lippe platzte auf. Er taumelte zurück. Als Frank zu einem weiteren Schlag ausholte, waren Munarez und Anderson zur Stelle. Sie packten Frank an den Armen und hielten ihn zurück. Der Agent versuchte sich loszureißen, doch die beiden hatten ihn fest im Griff.
»Deinetwegen ist sie tot!« Frank wand sich unter dem eisernen Griff der Detectives. »Dein verdammtes Profil taugt nichts, sonst hätten sie ihn längst erwischt, und jetzt hat Diana …« Einmal mehr brach seine Stimme und plötzlich erschlaffte er, sackte in sich zusammen, als wäre mit einem Schlag alles Leben aus ihm gewichen. Der Hass, der seine Augen einen Moment zuvor noch zum Glühen gebracht hatte, war verschwunden und hatte nichts als Leere hinterlassen.
Schnell griffen Munarez und Anderson fester zu, damit er ihnen nicht entglitt.
»Mierda!«, fluchte Munarez. »Was machen wir jetzt mit ihm?«
Anita Munarez mochte ein guter Detective sein, sie hatte eine ausgezeichnete Kombinationsgabe und ein gutes Händchen im Verhör. Sobald sich ein Problem jedoch nicht mit dem Anlegen von Handschellen oder dem Verlesen der Rechte aus dem Weg räumen ließ, sondern ein einfühlsames Vorgehen erforderte, war sie aufgeschmissen.
»Bringen Sie ihn nach unten«, sagte Chase. »Der Notarzt ist immer noch da. Er soll ihm etwas zur Beruhigung geben und ein Auge auf ihn haben, bis der psychologische Dienst eintrifft.«
Da Frank keine Anstalten machte, sich aus freien Stücken zu bewegen, und noch immer wie ein nasser Sack zwischen den Detectives hing, legten sie sich seine Arme über die Schultern und führten ihn nach draußen. Diesmal leistete er keinen Widerstand.
Chase rieb sich den Unterkiefer und versuchte das Pochen ebenso zu ignorieren wie das Brennen seiner aufgeplatzten Lippe. Trotz des Schlages konnte er Frank keine Vorwürfe machen. Er war im Augenblick nicht er selbst und vermutlich würde es eine sehr lange Zeit dauern, bis er das wieder sein konnte.
»Alles in Ordnung bei Ihnen, Agent Ryan?« Dr. Edwards hatte sich ihm zugewandt und musterte seine Lippe. »Brauchen Sie Hilfe?«
»Wenn Sie zwei Paracetamol für mich haben, sage ich nicht Nein.« Im Moment spürte Chase nur ein leises Pulsieren, doch vermutlich würde das bald in hämmernde Kopfschmerzen übergehen. Abgesehen davon hatte er heute noch eine Menge Arbeit vor sich, die sich mit einem Brummschädel nur schwer erledigen lassen würde.
Edwards bückte sich nach seinem Koffer, fischte ein weißes Plastikröhrchen heraus und warf es Chase zu. »Bedienen Sie sich.«
Chase fing es auf und ließ zwei Tabletten in seine Handfläche fallen, die er ohne Wasser herunterschluckte. »Ich hätte nicht gedacht, dass Ihre Patienten so etwas noch brauchen.«
Der Mediziner grinste. »Die sind für mich, wenn mir meine Patienten mal wieder Kopfzerbrechen bereiten.« Er nahm Chase das Röhrchen ab und warf es in seinen Koffer zurück. Dann wandte er sich erneut Chase zu und hielt ihm ein Papiertaschentuch entgegen. »Hier.«
Chase nahm das Taschentuch und wischte sich das Blut von der Lippe. »Besser?«
»Zumindest gut genug, damit die Reporter es nicht sofort wittern und in der Hoffnung auf eine sensationelle Story über Sie herfallen.«
»Was passiert jetzt mit Agent Cassell?« Ben hatte endlich seine Kamera ausgeschaltet und steckte den Deckel auf das Objektiv. »Wer passt auf ihn auf?«
»Ich denke, dass man ihn für eine Nacht im Krankenhaus behalten wird, bevor sich die Psychologen des FBI auf ihn stürzen.« Chase’ Blick fiel auf den blutigen Teppich und wanderte von dort aus nach oben, zu Dianas erstarrten Zügen. Hierher konnte Frank nicht zurück. Er hätte ihm angeboten, erst einmal zu ihm nach Hause zu kommen, doch er bezweifelte, dass sich Frank darauf einlassen würde – nicht, solange er Chase als den Schuldigen am Tod seiner Frau auserkoren hatte. Vielleicht konnte Frank für eine Weile zu seiner Schwester nach Silver Spring ziehen. Der Agent mochte wütend sein, doch schon bald würde seine Wut in Trauer umschlagen. Dann war es besser, wenn jemand bei ihm war.
»Nehmen Sie es nicht zu schwer«, meinte Ben und trat einen Schritt zur Seite, um die Gehilfen des Gerichtsmediziners mit dem Leichensack vorbeizulassen. »Frank kann Ihnen wohl kaum die Schuld daran geben, dass Ihr Profil nicht gleich Namen und Adresse des Täters mit ausgespuckt hat. Den Kerl zu finden, ist immer noch Aufgabe der Polizei.«
Natürlich wusste Chase, dass es nicht seine Schuld war, doch ebenso gut wusste er, dass Frank das im Augenblick vollkommen egal war. Chase’ Blick wanderte zu Diana. Edwards Assistenten hatten sie von ihren Fesseln befreit und hoben sie vom Stuhl, um sie in den ausgebreiteten Leichensack zu legen. Sich ein Opfer zu suchen, das in direkter Verbindung zu den Ermittlern stand, war gewagt. Dieser Kerl war clever, zugleich schien er mutiger zu werden, als wolle er seine Verfolger zu einem Spiel auffordern. Fangt mich, wenn ihr könnt! Genau das würden sie tun, denn früher oder später würde sein Mut in Übermut umschlagen und er würde anfangen, Fehler zu machen. Vielleicht war Diana bereits sein erster Fehler.
Der Anblick des blutigen Teppichs, gepaart mit dem Gestank, der überall im Raum hing, schien den aufkeimenden Kopfschmerz noch zu beschleunigen. Da es für ihn hier oben ohnehin nichts mehr zu tun gab, nickte er Dr. Edwards und Ben zum Abschied kurz zu und wollte hinaus.
»Sind Sie heute Abend noch in der Stadt?«, rief Ben ihm hinterher.
»Vermutlich nicht, warum?«
»Einige von uns werden sicher auf ein Bier im Golden Bell sein. Falls Sie also da sind, kommen Sie doch vorbei.«
Chase kannte den Laden. Er war selbst bereits des Öfteren mit Frank dort gewesen, ein oder zweimal auch mit Anderson und Munarez, wenn sie außerhalb des Büros über einen Fall sprechen wollten. Das Golden Bell war eine der Kneipen, in der hauptsächlich Cops verkehrten, was das Bell wohl zu einem der sichersten Orte im Washingtoner Nachtleben machte.
»Vielleicht ein andermal.«
Ben nickte. »Dann schicke ich Ihnen die Fotos wohl am besten so schnell wie möglich per E-Mail, damit Sie sich alles ansehen können.«
»Danke.« Chase verließ das Schlafzimmer und den ersten Stock. Unten im Flur kam ihm Munarez entgegen. »Wie geht es Frank?«, fragte er.
»Die werden ihn gleich mit Beruhigungsmitteln vollpumpen, bis er nur noch rosa Nilpferde sieht. Danach geht es ihm hoffentlich für eine Weile besser.« Trotz ihrer ruppigen Worte war Munarez ihr Unbehagen anzumerken. Auch wenn Frank zum FBI gehörte und damit nicht unbedingt ganz oben auf der Liste von Munarez’ Freunden stand, hatte er dennoch mit seinen Leuten die polizeilichen Ermittlungen unterstützt. Das machte ihn zu einem von ihnen. »Anderson ist bei Lieutenant Murphy und dem Reporterpack. Ich fahre jetzt zum Revier zurück. Die Berichte schicke ich Ihnen, sobald sie fertig sind.« Sie machte ruckartig kehrt und verschwand so schnell, wie sie gekommen war.
Chase folgte ihr nach draußen. Kaum hatte er die Veranda hinter sich gelassen, schwenkte er nach rechts und hielt auf die Garageneinfahrt und den Krankenwagen zu. Die hinteren Türen waren weit geöffnet und auf der Ladekante saß Frank und starrte ins Nichts. Seine Züge wirkten eingefallen und wächsern, die dunklen Ringe, die sich unter seinen Augen ausgebreitet hatten, ließen ihn weit älter erscheinen, als er mit seinen fünfunddreißig Jahren tatsächlich war. Sein Mantel und das Sakko lagen neben ihm, einer seiner Hemdsärmel war hochgekrempelt. Ein Sanitäter löste die Blutdruckmanschette von Franks Oberarm und tastete nach seinem Puls. Im Inneren des Wagens war ein zweiter Sanitäter dabei, eine Infusion vorzubereiten. Frank nahm davon ebenso wenig Notiz wie von Chase, der langsam näher kam.
»Agent Ryan.« Ein uniformierter Officer kam über den Rasen auf ihn zu, einen stämmigen Kerl im Schlepptau, für den die Bezeichnung exotisch erfunden worden war. Der Mann mochte etwa Ende dreißig sein und hatte langes, glattes Haar von einer Farbe ähnlich dem Federkleid eines Raben. Die dunkle Haut und die beinahe schwarzen Augen, um die herum sich Lachfältchen wie ein feines Netz eingegraben hatten, offenbarten seine Abstammung. Unterstrichen wurde der Eindruck noch von einem geflochtenen Stirnband, an dessen Seite eine kleine silberne Kette mit bunten Perlen und einer Rabenfeder baumelte. Der Officer stand dicht neben dem Indianer, als fürchtete er, der Mann könne jeden Augenblick loslaufen und ins Haus stürmen. »Dieser Mann behauptet, helfen zu können.«
»Dann wäre es besser, er würde mit einem der zuständigen Detectives sprechen.« Munarez würde ihm die Hölle heißmachen, wenn sie mitbekäme, dass er sich in einer Art und Weise in die laufenden Ermittlungen einmischte, die über Täterprofile und Vorschläge, wie viele Informationen über den Täter zu welchem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gelangen sollten, hinausging. Allerdings war Munarez nicht mehr hier.
»Er sagt, er möchte mit Ihnen sprechen.«
Chase warf einen Blick zu Detective Anderson, der an der Seite seines Lieutenants der Reportermeute gegenüberstand. Natürlich konnte er hinübergehen und Anderson loseisen. Wenn allerdings einer der Journalisten Wind davon bekam, dass es jemanden gab, der behauptete, etwas über die Morde zu wissen, würden ihm morgen die wildesten Gerüchte und Spekulationen aus den Zeitungen entgegenspringen. Schlagzeilen wie: Ist der Killer ein Indianer? oder: Was weiß dieser Mann über die Morde? zusammen mit einem Foto des Indianers, gehörten dann vermutlich noch zu den harmloseren Überschriften.
Chase unterdrückte einen Seufzer. Wenn der Kerl tatsächlich etwas wusste, was für den Fall wichtig war, konnte er ihn später immer noch an Anderson weiterleiten. Bis dahin würde er ihn von der Meute fernhalten.
»Ich kümmere mich darum«, sagte er zu dem Officer, ehe er sich dem Indianer zuwandte. »Special Agent Chase Ryan, FBI«, stellte er sich vor, obwohl sein Gegenüber sichtlich wusste, mit wem er es zu tun hatte.
»Joseph Quinn.«
Chase hob eine Augenbraue, woraufhin der Indianer das Gesicht verzog. »Was haben Sie erwartet, Agent? Einen Namen wie Hinkende Krähe? Diese Zeiten sind schon lange vorbei.«
»Entschuldigen Sie, Mr Quinn, ich wollte nicht unhöflich sein. Was kann ich für Sie tun?«
»Die Frage ist wohl eher, was ich für Sie tun kann.«
Trotz seiner großspurigen Worte sah sich der Indianer um, als wolle er sicherstellen, nicht mehr Beachtung zu bekommen als unbedingt nötig. Erst nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass die Reporter keine Notiz von ihm nahmen, entspannte er sich. Was auch immer Joseph Quinn hierher führte, der Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen, war es nicht.
»Was haben Sie für uns?«
»Womöglich einen Weg, wie Sie diesen Killer aufspüren und dingfest machen können.«
»Meine Aufmerksamkeit gehört Ihnen.« Obwohl Chase bezweifelte, dass dieser Mann etwas über den Aufenthaltsort des Killers wissen konnte, wenn Polizei und FBI seit drei Jahren erfolglos nach ihm fahndeten und alle Zeugenbefragungen bisher ins Nichts geführt hatten, wollte er keine Möglichkeit ungenutzt lassen, die ihn ans Ziel führen konnte. »Was haben Sie gesehen?«
»Nichts.«
Chase runzelte die Stirn. »Dann kennen Sie jemanden, der etwas gesehen hat?«
Der Indianer schüttelte den Kopf. »Auch nicht.«
Allmählich beschlich Chase das Gefühl, seine Zeit zu verschwenden. »Hören Sie, Mr Quinn, warum kommen Sie nicht ohne Umschweife zur Sache und sagen mir, warum Sie glauben, uns helfen zu können.«
Statt sofort zu antworten, richtete sich der Blick des Indianers auf das Haus. Ein Schatten glitt über seine Züge und in seinen Augen lag ein Ausdruck, als wisse er genau, was für ein Anblick hinter diesen Wänden lauerte. »Wir brauchen eine DNA-Probe, vielleicht ein wenig Blut, wenn vorhanden. Das wäre perfekt. Dann kann ich Sie zu ihm führen.«
»Was sind Sie? Eines dieser Medien, die vorgeben, Auren zu erkennen?« Chase unterdrückte das Verlangen, ihn auf der Stelle vom Tatort entfernen zu lassen. »Waren Sie mit Ihrem Anliegen bereits bei der Polizei?«
»Ich bezweifle, dass die Cops mir zuhören würden.«
Und das vermutlich nicht ohne Grund. Die Frage war nur, wie er auf die Idee kam, bei Chase auf offene Ohren zu stoßen?
»Ich weiß, wie sich das anhören mag, Agent Ryan, aber Sie müssen mir glauben, ich kann Ihnen wirklich helfen!«
»Und was erwarten Sie dafür?«
Einmal mehr kehrte der Blick des Indianers zum Haus zurück. »Ich will einfach, dass es aufhört. Kein Mensch sollte solche Dinge erleiden müssen.« Seine Aufmerksamkeit richtete sich erneut auf Chase. Für die Dauer einiger Herzschläge musterte er ihn. »Manchmal liefert die Wissenschaft keine Ergebnisse, dann muss man zu anderen Mitteln greifen«, sagte er schließlich. »Rituale gehören zum Leben eines jeden Menschen. Für den einen ist es die Tasse Kaffee nach dem Aufstehen, ohne die der Tag nicht beginnen kann. Ein anderer braucht ein gutes Buch oder Musik, um abschalten zu können. Mein Volk pflegt seine Traditionen, Agent Ryan. Einige davon sind sehr alt und bewirken weit mehr, als das eigene Wohlbefinden zu steigern.« Er kam einen Schritt näher und senkte die Stimme. »Es gibt ein Ritual, das es möglich macht, eine Verbindung zu dem zu schaffen, den Sie suchen.«
»Ihre Hilfsbereitschaft in Ehren, aber wir verlassen uns lieber auf herkömmliche Methoden als auf Zauberei.«
»Hör auf mit der Scheiße, Ryan!« Frank schob den Sanitäter beiseite, der ihm gerade eine Infusion legen wollte, sprang von der Ladekante und kam näher. »Sprechen Sie weiter«, forderte Frank den Indianer auf. »Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können.«
Chase sparte sich den Widerspruch, da er wusste, dass Frank Argumenten gegenüber im Moment nicht zugänglich war. Statt sich auf eine Debatte einzulassen, warf er dem Sanitäter einen beschwörenden Blick zu, woraufhin der sich vor Frank stellte. »Sie können sich später mit dem Mann unterhalten«, sagte er ruhig und griff nach Franks Arm, um ihn zum Wagen zurückzuführen. Als er sich wehrte, kam der zweite Sanitäter seinem Kollegen zu Hilfe. Mit vereinten Kräften zogen sie ihren Patienten mit sich.
»Sei nicht so vernagelt, Chase!«, brüllte Frank und stemmte sich gegen den Griff der Männer, doch die gaben ihn nicht mehr frei. Um ihnen ihre Arbeit zu erleichtern, lotste Chase den Indianer vom Krankenwagen fort.
»Ich weiß Ihr Hilfsangebot wirklich zu schätzen, Mr Quinn«, sagte er und versuchte Franks Geschrei auszublenden, das jetzt aus dem Inneren des Wagens drang, »aber es entspricht nicht unserem üblichen Vorgehen.«
»Manchmal muss man sich abseits gewohnter Pfade bewegen, um auf seinem Weg voranzukommen.«
Abgesehen davon, dass es nicht den Vorschriften entsprach, bei den Ermittlungen auf übersinnliche Mittel zurückzugreifen, glaubte Chase nicht an Hokuspokus. Nichts hatte ihn bisher davon überzeugen können, dass Menschen wie Joseph Quinn mehr waren als Scharlatane. Manche waren geschickter oder überzeugender als andere, eines jedoch hatten sie alle gemeinsam: Sie waren Mogelpackungen. Chase deutete in Richtung der Absperrung. »Ich denke, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen.«
Quinn nickte. »Natürlich.« Er griff in die Tasche seines Parkas, zog eine Visitenkarte heraus, deren Ränder abgestoßen und schon ein wenig verschmutzt waren, und hielt sie Chase entgegen. »Falls Sie es sich doch noch anders überlegen, rufen Sie mich an.«
Da Chase nicht länger diskutieren wollte, nahm er die Karte und schob sie in seine Sakkotasche. »Danke.« Er begleitete den Indianer zur Absperrung und beobachtete, wie der Mann darunter hindurchtauchte und ein Stück die Straße hinunter zu seinem Wagen ging.
»Voodoo-Kram?«, erkundigte sich der Officer, der den Indianer zu ihm geführt hatte. Dann seufzte er. »Tut mir leid, dass ich Ihre Zeit mit dem Kerl verschwendet habe. Das ist eine der Nebenwirkungen bei Fällen wie diesem: Die Spinner kriechen aus allen Löchern und behaupten, helfen zu können.«
Ben Summers, der gerade seine Fotoausrüstung über den Rasen schleppte, hatte die letzten Worte mitbekommen. »Vielleicht gibt es wirklich mehr zwischen Himmel und Erde, als wir ahnen?«
Der Officer schnaubte. »Du glaubst auch noch an den Weihnachtsmann, Summers!«
*
Schlecht gelaunt und mit hämmernden Kopfschmerzen kam Chase schließlich in Quantico an. Die fünfunddreißig Meilen von Alexandria zur Marinebasis, auf deren weitläufigem Gelände neben der FBI-Akademie unter anderem auch die Spezialeinheit für Serienverbrechen ihren Sitz hatte, waren an ihm vorübergerauscht, ohne dass er mehr von seiner Umwelt wahrgenommen hatte als den fließenden Verkehr um sich herum. Anfangs hatte er noch versucht, sich mit Musik abzulenken. Da das laufende Programm jedoch alle paar Minuten von Nachrichten über den neuesten Mord des Schlitzers unterbrochen wurde, hatte er das Radio bald wieder abgeschaltet und sich dem gleichmäßigen Rauschen des Verkehrs und dem Durcheinander seiner eigenen Gedanken ergeben.
Der Killer suchte sich seine Opfer stets in ruhigen Mittelstandsgegenden aus, deren Häuser nicht zu dicht aneinandergebaut waren und in denen es in der Regel weder einen Wachdienst noch Alarmanlagen gab. Als die Morde sich zu häufen begannen und klar wurde, dass es sich um ein und denselben Täter handelte, hatte die Mordkommission sich an das FBI gewandt. Seitdem unterstützten Agenten des örtlichen Field Office die Ermittlungen der D. C. Metro Police, während Chase nach Einsicht der Akten, Gesprächen mit Polizisten und Begutachtung der Tatorte ein Profil des Täters erstellt hatte. Doch obwohl er das Gefühl hatte, ziemlich genau zu wissen, wie dieser Mann tickte, brachte sie das keinen Schritt näher an ihn heran. Nicht, solange es keine Verdächtigen gab. Natürlich hatte es immer wieder jemanden gegeben, der ein Motiv gehabt hätte – eifersüchtige oder gewalttätige Ehemänner, Geschwister, Arbeitskollegen und Vorgesetzte. Doch abgesehen davon, dass sie nicht in das Täterprofil passten und außer Indizien keine wirklichen Beweise vorlagen, gab es nichts, was die jeweiligen Verdächtigen mit den anderen Morden in Verbindung gebracht hätte – weshalb die Polizei in ihren Ermittlungen nie über einen Anfangsverdacht hinausgekommen war.
Mit schnellen Schritten durchquerte Chase das Großraumbüro seiner Abteilung. Es war inzwischen Abend geworden, sodass die meisten Schreibtische bereits verlassen waren. Die wenigen, die noch an ihren Plätzen saßen, bedachten ihn zwar mit neugierigen Blicken, als er vorüberkam, stellten aber keine Fragen.
In seinem Büro angekommen, das er als stellvertretender Abteilungsleiter für sich allein hatte, schloss er die Milchglastür hinter sich und ging zum Schreibtisch. Er schaltete den Computer an und ließ sich in seinen Stuhl fallen. Sobald das System hochgefahren war, meldete er sich mit seiner Kennung und seinem Sicherheitscode an und rief seine E-Mails ab. Summers hatte ihm bereits die Fotos vom Tatort geschickt. Statt jedoch den Mail-Anhang zu öffnen, lehnte Chase sich im Stuhl zurück und starrte an die Decke. Er hatte noch deutlich genug vor Augen, wie es in Franks Schlafzimmer ausgesehen hatte – dazu brauchte er die Fotos nicht anzusehen. Nicht heute. Während der nächsten Tage und Wochen würde er sich eingehend genug damit beschäftigen müssen.
Eine Weile saß er einfach nur da, den Blick auf die Deckenplatten gerichtet, deren Einheitsgrau ein perfektes Spiegelbild seiner Stimmung war. Für gewöhnlich empfand er die unterschiedlichen Grau- und Silbertöne der Büroeinrichtung als modern und freundlich, heute jedoch strahlten sie etwas zutiefst Niederschmetterndes aus.
Auf der Suche nach einem Kaugummi durchwühlte er die Taschen seines Sakkos und stieß dabei auf die ramponierte Visitenkarte des Indianers. Er fischte sie aus der Tasche und warf sie auf den Schreibtisch, ehe er seine Suche fortsetzte und schließlich fündig wurde. Den Blick auf die Karte gerichtet, wickelte er den Streifen Kaugummi aus dem Papier und schob ihn sich in den Mund. Nur Name, Adresse und Telefonnummer. Kein Zusatz, aus dem hervorgegangen wäre, dass sich der Mann für einen Zauberer hielt.
Während er auf dem Kaugummi herumkaute und ihn der Pfefferminzgeschmack wieder ein wenig mit Leben erfüllte, machte er sich daran, eine E-Mail an Munarez zu verfassen, in der er von Joseph Quinns Auftauchen berichtete. Sobald die Mail fertig war, würde er die Visitenkarte einscannen und als Anhang versenden. Er mochte von der Walla-Walla-Magie des Indianers nichts halten und noch weniger daran glauben, trotzdem musste er das Erscheinen des Mannes der Vollständigkeit halber weitergeben.
Als er den Scanner einschaltete, klingelte das Telefon. Miss Tanner, die üblicherweise seine Anrufe entgegennahm, war nicht mehr im Haus, deshalb nahm er das Gespräch selbst an.
»Ryan«, meldete er sich knapp.
»Hier ist Kate Lombardi, Agent Ryan. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.« Obwohl ihre Stimme am Telefon sympathischer klang, als ihm die Frau selbst war, stand ihm nicht der Sinn danach, sich mit ihr herumzuschlagen.
»Ungünstiger Zeitpunkt«, brummte er. »Warum rufen Sie nicht morgen noch einmal an?«
»Damit mich Ihre Assistentin abwimmeln kann?«
Er zuckte die Schultern. »So hatte ich mir das vorgestellt.« Dass sie seine Absicht durchschaut hatte, störte ihn nicht im Geringsten.
»Das passt nicht ganz zu meiner Vorstellung«, gab sie zurück. »Nachdem ich Ihretwegen das Statement des Lieutenants habe sausen lassen, dachte ich mir, dass Sie mir ein paar Antworten schuldig wären.«
»Ich kann mich nicht erinnern, Sie darum gebeten zu haben, mir zu folgen, statt dem Lieutenant zu lauschen.« Er legte die Visitenkarte auf den Scanner und startete den Einlesevorgang. »Wenn Sie also glauben, ich würde hier in Schuldgefühlen versinken – vergessen Sie es, Lombardi.«
»Kommen Sie schon, Ryan«, hakte sie nach. »Geben Sie mir etwas, womit ich arbeiten kann.«
»Schreiben Sie von Ihren Kollegen ab.«
»Hab ich schon«, gab sie unumwunden zu. »Allerdings finde ich Ihr Wissen wesentlich interessanter.«
»Was man nicht kennt, ist immer spannender als das Altbekannte. Ich möchte meinen Zauber nur ungern verlieren, deshalb werde ich weiterhin geheimnisvoll bleiben.«
Lombardi schnaubte. »Ich weiß, dass Sie ein Täterprofil erstellt haben.«
»Es ist mein Job, Profile zu erstellen.«
»Erzählen Sie mir davon und pochen Sie nicht wieder auf Ihre verdammten Vorschriften!«
Chase lehnte sich zurück und ließ einige Zeit verstreichen, ohne dass er etwas sagte. Sosehr Lombardi ihm auch auf die Nerven ging, so viel Vergnügen bereitete es ihm, sie auflaufen zu lassen. Zwar kein Ausgleich für die Ereignisse des Tages, aber immerhin eine willkommene Ablenkung. »Wenn Sie etwas über Profiling wissen wollen, sollten Sie einen meiner Vorträge besuchen.«
»Ich will kein allgemeines Blabla hören!«, entfuhr es ihr. Schnell senkte sie ihre Stimme wieder. »Wer ist dieser Killer? Nach was für einem Menschen suchen Sie?«
Sie wurde immer zorniger und versuchte dabei krampfhaft, ruhig zu bleiben, da sie wusste, dass Wut ihr nur die letzte Chance nehmen würde, etwas aus ihm herauszubekommen – nicht dass die je existiert hätte.
»Wenn Lieutenant Murphy entscheidet, diese Informationen zu veröffentlichen, werden Sie es erfahren.«
»Ryan!«
»Halten Sie sich an die offiziellen Statements der Mordkommission. Etwas anderes kann und werde ich Ihnen nicht sagen.« Es war ein beschissener Tag gewesen, trotzdem konnte Chase sich ein Grinsen nicht verkneifen, als sie am anderen Ende der Leitung nach Luft schnappte.
»Zu schade, dass Sie im Dienst sind«, sagte sie plötzlich.
»Warum? Hätten Sie mich sonst gefragt, ob ich mit Ihnen ausgehen möchte?« Du würdest dir ein glattes Nein einfangen, Lombardi.
Wieder ein Schnauben. »Ganz sicher nicht! Aber ich hätte Ihnen gesagt, was für ein unausstehlicher, arroganter …« Sie brach ab. Er hörte das leise Klimpern ihrer Ohrringe, die gegen den Hörer schlugen, und wusste, dass sie den Kopf schüttelte. »Was auch immer Sie sind, ich werde es Ihnen nicht sagen. Ich habe keine Lust, auch noch wegen Beleidigung eines Bundesagenten hinter Gittern zu landen, nur weil es Ihnen nicht reicht, mich auflaufen zu lassen.«
»Verbuchen Sie es unter Anfängerfehler.«
»Dafür schulden Sie mir was.«
»Sie werden auch beim nächsten Mal keine anderen Antworten bekommen.« Ihr Atem wurde leiser, sie war im Begriff, aufzulegen. »Lombardi?«
Chase dachte schon, sie würde ihn nicht mehr hören, als ein »Ja?« erklang.
»Ich könnte Sie auch verhaften lassen, wenn ich nicht im Dienst bin«, sagte er und beendete die Verbindung.
Drei Monate später …
1
»Hier ist die Teilnehmerliste, Agent Ryan.« Miss Tanner war in der Tür stehen geblieben und wedelte mit einem Blatt Papier. »Brauchen Sie Kopien davon?«
Chase schüttelte den Kopf. »Mir reicht ein kurzer Blick darauf.«
Morgen früh würde er in der FBI-Akademie einen Vortrag über Profiling halten. Die Veranstaltungen waren jedes Mal ausgebucht und wurden von einer Reihe unterschiedlicher Zuhörer besucht, die sich von Polizisten über FBI-Anwärter bis hin zu gestandenen Agenten erstreckte. Von Zeit zu Zeit fanden sich auch interessierte Laien im Auditorium, die sich aus den verschiedensten Gründen für sein Fachgebiet interessierten. Für gewöhnlich waren es Autoren oder Drehbuchschreiber, die einen ersten Eindruck gewinnen wollten, bevor sie sich mit ihren tiefer gehenden Fragen direkt an Chase wandten. Die Beratung von Kreativen war nur ein winziger Teil seiner Tätigkeit, den er sehr zu schätzen wusste. Es war eine angenehme Abwechslung, sich über fiktive Morde und Täter zu unterhalten, statt über reale Verbrechen, deren Bilder auf seinem Tisch lagen und in seinem Kopf herumspukten.
Er nahm seiner Assistentin die Liste ab und warf einen Blick darauf. Viele Polizisten, noch mehr FBI-Leute, keine Kreativen. Es sei denn, man zählte Lombardi dazu, die ebenfalls auf der Liste stand.
»Brauchen Sie sonst noch etwas, Agent Ryan?«
»Danke, Miss Tanner, das wäre für den Moment alles.«
Sobald sie gegangen war, ließ Chase das Blatt auf den Schreibtisch segeln, griff nach seiner Kaffeetasse und spülte einen aufkommenden Seufzer mit einem großen Schluck kaltem Kaffee herunter.
Seit seinem letzten Telefonat mit Lombardi waren drei Monate vergangen. Sie hatte danach noch einige Male versucht, ihn zu erreichen, war jedoch jedes Mal an Miss Tanner gescheitert, die Anweisung hatte, sie abzuwimmeln. Schließlich hatte sie aufgegeben und Chase war davon ausgegangen, endlich Ruhe zu haben. Offensichtlich hatte er ihre Hartnäckigkeit unterschätzt. Diese Frau war wie ein Kaugummi, der einem unter der Schuhsohle klebte.
Überhaupt war in den letzten drei Monaten vieles nicht so gelaufen, wie er es gern gehabt hätte. Frank war einige Zeit krankgeschrieben gewesen und hatte bei seiner Schwester gewohnt. Auf Chase’ Anrufe hatte er nicht reagiert und nie zurückgerufen. Schließlich hatte er das Haus in Alexandria verkauft und sich nach Quantico versetzen lassen, wo er die Neulinge in Verbrechensanalyse und forensischer Psychologie unterrichtete. Er ging Chase nicht aus dem Weg, doch wenn sie einander begegneten, kamen sie nie über den Austausch von Belanglosigkeiten hinaus. Alle Versuche, mit ihm über Dianas Tod zu sprechen, scheiterten an Franks Ausweichmanövern. Es gab keine Anzeichen, dass Frank noch immer wütend auf ihn war. Chase wusste nur zu gut, dass er an jenem Tag einfach jemanden gebraucht hatte, dem er die Schuld geben und auf den er seinen Hass konzentrieren konnte – andernfalls wäre er daran zerbrochen. Seine Befürchtung war jedoch, dass Frank mittlerweile klar geworden war, dass sein eigenes Pressestatement, in dem er den Mörder als einen kranken Perversen bezeichnet hatte, mit großer Wahrscheinlichkeit der Auslöser für die Tat gewesen war. Dieser Mann war so versessen darauf, seine Überlegenheit zu demonstrieren, dass er eine derartige Herausforderung unmöglich ignorieren konnte. Darauf hatte Frank gebaut – ohne zu ahnen, welche Konsequenzen das für ihn haben würde. Chase wusste nicht, ob Frank in therapeutischer Behandlung war, doch so, wie er den Mann kannte, hatte er jedes Angebot auf Unterstützung abgelehnt. Wenn er jedoch länger auf die Hilfe eines Fachmannes verzichtete, würden ihn die Schuldgefühle auffressen und zerstören, was von seinem Leben übrig geblieben war. Dass er sich abschottete, war ein erstes Anzeichen dafür, dass er die Straße zur Selbstzerstörung bereits betreten hatte.
Chase hatte Frank nie gedrängt. Er hatte ihm den Raum gegeben, der nötig war, doch womöglich war der Zeitpunkt gekommen, an dem ein freundschaftlicher Tritt in den Hintern hilfreicher war, als ihm weiteren Freiraum zu gewähren.
Während die Mauer, mit der Frank sich umgab, immer höher zu werden schien, traten die Ermittlungen weiter auf der Stelle. Chase hatte einige andere Fälle zu bearbeiten, Fälle, in denen sich rasche Erfolge abzeichneten, da es Spuren und Verdächtige gab. Die übrige Zeit nutzte er, um die Verbrechen des Schlitzers zu studieren. Wieder und wieder ging er die einzelnen Akten durch, studierte die Fotos und las die anhängenden Berichte von Polizei, Spurensicherung und Gerichtsmedizin zum wohl hundertsten Mal. Nichts davon brachte ihn auch nur einen Schritt weiter.
Frustriert warf er die Akte, in der er gerade geblättert hatte, auf den Tisch zurück, als das blecherne Klingeln des Telefons die Stille im Büro durchbrach. Er schaltete den Lautsprecher ein. »Miss Tanner?«
»Detective Munarez möchte Sie sprechen.«
»Stellen Sie sie durch.« Chase nahm den Hörer ab. »Was gibt es, Detective?«
»Er hat wieder zugeschlagen«, kam Munarez sofort zur Sache. »Diesmal in Edmonston.«
»Ist das Opfer jemand, den wir kennen?«
»Diesmal nicht.« Mit knappen Worten schilderte Munarez ihm, wer das Opfer war und was sie am Tatort vorgefunden hatten – alles entsprach der gewohnten Vorgehensweise. Ein ruhiger Vorort ohne Videoüberwachung, der Ehemann auf Geschäftsreise, die Frau betäubt und an einen Stuhl gefesselt, der vor einem Spiegel stand. Auch die Tat an sich folgte dem üblichen Muster. Lippen und Augenlider festgenäht, Schnitte an den Venen und zwei Einstichstellen am Hals, durch die ihr mit großer Wahrscheinlichkeit das Betäubungsmittel und der Gerinnungshemmer injiziert worden waren.
»Soll ich zu Ihnen kommen?«
»Nein. Das Haus ist zu klein, wir treten uns hier auch so schon gegenseitig auf die Füße, ohne dass wir aufpassen müssen, euch FBI-Typen nicht im Gedränge die Anzüge zu zerknittern.« Typisch Munarez. Für gewöhnlich wollte sie so wenig wie möglich mit dem FBI zu tun haben, da sie immer befürchtete, dass sich die Bundespolizei zu sehr in ihre Arbeit einmischte oder ihr gar den Fall entziehen könnte. Munarez hatte ihr Feindbild gefunden, an dem sie ihren aufgestauten Frust über die stockenden Ermittlungen auslassen konnte – und üblicherweise tat sie das auch ausgesprochen großzügig. Auch wenn sie das Field Office gern aus ihren Angelegenheiten heraushielt, hatte sie zumindest eingesehen, dass Chase’ Arbeit für sie von Nutzen sein konnte. Er hatte weiß Gott lange genug auf sie eingeredet, um ihr begreiflich zu machen, dass seine Abteilung keine Fälle an sich riss, sondern lediglich dazu da war, die Polizei zu unterstützen.
Sie bellte jemandem einen Befehl zu, gefolgt von einem ihrer mexikanischen Flüche, ehe sie sich wieder an Chase wandte. »Kommen Sie morgen Mittag aufs Revier, dann können Sie sich Edwards’ Bericht anhören, bevor wir zum Tatort fahren.«
»In Ordnung.« Sobald er seinen Vortrag beendet hatte, würde er sich auf den Weg machen. Trotzdem ließ er sich die Adresse geben und kritzelte sie auf seinen Notizblock. Als er den Stift zur Seite legte, fragte er: »Wie geht es Anderson?«
Munarez schnaubte. »Immer noch krankgeschrieben, schon die fünfte Woche, und vermutlich dauert es mindestens noch einmal so lang, bis er endlich zurückkommt. Und in der Zwischenzeit kann ich die ganze Scheiße hier allein machen, mit so einem Grünschnabel an der Backe, der nicht mal mit einem Navigationssystem seinen eigenen Hintern finden würde.«
Chase konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. So leid es ihm für Anderson tat, der vor einigen Wochen vollkommen überarbeitet und ausgebrannt zusammengeklappt war, sosehr amüsierte ihn Munarez’ Ausbruch. »Jetzt wissen Sie wenigstens, wie es Anderson ging, als Sie zu ihm kamen.«
»Chinga tu madre!«
»Sie polieren meinen Wortschatz ganz schön auf. Adiós, Anita.«
Er beendete das Gespräch und ging zur Pinnwand, die hinter ihm hing. Dort hatte er schon vor Monaten einen Stadtplan aufgehängt, auf dem er die jeweiligen Tatorte einzeichnete. Beim Anblick der Markierungen verflog seine gute Laune schlagartig. Er griff nach dem roten Filzstift und zeichnete das dreizehnte Dreieck ein, ehe er einen Schritt zurücktrat, um die Karte zu betrachten.
Fast alle Markierungen verteilten sich über die nördlichen und östlichen Vororte, doch abgesehen davon, dass sich die Gegenden glichen und alle Frauen allein zu Hause gewesen waren, schien es keinen weiteren Zusammenhang zwischen den Opfern zu geben, außer dass die Ehemänner häufig auf Reisen waren oder im Schichtbetrieb arbeiteten. Die Frauen hatten einander nicht gekannt, ebenso wenig gab es zwischen deren Männern, Kindern oder Geschwistern Verbindungen, die zu den anderen Opfern geführt hätten. Damit konnten sie ausschließen, dass der Täter aus dem Bekanntenkreis stammte. Er fing bei jedem Opfer von null an, beobachtete es, überwachte seinen Tagesablauf und ließ womöglich auch von ihnen ab, wenn er merkte, dass der Ehemann jeden Abend nach Hause kam und ihm damit keine Zeit blieb, sein Vorhaben durchzuführen.
Chase starrte immer noch auf den Stadtplan und versuchte ein Muster zu erkennen, irgendetwas, das ihm weiterhalf, als die Tür zu seinem Büro aufgerissen wurde.
»Was zum Teufel …?« Er fuhr herum, bereit, denjenigen zusammenzustauchen, der da in sein Büro platzte, als er Frank erkannte. Hinter ihm schoss Miss Tanner in ihrem dunkelblauen Kostüm heran und versuchte Frank aus dem Büro zu bugsieren, während sie Chase mit einem halb erschrockenen und halb entschuldigenden Blick bedachte. Frank ignorierte ihre Bemühungen, machte einen Schritt in den Raum und knallte ihr die Tür vor der Nase zu.
»Er hat wieder zugeschlagen!«, rief er, bevor Chase seinen Auftritt kommentieren konnte. »Ich habe es gerade in den Nachrichten gehört. Edmonston.« In seinen Augen lag ein fiebriger Glanz, seine Haut war fahl, durchbrochen von unregelmäßigen hellen Bartstoppeln, und seine Stirn glänzte vor Schweiß.
»Ich habe es auch eben erfahren.« Was er in Franks Zügen sah, ließ nicht zum ersten Mal die Frage in ihm aufkommen, ob der Mann noch diensttauglich war. Selbst wenn er seit Dianas Tod nicht mehr im Außendienst arbeitete, verlangten seine Aufgaben von ihm, dass er sich Tag für Tag mit Verbrechen und der Psyche der Täter auseinandersetzte. Im Augenblick war sich Chase nicht sicher, ob Frank damit umgehen konnte.
»Wir müssen endlich etwas unternehmen!«