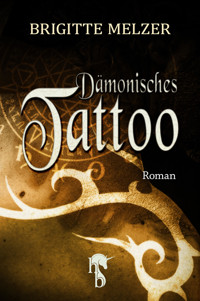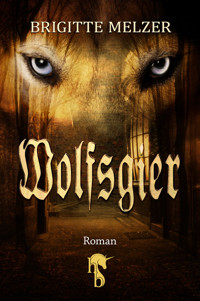4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit einem Zusammenstoß mit dem Krieger Ardan verfügt Elyria über dessen magische Kräfte. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass ihr jegliche Kontrolle über die neue Gabe fehlt, zieht sie damit auch noch die Aufmerksamkeit der gefürchteten Hexenjäger auf sich. Gemeinsam mit Ardan macht sie sich auf die Suche nach einem Weg, ihm seine Magie zurückzugeben. Dabei stoßen sie auf eine uralte Prophezeiung: Ist Elyria das Mädchen, das die Welt in den Untergang führen wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brigitte Melzer
Elyria
Im Visier der Hexenjäger
Roman
Unzählige Scheiterhaufen erhellen die Nächte, Magie als Wurzel des Übels birgt alles Schlechte. Die Zeit der Reinigung ist nicht mehr weit, dann sind die Menschen für die Götter bereit. Aus der Chronik des Sehers Dál Cais
Prolog
Ich bin alt und müde. Doch die Schuld, die ich auf mich geladen habe, lässt meine Hand nicht zur Ruhe kommen. Knorrig wie die Äste einer alten Eiche klammern sich meine Finger um den Federkiel. Meine Augen folgen der Bewegung, beobachten, wie die Tinte auf das Pergament fließt, Worte formend, die aus den Tiefen meiner Seele aufzusteigen scheinen. Bilder, Geräusche und Gefühle, die ich so lange in meinem Herzen verschlossen hatte und die dennoch nichts von ihrem Schrecken verloren haben. Jetzt manifestieren sich meine Erinnerungen auf dem Pergament und machen sichtbar, was wir getan haben.
Es war der Wunsch nach Wissen, der uns auf diesen Pfad führte. Einen Pfad, der anfangs so angenehm zu beschreiten war und doch steiniger endete, als ich es mir je vorzustellen gewagt hätte.
Die Elben sagen, die schrecklichsten Dinge geschehen aus guter Absicht. Wie recht sie doch haben. Die schlimmste aller guten Absichten ist der Wunsch nach Wissen. Ein naiver Wunsch, geboren aus dem Verlangen, die Welt zu verstehen. Doch hinter dem Wissen lauert sein dunkler Bruder – die Macht. Das Verlangen danach ist wie eine Krankheit, die die Menschen befällt und verdirbt. Ich habe selbst gesehen, welches Unheil diese Seuche über die Welt bringen kann.
Es gelang uns die Bedrohung abzuwenden, doch der Preis dafür war hoch. Seitdem ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Welt hat sich verändert – und mit ihr die Menschen.
Die Bruderschaft der Erleuchteten, die bisher ein wenig beachtetes Dasein neben dem Druidentum geführt hatte, erfuhr erstaunlichen Zulauf von furchtsamen Menschen auf der Suche nach Schutz. Aufgewiegelt durch die flammenden Reden der Priester war ihre wachsende Anhängerschaft bald überzeugt, dass allein die Macht der Druiden und Zauberwirker all das Leid über die Menschen gebracht hatte. Wie konnten sie ahnen, dass hinter all dem lediglich eine Handvoll eitler Männer und Frauen standen, die in ihrem unerschütterlichen Glauben an die Macht des Wissens die damit einhergehende Verführung unterschätzt hatten.
Weder Magier noch Druiden waren es, die die Welt beinahe in den Untergang getrieben hätten. Es war einer aus unseren eigenen Reihen. Ein Gelehrter, der den Einflüsterungen eines Dämons erlag. Verblendet von der Gier nach Wissen beschwor er den Schwarzen König, der ihm im Gegenzug versprach, ihn an seinem Wissen teilhaben zu lassen. In einem entsetzlichen Ausbruch vernichtete der Dämon die Stadt der Magier und entstieg ihren Ruinen – mächtiger denn je. So begann, was als der Krieg der Mächte in die Geschichte Cartómiens eingehen sollte. Eine tödliche Auseinandersetzung zwischen den Zaubernden und dem Dämon.
Während sich Druiden und Magier mit vereinten Kräften der Bedrohung entgegenstellten, vergiftete die Bruderschaft die Herzen der Menschen mit Gerüchten. Mit ihren verderbten Ritualen hätten Druiden und Zauberwirker jenen Dämon gerufen, der nun alles Leben auszulöschen drohte. Einzig jenen, die ihr Heil im Glauben an die Götter suchten, versprach die Bruderschaft Rettung. Scharenweise wandten sich verängstigte Menschen von ihrer alten Religion ab und suchten Schutz und Trost in den Tempeln, die zu jener Zeit überall neu entstanden.
Der druidische Glaube, seit Anbeginn der Zeit fest im Volk verwurzelt, fand durch unsere Schuld sein Ende. Magie, die als Auslöser für den Krieg der Mächte gesehen wurde, ist seither geächtet und wird gnadenlos verfolgt. »Zeit der Reinigung« nannte die Bruderschaft jene finsteren Jahre, die dem Krieg der Mächte folgten. Aufgebrachte Menschen brannten die Magiergilden nieder, vernichteten Bücher mit unschätzbarem Wissen und töteten jeden, der in Verdacht stand, Magie zu beherrschen. Um weitere Selbstjustiz zu verhindern, rief die Bruderschaft schließlich die Söhne Eaghans in die Welt. Sie nennen sich selbst Ordenskrieger. Hexenjäger wäre treffender, denn den Söhnen Eaghans fällt es seither zu, Magie zu verfolgen und zu vernichten. Sie zerstörten die heiligen Stätten der Druiden und brannten die Bluteichen nieder, die seit Jahrtausenden den Wandernden am Wegesrand zum Gebet einluden.
Unzählige Scheiterhaufen erhellten die endlosen Nächte. Harmlose Kräuterweiber, Gelehrte und Heiler fanden ebenso den Tod wie Druiden und Magier. Einzig gegen die Magie des Alten Volkes konnte die Bruderschaft nichts ausrichten. Obwohl die Heimat der Elben innerhalb der Grenzen Cartómiens liegt, verwehrt ein unsichtbarer Schleier, gewebt aus uralter Magie, ungebetenen Eindringlingen den Zutritt. So bleiben zumindest sie von den Übergriffen der Hexenjäger verschont.
Nur ein kleiner Trost angesichts der Wunden, die wir dem Land zugefügt haben. Verbrannte Erde. Zornige schwarze Narben im Angesicht der Welt. Das ist alles, was bleibt, nachdem die Scheiterhaufen niedergebrannt sind und der Wind die Asche verweht hat. Obwohl die Feuer erloschen sind und sich der Rauch verzogen hat, brennen meine Augen noch immer. Zu viel haben sie gesehen. Zu viel, das hätte verhindert werden können. Und es ist noch nicht vorüber.
1
Dunkelheit.
Er war tot. Gestorben, als die Sieben Meistermagier den Schwarzen König zu vernichten versucht hatten. Sie hatten das Wissen des Schwarzen Königs aus seinem Körper gerissen und ihn, des Wissens und der Essenz seines Meisters beraubt, als leblose Hülle zurückgelassen. Doch wenn er tot war, warum konnte er sich erinnern?
Er selbst hatte den Schwarzen König gerufen. Deshalb wusste er, über welche Kräfte der Dämon verfügte. Ein Teil dieser Kräfte war nach der Beschwörung auch in ihn geflossen. Allein dafür verehrte er seinen Meister. Hatten diese armseligen Zauberer wirklich geglaubt, sie könnten seinen Meister vernichten? Sie mochten ihn geschwächt haben, doch er war noch immer hier. Er spürte die Macht des Dämons, die jede Faser seines toten Leibes durchdrang.
Diene mir! Wispernd bohrte sich die Stimme in seinen Verstand. Er wusste, dass es nicht wirklich eine Stimme war. Es war pure Macht, die wie ein Windhauch über seinen Geist strich und ihn in Besitz nahm. Sein Leib begann zu zucken, als er sich mit unheiligem Leben füllte. Ruckartig setzte er sich auf. Trotz der Dunkelheit erkannte er seine Umgebung klar und deutlich. Sein Blick erfasste den Ort, an dem er gestorben und nun wiedergeboren worden war, strich über raues Mauerwerk, streifte die Bluteiche im Zentrum der unterirdischen Kammer und wanderte zu den Stufen, die in die Grabkammer führten.
Er blickte an sich herab. Die alten Gewänder umwehten seinem Leib, zerschlissen vom Atem der Zeit. Was von seinem Fleisch übrig geblieben war, hing in Fetzen von seinen Knochen. Maden wimmelten in der klumpigen Masse, bestrebt ihr Werk zu vollenden und seine Knochen zu säubern. Er streckte eine skelettierte Hand aus und fegte ein paar Maden von seinem Bein, wo ihm die Kniescheibe wie ein bleiches Auge entgegenstarrte. Voller Erstaunen betrachtete er seinen Arm, an dem sich Sehnen und Muskelstränge zu erneuern begannen und sich ausbreiteten, hinauf in die Schulter, weiter über seinen Oberkörper, in den anderen Arm und über seine Beine, bis sie seinen Körper wie ein neues Gewand verhüllten. Ein leises Krächzen verließ seine Kehle, als sich seine Stimmbänder neu bildeten und ihm nach all den Jahren die Fähigkeit, sich zu artikulieren, zurückbrachten. Das verweste Fleisch fiel wie welkes Herbstlaub von seinen Knochen. Darunter kam neues zum Vorschein, schon bald von einer Schicht rosiger Haut bedeckt, die seine Metamorphose beendete. Sein Herz schlug nicht und er atmete auch nicht. Dennoch war er nicht tot. Er war ein Diener des Schwarzen Königs – er trug die Macht seines Meisters in sich. Er würde dem Herrn seinen Großmut vergelten, indem er seine Jünger um sich scharte und alles für seine Rückkehr vorbereitete.
2
Zelte aus bunten Flicken leuchteten im Schein der Frühlingssonne und offenbarten schon von Weitem den Aufenthaltsort des Fahrenden Volkes. Vor, während und nach den Vorstellungen wimmelte es zwischen den Zelten von Besuchern. Menschen aus der Stadt und den umliegenden Dörfern kamen, um Kunststücke zu sehen, sich von Schauspielen bezaubern und von Gauklern unterhalten zu lassen.
Jetzt, da der Beginn der nächsten Vorstellung noch Stunden entfernt war, lag der Platz verlassen da. Nachdem der Regen der vergangenen Nacht den Boden in matschigen Sumpf verwandelte hatte, waren Gaukler, Akrobaten und Schauspieler noch nicht aus ihren Zelten hervorgekommen. Selbst die Schaulustigen, die sich sonst immer in der Nähe des Lagerplatzes aufhielten, hatten sich noch nicht blicken lassen.
Elyria streifte zwischen den Zelten hindurch und hielt die Nase in den Wind. Statt dem Dröhnen lachender, schwatzender Menschen hörte sie den Gesang der Vögel, unter den sich das gelegentliche Schnauben der Pferde mischte. Obwohl sie das bunte Treiben mochte, schätzte sie diese seltenen Augenblicke der Ruhe.
Mit ihren achtzehn Sommern war Elyria ein fester Bestandteil der Truppe. Sie war nicht nur eine geschickte Messerwerferin, sondern kümmerte sich auch mit um die Tiere und half den Schauspielern beim Einüben ihrer Rollen.
Seit sie denken konnte, war ihr Vater der Anführer der Gauklertruppe, die während des Sommers von Stadt zu Stadt reiste und sich mit ihren Vorstellungen den Lebensunterhalt verdingte. Im Winter zogen sie in den Süden und ließen sich an der Küste nieder, bis sie im Frühjahr ihre Reise wieder aufnehmen konnten.
Der Winter war gerade erst vorüber, die Straßen noch nicht lange frei von Eis und Schnee. Travencore war die erste Station in diesem Jahr. Die größte Stadt im Westen Cartómiens und zugleich die Stadt des Königs. Dennoch kamen Adlige nur selten zu den Vorstellungen. Sie hatten ihre eigenen Gaukler und Barden, die sie innerhalb der Mauern ihrer Burgen unterhielten. Wenn sich jedoch von Zeit zu Zeit ein Adliger blicken ließ, bedeutete das für die Truppe einen Segen an Münzen, der die Einnahmen eines ganzen Monats aufwog.
Am Zelt ihres Vaters blieb Elyria stehen. Sie streckte schon die Hand nach der Zeltplane aus, als seine Stimme an ihr Ohr drang.
»Elyria kommt allmählich in ein Alter, in dem ich daran denken sollte, sie zu verheiraten.«
Elyria ließ die Hand sinken. Heiraten? Sie hatte nie auch nur einen Augenblick gedacht, dass das Leben jemals anders sein könnte, als es im Augenblick war. Endlose Wege, die sie mit ihren bunt geschmückten Planwagen über die Straßen Cartómiens zu neuen Auftritten führten, und lange Abende am Lagerfeuer, im Kreise ihrer Freunde. Der Gedanke, diese Freiheit für einen Mann aufzugeben, war ihr noch nie gekommen. Und genau genommen behagte er ihr nicht sonderlich.
Neugierig spähte sie zwischen den Stoffbahnen hindurch, die den Eingang beinahe vollständig verhüllten. Ihr Vater stand vor einem Kohlebecken und wärmte sich die Hände über der Glut. Hinter ihm saß Dhori. Der mächtige Leib der Gauklerin versank in einem Stapel Kissen, der sonst Elyrias Vater als Sitzplatz diente. Ihr langes graues Haar schimmerte im Schein der Laterne wie Stahl.
Verschwommen erinnerte Elyria sich an eine Zeit, in der Dhori die Wahrsagerin der Truppe gewesen war. Ihr Vater hatte sie stets als die talentierteste Schauspielerin von allen bezeichnet. Wann immer die Sprache auf sie gekommen war, hatte er Elyria grinsend zugezwinkert. Das war seine Art, ihr zu sagen, dass er die alte Frau für eine Schwindlerin hielt. Dennoch war sie es gewesen, die der Truppe einst die größten Einnahmen beschert hatte. Sie hatte in einem verdunkelten Zelt gesessen und den Menschen gegen eine Münze aus der Hand gelesen oder ihnen die Runen geworfen.
Sie hat ihnen erzählt, was sie hören wollten. Als Kind war Elyria oft um Madame Dhoris Zelt herumgeschlichen, um zu belauschen, was sie den Menschen verkündete.
Seit der Zeit der Reinigung, die dem Krieg der Mächte gefolgt war, hatte Madame Dhori keine Auftritte mehr absolviert. Elyrias Vater hatte es für zu gefährlich befunden. In einer Zeit, in der jeder, der auch nur den Anschein von Magie erweckte, verfolgt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, wollte er nicht riskieren, dass die alte Scharlatanin für ihr Schauspiel brennen musste. Seither war sie nur noch Dhori, ein weiteres Mitglied der Truppe und ein Teil der Schauspieler, die Tag für Tag ihre Stücke darboten.
»Dem Mädchen sind andere Dinge vorbestimmt, Mícheil.« Dhori richtete sich in den Kissen auf. »Ihr Leben liegt nicht in deiner Hand. Sie hat ihre eigene Zukunft. Eine Zukunft, die nichts mit Heirat und Kindern oder dieser Truppe zu tun hat.«
Also keine Heirat. Um ein Haar hätte Elyria erleichtert aufgeseufzt, dennoch klangen Dhoris Worte beunruhigend. Was soll das heißen, meine Zukunft hat nichts mit dieser Truppe zu tun? Sie schüttelte den Kopf. Dhori war eine Betrügerin! Warum sollte sie ihr Beachtung schenken? Warum hörte ihr Vater ihr überhaupt zu?
»Vor vielen Jahren bist du zu mir gekommen und hast mir gesagt, dass sie ein besonderes Schicksal hätte. Seither hast du dich in Schweigen gehüllt. Und heute kommst du plötzlich und …« Elyrias Vater wandte dem Kohlebecken den Rücken zu und richtete seinen Blick auf Dhori. »Willst du mir nicht endlich sagen, was meine Kleine erwartet?«
»Ihre Zukunft liegt hinter den Nebeln der Zeit verborgen.« Dhoris Augen hefteten sich auf einen Punkt an der Zeltplane und hielten ihn fest. »Ich weiß nur, dass der Zeitpunkt, an dem sich ihre Bestimmung offenbaren wird, näher rückt.«
»Was meinst du mit Nebeln?«
Dhori zuckte schwerfällig die Schultern, ihre fleischigen Finger spielten unaufhörlich an einem Ring, drehten ihn mal in die eine, dann wieder in die andere Richtung. »Sie wird jemandem begegnen, Mann und Tier gleichermaßen. Diese Begegnung wird großen Einfluss auf ihr Leben haben.«
»Mann und Tier? Was ist das für ein Unsinn?«
Dhoris nächste Worte ließen seine Züge gefrieren. »Die Bilder sind unklar … Ihr Leben versinkt in der Dunkelheit. Gerade so, als …«
»… als wäre es ihr Ende?«
Dhori schwieg.
Elyria hielt den Atem an und klammerte ihre Finger in die Falten ihrer Röcke. Ihr Blick sog sich an der Miene ihres Vaters fest, folgte den harten Linien, die das Laternenlicht in seine Wangen kerbte, hinauf zu seinen Augen. Tiefe Sorge schwamm in seinem Blick. Um ein Haar wäre sie ins Zelt gestürmt, um ihn zu trösten. Der Gedanke an das Donnerwetter, das sie erwartete, wenn er herausfand, dass sie gelauscht hatte, hielt ihre Füße jedoch an Ort und Stelle verwurzelt. Warum erschrecken Dhoris Worte ihn so? Ausgerechnet ihr Vater, der immer über Wahrsager lachte, wirkte, als hätte Dhori vor ihm die Pforten zur Neunten Hölle aufgestoßen.
Endlich fand er seine Stimme wieder. Leise sagte er: »Seit mir dieser Mann das Mädchen brachte, wusste ich, dass sie etwas Besonderes ist. Dennoch war sie immer mein Mädchen.«
Elyria runzelte die Stirn. Natürlich war sie sein Mädchen. Sie war seine Tochter! Nachdem ihre Mutter am Winterfieber gestorben war, waren Gwynn und sie das Ein und Alles ihres Vaters gewesen. Das sagte er immer wieder. Elyria versuchte sich das Gesicht ihrer Mutter in Erinnerung zu rufen. Als sie starb, war Elyria gerade vier Sommer alt gewesen; zu jung um die Erinnerung für immer festzuhalten. Die sanften Züge der Frau mit dem goldenen Haar verblassten mit jedem Tag ein wenig mehr. Elyria streifte die düstere Erinnerung ab und lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf Dhoris Worte. Was für ein Mann soll mich gebracht haben?
Eine Hand legte sich auf ihre Schulter. Mit einem unterdrückten Aufschrei fuhr Elyria herum und blickte in Gwynns schelmisch blitzende blaue Augen. Sein rotblondes Haar schimmerte im Sonnenlicht. Er nahm sie bei der Hand und zog sie mit sich, zwischen den Zelten davon. Erst in sicherer Entfernung hielt er inne.
»Es dürfte Vater nicht gefallen, wenn er mitkriegt, dass du ihn belauschst.«
Elyria rümpfte die Nase. »Erzähl mir nicht, dass du das noch nie gemacht hast.«
»Habe ich«, stimmte er zu. »Deshalb weiß ich aus erster Hand, welchen Ärger man sich damit einhandeln kann. Davor will ich dich bewahren.«
Gwynn war nicht nur ihr Bruder, sondern zugleich ihr bester Freund. Tatsächlich schien er immer da zu sein, wenn Elyria in Schwierigkeiten war. Sie setzte an, ihm von dem merkwürdigen Gespräch zwischen ihrem Vater und Dhori zu berichten, und brach wieder ab, als ihr Blick auf einen dunklen Fleck im Schlamm fiel. Neugierig geworden trat sie näher. Es war ein Stück Tuch, halb im Morast versunken. Sie wollte sich schon wieder abwenden, als ihr die merkwürdige Form auffiel – etwas war darin eingewickelt. Elyria bückte sich danach. Es war schwerer, als sie erwartet hatte. Gespannt schlug sie den schmutzigen Stoff zurück und blickte staunend auf ein Medaillon von der Größe ihres Handtellers. Ein Sonnenstrahl spiegelte sich in der Oberfläche und badete es in Licht. Sie hob die Hand, um es besser sehen zu können. Nach und nach offenbarten sich die kunstvollen Gravuren in der silbernen Oberfläche und fügten sich zu einem Bild zusammen. Dem Antlitz der Weisen Mutter, der obersten Göttin der Bruderschaft der Erleuchteten.
Gwynn spähte in ihre Hand. »Was ist das?«
Elyria hielt ihm das Schmuckstück entgegen. Am Tag ihrer Ankunft waren sie im Tempel in Travencore gewesen, um die Götter um gute Geschäfte zu bitten. Da hatte Elyria das Medaillon gesehen – auf einem Podest unter dem Bildnis der Weisen Mutter.
»Ist es das, was ich denke?«, fragte Gwynn.
Sie nickte.
Gwynn stieß einen Pfiff aus. »Das bringt sicher einen guten Preis! Wenn wir –«
»Bist du übergeschnappt!«, fuhr sie ihn an. »Jeder würde es sofort erkennen! Das würde uns den Kopf kosten!« Sie hatte Geschichten gehört, dass bestimmte Gegenstände, die den Göttern geweiht waren, jederzeit von den Männern der Bruderschaft gefunden werden konnten. Was, wenn sie inzwischen wissen, wo es ist, und die Truppe mit seinem Verschwinden in Verbindung bringen? »Wir müssen es zurück in den Tempel bringen.«
»Jetzt bist du die Übergeschnappte!« Gwynn schüttelte den Kopf. »Die werden uns dafür verantwortlich machen. Wirf es einfach weg.«
Er wollte nach dem Medaillon greifen, doch Elyria schloss die Faust darum. »Ich werde es zurückbringen. Du kennst die Geschichten über Flüche, die einen befallen, wenn man das Eigentum der Götter nicht mit dem Respekt behandelt, der ihm gebührt.« Ein Medaillon wegzuwerfen, das der Weisen Mutter geweiht war, konnte man zweifelsohne als respektlos betrachten. Elyria wusste nicht, ob die Geschichten der Wahrheit entsprachen. Ganz sicher hatte sie nicht vor, es herauszufinden. »Ich werde es einem Priester geben. Gleich jetzt.«
Gwynn verzog das Gesicht. »Ich mache das.«
Du würdest es nur irgendwo verschwinden lassen. Sie schüttelte den Kopf, wickelte das Medaillon wieder ein und verstaute es in den Falten ihres Kleides. »Bis zur Vorstellung bin ich zurück.«
*
Elyria schlenderte durch die Gassen Travencores wie eine harmlose Spaziergängerin auf dem Weg zum Markt. Je näher sie dem Tempel kam, umso heftiger hämmerte ihr Herz in ihrer Brust. Eng stehende Häuser neigten sich weit in die Gassen, die Kamine schienen sich wie schattige Finger nach Wanderern auszustrecken. Elyrias Augen hefteten sich auf das weiß-goldene Mauerwerk des Tempels, das schon von Weitem zu sehen war. Nie zuvor hatte ein Tempel so bedrohlich gewirkt. Bisher hatte sie darin immer einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit gesehen. Aus den Erzählungen ihres Vaters wusste sie, dass die Götter noch nicht lange ihren Weg in die Herzen der Menschen gefunden hatten. Sie war jedoch zu jung, um sich an den Krieg der Mächte und an den Wechsel des Glaubens, der sich während dieser Zeit vollzogen hatte, zu erinnern. Ihr Vater hatte sie wohl behütet und alle Gefahren, die während jener Zeit gelauert hatten, von ihr und der Truppe fern gehalten. Elyria glaubte, sich zu entsinnen, wie die Truppe früher oft vor einer Bluteiche haltgemacht hatte, um Früchte und Getreide als Opfergaben für die Mächte der Ewigkeit darzubringen, auf dass ihnen eine gefahrlose Reise beschert sein mochte. Das war lange her. Heute erinnerten lediglich die verbrannten Skelette der heiligen Bäume – einem Mahnmal gleich – an die finstere Ära der Druiden und Magier. Wer heute betete, tat das zu den Göttern der Bruderschaft der Erleuchteten.
Die Geschichte, wie die Götter das erste Mal Kontakt zu den Menschen gesucht hatten, gehörte zu Elyrias Lieblingsgeschichten. Man sagte, die Götter weilten schon lange vor den Menschen auf Cartómien. Schon als Tyr Berengar, der erste Nebellord, seine Leute auf den Kontinent führte, hatten sie über das Schicksal der Menschen gewacht, ohne sich ihnen zu offenbaren. Die Weise Mutter hielt ihre Söhne Laecan, den Gott des Todes, und Dergas, den Gott des Krieges, im Zaum und wachte über ihre Tochter Elúere, die Göttin der Fruchtbarkeit. Der Große Vater hielt seine schützende Hand über das Land, ohne dass je ein Mensch von ihnen erfuhr.
Erst Jahrhunderte später, als Caldiran, der Wanderer – ein anständiger und aufrechter Mensch – in große Gefahr geriet, offenbarte sich ihm der Gott des Todes. Laecan sagte ihm, dass er gekommen sei, ihn in sein Reich zu holen. Doch er hatte Mitleid mit dem tapferen Mann, der sein Leben geben sollte, weil er ein Kind vor dem Tode bewahrt hatte und dabei selbst von den Klippen gestürzt war. Laecan verschonte ihn und trug ihn ins Leben zurück. Zum Dank sollte Caldiran den Menschen von den Göttern berichten.
Ab da trug der Gerettete das Wissen in die Welt. Lange Zeit kaum beachtet traf er im Laufe seiner Wanderjahre auf andere, die wie er diesen Göttern begegnet waren. Sie schlossen sich zur Bruderschaft der Erleuchteten zusammen, bauten Schreine und Gebetshäuser und wurden doch nur von den Menschen, die fest im Druidentum verwurzelt waren, belächelt. Erst der Krieg der Mächte hatte es vermocht, die Götter ins Bewusstsein der Menschen rücken zu lassen.
Elyria erreichte den Marktplatz. Sie überquerte ihn und ging mit großen Schritten dem Tempel entgegen. Das Medaillon, das sie in den Falten ihres Gewandes verborgen hielt, schien mit jedem Schritt schwerer zu wiegen. Ihre Handflächen waren feucht, ihre Finger zitterten. Warum habe ich Gwynn nicht gehen lassen? Doch sie wusste, warum sie darauf bestanden hatte, das Medaillon selbst zurückzubringen. Es war ihm zuzutrauen, dass er es doch noch irgendwo in ein Gebüsch warf, statt es den Göttern zu geben. Ganz sicher wollte sie nicht, dass er den Zorn der Götter auf sich zog. Sie würde kein Risiko eingehen und das Artefakt selbst zurückbringen.
Ohne innezuhalten, stieg sie die Stufen empor und tauchte in die Schatten des Eingangsportals. Ein sanfter Lufthauch kühlte ihre erhitzten Wangen. Sie verneigte sich vor dem Abbild des Vaters und der Mutter, die neben dem Portal in den Stein getrieben worden waren, und betrat das Haus der Götter.
Sie folgte dem langen Gang an den Bankreihen entlang, die den Weg zum großen Altar säumten, und trat zwischen den Säulen an der Längsseite des Gebäudes hindurch. Die wenigen Gläubigen, die sich zu dieser frühen Stunde zum Gebet eingefunden hatten, schenkten ihr keine Beachtung. Am Altar entzündete ein Priester Kerzen. Elyria hielt auf ihn zu. Kurz bevor sie ihn jedoch erreichte, bekam sie es mit der Angst zu tun. Was, wenn er ihr nicht glaubte, dass sie das Medaillon gefunden hatte? Ihr Blick zuckte zur Seitenwand, wo der Schrein der Weisen Mutter in einer schattigen Nische lag. Es war besser, das Schmuckstück unbemerkt an seinen Platz zu legen. Elyria verließ den Mittelgang und ging zum Schrein. Ihre Röcke raschelten vernehmlich, als sie davor niederkniete und ein leises Gebet zu sprechen begann, das sie seit ihrer Kindheit kannte. Ohne den Kopf zu bewegen, ließ sie ihre Augen umherschweifen. Die Säulen zeichneten lange Schatten auf den hellen Steinboden, die Wände versanken in Dunkelheit. Niemand war in der Nähe. Ohne ihr Gebet zu unterbrechen, ließ sie ihre Hand zum Medaillon wandern. Noch einmal sah sie sich um. Nichts. Da zog sie das Medaillon zwischen den Falten ihres Gewandes hervor und streckte die Hand aus, um es unter dem Bildnis der Mutter abzulegen.
»Haben wir dich!« Ein Mann trat zu ihrer Linken aus dem Schatten einer Säule. Zwei weitere zu ihrer Rechten. Sie trugen die Uniform der Ordenskrieger, strahlend weiße Waffenröcke über silbern glitzernden Kettenhemden. Jeder von ihnen hatte einen Dolch im Gürtel stecken.
»Du bist verhaftet, Diebin!«, sagte einer zu ihrer Linken.
»Ich bin keine Diebin.« Elyria zog die Hand mit dem Medaillon zurück. »Ich habe es gefunden und wollte es zurückbringen.«
Der Mann, der als Erster gesprochen hatte, trat vor und nahm ihr das Medaillon aus der Hand. Er wickelte das Schmuckstück aus dem Tuch und legte es an seinen Platz – denselben, an den auch Elyria es hatte legen wollen. »Du wurdest gesehen – an dem Tag, an dem es verschwand. Und heute bist du wieder hier. Mit dem Medaillon. Das genügt, deine Schuld zu beweisen.«
»Ihr könnt doch nicht –«
»Das Urteil wurde soeben verhängt.« Sein Ton war selbstsicher, als wäre es für ihn nichts Besonderes. »Du erhältst das Brandmal einer Diebin. Du kannst dich glücklich schätzen ob meiner Gnade. Hättest du es nicht zurückgebracht, hätte ich dir die Hände abhacken und die Augen ausstechen lassen, auf dass weder deine Finger noch deine Blicke jemals wieder berühren mögen, was den Göttern geweiht.«
»Aber –« Ihre Worte erstarben, als er sie packte und auf die Beine riss. Dann hatte sie ihre Stimme wieder gefunden. »Hört mich an!« Schwankend wie ein Schiff auf hoher See verließen die Worte ihren Mund. »Ihr müsst mir glauben! Ich habe es nicht gestohlen. Ich habe es gefunden!«
»Halt den Mund!«, zischte einer der Männer und schlug ihr in den Nacken.
»Bitte.« Panik durchströmte ihre Adern wie Eis und tötete jeden Funken Wärme. Ihre Absätze scharrten über den Steinboden, als die Ordenskrieger sie aus dem Tempel zerrten, dem Kerker der Bruderschaft entgegen.
3
Eddan Peristae, der Oberste Hexenjäger, trat aus der Kerkerzelle auf den Gang. Er zog ein Tuch aus dem Ärmel und wischte seine blutigen Finger daran ab. Sein Blick wanderte geistesabwesend den fensterlosen Gang entlang. Gespräche wie jenes, das gerade hinter ihm lag, bereiteten ihm keine Freude. Es gefiel ihm nicht, Geständnisse mit Gewalt zu erzwingen. Doch seine Aufgabe ließ ihm nur selten eine Wahl. Nur die wenigsten, die sich der Hexerei verschrieben hatten, waren geständig.
Der Mann, dessen geschundener Leib nun in der Zelle auf den Scheiterhaufen wartete, war einer der letzten Druiden. Ein Anhänger der Finsteren Künste, der der Zeit der Reinigung entkommen und erst jetzt aufgegriffen worden war. Zweifelsohne hat er seine Zauberkraft genutzt, sich zu verbergen. Ein grimmiges Lächeln streifte wie ein Windhauch über Peristaes Züge. Geholfen hat dir deine Macht nichts. Die Götter sind gerecht. Sie lassen verderbte Kreaturen wie dich nicht entkommen. Letztendlich hatte auch dieser sein beharrliches Schweigen gebrochen und gestanden. Im Morgengrauen würde er brennen.
Peristae war zufrieden mit dem Ergebnis des Verhörs, hatte er doch von Anfang an gewusst, wie es enden würde. Manchmal konnte er Magie sogar riechen. Ein Aroma ähnlich blühendem Jasmin. Je stärker die Kraft desto ausdrucksvoller war der Geruch. Magie zu riechen war seine Gabe. Ein Segen der Götter. Aber nicht zuverlässig genug, um sich allein darauf verlassen zu können.
Gerade wenn seine Gefangenen nicht geständig waren, musste er sichergehen. Er konnte sich nicht erlauben, einen Fehler zu machen und einen Zauberwirker davonkommen zu lassen, weil er sich gescheut hatte zu härteren Mitteln zu greifen und stattdessen nur seinen Geruchssinn einsetzte. Die Magie musste an der Wurzel gepackt und aus dem Acker der Welt gerissen werden. Zu viel Leid hatte sie über die Menschen gebracht. Zu viele Tote. Darunter seine eigene Familie, die im Krieg der Mächte unter dem Sturm der entfesselten Magie den Tod gefunden hatte. Sein ganzes Dorf war damals vernichtet worden. Peristae war schon immer ein glühender Anhänger der Bruderschaft der Erleuchteten gewesen. Doch erst der Tod seiner Frau und seines Sohnes hatte ihm bewusst gemacht, dass Glaube allein nichts zu bewirken vermochte, nicht, wenn man nicht bereit war, auch dafür zu kämpfen. Die Gründung der Söhne Eaghans war seiner Initiative und der Unterstützung des Ersten Bruders, des Hohepriesters der Bruderschaft, zu verdanken. In Zukunft sollte niemand mehr fürchten müssen, seine Familie durch finsteres Zauberwerk zu verlieren.
Schreie durchbrachen die Mauer, die seine Gedanken um ihn errichtet hatten, und rissen ihn in die Wirklichkeit zurück. Noch immer rieb er seine Finger an dem Tuch. Der weiße Stoff hatte sich rot gefärbt, doch seine Hände waren noch nicht sauber. Getrocknetes Blut klebte in den feinen Linien seiner Handflächen. Einen Augenblick lang starrte er darauf, als wäre es eine Landkarte, die ihm den Weg in die Zukunft weisen sollte. Dann erklangen erneute Schreie. So verzweifelt und voller Angst, dass sich die feinen Härchen an seinen Armen aufrichteten. Sein Blick flog den Gang entlang zu einer offenen Kammer. Schwarze Schatten türmten sich im Fackelschein, wuchsen an und schrumpften unter dem Zucken der Flammen wieder zusammen, um einen Atemzug später erneut anzuwachsen. Er blinzelte. Die Schattengebilde fielen in sich zusammen und gaben den Blick auf den Kerkermeister frei. Vor ihm kniete eine junge Frau, von zwei seiner Gehilfen am Boden gehalten. Ihre Schreie waren es, die durch den Gang an sein Ohr krochen und sich wie ein Dorn in sein Herz bohrten. Die Männer hielten ihre Arme zur Seite gestreckt und verdrehten sie, bis sie sich kaum mehr bewegen konnte. Lange dunkelbraune Locken fielen ihr ins Gesicht und verhüllten es wie ein Schleier. Sie stemmte sich gegen den Griff und versuchte sich zu befreien. Vergeblich. Auf einen Wink des Kerkermeisters riss ihr einer das Kleid von den Schultern und entblößte zarte, sonnengebräunte Haut.
Peristae kam näher, um einen Blick auf ihr Gesicht zu erhaschen. Noch immer zwang der Griff der Männer sie, den Kopf gesenkt zu halten. Hätte sie ihn gehoben, hätten sie ihr die Schultern aus dem Gelenk gekugelt. Sie schrie und kämpfte gegen die Männer an, ohne etwas auszurichten. Noch während er sich fragte, was sie getan haben mochte, fiel sein Blick auf die Feuerschale. Ein Brandeisen lag in der Glut bereit. Eine Diebin also. Fast hatte er Mitleid.
Ihre Schreie gingen mehr und mehr in ein erschöpftes Keuchen über. Peristaes Blicke strichen ihren Rücken hinab. Feine Schweißperlen überzogen ihre Haut und glitzerten im Fackelschein wie Diamanten.
Der Kerkermeister griff nach dem Brandeisen. Glühend rot wie ein dämonisches Auge starrte es der Haut der Frau entgegen. Die Gehilfen packten sie fester. Der Kerkermeister setzte an. Zischend fraß sich das glühende Eisen in ihre Schulter. Brüllend riss sie den Kopf zurück. Ihr Haar glitt zur Seite und offenbarte für einen Atemzug ihre Züge. Peristaes Blick saugte sich an ihren Augen fest. Schmerz trübte ihren Blick, ohne jedoch den goldenen Schimmer zu verbergen, der seine Aufmerksamkeit gefangen nahm. Eisige Hände griffen nach seinem Herzen und drohten es zu zermalmen. Die Luft schien in Flammen zu stehen und ließ jeden Atemzug zu einer sengenden Qual werden. Unfähig sich zu bewegen, wurde er von den lodernden Flammen ihrer Augen gefangen gehalten. Dann gaben die Männer sie frei. Sie sank zu Boden. Der Bann war gebrochen.
Wie vom Donner gerührt stand der Oberste Hexenjäger da. Diese Augen. Hatte er jemals derartiges Entsetzen verspürt wie beim Anblick dieser Augen?
Nur langsam kehrte seine Fassung zurück. Er riss seinen Blick von ihr los und fixierte den Kerkermeister. »Schaff sie in eine meiner Zellen«, befahl er grob.
Der Kerkermeister sah auf. Schweiß glänzte auf seinem kahlen Schädel. »Herr?«
»Du hast mich verstanden!« Peristae wartete nicht, bis die Kerkertür hinter ihr ins Schloss fiel. Er wusste, dass der Kerkermeister nicht wagen würde, sich seinem Befehl zu widersetzen. Mit großen Schritten stürmte er den Gang entlang, vorbei an der Frau und ihren Wachen. Der Geruch von verbranntem Fleisch hing schwer in der Luft.
Er hastete die Stufen zum Turm hinauf in sein Studierzimmer. Dort angekommen stürmte er zum Schreibtisch, riss eine Schublade heraus und griff nach der Holzkassette, die er seit Langem darin aufbewahrte. Mit der freien Hand fegte er den Tisch leer. Papiere wirbelten durcheinander und segelten, wie von Geisterhand getragen, langsam herab. Das Tintenfass fiel zu Boden und zerbrach. Peristaes Blick legte sich auf das Kästchen, strich langsam über das dunkel glänzende Holz der Pelleron-Kiefer und folgte den goldenen Beschlägen, die die Kanten zierten. Zögernd streckte er die Hand danach aus. Seine Finger strichen über die glatte Oberfläche, ehe er nach dem Verschluss griff, ihn zurücklegte und bedächtig die Kassette öffnete. Aus dem Inneren starrte ihm eine Schriftrolle entgegen, vergilbt und halb zerfallen.
Peristae kannte ihren Inhalt – zumindest jenen Teil, der noch zu entziffern war. Und doch musste er sich mit eigenen Augen vergewissern, dass er sich nicht irrte. Das brüchige Pergament knisterte unter seiner Berührung, als er es vorsichtig entrollte. Seine Augen flogen über die verblasste Tinte, folgten den verschwommenen Linien zu jener Stelle, nach der er gesucht hatte. Lautlos formten seine Lippen die Worte, die sein Auge aufnahm. »Sie, in deren goldenen Augen die Feuer der Neunten Hölle brennen, wird ihre Magie in einem alles zerstörenden Sturm entfesseln …« Die folgenden Worte waren nicht lesbar. Erst weiter unten waren wieder einige Passagen des Textes zu entziffern. Passagen, die in so grässlicher Genauigkeit von der Zerstörung der Welt kündeten, dass er nicht wagte, sie ein weiteres Mal zu lesen. Er ließ das Pergament sinken.
Goldene Augen. Wie das Mädchen im Kerker. Seit der Erste Bruder die Schriftrolle an ihn übergeben und er sie studiert hatte, hielt Peristae nach diesen Augen Ausschau. Sie hat so harmlos und verängstigt gewirkt. Würde ein Mensch, der über derartige Macht verfügte, zulassen, dass man ihn brandmarkte? Wenn sie nicht will, dass man ihre Magie entdeckt, ist ihr womöglich keine andere Wahl geblieben.
*
Die nächsten beiden Tage verbrachte Peristae in seinem Turmzimmer. Er wies jeden ab, der ihn sprechen wollte, und widmete seine Zeit dem Studium der alten Schriften, ohne etwas zu finden, das er nicht ohnehin schon gewusst hätte. Schließlich stieg er erneut in den Kerker hinab.
Er hatte seine Gehilfen angewiesen, das Mädchen in eine seiner Verhörkammern zu verlegen. Einen Raum, dessen Wände vollständig mit einer dünnen Schicht Eisen verkleidet waren. Das Metall unterbrach den Fluss der magischen Energie und verhinderte, dass die Kraft nach außen dringen konnte. Kein Zauberwirker hatte diesen Raum je gegen Peristaes Willen verlassen. Außerdem trug Peristae einen Ring mit dem Zeichen der Bruderschaft, in den der Segen der fünf Götter eingewebt war. Dieser Ring hatte ihm schon früher unschätzbare Dienste geleistet und ihn während der Zeit der Reinigung vor magischen Angriffen beschützt. Magie vermochte nicht ihn zu berühren, solange er das Schmuckstück der Götter trug. Er hätte noch weitere Vorkehrungen treffen können, um ihre Magie zu unterdrücken. Wenn er sie jedoch überführen wollte, musste er mit eigenen Augen sehen, wie sie auf ihre Schwarze Kunst zurückgriff.
Fackeln hingen an den Wänden und tauchten den Raum in träges Licht. Peristaes Blick streifte die Folterbank im Zentrum und blieb kurz an einem Tisch daneben hängen, wo sich, verborgen unter einem Tuch, die Umrisse seiner Werkzeuge abzeichneten. Alles war bereit.
Mit einem grimmigen Nicken richteten sich seine Augen auf die junge Frau. Sie kauerte in einer Ecke, die Arme um die Knie geschlungen, den Kopf gesenkt, und rührte sich nicht. Ihre rostroten Röcke waren zerknittert und schmutzig. Er atmete durch die Nase ein und prüfte den Geruch im Raum. Keine Spur von Jasmin. Noch nicht.
»Du weißt, warum du hier bist?«, fragte er und trat einen Schritt auf sie zu.
Sie hob den Kopf und offenbarte ein Gesicht, das unter all dem Schmutz ansehnlich sein mochte. Sie war jung. Viel jünger als jeder Zauberwirker, dem er je begegnet war. Tränen hatten helle Spuren auf ihren Wangen hinterlassen. Doch es war nicht ihr Gesicht, das seine Aufmerksamkeit auf sich zog, sondern ihre Augen. Sie waren von einem warmen Braunton, mit bernsteinfarbenen Sprenkeln. Nicht golden. Er hatte sich geirrt.
Auf dem Gang hat es so ausgesehen … Er schüttelte den Kopf. Er würde sie gehen lassen. Sobald er sicher sein konnte, dass er sich tatsächlich geirrt hatte.
»Ich habe nichts getan.« Die Worte kamen schleppend und leise, als trugen sie ihren Schmerz nach außen. Erst jetzt bemerkte er das Fieber in ihrem Blick.
»Wie ist dein Name?«
Misstrauen lauerte in ihren Augen. Er glaubte schon, sie würde nicht antworten, dann sagte sie: »Elyria.«
»Elyria«, wiederholte er und nickte. Seine Augen hafteten auf ihr, verfolgten jede noch so winzige Regung. »Ich bin Eddan Peristae, der Oberste Hexenjäger der Bruderschaft der Erleuchteten.« Ihre Augen weiteten sich. Eine vertraute Reaktion. »Dies ist die Eisenkammer. Du bist hier, weil ich glaube, dass du eine Hexe bist.«
Sie fuhr hoch und kam taumelnd zum Stehen. Zum ersten Mal entdeckte er einen Funken Leben in ihren Augen. »Was habe ich Euch und Euren Ordensbrüdern getan, dass Ihr mich so quält?« Ihre Stimme klang rau und brüchig. Der Schmerz des Brandeisens wütete noch immer in ihrem Körper und schwächte sie. »Hattet Ihr nicht Euren Spaß, zu sehen, wie eine Unschuldige gebrandmarkt wird?«
»Ob du unschuldig warst oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Mir geht es einzig und allein darum, herauszufinden wer du wirklich bist.« Er verschränkte die Arme vor der Brust und betrachtete sie. Sie wankte und schien kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Ihre Hände tasteten Halt suchend nach der Wand. Ihr Blick zuckte von einer Seite zur anderen wie ein Tier in der Falle, auf der Suche nach einem Fluchtweg. »Weißt du«, fuhr er fort und begann langsam auf und ab zu gehen, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen, »ich habe das schon unzählige Male gemacht. Jedes Verhör verläuft ähnlich. Ich versuche mit den Verdächtigen zu sprechen. Die meisten sind verstockt und weigern sich mit mir zusammenzuarbeiten. Dabei will ich ihnen Leid ersparen.« Er seufzte. »Wenn ein Gefangener nicht kooperieren will, bin ich gezwungen zu anderen Mitteln zu greifen. Schmerzhaften Mitteln. Manchmal dauert es eine Weile, bis sie, um Erlösung bettelnd, aufgeben. Die meisten jedoch ertragen die Qualen nicht lange.«
Das Mädchen erweckte nicht den Eindruck, als könne es seiner Befragung auch nur für kurze Zeit widerstehen. Warum war es so schwach? Er griff nach ihrem Kleid und zog es von ihrer Schulter. Der Stoff löste sich mit einem vernehmlichen Laut. Sie schrie auf. Eiter und Wundwasser hatten das Gewebe mit dem entzündeten Brandmal verklebt. Ihr knickten die Beine ein. Peristae hielt sie fest, ehe sie stürzen konnte. Sie zitterte unter seinem Griff, und ihre Haut glühte vor Hitze. Dennoch versuchte sie, sich ihm zu entziehen, doch sie war zu schwach, ihn von sich zu stoßen. Sobald er sicher war, dass sie nicht zusammenbrechen würde, gab er sie frei und trat an den Tisch, der neben der Folterbank stand. Mit einem Ruck zog er das Tuch zur Seite und offenbarte den Blick auf die Werkzeuge, die darunter aufgereiht lagen. Das Mädchen sog scharf die Luft ein. Peristaes Finger glitten über einen Dolch, streiften ein Paar Daumenschrauben und einen Hammer, ehe sie über einem Lederriemen innehielten. »Du solltest mir die Wahrheit sagen, Elyria. Ich möchte dir nicht unnötig wehtun müssen.« Er packte die Enden des Riemens und zog sie mit einem heftigen Ruck auseinander, dass es schnalzte.
Elyria zuckte zusammen. »Ich habe nichts getan.« Die Worte krochen aus ihrem Mund, stockend und zäh. Sie wirkte so schwach, dass Peristae nicht wagte, eine eingehende Befragung vorzunehmen. Sie würde sterben, ehe er die Wahrheit über sie herausgefunden hatte. Er runzelte die Stirn. Was wollte er noch herausfinden? Er hatte ihre Augen gesehen. Auf dem Gang waren sie golden gewesen, dessen war er sich sicher. Dass sie es jetzt nicht mehr waren, mochte vieles bedeuten. Sicher war sie imstande, die Farbe ihrer Augen zu verändern und so darüber hinwegzutäuschen, was sie wirklich war. Peristaes Finger umklammerten die Enden des Riemens. Alles in ihm schrie danach, die Wahrheit aus ihr herauszupressen. Was machte es schon, wenn sie dabei starb? Sie würde ohnehin auf dem Scheiterhaufen brennen! Ich könnte mich geirrt haben. Der Gedanke, womöglich den Tod einer unschuldigen Seele zu verantworten, bedrückte ihn. Nein, er konnte nicht zulassen, dass sie starb, ohne ein Geständnis abgelegt zu haben. Er brauchte einen Beweis für ihr ruchloses Zauberwerk – und er würde ihn bekommen! Wenn nicht jetzt, dann zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es ihr besser ging. Heute wollte er von seinen gewohnten Methoden Abstand nehmen, dennoch würde er ihr einige Fragen stellen. Vielleicht reichte der Anblick seiner Werkzeuge aus, um sie zum Sprechen zu bringen.
»Zu verleugnen, was du bist, wird dir nicht helfen. Ich werde die Wahrheit herausfinden.« Er legte den Riemen zur Seite und griff nach dem Hammer. »Weißt du, welchen Schaden man damit anrichten kann?« Krachend ließ er das Werkzeug auf die Folterbank herniederfahren. »Stell dir vor, deine Hand hätte darunter gelegen.«
Die Augen starr auf den Hammer gerichtet, presste sie ihre Hand schützend an den Körper. »Ich bin unschuldig.«
War da ein erster Anflug von Panik in ihrer Stimme? Jetzt schon? Sie würde nicht lange durchhalten. Schon bald würde sie gestehen oder auf ihre Magie zugreifen, um sich zu verteidigen. Dann hatte er seinen Beweis.
»Du bist verstockt.« Er legte den Hammer zur Seite und griff erneut nach dem Riemen. Langsam trat er näher, dabei sog er prüfend die Luft ein. Noch immer nicht der leiseste Hauch von Jasmin. Sie mochte schwach sein, doch sie hatte ihre Magie unter Kontrolle und verbarg sie geschickt. Dennoch werde ich sie finden! Seine Frau und seinen Sohn hatte er nicht retten können, doch er wollte verdammt sein, wenn er zulassen würde, dass die verderbte Kunst weitere Familien zerstörte. Wut und Trauer erfassten ihn und trieben ihn voran, wie sie es schon während der vergangenen Jahre getan hatten. Wenn er die Augen schloss, konnte er hören, wie seine Frau um Hilfe rief, ehe das magische Feuer ihrem Leben ein Ende setzte. Er hörte das Schreien eines Säuglings und wusste, es war sein Sohn, dem er nicht mehr helfen konnte. Peristaes Finger klammerten sich um den Riemen. Die Hexe sollte bezahlen! Ein entsetzlicher Schrei, erfüllt von Furcht und Qual, drang an seinen Verstand. Ich kann nichts mehr für dich tun, Ilani, ebenso wenig wie ich Padraig noch retten kann. Verzeiht mir! Doch der Schrei wollte nicht verstummen. Nur langsam wurde ihm bewusst, dass es weder seine Frau noch sein Sohn waren, die da schrien. Während er sich noch fragte, wen er da hörte, lichtete sich der Schleier des Zorns und eröffnete ihm erneut den Blick auf Elyria.
Sie war in eine Ecke zurückgewichen. Ein zorniger roter Streifen zeichnete ihre Wange dort, wo der Lederriemen in ihre Haut geschnitten hatte, weitere Striemen auf ihrem Arm und den Handrücken kündeten davon, dass sie versucht hatte, sich vor seinen Angriffen zu schützen. Entsetzt ließ Peristae den Arm sinken. Wie hatte er sich so vergessen können? Der Verlust seiner Familie peinigte ihn jeden Tag aufs Neue, doch nie zuvor hatte er darüber die Verantwortung vergessen, die seine Aufgabe mit sich brachte. Der Schutz unschuldigen Lebens! Solange nicht erwiesen war, dass das Mädchen vor ihm tatsächlich eine Hexe war, galt auch sie als unschuldig. Seine Trauer, der Hass auf alles Zauberwerk und der Gedanke, dass dieses Mädchen womöglich die gefährlichste aller Hexen war, hatte ihn für einen Augenblick die Fassung verlieren lassen. Das durfte nicht noch einmal geschehen!
Ein Schluchzen vibrierte in ihrer Kehle und drängte zitternd nach außen. Dann gaben ihre Beine nach. Sie fiel auf die Knie. Heftig atmend hielt sie den Blick auf ihn gerichtet. Ihre Augenlider flatterten, und sie schien kaum noch in der Lage, ihn länger zu fixieren. Sie stand kurz davor, die Besinnung zu verlieren. Und noch immer griff sie nicht auf Magie zurück.
Vielleicht hat sie wirklich keine.
»Du bist das Mädchen mit den goldenen Augen!« Die Worte waren mehr dazu gedacht, sich selbst von ihrer Bösartigkeit zu überzeugen, als der Versuch, sie mit dieser Anschuldigung zu konfrontieren. Bei ihrem Anblick schnürte es ihm die Kehle zu. Wie sollte dieses zierliche Geschöpf eine Hexe sein? »Warum benutzt du deine Magie nicht, um dich zu schützen?«
Ihre Lippen bewegten sich, Worte formend. Zu leise, als dass er sie hätte verstehen können. Er beugte sich herab und brachte sein Ohr nahe an ihren Mund.
»Ich habe … nichts … getan.« Wie ein Flüstern strichen die Worte über seine Wange und fanden den Weg in sein Ohr. Er kannte die feinen Abstufungen der menschlichen Stimme. Der Schmerz und die Angst waren echt. Keine Gaukelei, um über magische Fähigkeiten hinwegzutäuschen. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Und noch immer lag keine Spur von Jasmin in der Luft.
»Es tut mir leid.« Er hob die Hand und strich ihr übers Haar. »Aber ich kann dich nicht gehen lassen. Ich muss sichergehen.« Es bestand noch immer die Möglichkeit, dass sie ihre Magie verbarg. Wenn sie das Mädchen mit den goldenen Augen war, musste sie etwas Besonderes sein. Besser und stärker als alle Hexen und Zauberwirker, mit denen er bisher zu tun gehabt hatte. Erst, wenn sie alle Prüfungen überstanden hatte, ohne Magie zu entfesseln, konnte er sicher sein, dass sie keine Hexe war. Mit ihr musste er weiter gehen, als er es je mit einem Gefangenen getan hatte. Für den Augenblick jedoch war ihr nicht mehr zuzumuten. Nicht, wenn er sie nicht umbringen wollte.
4
Eine Berührung an ihrem Hals riss Elyria in die Welt zurück. Ein kühles Band, das sich um ihre Kehle schloss. Mit ihrem Bewusstsein kam der Schmerz, der wie ein lauerndes Raubtier in der Dunkelheit gewartet hatte. Ein Stöhnen kroch über ihre Lippen. Ihr Körper brannte vom Fieber, das auch ihren Verstand umfangen hielt. Sie wagte nicht die Augen zu öffnen. Zu sehr fürchtete sie sich vor dem, was sie sehen würde.
Ihre Finger ertasteten etwas, das eine Holzpritsche sein mochte. Sie lag auf dem Bauch. Ein kühler Lufthauch strich über ihren Rücken und ließ sie frösteln. Da erst wurde ihr bewusst, dass jemand das Oberteil ihres Kleides zur Seite geschoben hatte.
Eine Berührung an der Schulter, dort wo das Brandeisen ihr Fleisch gezeichnet hatte, riss sie aus ihrer Erstarrung. Schmerz flammte auf und ließ sie die glühende Hitze des Metalls in unzähligen Echos spüren. Mit einem Schrei fuhr sie hoch.
»Schsch. Es wird gleich besser.« Die sanfte Stimme eines Mannes durchbrach den Nebel, der sich erneut über ihr Bewusstsein legen wollte. Eine Hand auf ihrer unversehrten Schulter hinderte sie daran, sich zu bewegen. Elyria sank auf die Pritsche zurück. Sie versuchte die Augenlider zu heben, doch der Schmerz ließ es nicht zu. Trotz des Fiebers fror sie plötzlich erbärmlich. Zitternd wartete sie, dass der Schmerz abklang, während sie sich von der Stimme durch die Dunkelheit führen ließ.
»Es wird nachlassen.« Er berührte ihre Schulter erneut. Stöhnend bäumte sie sich auf. Das Letzte, was sie wahrnahm, war eine kühle Paste, die sich über das Brandmal schmiegte.
Als sie das nächste Mal zu sich kam, war der Schmerz zu einem dumpfen Pochen abgeflaut, und selbst das Fieber schien ein wenig gesunken zu sein. Dieses Mal wagte sie, die Augen zu öffnen. Der flackernde Schein einer einzelnen Fackel bohrte sich schmerzhaft in ihre Augen. Sie lag bäuchlings auf einer Kerkerpritsche. Im Gegensatz zu vorher fror sie nun nicht mehr. Sie spürte den Stoff ihres Kleides und die warme Last einer Decke um ihren Körper. Ihr Blick wanderte über die feuchten Steinmauern. Ein Schatten bewegte sich über die Wand, wuchs an und verschlang mehr und mehr von der Umgebung. Elyria fuhr zusammen, als sie das leise Rascheln von Gewändern vernahm. Sie war nicht allein!
Vorsichtig wandte sie sich um. Augenblicklich kehrte der Schmerz zurück. Sie biss sich auf die Unterlippe und unterdrückte einen gequälten Aufschrei. Kräftige Hände griffen nach ihr und halfen ihr sich aufzusetzen. Der Schatten hüllte sie nun vollends ein. Nur langsam gab die Dunkelheit Einzelheiten preis. Die eindrucksvolle Statur eines Kriegers, das lange blonde Haar zu einem Zopf gebunden. Sein ebenmäßiges Gesicht, ein Gemälde aus Licht und schattigen Flächen, die Augen grün wie Moos und voller Mitgefühl.
Mitgefühl? Elyria blinzelte und versuchte sich aus seinem Griff zu befreien. Er gab sie nicht frei, und sie war zu schwach, sich ihm zu entziehen.
»Hab keine Angst«, sagte er mit jener sanften Stimme, die sie schon zuvor vernommen hatte. Plötzlich erinnerte sie sich wieder, dass sie erwacht war, weil sie etwas an ihrem Hals gespürt hatte. Sie hob die Hand und tastete danach. Ein breites eisernes Band lag eng um ihre Kehle, doch nicht so eng, dass sie nicht atmen konnte.
»Es ist gegen die Magie«, erklärte er, ehe sie fragen konnte. »Es verhindert, dass du auf deine Zauberkraft zurückgreifen kannst.«
Elyria tastete nach dem Verschluss.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Nur der, der dir das Band umlegt, kann es auch wieder lösen.« Er griff nach einem Trinkschlauch, der auf dem Boden gelegen hatte, entkorkte ihn und hielt ihn ihr entgegen. »Trink. Das ist Kalva-Saft. Gut gegen Schmerzen und Fieber. Deine Wunde habe ich bereits damit eingerieben.« Sie machte keine Anstalten nach dem Schlauch zu greifen. Als er näherkam, rückte sie von ihm ab. »Ich will dir helfen.«
»Warum solltest du mir helfen wollen?« Die Worte stolperten aus ihrem Mund, krächzend wie ein Rabe. »Will der Hexenjäger, dass ich bei guter Gesundheit ins nächste Verhör gehe? Hat er Angst, dass ich nicht lange genug durchhalte?« Hexenjäger. Das Wort klang unwirklich, als sei es einem Albtraum entsprungen. Fröstelnd zog sie die Decke enger um die Schultern. Tränen sammelten sich in ihren Augen. Sie schluckte sie hinunter.
Sie war als Diebin verhaftet worden. Doch statt sie nach ihrer Brandmarkung freizulassen, hatte sie sich in einem weiteren Kerker wiedergefunden. Und dann in dem Raum, den Peristae als Eisenkammer bezeichnet hatte. Sie verstand nicht, wie jemand auf den Gedanken kam, sie könne eine Hexe sein. Nicht jemand, verbesserte sie sich. Der Oberste Hexenjäger persönlich. Das Mädchen mit den goldenen Augen hatte er sie genannt.
»Warum bin ich hier?«
Der Mann verkorkte den Schlauch und legte ihn neben ihr auf die Pritsche. Ohne zu antworten, erhob er sich, griff nach der Fackel und ging zur Tür. Ehe er die Zelle verließ, wandte er sich noch einmal um. In einer beinahe hilflosen Geste zuckte er die Schultern. »Ich weiß nicht, was er in dir sieht.«
Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, war auch das Licht fort. Einmal mehr war Elyria in der Dunkelheit gefangen. Endlich griff sie nach dem Schlauch und nahm einen tiefen Zug. Samtig schwer rann der Kalva-Saft ihre Kehle hinab und hinterließ einen bitteren Nachgeschmack in ihrem Mund. Bitter wie die Angst, die ihre Hände zittern ließ. Der Trank entfachte eine wohlige Wärme in ihrem Innersten und ließ den Schmerz auf ein erträgliches Maß schrumpfen. Ihr Verstand klärte sich, und das Fieber schien tatsächlich ein wenig zu sinken. Einzig an der Ausweglosigkeit ihrer Situation vermochte die Medizin nichts zu ändern. Sie sank zurück auf die Pritsche und starrte in die Dunkelheit.
Elyria wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sich die Tür erneut öffnete und der blendende Schein einer Laterne in die Zelle fiel. Blinzelnd kämpfte sie gegen die plötzliche Helligkeit an.
»Trägt sie das Halsband?«, vernahm sie eine Stimme.
Der Laternenschein schwankte, schoss in die Höhe und senkte sich sogleich wieder. »Er hat es ihr umgelegt.« Eine zweite Stimme, tief und dröhnend.