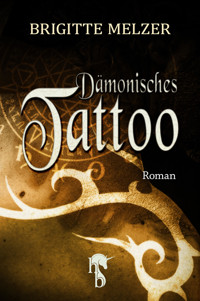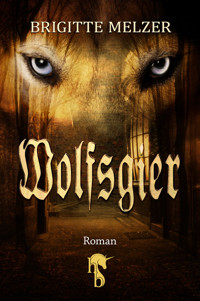4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als Sam in das Haus ihrer verstorbenen Tante zieht, geschehen unheimliche Dinge. Eine unerklärliche Kälte scheint ihr durch das ganze Haus zu folgen. Tatsächlich hat sie einen Mitbewohner: Nicholas, charmant, attraktiv und tot. Obwohl Nicholas ein Geist ist, fühlt sich Sam schon bald zu ihm hingezogen. Gut, dass es da noch den ausgesprochen lebendigen Adrian gibt. Auf der Suche nach einem Weg, Nicholas seinen Frieden zu schenken, gerät Sam immer tiefer in einen Strudel aus Hass und schwarzer Magie. Dann geschieht ein Mord und Sam weiß nicht mehr, wem sie noch trauen kann – den Lebenden oder den Toten? Der Geist, der mich liebte – Band 1.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brigitte Melzer
Der Geist, der mich liebte
Roman
1
Das Haus an der Maple Street war ein Albtraum.
Nie werde ich diesen Tag im September vergessen, an dem ich es zum ersten Mal sah. Auf den ersten Blick wirkte es vollkommen normal. Auch auf den zweiten. Unglücklicherweise gehöre ich nicht zu den Leuten, die sich damit zufriedengeben. Ich musste schon immer alles genau wissen.
Im Licht der untergehenden Sonne schimmerten die weißen Holzwände in flammendem Rot, als ich meinen roten VW-Käfer vor der Garage zum Stehen brachte.
Ich stellte den Motor ab, doch obwohl eine dreitägige Autofahrt – mit mehr als tausenddreihundert Meilen – hinter mir lag, hatte ich es plötzlich nicht mehr eilig, aus dem Wagen zu kommen. Mich erwartete ohnehin nur ein leeres Haus.
Schon der Anblick des Häuschens stimmte mich traurig. Das war alles, was von Tante Fiona geblieben war; ein Haus am Rande einer Kleinstadt – nicht mehr, als ein Haufen alter Dachziegel und Holzbohlen. Für einen Moment war ich versucht, den Zündschlüssel umzudrehen, den Wagen zu wenden und so schnell wie möglich nach Minneapolis zurückzukehren. Doch das ging nicht. Erst musste ich mich um Tante Fionas Nachlass kümmern.
Alles, was ich besitze, vermache ich meiner Nichte, Samantha Mitchell. Die Worte des Testamentsvollstreckers versetzten mich selbst jetzt – zwei Wochen später – noch in Unglauben. Obwohl ich immer ein gutes Verhältnis zu Tante Fiona gehabt hatte, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, sie könne mir einmal ihren gesamten Besitz überlassen. Darüber hatten wir nie gesprochen. Genauer betrachtet gab es nicht viele Alternativen. Tante Fiona hatte keinen Mann und keine Kinder, und mein Vater – ihr Bruder – war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als ich neun war. Zwölf Jahre war das nun her, doch manchmal kam es mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass die Polizisten an unserer Tür klingelten.
Ich glaube, Tante Fiona fühlte sich immer verpflichtet, die Lücke zu schließen, die Dad in meinem Leben hinterlassen hatte. Trotz der großen Entfernung gab es keine Ferien, keinen Feiertag und keinen Geburtstag, an dem sie mich nicht besucht hätte. Und natürlich war sie im Juni bei meiner College-Abschlussfeier gewesen. Sie war immer für mich da, besonders nachdem Mom wieder geheiratet hatte. Ich komme gut mit Brian zurecht, aber er ist eben nicht mein Dad.
Mein Blick fiel auf den Briefkasten neben der Einfahrt. Ein rot lackiertes Blechungetüm, von dem allmählich die Farbe abblätterte. Ich fragte mich, wie viele Briefe von mir wohl im Laufe der Jahre darin gelandet waren. Obwohl Tante Fiona erst siebenundvierzig war, als sie starb, hatte sie sich immer vehement gegen E-Mails verwehrt und darauf bestanden, zu telefonieren oder Briefe zu schreiben. Früher hatte ich sie oft damit aufgezogen, wie altmodisch das doch sei. Seit ihrem Tod bin ich froh, dass sie sich trotz all meiner Seitenhiebe nie davon abbringen ließ. So bleiben mir wenigstens ihre Briefe als Erinnerung.
Plötzlich fiel es mir schwer zu glauben, dass ich Tante Fiona über die Jahre zwar häufig gesehen hatte, selbst aber nicht ein einziges Mal bei ihr zu Besuch gewesen war. In erster Linie lag das wohl auch daran, dass Tante Fiona Minneapolis mochte. Sie sagte immer, es tue ihr gut, für einige Tage den Kleinstadtmief hinter sich zu lassen. Doch auch wenn sie sich gerne über das verschlafene Cedars Creek beklagte, wäre sie nie auf den Gedanken gekommen, fortzuziehen. Dafür hatte sie diesen Ort zu sehr geliebt.
Nun war ich also zum ersten Mal in meinem Leben in Cedars Creek. Zugleich war es das erste Mal überhaupt, dass es mich in eine Kleinstadt verschlug. Ich bin ein Großstadtmensch – schon immer gewesen. Ich mochte die Anonymität dort und hatte nichts dagegen einzuwenden, nur ein Gesicht unter vielen zu sein. Wenn ich etwas nicht mochte, dann im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen.
Tante Fionas Haus lag am Rande von Cedars Creek, sodass ich noch nicht viel von der Ortschaft gesehen hatte. Allein die Tatsache, dass es hier nicht einmal Hochhäuser gab, vermittelte mir das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Keines der Häuser schien mehr als zwei Stockwerke zu haben. Aus der Entfernung wirkten die hellen Fassaden so idyllisch und altmodisch, dass ich mich fast in ein anderes Jahrhundert versetzt fühlte. Der Anblick eines Fabrikschlotes, der weißen Rauch in den Himmel spie, machte diesen Eindruck allerdings recht schnell wieder zunichte. Das musste die Crowley Distillery sein. Tante Fiona hatte mir von der Schnapsbrennerei erzählt; dem größten Arbeitgeber in Cedars Creek.
Obwohl mir noch immer nicht der Sinn danach stand, in ein leeres Haus zu gehen, in dem mich alles an Tante Fiona erinnern würde, öffnete ich jetzt endlich die Autotür und stieg aus. Hauptsächlich wohl, weil ich nach der langen Fahrt schon nicht mehr wusste, wie ich sitzen sollte.
Nach der Hitze im Auto (der Käfer hat keine Klimaanlage) war die frische Luft herrlich. Es war schon nach sechs und die Sonne würde bald untergehen. Dennoch war es für Mitte September noch erstaunlich warm.
Ich stand vor der offenen Wagentür und reckte meine steifen Glieder, während ich meine Augen über die Umgebung wandern ließ. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stieg das Land langsam an. Die Straße schlängelte sich einen bewaldeten Hügel hinauf, ehe sie im Schatten des Waldes außer Sicht verschwand. Bäume und Farne glühten in den feurigen Rot- und Orangetönen des Indian Summer. Ein starker Kontrast zum strahlend blauen Himmel. Tante Fiona hatte immer davon geschwärmt, wie wundervoll der Herbst in Cedars Creek sei. Beim Anblick des Waldes bekam ich zum ersten Mal das Gefühl, dass sie nicht übertrieben hatte. Auf der Kuppe erspähte ich, halb hinter Bäumen verborgen, ein prächtiges Herrenhaus. Selbst von hier unten sah es riesig aus. Wie ein verwunschenes Haus aus dem Märchen. Bei dem Gedanken musste ich grinsen. Ich fragte mich, wer wohl dort leben mochte.
Womöglich würde ich es ja herausfinden.
Dieses Haus, der verschlafene Ort, einfach alles hier wirkte auf mich, die ich an die Hektik der Großstadt gewöhnt war, seltsam und fremd. Schwer vorstellbar, dass Seattle keine zwei Autostunden entfernt lag.
Ich nahm meinen Rucksack vom Beifahrersitz – meine restlichen Sachen würde ich später holen – und wandte mich dem Haus zu. Nach allem, was ich bisher gesehen hatte, war es das einzige Haus in der Straße. Das letzte Haus am Ortsrand. Großartig. Das würde es nicht gerade leicht machen, einen Käufer zu finden. Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass jemand so abgeschieden leben wollte.
Die ganze Straße war von hohen Ahornbäumen gesäumt, deren Blätter in herbstlichen Flammen standen. Rechts und links der Straße sah ich nichts weiter als wild wuchernde Wiesen voller Herbstblumen, immer wieder von vereinzelten Bäumen und Farnen durchbrochen. Auf der einen Seite gingen die Wiesen schließlich in den Hügel über. Auf der anderen Seite, in Richtung Cedars Creek, stand eine Kirche – das einzige Gebäude in der näheren Umgebung. Ein karmesinroter Holzbau mit weiß gestrichenen Kanten, der sich, keine zweihundert Meter hinter Tante Fionas Haus, aus dem Gras erhob. Trotz des kleinen Glockenturms hatte der Bau mehr Ähnlichkeit mit einer Scheune als einer Kirche. Wenn ich die Augen zusammenkniff, glaubte ich daneben einen Parkplatz und dahinter eine Straße ausmachen zu können.
Ich kramte den Schlüsselbund, den mir der Testamentsvollstrecker gegeben hatte, aus meiner Jeanstasche und ging zur Garage. Der Öffnungsmechanismus war einfach gestrickt. Wenn man keine Fernbedienung hatte, steckte man den Schlüssel ins Schloss und schob das Tor nach oben. Das Schloss klemmte jedoch und ließ sich auch nach mehrfachen Versuchen nicht öffnen. Ich beschloss, es mir später anzusehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand hier mitten im Nirgendwo auf meinen klapprigen Käfer abgesehen haben sollte, erschien mir ohnehin eher gering. Vermutlich musste ich den Wagen nicht einmal abschließen.
Ich schwenkte nach links und ging über einen schmalen gepflasterten Weg zum Haus. Obwohl der Rasen seit Tante Fionas Tod gewachsen war, wirkte der Vorgarten verglichen mit den hüfthohen Gräsern in der Umgebung noch immer erstaunlich gepflegt. Zwei große Ahorne warfen lange Schatten über den Rasen und auf das Dach der Veranda.
Die Holzbohlen knarrten leise, als ich die beiden Stufen erklomm und die Veranda überquerte. Die Hitze des Tages hatte sich unter dem Vordach aufgestaut. Kein Lüftchen regte sich. Erneut griff ich nach dem Schlüsselbund und steckte den Schlüssel ins Schloss. Ein leises Klicken erklang, dann drehte ich den Griff herum. Im Gegensatz zum Garagentor ließ sich die Haustür problemlos öffnen. Ich stieß sie auf und erwartete einen Schwall warmer, abgestandener Luft. Stattdessen kroch mir ein kalter Luftzug entgegen. So kühl, dass ich eine Gänsehaut bekam. Überrascht von der plötzlichen Kälte wich ich einen Schritt zurück.
Da stand ich nun vor Tante Fionas Haus und wünschte mir, ich wäre schon viel früher gekommen. Wie gerne hätte ich sie noch einmal gesehen. Ich seufzte und straffte die Schultern, ehe ich mich endlich überwand und eintrat.
Die Luft war tatsächlich stickig und immer noch kühl. So kühl, dass ich unwillkürlich nach einer Klimaanlage Ausschau hielt. Das Ding musste auf arktische Kälte eingestellt sein! Hier im Flur ließ sich keine Klimaanlage entdecken. Womöglich würde ich sie später finden, wenn ich mich erst einmal genauer umgesehen hatte. Ich konnte nur hoffen, dass ich sie abschalten konnte, ehe ich mich erkälten würde.
Ich stand in einem kleinen Flur, an dessen hinterem Ende ich einen Blick auf das Wohnzimmer erhaschte. Zu meiner Rechten führte eine Tür in die Küche. Die Sohlen meiner Turnschuhe quietschten leise, als ich über das abgetretene, elfenbeinfarbene Linoleum ging. Meine Augen streiften über die Kücheneinrichtung, die Mom mit ihrer Vorliebe für Edelstahl und Chrom bestenfalls als rustikal bezeichnet hätte. Ich fand sie gemütlich. Die Vorhänge waren ein wenig ausgeblichen und die Kräuter und Blumen, die in kleinen Keramiktöpfen auf dem Fensterbrett standen, vertrocknet. Dennoch war das genau die Umgebung, in der ich mir Tante Fiona vorstellen konnte. Warm und herzlich. Ich war ebenso davon überzeugt, dass sie die mit Rüschen verzierte Küchenschürze, die an einem Haken neben der Tür hing, regelmäßig getragen hatte, wie ich daran glaubte, dass sie dieses Haus tatsächlich geliebt hatte. Alles hier trug ihre Handschrift. Die Blumenmalereien auf den Wandfliesen, die Sammlung knallbunter Kaffeetassen auf einem Regal, selbst der alte Teekessel, der auf einer der hinteren Herdplatten stand. Das alles war so sehr Tante Fiona, dass es wehtat.
Auf dem Weg zum Wohnzimmer kam ich an der Treppe vorbei, die nach oben führte. Mein Blick fiel auf die gerahmten Bilder, die am Fuß der Treppe an der Wand hingen. Viele davon zeigten meinen Dad; einen lächelnden Hünen mit dichtem braunem Haar und dunklen Augen, der den Eindruck erweckte, ihn könne nichts aus der Bahn werfen. Auf einigen schon reichlich vergilbten Exemplaren waren Dad und Tante Fiona als Kinder zu sehen. Und dann gab es noch eine Reihe Fotos, auf denen ich mich wiederfand. Geburtstage, Thanksgiving, Weihnachten, Abschlussfeiern. Als ich das Bild entdeckte, das Dad von mir in Disney World geschossen hatte, musste ich lachen. Es zeigte ein siebenjähriges sommersprossiges Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und Zahnspange, das sich in einer überschwänglichen Umarmung an Mickey Mouse klammerte. Zahnspange und Zöpfe gehörten heute längst der Vergangenheit an. Stattdessen war ich dazu übergegangen, meine störrischen schulterlangen Locken zu einem Pferdeschwanz zusammenzubinden. Das dichte braune Haar hatte ich ebenso von meinem Dad geerbt wie die dunklen Augen und den olivfarbenen Teint. Seine einschüchternde Körpergröße ist mir glücklicherweise erspart geblieben.
Noch immer grinsend ging ich ins Wohnzimmer. Die beigefarbenen Vorhänge waren zugezogen und hüllten den Raum in Halbdunkel. Die Luft war abgestanden. Im ersten Augenblick hatte ich das Gefühl, dass es hier wärmer war als auf dem Gang und in der Küche. Dann streifte mich erneut ein kühler Luftzug und die Gänsehaut kehrte auf meine Arme zurück. Irgendwo musste doch die Klimaanlage sein!
Meine Augen wanderten über die dunklen Holzmöbel, streiften das geblümte Sofa und einen klobigen Sessel in der Mitte des Raumes und fuhren über die getäfelten Wände und den offenen Kamin auf der Suche nach dem Gerät. Nichts! Nicht einmal ein Ventilator! Konnte ein Haus tatsächlich so zugig sein? So kalt – im Spätsommer? Wenn ich es verkaufen wollte, musste ich unbedingt die Ursache für die Kälte finden und abstellen. Aus dem Kamin kam sie jedenfalls nicht.
Mir war schon jetzt klar, dass es nicht einfach werden würde, das Haus zu entrümpeln und herzurichten. Allein der Gedanke, Tante Fionas Heim einem Fremden zu überlassen, schmerzte. Trotzdem blieb mir keine andere Wahl. Was sollte ich mit einem Haus in Cedars Creek? Mein Leben spielte sich im Augenblick noch in Minneapolis ab. Dort waren all meine Freunde. Doch bald schon würde ich nach Boston gehen, wo ein Job in der Marketingabteilung von Jameson Industries auf mich wartete. Die Zusage hatte ich am Tag meines Collegeabschlusses bekommen. Ich war vor Freude völlig aus dem Häuschen gewesen. Während Mom entsetzt darüber war, dass ich Minneapolis verlassen und nach Boston ziehen wollte, hatte Tante Fiona meine Begeisterung uneingeschränkt geteilt. Sie war mir um den Hals gefallen und hatte immer wieder gerufen: Das ist großartig, Sam! Von allen Unternehmen, bei denen ich mich beworben hatte, war Jameson Industries meine erste Wahl gewesen. Dort konnte ich viel lernen, ehe ich mich eines Tages womöglich mit meiner eigenen Marketingfirma selbstständig machen würde. Ich sollte die Stelle in sechs Wochen antreten. Bis dahin hatte ich Zeit, Tante Fionas Nachlass zu regeln.
Ich hatte daran gedacht, eine Firma mit der Renovierung zu beauftragen und einen Makler mit dem Verkauf zu betrauen, doch ich fand, dass ich Tante Fionas Zuhause zumindest ein einziges Mal sehen sollte. Da ich ohnehin die nächsten Wochen freihatte, beschloss ich, mich selbst um alles zu kümmern. Beim Anblick der sperrigen alten Möbel fragte ich mich zum ersten Mal, ob ich das wirklich allein bewältigen konnte.
Grübelnd starrte ich vor mich hin und ließ zu, dass meine Gedanken von der bevorstehenden Arbeit zu Tante Fiona zurückkehrten. Nach meinem Dad war sie der zweite Mensch, der so urplötzlich aus meinem Leben gerissen worden war. Sie war kerngesund gewesen, das hatte sie immer wieder versichert. Dass sie an Herzversagen gestorben war, wollte mir noch immer nicht in den Kopf. Noch schlimmer jedoch war, dass ich nicht da war, als sie starb. Ich war mit meiner besten Freundin Sue für zwei Wochen in Florida gewesen, um unseren Abschluss zu feiern. Bei meiner Rückkehr war bereits alles vorüber. Selbst die Beerdigung hatte ich verpasst. Nur die Testamentseröffnung, für die Tante Fiona schon zu Lebzeiten eigens einen Anwalt in Minneapolis beauftragt hatte, hatte mir noch bevorgestanden.
Obwohl es noch immer erstaunlich kühl war, hatte ich auf einmal das Gefühl zu ersticken. Ich brauchte Luft! Mit zwei Schritten erreichte ich die Fensterfront und zog die Vorhänge zur Seite. Helligkeit flutete in den Raum. Ich öffnete die Schiebetür und trat nach draußen.
Die Abendsonne wärmte meine Haut und vertrieb die Kälte, die mich im Haus ergriffen hatte. Die gepflasterte Terrasse war gerade groß genug, um einem Tisch mit ein paar Stühlen, einem abgedeckten Grill und einer Sonnenliege Platz zu bieten. Dahinter eröffnete sich der Blick auf einen ausladenden Garten. Blumenbeete säumten zu beiden Seiten die Rasenfläche in der Mitte. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, deshalb gelang es mir lediglich, die Rosenstöcke zu erkennen. Die restlichen Blumen, die ihre Köpfe in der Herbstluft hängen ließen, hatte ich zwar alle schon einmal gesehen, wusste aber nicht, wie sie hießen. Das Unkraut, das überall dazwischen aus dem Boden wucherte, konnte sogar ich als solches erkennen. Ich kann nicht gerade behaupten, mit dem berühmten grünen Daumen gesegnet zu sein. Sam Mitchell und Pflanzen, das sind zwei Welten, die nicht gut miteinander klarkommen. Mom behauptet sogar, es grenzte bereits an ein Wunder, wenn künstliche Pflanzen in meiner Nähe überlebten. Das ist natürlich übertrieben, allerdings bekomme ich selbst die robustesten Pflanzen klein. Ich werde wohl nie lernen, welche Pflanzen wie viel Wasser brauchen. Entweder gebe ich ihnen zu wenig, oder aber ich meine es zu gut und ersäufe sie. So oder so: Gäbe es eine Organisation gegen Pflanzenfolter, ich wäre der Staatsfeind Nummer eins.
Eine Holzhütte zog meinen Blick auf sich. Vermutlich ein Geräteschuppen. Auf der Rückseite wucherte hüfthohes Gras, durchzogen von Farnen und Bäumen, die ihre Schatten auf den Boden warfen. Dahinter sah ich in einiger Entfernung die roten Umrisse der Kirche. Ich nahm an, dass der Schuppen direkt an der Grundstücksgrenze erbaut war. Was dahinter lag, gehörte wahrscheinlich nicht mehr zu Tante Fionas Haus, sondern zur Kirche.
Ich trat von der Terrasse auf den Rasen und ging auf den Schuppen zu. Wenn ich recht hatte, musste es dort einen Zaun oder eine Mauer geben. Irgendetwas, das die Grenze markierte.
Als ich den Schuppen beinahe erreicht hatte, konnte ich noch immer keinen Zaun erkennen. Wenn man nach einer Grenze suchte, musste man wohl die veränderte Vegetation als solche akzeptieren. Die lichte Reihe Douglasien – eine der wenigen Baumarten, die ich kannte – wirkte tatsächlich wie eine Trennungslinie. Geblendet von der Abendsonne kniff ich die Augen zusammen und spähte ins Halbdunkel am Fuß der Bäume. Zwischen Farnen und hüfthohem Gras glaubte ich vereinzelte Schatten ausmachen zu können. Vielleicht Teile einer alten Mauer. Ohne meine Augen von den Schemen zu lösen, die dort dunkel aus dem Boden ragten, trat ich noch näher. Umrisse schälten sich aus dem Zwielicht, schief und halb in den Erdboden eingesunken. Ich blieb abrupt stehen. Moosüberwucherte Klumpen wuchsen in unregelmäßigen Abständen aus dem Boden. Was ich zunächst für die Überreste einer Mauer gehalten hatte, entpuppte sich als etwas vollkommen anderes. Schlagartig war die Kälte wieder da, von der ich geglaubt hatte, sie im Haus zurückgelassen zu haben. Eine schmerzhafte Gänsehaut überzog meine Arme und meinen Rücken, als ich mit pochendem Herzen auf die Grabsteine starrte, die sich vor mir aus dem Grün erhoben.
2
Der Anblick des alten, verwilderten Friedhofs trieb mich ins Haus zurück. Drinnen war es noch immer kühl, doch plötzlich machte es mir weniger aus als noch vor ein paar Minuten. Ich warf die Terrassentür hinter mir zu und starrte aus dem Fenster. Mein Herz hämmerte noch immer wie wild und wollte sich nur sehr langsam beruhigen. Immer wieder versuchte ich mir einzureden, dass es Unsinn war, sich wegen eines Friedhofs aufzuregen. Ein Teil von mir war sogar bereit, das zu akzeptieren. Der andere Teil jedoch hatte bei Weitem zu viele Horrorfilme gesehen, um die Nähe der Toten einfach so zu verdrängen.
»Okay, Sam«, murmelte ich und erschrak, als meine Stimme empfindlich laut durch die Stille schnitt, »krieg dich wieder ein!« Immerhin war ich diejenige, die sich jedes Mal darüber beklagte, wie unglaubwürdig Horrorfilme doch waren. Nichtsdestotrotz hatten sich sichtlich einige Geschichten ein wenig zu sehr in mein Hirn gebrannt.
Ich zwang mich, tief durchzuatmen. Was hatte ich schon gesehen? Ein paar völlig überwucherte, windschiefe Steinklumpen. So wie es dort ausgesehen hatte, wurde dieser Teil des Friedhofs bereits seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Vermutlich waren selbst die Geister längst an Altersschwäche oder Langeweile gestorben. Die frischen Gräber mussten sich an einer anderen Stelle – weiter weg von meinem Haus – befinden. Irgendwie war der Gedanke beruhigend. Dann jedoch fragte ich mich, wie das möglich war. Sollten nicht gerade die ältesten Gräber nahe der Kirche sein? Ich schüttelte den Kopf und beschloss, den Gedanken nicht weiter zu verfolgen. Zumindest vorerst nicht.
Meine Einstellung zum Haus hatte sich jedoch grundlegend geändert. Es war jetzt weit mehr als Tante Fionas gemütliches Heim. Es war das Haus am Friedhof.
Ich versuchte zu überschlagen, wie lange mein Aufenthalt in Cedars Creek wohl dauern mochte. Selbst bei vorsichtigen Schätzungen – ohne das gesamte Haus zu kennen und zu wissen, wie gut meine Chancen standen, es an den Mann zu bringen – würde ich wohl mindestens die nächsten drei oder vier Wochen hier festsitzen. Ob ich doch einen Makler …? Nein! Den Gedanken, mir im Ort ein Zimmer zu mieten und nur tagsüber herzukommen, um im Haus zu arbeiten, verwarf ich ebenso rasch wieder. Tante Fiona hatte ihr ganzes Leben in diesem Haus verbracht. Was waren im Vergleich dazu schon ein paar Wochen.
Ein schriller Laut durchschnitt die Stille und ließ mich heftig zusammenfahren. Mein Handy! Ich fischte es aus meiner Jeanstasche und warf einen Blick auf das Display, bereit den Anrufer wegzudrücken, falls es meine Mom war. Mir stand im Augenblick nicht der Sinn danach, mit ihr zu sprechen. Sie würde nur die leidige Diskussion fortführen, mit der sie seit Wochen versuchte, mich dazu zu bewegen, nicht nach Boston zu gehen. Als ich Sues Nummer sah, nahm ich das Gespräch erleichtert an.
»Hi, Sue.«
»Sam!«, schallte mir Sues Stimme blechern entgegen. Die Verbindung war nicht besonders gut. »Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich habe seit drei Tagen nichts mehr von dir gehört!«
Ich seufzte. »Entschuldige. Ich war einfach zu müde. Wenn ich abends aus dem Auto gestiegen bin, wollte ich nur noch ins Bett.«
Am anderen Ende stieß Sue den Atem aus. Ich wusste, dass sie sich Sorgen um mich machte, und es tat mir leid, mich nicht früher gemeldet zu haben.
»Wo steckst du jetzt?«, fragte Sue.
»Cedars Creek. Bin gerade angekommen.«
Meinen Worten folgte eine kurze Pause. Dann fragte sie: »Und? Geht es dir gut? Kommst du klar?«
Für einen Moment war ich versucht, ihr die Wahrheit zu sagen. Ich wollte ihr erzählen, wie schwer es mir fiel, hier zu sein, und wie sehr ich den Gedanken hasste, alles fortzugeben, was einmal Tante Fiona gehört hatte. Das Haus liegt an einem Friedhof!, wollte ich herausschreien, doch ich schluckte die Worte hinunter.
Sue war meine beste Freundin. Wenn sie auch nur das leiseste Anzeichen entdeckte, dass es mir nicht gut ging, würde sie sich augenblicklich auf den Weg zu mir machen. Selbst wenn das bedeutete, ihren Job in der Anwaltskanzlei, in der sie erst vor einer Woche angefangen hatte, aufzugeben. Das wollte ich nicht. Sie hatte ein Recht auf ihren Traumjob.
»Ich bin okay«, sagte ich schnell, um ihr keinen Grund zu geben, in Minneapolis alles stehen und liegen zu lassen und mir hierher ans Ende der Welt zu folgen.
Sue seufzte vernehmlich. »Du vergisst, dass ich dich seit einer Ewigkeit kenne. Komm mir also nicht mit dieser ›Mir-kann-nichts-etwas-anhaben‹-Tour. Ich weiß, dass du gerne mit deinem Sarkasmus und deinem losen Mundwerk darüber hinwegtäuschst, was wirklich in dir vorgeht, und manchmal glaube ich, du kannst dich damit sogar selbst täuschen. Bei mir gelingt dir das nicht. Also versuch es gar nicht erst.«
Manchmal war es wirklich ein Fluch, dass sie mich so gut kannte. »Du musst dir keine Sorgen machen.«
»Sam, bist du sicher, dass –«
»Ja«, unterbrach ich sie hastig. »Wenn etwas nicht in Ordnung wäre, würdest du es als Erste erfahren. Jetzt erzähl mir lieber, was es bei dir Neues gibt!«
Während der nächsten halben Stunde versorgte Sue mich mit allen Neuigkeiten, die sich während der letzten drei Tage zu Hause ereignet hatten. Sie erzählte mir von ihrem Date mit einem Typen aus der Kanzlei, den ich nicht kannte, und davon, wie glücklich sie mit ihrem Job war. Allein das bestätigte mich darin, den Mund zu halten und ihr nicht zu sagen, wie ich mich tatsächlich fühlte. Als ich schließlich das Gespräch beendete und das Handy auf den Couchtisch legte, erschien mir die plötzliche Stille erdrückend.
Ich stand auf und schaltete das Radio ein. Ein wenig Musik würde die Stille erträglicher machen. Doch ganz gleich, wie sehr ich mich auch bemühte, einen Sender einzustellen, es wollte mir nicht gelingen, mehr als ein statisches Rauschen zu empfangen. Frustriert schaltete ich das Gerät wieder ab und holte stattdessen mein Gepäck aus dem Wagen. Ich hatte genügend Sachen dabei, um für einige Wochen über die Runden zu kommen. Der Hauptgrund jedoch, warum ich die lange Autofahrt auf mich genommen hatte, anstatt mich bequem in ein Flugzeug zu setzen, war, dass ich im Wagen jene Dinge aus Tante Fionas Erbe transportieren konnte, von denen ich mich nicht trennen wollte. Die Bilder im Flur würden mich ganz bestimmt nach Hause begleiten.
Inzwischen wurde es allmählich dunkel, sodass ich, als ich mit meinen Sachen ins Haus kam, zum Lichtschalter griff. Nachdem mich schon das Radio im Stich gelassen hatte, erwartete ich fast, dass das Licht auch nicht funktionieren würde. Das Haus am Friedhof ohne elektrisches Licht. Das wäre der Moment, in dem ich ganz bestimmt kehrtmachen und mir doch ein Zimmer im Ort suchen würde. Der Schalter klickte vernehmlich. Augenblicklich wurde es hell.
Erleichtert wuchtete ich meine beiden Reisetaschen die Treppen hoch und stellte sie erst einmal im Gang ab. Hier oben war es wesentlich wärmer. Vielleicht kam es mir, nachdem ich die schweren Taschen heraufgeschleppt hatte, auch nur so vor.
Vom Flur gingen vier Türen ab. An einer Wand stand eine monströse Kommode, darüber hing ein ovaler Spiegel in einem schmiedeeisernen Rahmen. Ein wunderschönes, altmodisches Stück. Hinter mir knarrte eine Stiege. Ich fuhr herum. Keine Ahnung, was ich erwartet hatte. Natürlich war da nichts. Ich war allein in einem alten Haus. Die Treppen waren aus Holz, so wie das meiste hier. Holz knarrte nun einmal. Plötzlich kam ich mir lächerlich vor.
Kopfschüttelnd über meine eigene Angst öffnete ich die erste Tür. Dahinter lag ein geräumiges Schlafzimmer mit einem riesigen, begehbaren Kleiderschrank. Hier waren die Möbel heller als im Wohnzimmer. Die geblümten Tapeten waren zwar nicht mein Geschmack, verliehen dem Raum aber zusammen mit den bunten Läufern, die auf dem Parkett lagen, etwas Gemütliches. Über einem Schaukelstuhl hingen ein Paar Jeans und eine weiße Bluse, darunter standen knallrote Sneakers, einer war zur Seite gekippt. Der Anblick traf mich ins Mark. Es sah aus, als sei Tante Fiona noch hier. Vielleicht würde sie gleich aus der Dusche steigen und in die Sachen schlüpfen, die sie sich zurechtgelegt hatte. Doch Tante Fiona würde nicht mehr kommen. Zum ersten Mal, seit ich die Nachricht ihres Todes erhalten hatte, schossen mir die Tränen in die Augen. Ein Teil von mir schien erst jetzt zu begreifen, dass sie tatsächlich nicht mehr da war.
Ein kühler Hauch strich über meine tränennasse Wange. Fast kam es mir vor wie eine Berührung. Dann jedoch erfasste mich schlagartig dieselbe Kälte, die ich schon unten verspürt hatte. Ich musste dringend etwas gegen die Zugluft unternehmen! Dann kam mir eine andere Idee. Was, wenn die Kälte weder etwas mit einer Klimaanlage noch mit schlechter Isolierung zu tun hatte? Was, wenn der Friedhof … Ich weigerte mich, den Gedanken weiterzuverfolgen. Allein dass mich die Nähe des Friedhofs so sehr beschäftigte, war schon lächerlich. Dass die Kälte im Haus etwas damit zu tun haben könnte, war völlig bescheuert!
Ich wischte mir die Tränen ab und setzte meinen Erkundungszug fort. Neben dem Schlafzimmer fand ich ein Arbeitszimmer mit einem großen Schreibtisch. Ein wenig ungläubig blickte ich auf den PC darauf. Angesichts Tante Fionas Weigerung, E-Mails zu schreiben, war ich nicht einmal auf den Gedanken gekommen, sie könne überhaupt einen PC besitzen. Sichtlich war sie fortschrittlicher gewesen, als ich immer angenommen hatte. Um den PC herum lagen unzählige Notizzettel, Zeitungsartikel und Schulbücher. Knallgelbe Post-its zierten eine Pinnwand darüber. Tante Fiona hatte an der Grundschule von Cedars Creek unterrichtet. Hier hatte sie wohl ihre Stunden vorbereitet.
Die Bücherregale waren so vollgestopft, dass einige Bücher sich schon übereinanderstapelten. Ich war versucht, einen genaueren Blick auf die Buchrücken zu werfen, verkniff es mir dann aber doch. Ich war müde und wollte bald ins Bett. Davor jedoch wollte ich mir erst noch die restlichen beiden Räume ansehen. Die Regale würde ich spätestens dann in Augenschein nehmen, wenn ich entscheiden musste, was ich behalten und was ich weggeben sollte. Ich ignorierte den großen Schrank an der anderen Wand und kehrte auf den Gang zurück, um mich der nächsten Tür zuzuwenden. Dahinter lag das Badezimmer. Im Gegensatz zu den anderen Räumen roch die Luft hier nicht abgestanden, sondern angenehm frisch. Die Ursache dafür fand ich in einem Lufterfrischer, der zwischen einer Schale mit Muscheln, ein paar Teelichtern und einem kleinen Keramikleuchtturm auf dem Fensterbrett stand. Die hellgrauen Wandfliesen waren immer wieder mit knallblauen Mustern durchsetzt, deren Farbe sich auch in den Vorhängen, den flauschigen Läufern und der Spiegelumrandung wiederfand. Alles in allem war das Bad mit seiner großen Wanne, der gläsernen Duschkabine und der Handtuchheizung der modernste Raum im Haus.
Blieb nur noch ein weiteres Zimmer. Ich verließ das Bad wieder und trat auf die Tür am Ende des Ganges zu. Dort erwartete mich ein überraschend geräumiges Gästezimmer. Mir war sofort klar, dass ich mich hier einquartieren würde. Die Vorstellung, in Tante Fionas Schlafzimmer zu übernachten, hatte mir von Anfang an nicht sonderlich behagt. Umso erleichterter war ich beim Anblick dieses Zimmers. Bett und Möbel waren mit hellen Laken abgedeckt. Mit wenigen Handgriffen zog ich die Tücher fort. Noch während ich sie zusammenlegte, ließ ich meine Augen über die Möbel wandern. Ein kleiner Nachttisch mit Lampe. Eine große Holztruhe mit schweren Messingbeschlägen am Fußende des Bettes. Leere Bücherregale an den Wänden und ein großer Lehnsessel mit Fußhocker in einer Ecke des Raumes. Gleich neben der Tür stand ein altmodischer kleiner Sekretär, davor ein nicht besonders bequem aussehender Holzstuhl. Hinter einer Lamellentür fand ich einen leeren Wandschrank, in dem ich mühelos all meine Sachen unterbringen würde.
Ich warf die zusammengefalteten Laken auf die Truhe und holte meine Reisetaschen. Obwohl ich inzwischen hundemüde war, wollte ich zumindest noch auspacken. Da meine Klamotten größtenteils aus Jeans, T-Shirts und Pullis bestanden, brauchte ich nicht lange, bis alles verstaut war. Ich warf meinen Schlafanzug aufs Bett, schnappte mir meinen Kulturbeutel und ging ins Bad. Für einen Moment war ich versucht, mir ein Bad einzulassen, verschob das aber, da ich so müde war, dass ich fürchtete, in der Wanne einzuschlafen. Baden konnte ich auch morgen. Für jetzt tat es eine kurze Katzenwäsche und Zähneputzen.
Zurück im Zimmer tauschte ich Jeans und T-Shirt gegen den Schlafanzug, knipste die Nachttischlampe an und löschte das Deckenlicht. Als ich ins Bett schlüpfen wollte, fiel mein Blick aufs Fenster. Es war mittlerweile nach zehn und draußen war es längst finster. Das Spiegelbild, das meine Nachttischlampe auf die Scheibe warf, gefiel mir nicht. Es wirkte verzerrt und sah gar nicht mehr wie die kleine Lampe mit dem beigefarbenen Schirm aus. Das Ganze hatte viel mehr Ähnlichkeit mit einem Kopf als mit einer Lampe.
Okay, das genügte! Ich ließ die Bettdecke, die ich gerade zurückschlagen wollte, los und ging zum Fenster. Obwohl ich es in der Finsternis nicht erkennen konnte, wusste ich, dass sich unter meinem Zimmer der Garten erstreckte. Und dahinter der Friedhof. Plötzlich wirkte die Dunkelheit auf der anderen Seite der Scheiben so erdrückend, dass ich es nicht mehr über mich brachte, hinauszusehen. Ich packte die Vorhänge und zog sie mit Schwung zu. Sofort fühlte ich mich besser. Dann fragte ich mich jedoch, ob ich die Haustür und – fast noch wichtiger – die Terrassentür abgeschlossen hatte. Ich war der Meinung, dass ich es getan hatte, doch mir war klar, ich würde keine Ruhe finden, solange ich mich nicht noch einmal davon überzeugt hatte. Obwohl ich mir vollkommen idiotisch vorkam, blieb mir keine andere Wahl: Ich musste einfach nachsehen.
Barfuß tappte ich über den Gang, natürlich nicht, ohne überall Licht anzumachen. Schon nach wenigen Schritten waren meine Füße eiskalt und ich nahm mir vor, Socken anzuziehen, ehe ich ins Bett ging. Ich polterte die Treppen hinunter zur Wohnungstür und überprüfte das Schloss. Ordnungsgemäß verriegelt. Blieben noch die Tür zur Garage und die Terrassentür. Auf meinem Weg durch das Haus zog ich an jedem Fenster die Vorhänge vor. Selbst wenn ich mich nicht hier unten aufhielt, gefiel mir der Gedanke nicht, jemand könne womöglich von draußen hereinschauen. Die Garagentür war verschlossen, die Terrassentür nicht. Mit einem heftigen Ruck legte ich den Riegel um und rüttelte an der Tür, um ganz sicher zu gehen, dass sie auch wirklich zu war.
Ich benahm mich wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal allein zu Hause war. »Als ob ein paar Vorhänge und Riegel etwas gegen Geister nutzen würden«, murmelte ich. In sämtlichen Geistergeschichten, die ich kannte, glitten die Gespenster einfach durch Wände hindurch. Ich zuckte die Schultern und fügte mit einem schiefen Grinsen hinzu: »Zumindest Zombies wird es aufhalten.«
Nachdem das Haus gesichert war, kehrte ich in mein Schlafzimmer zurück und fischte mir ein Paar Socken aus dem Schrank. Dann schlüpfte ich endlich ins Bett und knipste das Licht aus.
Obwohl ich müde war, konnte ich lange nicht schlafen. Alles um mich herum war mir fremd; Gerüche, Geräusche, selbst das Gefühl der Daunendecke auf meiner Haut. Jedes Geräusch schreckte mich auf. In Gedanken suchte ich ständig nach Ursachen. Das leise Knarren der Holzdielen. Das Säuseln des Windes, der ums Haus strich und raschelnd ins trockene Laub fuhr. Ein paar Katzen, die sich fauchend hinter dem Haus begegneten. Allmählich gelang es mir, alle Gedanken an Gespenster zu verdrängen. Dann schlief ich endlich ein.
Im Laufe der Nacht begann ich so heftig zu frieren, dass ich zitterte.
Noch immer im Halbschlaf und zu müde, um meine Augen zu öffnen, tastete ich nach der Decke. Ich musste sie im Schlaf von mir geworfen haben. Meine Finger fuhren über den Stoff und fanden die Decke dort, wo sie hingehörte. Hatte ich das Fenster offen gelassen und spürte nun die kalte Nachtluft? Nein, ich hatte es geschlossen aus Furcht vor …
»Hab keine Angst«, hauchte eine sanfte Stimme neben meinem Ohr.
Ich riss die Augen auf und starrte in die verschwommenen Züge eines Mannes, keine zwanzig Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Ein undeutlicher Schemen, der sich über mich beugte. Mit einem Schrei sprang ich aus dem Bett und fuhr bis an die Wand zurück. Ich riss die Lampe vom Nachttisch und hielt sie schützend vor mir in die Höhe, bereit, sie als Waffe einzusetzen. Mein Puls raste so heftig, dass ich glaubte, ich würde jeden Moment umkippen. Zitternd tastete ich über die Lampe, bis ich den Schalter fand. Als das Licht anging, kniff ich geblendet die Augen zusammen. Über dem Bett glaubte ich hellen Nebel zu erkennen, der sich langsam verflüchtigte, als würde er von einer unsichtbaren Brise auseinandergetrieben. Womöglich irrte ich mich auch, was den Nebel anging, denn es war so eisig, dass mein Atem dampfend in die Luft stieg. Mit dem Rücken an die Wand gepresst stand ich da und starrte in den Raum. Meine Finger klammerten sich noch immer um die Lampe, die jetzt Waffe und Lichtquelle in einem war. Ich hielt den Atem an, bis keine störenden Kondenswolken mehr aufstiegen. Dann suchte ich mit meinem Blick nach dem Eindringling. Doch da war niemand. Ich war allein.
*
Den Rest der Nacht verbrachte ich im hell erleuchteten Wohnzimmer. Hier unten war es kühl, aber längst nicht so kalt wie zuvor in meinem Schlafzimmer. Ich verschob den Sessel so weit, dass ich mit dem Rücken zur Wand sitzen konnte. Allein die Vorstellung, etwas – oder jemand – könne sich von hinten an mich heranschleichen, war grauenhaft. In eine Decke gewickelt saß ich da, die Nachttischlampe noch immer als Waffe im Schoß, und gab mir redlich Mühe, nicht auf die geschlossenen Gardinen zu blicken.
Hab keine Angst. Hatte ich das wirklich gehört? Hatte ich wirklich einen Mann gesehen, der sich über mich beugte? Nach einer Weile kam ich mir reichlich albern vor. Ich hatte einen Albtraum gehabt, nichts weiter. Manchmal kamen mir meine Träume eben sehr real vor. Das war nicht das erste Mal, dass ich geträumt hatte, obwohl ich überzeugt war, längst wach zu sein. Vermutlich bin ich erst in dem Moment wirklich aufgewacht, als ich aus dem Bett sprang.
Ich versuchte erfolglos, mich an das Gesicht zu erinnern, das ich gesehen – oder zu sehen geglaubt – hatte. Nur die Stimme war in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Sie war mir so real erschienen, dass ich noch immer glaubte, sie zu hören. Ein sanfter, warmer Tonfall, der mich nicht mehr loslassen wollte. Wenn es ein Traum war, sollte die Erinnerung dann nicht langsam verblassen?
»Sam, du spinnst doch!«, schimpfte ich mit mir selbst. Ich war noch keinen Tag hier und begann schon Gespenster zu sehen. Ausgerechnet ich, die ich immer so viel Spaß an Horror- und Gruselfilmen hatte, fürchtete mich plötzlich vor Geistern?
»Es gibt keine Geister!«, rief ich, wenig begeistert darüber, dass ich nach ein paar Stunden des Alleinseins bereits begann, Selbstgespräche zu führen. Nicht auszudenken, in welchem Zustand ich mich befinden würde, wenn ich erst länger hier wäre!
Ich dachte daran, nach oben zurückzukehren, um mich noch einmal genauer umzusehen. Bei dem bloßen Gedanken beschleunigte sich mein Herzschlag jedoch sosehr, dass ich vorsichtshalber davon absah. Ich redete mir ein, dass ich bei Tageslicht ohnehin mehr erkennen würde.
Wenn ich überhaupt jemanden gesehen hatte, dann wohl eher einen Einbrecher als einen Geist. Wobei mir nicht in den Kopf wollte, wie ein Mensch so schnell und lautlos hätte verschwinden können.
3
Am nächsten Morgen zog ich als Erstes alle Gardinen zurück, um die Sonne hereinzulassen. Ich verwandte einige Zeit darauf, nach Spuren zu suchen, doch ich fand nicht den geringsten Hinweis, dass außer mir noch jemand im Haus gewesen wäre. Alle Fenster und Türen waren nach wie vor verriegelt. Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass alles doch nur ein Traum war, schnappte mir ein paar frische Sachen und ging unter die Dusche. Zu meiner Überraschung war das Bad der einzige Raum im Haus, in dem nicht eisige Kälte herrschte.
Trotz der durchwachten Nacht fühlte ich mich nach der Dusche langsam wieder wie ein Mensch. Ich hörte auf, mir Sorgen über Geister zu machen, und begann stattdessen, mein Augenmerk auf die Arbeit zu lenken, die vor mir lag.
Mir wurde schnell klar, dass ich die Tapeten in den oberen Stockwerken erneuern musste. Das Treppengeländer musste neu lackiert und die Holzböden abgeschliffen und frisch versiegelt werden. Ebenso würde ich einige Wandpaneele ausbessern, Teppichböden austauschen und Wände neu streichen müssen. Das waren nur die Dinge, die ich auf den ersten Blick erkannte. Das ganze Ausmaß der anstehenden Arbeiten würde ich vermutlich erst ermessen können, wenn die Möbel raus waren.
Ich hätte gerne etwas gegessen, doch die einzigen nicht verdorbenen Lebensmittel, die ich finden konnte, waren ein paar Beutel Kamillentee und eine Packung Zwieback. Sofern man dabei überhaupt von Lebensmitteln sprechen konnte. Ich beschloss, das Frühstück ausfallen zu lassen und mir später in Cedars Creek etwas Essbares zu besorgen.
In aller Eile mistete ich Kühlschrank und Speisekammer aus und packte alles in einen großen Müllsack, den ich in die Tonne vor dem Haus stopfte, ehe ich mich daran setzte, eine Einkaufsliste zu schreiben.
Zunächst einmal brauchte ich Lebensmittel und Getränke. Sobald alles Nötige auf der Liste stand, machte ich mich auf die Suche nach Tante Fionas Werkzeugschrank. Das Haus hatte weder einen Keller noch einen Speicher, so fand ich in der Garage, wonach ich suchte. Abgesehen von einem Hammer, zwei Schraubenziehern und je einer Dose mit Schrauben und Nägeln gab es nichts weiter Brauchbares. Also setzte ich Werkzeug auf meine Liste. Ich brauchte einen Spachtel, um die alten Tapeten zu entfernen, außerdem einen Schraubenschlüssel, eine Bohrmaschine und noch allerhand Kleinkram. Danach fanden Pinsel und Farbe auf meine Liste, ebenso wie Abdeckplanen, Klebeband, Müllsäcke und eine Menge Kartons, in denen ich die Dinge verpacken wollte, die sich noch verwenden ließen. Außerdem musste ich herausfinden, wie ich die Möbel loswerden konnte, die ich nach der Renovierung nicht im Haus lassen wollte.
Bewaffnet mit der Liste und meinem Rucksack schnappte ich mir den Autoschlüssel und trat vor die Tür. Nach der Kälte im Haus traf mich die morgendliche Wärme überraschend. Beim Anblick der Sonne besserte sich meine Laune schlagartig.
Als ich die Tür abschloss, musste ich grinsen. Kein Mensch, schon gar kein Einbrecher, würde sich hier heraus verirren. »Zombieabwehr«, machte ich mich über mich selbst lustig, stopfte den Schlüssel in meine Jeanstasche und ging zum Wagen.
In gemächlichem Tempo folgte ich der Straße, bis mich – etwa auf Höhe der Kirche – ein verwittertes Blechschild in Cedars Creek willkommen hieß. Stolz verkündete es, dass der Ort 8 457 Einwohner hatte. Ich fragte mich, ob das Schild wirklich jedes Mal aktualisiert wurde, wenn jemand geboren wurde, starb oder fortzog. Freiwillig hierherziehen würde wohl kaum jemand.
Kurz hinter dem Schild entdeckte ich eine Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt und einen Wegweiser zum Cedars Creek Superstore. Mit etwas Glück war das die Kleinstadtversion eines Wal-Mart. Da ich vermutlich im Ort nur einen kleinen Gemischtwarenladen finden würde, beschloss ich, auf dem Rückweg dort vorbeizufahren, um meine Lebensmitteleinkäufe zu erledigen.
Cedars Creek war eine Kleinstadt wie aus dem Bilderbuch. Während die Häuser im übrigen Ort mit großem Abstand zueinander standen, rückten die hellen Fassaden an der Main Street enger zusammen. Es war Mittwoch und die meisten Menschen waren vermutlich arbeiten, denn auf der Straße herrschte nur wenig Verkehr. Selbst von hier aus konnte ich den weißen Qualm sehen, der am anderen Ende des Orts aus dem Schlot der Crowley Distillery in den blauen Himmel stieg.
Ich parkte meinen Käfer hinter einem nagelneuen schwarzen Jeep und stieg aus. Das Erste, was mir auffiel, war das Herrenhaus auf dem Hügel, das deutlich erkennbar über dem Ort thronte. Von dort oben musste man einen schönen Blick über Cedars Creek haben. Ich dachte daran, einmal ein Stück weit den Hügel hinaufzufahren, einfach nur um zu sehen, ob die Aussicht so schön war, wie ich sie mir vorstellte, verschob das Unterfangen aber. Ehe ich an einen Ausflug in die Umgebung denken konnte, lag erst mal eine Menge Arbeit vor mir.
Meine Augen kehrten zur Main Street zurück und fielen auf ein gemütlich wirkendes Diner auf der anderen Straßenseite, genau der richtige Ort, um etwas gegen meinen Hunger zu tun. Das musste allerdings noch ein wenig warten. Zunächst wollte ich noch einige Dinge erledigen. Neugierig wanderte ich die Straße entlang. Zu meinem Erstaunen gab es hier alles, was man zum Leben benötigte. Nicht genug für einen ausgedehnten Einkaufsbummel, aber immerhin sah es nicht danach aus, dass ich elend an Unterversorgung zugrunde gehen würde. Neben dem Diner entdeckte ich den Gemischtwarenladen. An der Straßenecke stand ein Hotel. Cedars Inn verkündete die ausgeschaltete Leuchtschrift über dem Eingang. Ein Stück weiter gab es ein Post Office, einen Friseursalon und ein paar kleinere Läden, darunter sogar eine Boutique. Neben einem italienischen Lokal mit rot-weiß karierten Vorhängen gab es ein chinesisches Restaurant namens Green Dragon. Wenige Schritte weiter kam ich zu meinem Erstaunen an einem Kino und einer zugegeben reichlich rustikal aussehenden Bar vorbei. Ein Schild wies den Weg zur Grundschule und einem Sportplatz, die vermutlich beide am Ortsrand lagen. Auf einem weiteren waren die Crowley Distillery und der Cedars Creek Superstore ausgeschrieben.
Alles in allem deckte sich, was ich sah, ziemlich genau mit meiner Vorstellung über Kleinstädte. Und wenn auch nur die Hälfte von dem stimmte, was ich aus dem Fernsehen wusste, konnte ich mich schon mal von der Hoffnung verabschieden, Tante Fionas Angelegenheiten unbemerkt zu regeln. Ich war eine Fremde an einem Ort, an dem sich vermutlich jeder mit Namen und Lebensgeschichte kannte. Natürlich würde ich auffallen.
Egal, wie weit ich der Straße folgte, das Haus auf dem Hügel war von jedem Punkt aus gut sichtbar. Wie ein Wächter, der seine schützende Hand über die Stadt hielt. Das gefiel mir. Ob Geister auch in seinen Aufgabenbereich fielen? Sofort war die Erinnerung an die letzte Nacht wieder da. Ich hörte die Stimme, die mir sagte, ich solle keine Angst haben, und spürte, wie die eisige Kälte durch meine Knochen kroch. Obwohl ich in der Sonne stand, fror ich plötzlich. Es fiel mir schwer, die Erinnerung abzustreifen. Trotzdem zwang ich mich, meine Aufmerksamkeit wieder auf das, was vor mir lag, zu richten. Ich hielt auf einen kleinen Heimwerkermarkt zu. Ein Polizeiwagen fuhr an mir vorüber und blieb ein Stück weiter vorne, hinter einem weiteren Streifenwagen, am Straßenrand stehen. Bisher hatte Cedars Creek all meine Kleinstadtvorstellungen erfüllt. Der Mann, der jetzt jedoch aus dem Wagen stieg, entsprach ganz und gar nicht dem Klischee des Provinzsheriffs. Ich hatte einen Mann um die fünfzig, mit lichtem Haar und stattlichem Bauch erwartet. Oder wenigstens einen jüngeren, reichlich einfältig wirkenden Kerl. Stattdessen sah ich einen blonden Mann um die dreißig, mit einem Kaffeebecher in der Hand. Er war groß und schlank und machte auf mich nicht den Eindruck eines schlichten Gemüts. Mein Blick folgte ihm über den Bürgersteig, bis er in einem Gebäude verschwand. Büro des Sheriffs stand über dem Eingang. Einen Eingang weiter verkündete ein Schild, dass dort die Stadtverwaltung untergebracht war.
Ich ging weiter und betrat schließlich den Heimwerkermarkt. Ein bärtiger Kerl im Flanellhemd stand an der Kasse und unterhielt sich mit zwei anderen, die gemütlich an der Theke lehnten. Als ich in den Laden kam, sahen sie kurz auf, vertieften sich aber sofort wieder in ihr Gespräch. Die Diskussion drehte sich um Schrauben und Gewinde, was vermutlich das Gegenstück zu Schuhen und Make-up bei uns Frauen war. Mich interessierte weder das eine noch das andere.
Unbehelligt streifte ich durch die Regale. Das Sortiment war solide – soweit ich das mit meinen nicht sonderlich fachmännischen Kenntnissen beurteilen konnte. Zu meiner Freude fand ich alles, was auf meiner Liste stand. Stück für Stück schleppte ich die Sachen zur Ladentheke und legte meine Kreditkarte daneben.
»Sie habe ich hier noch nie gesehen«, sagte der Bärtige, während er begann Beträge einzutippen.
»Ich bin auch erst seit gestern hier.«
»Aha.« Mit einem Blick auf meine Waren und das Werkzeug fügte er grinsend hinzu: »Gefällt Ihnen Ihr Hotelzimmer nicht?«
Ich musste lachen. »Nein, nichts dergleichen. Ich renoviere Fiona Mitchells Haus.«
Augenblicklich wurde er ernst. »Fiona? Sind Sie –«
»Ich bin ihre Nichte. Sam Mitchell«, stellte ich mich vor.
»Tut mir leid, das mit Ihrer Tante«, meldete sich nun einer der beiden anderen Männer zu Wort. »Sie war ein guter Mensch. Ihr Tod hat uns alle überrascht.«
»Danke.« Ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte. Keine Ahnung, wie gut die Männer Tante Fiona gekannt hatten.
»Tja, dann mal willkommen in Cedars Creek. Ich bin Wilbur Perkins«, sagte der Bärtige und zog meine Kreditkarte durch den Kartenleser. »Ziehen Sie in Fionas Haus?«
Ich schüttelte den Kopf. »Wenn ich es hergerichtet habe, werde ich es wohl verkaufen. Sie kennen nicht zufällig jemanden, der ein Haus sucht?« Nicht, dass ich viel Hoffnung hatte, jemand könne ein Haus wollen, das nicht nur in einer Stadt am Ende der Welt, sondern auch noch außerhalb dieser Stadt lag.
»Ich fürchte nein. Aber ich kann mich ja mal umhören.«
»Gerne. Haben Sie Umzugskartons, Mr Perkins?«
»Wie viele brauchen Sie?«
Ich hatte keine Ahnung. »Dreißig?«, schätzte ich vorsichtig.
»Besorge ich Ihnen.«
»Wann kann ich –«
»Sobald ich sie habe, bringe ich sie Ihnen vorbei, abends, nach Ladenschluss. Einverstanden?«
»Vielen Dank.«
Mr Perkins schob mir den Kreditkartenbeleg und einen Stift über die Theke. Während ich unterschrieb, packte er meine Einkäufe in braune Papiertüten. Als er fertig war, legte er den Beleg in seine Kassenschublade. Während ich noch überlegte, wie oft ich gehen musste, um alles zum Wagen zu bringen, richteten sich Mr Perkins’ Augen auf die beiden Männer. Er deutete mit dem Kopf auf die Tüten. »Bill und Frank bringen Ihnen die Sachen zum Auto.«
Die beiden reagierten prompt. Jeder von ihnen klemmte sich zwei Tüten unter den Arm und schnappte sich dann noch einen Eimer Farbe. Alles, was mir zu tragen blieb, war ein kleiner Werkzeugkasten, für den ich mich entschieden hatte.
Ich verabschiedete mich und ging hinter Bill und Frank zur Tür.
»Miss Mitchell«, rief Mr Perkins mir hinterher.
Ich blieb noch einmal stehen. »Ja?«
»Zurzeit treibt sich ein Landstreicher in der Gegend herum. Irgend so ein Drogenfreak. Sperren Sie Ihre Tür gut ab!«
»Danke. Werde ich tun.« Allein schon wegen der Zombies. Ich unterdrückte ein Grinsen, als ich mal wieder an die wandelnden Toten denken musste. Der Gedanke an einen Landstreicher behagte mir allerdings weit weniger. Was, wenn ich ihm bereits begegnet war – vergangene Nacht … Nein! Ein Eindringling hätte Spuren hinterlassen. Was ich gesehen hatte, war entweder das Bild eines Traums oder ein Gespenst. Ich hoffte auf den Traum.