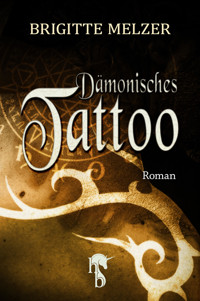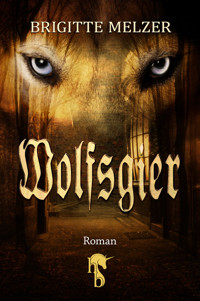4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sam ist in einen Todesfall verwickelt, wird von Einbrechern heimgesucht und von einer neugierigen Journalistin verfolgt – doch das sind im Moment ihre geringsten Probleme. Weitaus bedrohlicher ist die Veränderung, die mit Nicholas vor sich geht – dem Geist, der in ihrem Haus und ihrem Herzen spukt. Nachdem er für kurze Zeit lebendig war, kann er die Gier nach Leben kaum noch beherrschen. Das macht ihn auch für Sam zur Gefahr. Obendrein droht Sheriff Travis Sams Geheimnis auf die Spur zu kommen. Als dann auch noch die Toten aus ihren Gräbern zurückkehren, sieht Sam sich gezwungen, zu handeln. Nicht alle Geister lieben mich – Band 2.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brigitte Melzer
Nicht alle Geister lieben mich
Roman
1
Ich hetzte den Hügel hinauf, als wäre eine Horde Zombies hinter mir her.
Die Narbe an meinem Bauch pulsierte und meine Waden schmerzten so heftig, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis meine Beine den Dienst versagten. Trotzdem weigerte ich mich, stehen zu bleiben, gestattete mir lediglich, ein wenig langsamer zu laufen. Ich wollte es endlich hinter mich bringen. Ich musste es hinter mich bringen. Die Ungewissheit fraß mich auf und es hatte mich all meine Geduld gekostet, zumindest bis zum Einbruch der Dämmerung zu warten, bevor ich mich auf den Weg machte.
Die feuchtkalte Oktoberluft brannte in meinen Lungen und mit jedem Atemzug tanzten flimmernde Punkte vor meinen Augen. Ich hätte in meinem alten Käfer sitzen und gemütlich den Hügel nach oben fahren können, aber ich hatte mich gegen die bequeme Variante entschieden. Wenn jemand kam, wollte ich in der Lage sein, unbemerkt zu verschwinden, und solange mein Käfer keinen Unsichtbarkeitsknopf hatte, war der Fußmarsch die einzige Alternative.
Ich hielt mich am Rand des Gehwegs, dicht an den Bäumen, bereit, beim ersten auffälligen Laut zwischen dem Grünzeug abzutauchen. Das Keuchen und Pfeifen, das mit jedem Atemzug aus meinem Mund entwich, ließ mich allerdings bezweifeln, dass ich es überhaupt bemerken würde, wenn jemand käme.
Eine Hand auf die Narbe an meinem Bauch gepresst, lief ich weiter. Ich war erst gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden und nach Cedars Creek zurückgekehrt. Entgegen dem Rat der Ärzte, mich zu schonen, hatte ich den gestrigen Tag damit verbracht, Tante Fionas Sachen in Kartons zu packen und diese in der Garage zu stapeln – zumindest bis Nicholas bei Einbruch der Nacht erschienen war.
Ich warf einen Blick zum Himmel, der immer mehr an Licht und Farbe verlor. Nicht mehr lange, dann würde ich Nicholas wiedersehen.
Nachdem ich einmal tief durchgeatmet hatte, beschleunigte ich meinen Schritt wieder und folgte der gewundenen Straße weiter nach oben, bis zur letzten Kurve. Das Crowley-Anwesen tauchte so unvermittelt vor mir aus der Dämmerung auf, dass ich wie versteinert innehielt. Die dunklen Fenster starrten mir entgegen wie leere Augenhöhlen. Wunderbar. Drei Wochen ohne Kabelfernsehen im Krankenhaus und ich war so sehr auf Horrorfilmentzug, dass ich bereits in einem harmlosen Haus ein Monster sah. Dabei war der Anblick des Hauses nichts, verglichen damit, was mich drinnen erwartete. So eilig ich es auch gehabt haben mochte, hier heraufzukommen, jetzt wünschte ich mir, kehrtmachen und wieder verschwinden zu können. Meine Beine zuckten. Kies knirschte unter meinen Sohlen, als ich das Gewicht verlagerte.
Nein!
Ich würde nicht davonlaufen!
Allerdings brachte ich auch nicht den Mut auf, meinen Weg fortzusetzen. Ich stand einfach nur da und starrte das Haus an, bei dessen Anblick dunkle Bilder von vergangenen Erlebnissen in mir aufstiegen. Erst ein kühler Hauch an meiner linken Seite befreite mich aus meiner Lähmung. Nicholas. Zu wissen, dass er hier war, auch wenn ich ihn im Augenblick nur spüren, aber nicht sehen konnte, gab mir meine Entschlossenheit zurück. Ich verdrängte die aufkeimenden Erinnerungen und lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Überwachungskameras an den Hausecken. Die kleinen roten Lichter, die anzeigten, dass die Anlage in Betrieb war, waren erloschen. Ebenso tot wie ihr Besitzer.
Getrieben von dem Wunsch, es hinter mich zu bringen, lief ich die Auffahrt hoch, umrundete Adrians Jeep, der noch immer so dastand wie an jenem Abend, an dem ich das letzte Mal hier gewesen war, und ging zur Tür.
Wochenlang hatte ich damit gerechnet, dass Sheriff Travis jeden Moment mit einem Haftbefehl an meinem Krankenbett erscheinen würde. Als er schließlich kam, trug er weder seine Polizeiuniform noch stellte er die Fragen, die ich erwartet hatte. Er erkundigte sich lediglich danach, wie es mir ging und was geschehen war. Und er ließ mir ein Buch da, das meine Fantasie mehr ankurbelte als alles, was ich mir vor seinem Besuch ausgemalt hatte. Wer die Wahrheit kennt. So ein Buchtitel konnte unmöglich ein Zufall sein! Der Sheriff wusste etwas – unglücklicherweise konnte ich ihn nicht fragen, was.
Bei seinem Besuch hatte er Adrian mit keinem Wort erwähnt, ebenso wenig das Anwesen. Es bestand also durchaus die Möglichkeit, dass Adrians Leichnam immer noch unentdeckt dort drinnen lag und ich meine Spuren beseitigen konnte, ehe mich jemand mit seinem Tod in Verbindung bringen konnte. Schon bei dem Gedanken an all das Blut – mein Blut – wurde mir ganz schlecht. Wie eine Leiche nach ein paar Wochen roch, wollte ich mir gar nicht erst vorstellen. Ich würde es früh genug herausfinden.
An der Tür angekommen, blieb ich stehen. Ich zog ein Paar Latexhandschuhe aus meiner Jackentasche, streifte sie über und griff nach der Taschenlampe, die ich an meinem Gürtel befestigt hatte. Immer wieder sah ich mich nach allen Seiten um und rechnete damit, mich jeden Moment im Scheinwerferlicht eines um die Kurve biegenden Wagens wiederzufinden.
»Das wird nicht passieren«, versuchte ich mich selbst zu beruhigen.
Das Herrenhaus war das letzte Gebäude auf dem Hügel – das einzige Gebäude. Die Straße war kaum befahren und von meinem Haus bis hierher gab es keine anderen Häuser. Adrian hatte gezwungenermaßen ein sehr zurückgezogenes Leben geführt, sodass ich mich kaum um plötzlichen Besuch sorgen musste. Schon eher darum, dass ihn jemand in der Distillery vermisste und hierher kam, um nach dem Rechten zu sehen. Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass der Boss wochenlang verschwand und niemand nach ihm suchte? Vielleicht hatte Adrian seinen Angestellten erzählt, auf Geschäftsreise zu sein. Eine Ausrede, die er auch mir gegenüber erfolgreich benutzt hatte, um sein Hexenwerk samt Nebenwirkungen zu verbergen.
Die Tür, die Nicholas aus den Angeln gerissen hatte, um mich zu retten, lehnte am Rahmen. Als ich vorsichtig dagegendrückte, wäre sie beinahe nach innen gefallen. Ich schob sie weit genug zur Seite, um mich durch den Spalt zu zwängen, und wappnete mich gegen den Gestank. Doch statt der erwarteten Mischung aus Verwesungsgeruch und Blut schlug mir eine Wolke von Zitronenaroma entgegen – Putzmittel.
Im Haus war es bereits so düster, dass ich nur die Umrisse der Treppe im Halbdunkel ausmachen konnte. Ich knipste die Taschenlampe an und holte zischend Luft, als ich die sauberen Holzdielen sah. Meine Hand zitterte, während ich den Lichtschein über den sauberen Boden wandern ließ. Wo war das Blut? Meine Augen flogen zu der Stelle, an der Adrians Leichnam gelegen hatte.
Er war fort.
Was zum Teufel war hier los?
War es möglich, dass Adrian am Leben war?
Hatte der Trank, den er all die Jahre geschluckt hatte, ihn zurückgeholt?
Ein kühler Luftzug fuhr wie eisiger Atem über meinen Nacken und ließ mich herumfahren. Ein Paar leerer Augen starrte mich aus dem Halbdunkel an. Ich stolperte zurück und riss die Taschenlampe hoch. Der Lichtstrahl traf auf die Stammesmaske, die Teil des Geisterbanns gewesen war, der Nicholas vom Haus ferngehalten hatte. Ich hatte sie in der Nacht heruntergerissen, in der ich beinahe gestorben war. Jemand hatte sie wieder an den Haken auf der Innenseite der Tür gehängt. Nichts weiter als ein nutzloses Stück Holz. Trotzdem schlug mir das Herz bis zum Hals. Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, dass es kein Atem gewesen war, den ich gespürt hatte – bloß der Wind, der durch die angelehnte Tür hereinwehte.
Nur widerwillig drehte ich der Tür wieder den Rücken zu. Ich dachte daran, auf Nicholas zu warten – es konnte nicht mehr lange dauern, bis er endlich sichtbar wurde –, doch ich konnte hier nicht einfach herumstehen. Nicht in diesem Haus.
Ich durchquerte die Halle bis zur Kellertür, die Lampe auf den Boden gerichtet. Abgesehen von einer dünnen Staubschicht auf dem Holz gab es nicht die geringste Spur. Nichts deutete darauf hin, was hier geschehen war.
An der Kellertür angekommen, zögerte ich. Die Kälte, die ich jetzt verspürte, war anders als der Luftzug, der mich vorhin erschreckt hatte. Dieses Mal lag etwas Vertrautes darin – eine sanfte Berührung, die mir Mut zusprechen sollte. Auch wenn ich ihn noch nicht sehen konnte, wusste ich, dass Nicholas dicht neben mir stand. So dicht, als wolle er mich antreiben, das Unvermeidbare nicht noch länger aufzuschieben. Entschlossen packte ich den Knauf und riss die Tür auf. Der Zitrusgeruch war auch hier überall und ließ keinen Zweifel daran, dass, wer auch immer im Haus gewesen war, vor dem Keller nicht haltgemacht hatte.
Ich leuchtete auf die Stufen vor mir und folgte der Treppe langsam nach unten, jeden Winkel mit dem Lichtschein abtastend. Auch hier war nirgendwo Blut. Womöglich sollte ich erleichtert sein, dass jemand den Beweis meiner Anwesenheit entfernt hatte, doch solange ich nicht wusste, wer dafür verantwortlich war, konnte ich nicht einmal im Ansatz daran denken, aufzuatmen.
Am Fuß der Treppe angekommen, ging ich, ohne noch einmal stehen zu bleiben, zum Labor. Es kostete mich all meine Überwindung, die Tür zu öffnen – als ich es tat, stieß ich sie so heftig auf, dass sie gegen die Wand knallte. Da es hier keine Fenster gab, durch die mich das Licht hätte verraten können, tastete ich nach dem Lichtschalter und legte ihn um. Die nackte Glühbirne, die über dem OP-Tisch von der Decke hing, schaffte es kaum, den Raum zu erhellen. Im Zusammenspiel mit der niedrigen Steindecke verlieh das schwache Licht dem Labor etwas Beklemmendes.
Obwohl es mir widerstrebte, bewegte ich mich langsam vorwärts. Die Erinnerung an das, was in diesem Raum geschehen war, blitzte in einem Gewitter verstörender Bilder vor meinem inneren Auge auf und ließ die Narbe an meinem Bauch pulsieren. Im Raum war es so kalt, dass ich Nicholas’ Nähe nicht länger spüren konnte. Ich rieb mir über die Arme, um die Gänsehaut zu vertreiben, die sich über meine Haut ausbreitete.
Der Geruch von Putzmittel war hier noch stärker als im Rest des Hauses. Der Stahltisch, auf dem Adrian mir den Bauch aufgeschlitzt hatte, war blank poliert, jede Spur von Blut fort. Der Rollwagen, auf dem Adrians Werkzeug gelegen hatte, war wieder aufgestellt worden, die Blechschale und das OP-Besteck lagen nicht mehr darauf. Ebenso war die Apparatur mit all ihren Glaskolben, Schläuchen und dem Bunsenbrenner verschwunden, mit der er das Elixier gebraut hatte, das mich beinahe das Leben gekostet hätte.
Ich war vor ein paar Wochen nach Cedars Creek gekommen, um das Haus meiner Tante zu renovieren und zu verkaufen. Tante Fiona war überraschend verstorben und hatte mir ihren Besitz hinterlassen. Wie sich herausstellte, war das Haus jedoch alles andere als unbewohnt – ich teilte es mit einem Geist. Zusammen mit Tess, die ich in der Bibliothek kennengelernt und mit der ich mich angefreundet hatte, suchte ich nach einem Weg, den Geist zu vertreiben. Tess, die ein großes Interesse für Esoterik hegte, nannte es, »ihm seinen Frieden schenken«. Das war allerdings gründlich schiefgegangen und hatte lediglich den Effekt gehabt, dass wir Nicholas’ Anwesenheit ab da nicht nur spüren, sondern ihn nach Einbruch der Dunkelheit auch sehen konnten.
Wie sich herausstellte, war er der vor fünfzig Jahren verstorbene Sohn von Cedric Crowley, jenem Mann, der nach dem Ende der Prohibition die Crowley Distillery begründet hatte und zum größten Arbeitgeber im Ort geworden war.
Das Haus, in dessen Keller ich jetzt stand, war damals nichts weiter als ein Haufen Schutt gewesen, die Überreste einer Brandruine, in der Ende des 17. Jahrhunderts die Baker-Schwestern verbrannt worden waren, nachdem die Dorfbewohner sie der Hexerei für schuldig befunden hatten. Cedric ließ das neue Anwesen auf den Ruinen des Baker-Hauses erbauen und zog mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen Adrian und Nicholas ein.
Beim Stöbern im Keller fanden die beiden – versteckt in den Fundamenten des abgebrannten Hauses – ein altes Buch und darin Formeln, Sprüche und Riten. Obwohl Adrian von dem Buch fasziniert war, setzte sich Nicholas mit seinem Wunsch, es zu vernichten, durch. Noch in derselben Nacht warf er es in den Küchenofen, nicht ahnend, dass Adrian es aus den Flammen retten und verstecken würde.
Im Laufe der Jahre begann Adrian, sich das Buch zunutze zu machen. Kleine Täuschungen, die ihn älter wirken ließen, ermöglichten es ihm, das Haus unbemerkt zu verlassen, auch wenn seine Eltern es ihm verboten hatten. Es war eine der Formeln, die nach den Flammen des Ofens noch halbwegs zu entziffern waren. Diese und eine weitere, die ewiges Leben versprach. Letztere war es, die Nicholas Sorgen bereitete. Er warnte Adrian davor, sie anzuwenden, und der versprach, die Finger davon zu lassen.
Das Schicksal jedoch hatte andere Pläne.
Nach einem Unfall, der Adrian beinahe das Leben kostete, schwor er sich, niemals zu sterben. Er begann mit den noch lesbaren Teilen der Formel zu experimentieren und schließlich gelang es ihm, die Lücken zu füllen. Das Ergebnis war ein Elixier, das ihn nicht nur unsterblich machen, sondern auch seine Jugend erhalten sollte.
Einmal platzte Nicholas versehentlich mitten in seine Experimente. Er erwischte Adrian in einem Kreidekreis, wo er eine Katze bei lebendigem Leib ausweidete. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf Nicholas das Buch an sich brachte, um es ein für alle Mal zu vernichten. Adrian verfolgte ihn durchs Haus und stellte ihn auf der Galerie zum ersten Stock. Im darauf folgenden Gerangel verpasste Adrian seinem Bruder einen Tritt, der ihn aus dem Fenster stürzen ließ.
Ich hatte Nicholas’ Gesicht noch lebhaft vor Augen, als er mir von seinem eigenen Tod erzählte, beherrscht und frei von Hass. Adrian hatte ihn ermordet und trotzdem versuchte er noch immer den Bruder in ihm zu sehen, der er früher einmal gewesen war – bevor die Hexerei sein Wesen verändert hatte und er zu einem Menschen geworden war, der sich nicht länger um das Schicksal anderer scherte.
Ein paar Wochen nach Nicholas’ Tod kam Adrian eines Nachts an sein Grab und verbrannte das Buch, das so viel Unheil über die Brüder gebracht hatte.
Nicholas geisterte nun schon seit über fünfzig Jahren herum, doch er sah noch immer aus wie der Mann Ende zwanzig, als der er gestorben war. Im Laufe der Wochen, die wir zusammen in Tante Fionas Haus verbrachten, lernte ich ihn besser kennen, und ganz egal, wie oft ich auch mit dem Schicksal haderte, mich ausgerechnet in einen Geist zu verlieben, es änderte nichts an meinen Gefühlen. Ich hatte es wahrlich versucht. Meine Güte, ich hatte sogar mit seinem Großneffen Adrian junior geflirtet und mir einzureden versucht, dass er die bessere Wahl sei – gut aussehend, reich und eindeutig lebendig. Nicholas hatte mich auch noch ermuntert, mich mit Adrian zu treffen, denn sosehr er mich liebte, so wenig wünschte er sich für mich, dass ich mein Leben in einer Kleinstadt, an einen Geist gebunden, verbringen sollte, den ich nur berühren konnte, wenn er sich vorher etwas von meinem Atem genommen hatte.
Abgesehen davon, dass sich meine Gefühle für ihn nicht einfach so abstellen ließen, entpuppte sich Adrian als denkbar schlechte Wahl. Vermutlich hätte ich misstrauisch werden sollen, dass sich ein Mann wie Adrian überhaupt für jemanden wie mich interessierte. Nicht dass ich hässlich war oder langweilig, nichtsdestotrotz spielte Adrian in einer anderen Liga. Wären wir uns in Minneapolis oder irgendeiner anderen Großstadt begegnet, hätte mich jemand wie er nicht einmal bemerkt. Anfangs dachte ich, es läge an der Umgebung, dass er Notiz von mir nahm – zwei Großstädter, die es gegen ihren Willen in die Provinz verschlagen hatte und die sich deshalb zusammentaten –, doch auch das erwies sich als Irrtum.
An jenem Abend, an dem mich Adrian von zu Hause abholte, um mich zum Essen auszuführen, bekam Nicholas ihn das erste Mal zu Gesicht. Das Ganze war ziemlich dramatisch und ich dachte schon, Nicholas wäre vollkommen durchgedreht, als er versuchte, Adrian anzugreifen. Sobald er merkte, dass er damit nichts erreichen würde – er konnte Adrian weder berühren noch ihm sonst irgendwie schaden –, versuchte er mich davon zu überzeugen, im Haus zu bleiben. Er drängte mich in eine Ecke und nahm gewaltsam meinen Atem. Plötzlich materiell geworden, spürte ich seine Kraft und wusste, dass ich ihm nichts entgegenzusetzen hatte. Statt jedoch das Leben aus mir herauszusaugen, gab er mich schlagartig frei, entsetzt angesichts dessen, was er mir fast angetan hätte. Obwohl er mich sofort um Verzeihung bat, jagte mir sein Verhalten so viel Angst ein, dass ich aus dem Haus flüchtete.
Das Essen bei Adrian war dann alles andere als ein Vergnügen. Ich war viel zu abgelenkt, als dass ich mich auf das Date hätte konzentrieren können. Glücklicherweise fand der Abend ein frühes Ende.
Meine Furcht vor Nicholas war jedoch so groß, dass ich in jener Nacht im Hotel schlief. Am nächsten Morgen wollte ich zu Tess, um ihr von Nicholas’ Angst einflößendem Verhalten zu erzählen. Doch Tess war tot. Erstickt. Dieselbe Todesursache, die man bei mir festgestellt hätte, wenn Nicholas mit meinem Atem das Leben aus mir gesaugt hätte, um selbst wieder lebendig zu werden.
Aber das war nicht möglich. Nicholas konnte nicht zu Tess gelangt sein, denn er war an den Umkreis des Friedhofs gebunden – zumindest dachte ich das, bis ich seine kühle Gegenwart neben mir spürte. Fernab des Friedhofs. Es war für ihn nicht leicht, mich zu stellen, und noch schwieriger, mich dazu zu bringen, ihm zuzuhören. Als er mich schließlich in die Enge trieb, war meine Panik so groß, dass mir nicht einmal auffiel, dass er lebendig sein müsste, wenn er Tess das Leben ausgesaugt hätte. Doch er war immer noch ein Geist.
Den Atem, den er mir genommen hatte, hatte er genutzt, um Tess anzurufen und sie dazu zu bringen, ein Ritual durchzuführen, damit er nicht länger an den Friedhof gebunden war. Es war jedoch Adrian gewesen, der Tess umgebracht hatte – jener Adrian, in dessen Wohnzimmer ich wenige Stunden zuvor noch gesessen hatte. Er hatte sie mit einer Tüte erstickt, wohl wissend, dass ich Nicholas verdächtigen würde.
Doch das war längst nicht alles. Der junge Mann, der sich mir als Adrian Crowley junior vorgestellt hatte, war in Wahrheit Nicholas’ Bruder. Wie sich herausstellte, hatte er das Buch damals an Nicholas’ Grab nur verbrannt, weil er längst Ersatz dafür gefunden hatte. Er hatte nie aufgehört, seine Experimente voranzutreiben, und mittlerweile war es ihm gelungen, ein Elixier zu brauen, das ihn jung hielt. So gab er sich als sein eigener Enkel aus, der die Geschäfte der Distillery führte, während der vermeintlich gebrechliche Großvater im Herrenhaus ein zurückgezogenes Leben führte. Nach Jahren der Anwendung ließ die Wirkung des Elixiers jedoch immer schneller nach. Hatte der Effekt zu Beginn noch jahrelang angehalten, dauerte es mittlerweile nur noch ein paar Tage, bevor sein Körper zu altern begann und er den nächsten Schuss brauchte. Bei seinen Nachforschungen war er auf eine Möglichkeit gestoßen, die Wirkung dauerhaft zu machen. Dazu jedoch benötigte er Hexenblut.
Zu meinem Unglück war ausgerechnet ich, die harmlose Samantha Mitchell, eine entfernte Nachfahrin der Baker-Schwestern, jener Hexen, die damals in ihrem Haus verbrannt worden waren. Das war der wahre Grund, warum sich Adrian für mich interessiert hatte.
Nicholas und ich fassten einen Plan, wie wir Adrian das Handwerk legen, sein Labor und seine Bücher vernichten und ihn so ein für alle Mal von seinem Elixier abschneiden könnten. Adrian jedoch war uns einen Schritt voraus und so fand ich mich kurz darauf in seinem Keller auf dem OP-Tisch wieder, dessen spiegelblank polierte Oberfläche ich jetzt anstarrte – Nicholas durch einen Geisterbann vom Haus und von mir ferngehalten.
Adrian schlitzte mir den Bauch auf, um mich ausbluten zu lassen. Er hätte einfach eine Arterie nehmen können, dann hätte ich nicht die geringste Chance gehabt, aber vielleicht hatte er es auch auf meine Organe abgesehen. Darüber, ob diese eine Rolle in dem Ritual spielten – wie die Organe der ausgeweideten Katzen –, weigerte ich mich noch immer nachzudenken. Dass der Schmerz mich nicht umgehauen hatte, war allein dem Betäubungsmittel zuzuschreiben gewesen, das er mir verabreicht hatte.
Dank meines Pfeffersprays schaffte ich es zumindest bis nach oben und konnte den Geisterbann durchbrechen. Den Rest erledigte Nicholas.
Nachdem ich ihm bereits zuvor von meinem Atem gegeben hatte, war er noch materiell genug, um Adrian in einen Kampf zu verwickeln. Die Wirkung von Adrians Elixier war nahezu verbraucht, und als Nicholas seinen Atem nahm, holte ihn sein wahres Alter mehr und mehr ein, bis nur noch der Leichnam eines alten Mannes übrig blieb.
Durch Adrians Atem ins Leben zurückgekehrt, brachte Nicholas mich aus dem Haus und trug mich die Straße hinunter. Ich erinnerte mich nicht mehr an viel, was in diesen Momenten geschah, das Entsetzen jedoch, das ich verspürte, als Nicholas mir seinen Atem gab, um meinen Tod zu verhindern, brannte sich unauslöschlich in mein Gedächtnis ein.
Als Letztes erinnerte ich mich daran, dass Nicholas plötzlich fort war und Sheriff Travis über mir kniete. Dann war da eine lange Zeit nichts mehr, ehe ich im Krankenhaus wieder zu mir kam. Nicholas war bei mir und für einen Moment war ich erleichtert, ihn am Leben zu wissen. Dann jedoch sah ich, wie eine der Schwestern geradewegs durch ihn hindurchmarschierte, und erkannte die Wahrheit: Er hatte sein eigenes Leben geopfert, um meines zu retten.
Selbst heute wusste ich noch nicht, ob ich darüber wütend, erleichtert oder traurig sein sollte. Nicholas behauptete zwar, dass es ihm nichts ausmachen würde, immerhin sei er diesen Zustand nun seit über fünfzig Jahren gewohnt, mir jedoch machte es sehr wohl etwas aus.
Inzwischen hatte ich gelernt, meinen Atem zu dosieren und ihn Nicholas zu geben, um ihn berühren zu können und mich von ihm berühren zu lassen. Wir waren gut darin geworden, die richtige Dosis zu finden. Trotzdem war es zu wenig. Nicholas hatte so viel mehr verdient als dieses geisterhafte Dasein.
Der Mord an ihm war gesühnt, er hätte seinen Frieden finden müssen, doch er war immer noch hier. Er vermutete, dass es etwas mit dem Ritual zu tun hatte, durch das er sichtbar geworden war, vielleicht auch damit, dass er für kurze Zeit wieder lebendig gewesen war. Woran es auch liegen mochte, er störte sich nicht daran.
*
Obwohl nichts mehr daran erinnerte, was in diesem Gewölbe geschehen war, konnte ich den Anblick des OP-Tisches nicht länger ertragen. Statt nach weiteren Spuren zu suchen, machte ich kehrt und wollte aus dem Raum flüchten, als plötzlich eine Gestalt vor mir aufragte. Mit einem Schrei fuhr ich zurück, einen Moment lang davon überzeugt, Adrian vor mir zu haben. Als der Mann jedoch nach mir griff und seine Hand durch meinen Arm glitt, atmete ich erleichtert aus.
Nicholas machte einen Schritt auf mich zu und blieb abrupt stehen, als sei ihm schlagartig bewusst geworden, dass er mich nicht berühren konnte. »Entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken.«
Das wollte er nie und trotzdem schaffte er es regelmäßig, dass mir beinahe das Herz stehen blieb, wenn er nach Einbruch der Dunkelheit plötzlich sichtbar wurde. Mir war klar, dass er es nicht absichtlich tat. Es war ja nicht so, dass er sich an mich heranschlich, um mich mit einem lauten »Buh!« an die Decke zu jagen. Vielmehr wurde er einfach an der Stelle sichtbar, an der er gerade stand, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich mich umdrehte oder den Kopf hob, damit rechnete, ihn zu sehen.
Ich schlüpfte an ihm vorbei aus dem Labor und lehnte mich im Gang mit dem Rücken gegen die Wand. Kälte kroch aus dem Mauerwerk, durchdrang meine Jacke und den Pullover darunter und fraß sich langsam in meine Haut.
Dieses Mal spürte ich Nicholas’ Nähe, und als ich den Kopf hob, blickte ich in seine kantigen Züge. Er musterte mich besorgt aus diesen unglaublich blauen Augen, die mich vom ersten Moment an in ihren Bann gezogen hatten. Er war von meinem Plan, hierher zu kommen nicht sonderlich begeistert gewesen, und hatte nur zugestimmt, weil er begriffen hatte, wie wichtig es für mich war, herauszufinden, ob jemand von den Ereignissen im Haus wusste. Abgesehen davon hätte er mich in seiner körperlosen Gestalt auch nur schwer davon abhalten können.
»Alles in Ordnung, Sam?«
Ich brachte ein schiefes Lächeln zustande. »Nein, nicht wirklich.«
Er kam noch einen Schritt näher, seine Lippen ganz nah an meinen. Ich atmete aus und sah, wie er meinen Atem in sich aufnahm. Seine Lippen streiften meine in einem sanften Kuss. Einen Herzschlag später spürte ich seine Arme und lehnte mich erleichtert an seine Brust. Die Kälte, die seine Gegenwart verströmte, machte mir nichts aus, daran hatte ich mich längst gewöhnt, und das leise Frösteln, das mich von Zeit zu Zeit noch überfiel, ließ sich mit einem dickeren Pulli leicht beheben.
»Jemand hat aufgeräumt«, sagte ich an seiner Schulter. »Es ist alles sauber.«
»Die Spurensicherung?«
Ich hatte nirgendwo ein Absperrband gesehen und auch keine Reste des Pulvers, mit dem die Polizei Fingerabdrücke sichtbar machte. Überhaupt war alles viel zu ordentlich, als dass hier ein Horde Cops durchgetrampelt sein könnte. Wenn man einmal vom scharfen Geruch des Putzmittels absah, unter den sich der modrige Geruch des Kellers mischte, gab es nicht den geringsten Hinweis darauf, dass jemand im Haus gewesen war. Soweit ich wusste, hatte Adrian niemanden gehabt, der sich um das Haus kümmerte – das hatte er sich gar nicht erlauben können, angesichts der Dinge, die er in seinem Labor trieb.
»Wenn es die Spurensicherung gewesen wäre, hätte längst jemand vor meiner Tür gestanden.« Sheriff Travis beäugte mich schon seit geraumer Zeit mit Misstrauen – kein Wunder angesichts der Tatsache, dass mein Name mit so ziemlich jedem Verbrechen in Verbindung stand, das seit meiner Ankunft in Cedars Creek begangen worden war. »Ich wünschte, ich wüsste, was hier passiert ist!«
»Wenn du mich fragst, machst du dir zu viele Sorgen.« Nicholas schloss seine Arme enger um mich und strich mir über den Rücken. »Nichts von alldem lässt sich zu dir zurückverfolgen, solange deine Fingerabdrücke nirgendwo gespeichert sind. Du wurdest doch noch nie verhaftet, oder?«
»Natürlich nicht.«
»Dann können sie dich auch nicht mit den Ereignissen hier in Verbindung bringen.«
Vielleicht nicht nach den Ermittlungsmethoden, die es zu seinen Lebzeiten gegeben hatte. Seit den 50er Jahren hatte sich die Polizeiarbeit jedoch weiterentwickelt. Ich dachte an DNA-Spuren und an das viele Blut, das man hier von mir gefunden haben musste. Andererseits konnten sie auch damit nichts anfangen, da meine DNA ebenso wenig in irgendwelchen Polizeidateien gespeichert war wie meine Fingerabdrücke. Es hatte durchaus seine Vorteile, dass ich mich an der Highschool und am College von den bösen Jungs ferngehalten hatte: Ein Abgleich meiner DNA und Fingerabdrücke würde ins Leere laufen.
Es sei denn, der Sheriff hatte einen anderen Weg gefunden. Doch das hielt selbst ich, mit meiner ansonsten blühenden Fantasie, für unwahrscheinlich. Sheriff Travis war kein Mensch, der Dinge auf die lange Bank schob. Wenn er Beweise hätte, die mich mit den Vorgängen im Haus in Verbindung brachten, hätte er mich längst damit konfrontiert.
Als Nicholas nichts mehr sagte, hob ich den Kopf und bemerkte, dass sein Blick auf das Labor gerichtet war. »Die Katzen«, sagte er dann und gab mich so schnell frei, dass ich um ein Haar das Gleichgewicht verloren hätte.
Adrian hatte sein Elixier aus dem Blut von Katzen gebraut – zumindest so lange, bis eine Nachfahrin der Hexen auf seinem Tisch gelandet war. Ich folgte Nicholas zu dem Raum, in dem sein Bruder die Tiere gehalten hatte.
Es erstaunte mich nicht, dass wir nichts weiter vorfanden als eine Reihe leerer Käfige und den intensiven Geruch von Zitrone. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie lange eine Katze ohne Futter und Wasser überleben konnte, doch ich hoffte, dass sie rechtzeitig entdeckt worden waren.
Obwohl wir nicht viel Hoffnung hatten, noch etwas zu finden, sahen wir uns auch in den restlichen Kellerräumen um, ohne mehr zu entdecken als ein paar Lagerräume für Lebensmittel und alte Möbel. Als wir in die Eingangshalle zurückkehrten und uns dem Wohnzimmer zuwandten, um unsere Erkundungen dort fortzusetzen, hielt Nicholas mitten im Schritt inne. So plötzlich, dass ich beinahe gegen ihn gelaufen wäre.
Die Augen zusammengekniffen, blickte er auf die angelehnte Haustür. »Da kommt jemand.«
Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, fiel der Lichtschein einer Taschenlampe durch eines der Fenster in die Eingangshalle. Der Lichtstrahl streifte Nicholas’ schwarzes Haar. Ich griff nach seiner Hand und zog ihn zurück. Erst das amüsierte Funkeln in seinen Augen erinnerte mich daran, dass er sich mitten in die Tür stellen konnte, ohne von den Besuchern gesehen zu werden. Ich hielt noch immer sein Handgelenk umklammert, als mir der Fehler in diesem Gedankengang klar wurde.
»Geh sofort in Deckung!«, zischte ich.
Er öffnete den Mund, doch ehe ein Wort über seine Lippen kam, erlosch der amüsierte Glanz in seinen Augen. Offensichtlich hatte er ebenfalls begriffen, dass er – solange er meinen Atem in sich trug – so sichtbar war wie ein Zombie.
»Ich schätze, daran muss ich mich erst gewöhnen«, murmelte er und schob mich in den Schutz der Treppe. Sein Blick wanderte hinauf.
Kommt nicht infrage! Er war schon einmal nach oben geflohen, als ihm unten die Fluchtwege abgeschnitten waren. Es hatte ihm den Tod gebracht. Auch wenn ich vermutete, dass die Neuankömmlinge mich schlimmstenfalls verhaften würden, legte ich es nicht darauf an, ein Risiko einzugehen.
Ich löste meine Finger von seinem Handgelenk, verwundert darüber, dass er sich mit keiner Silbe über meinen erschrockenen Klammergriff beschwert hatte, und wollte in Richtung Fenster.
Nicholas hielt mich zurück. »Lass mich das machen.«
»Du bist zu sehr daran gewöhnt, unsichtbar zu sein, um dich in deinem jetzigen Zustand unauffällig zu bewegen.«
Er setzte zu einem Widerspruch an, dann nickte er jedoch und ließ meinen Arm los. »Sei vorsichtig.«
Geduckt schlich ich zu einem der vorderen Fenster. Den Rücken an die Wand daneben gepresst, richtete ich mich vorsichtig auf und spähte hinaus.
In der Einfahrt stand ein dunkler Wagen. Polizei oder FBI, vermutete ich, dann jedoch sah ich den in der Windschutzscheibe klebenden Strichcode, der das Fahrzeug als Mietwagen auswies. Wer zum Henker kam mit einem Mietwagen hier herauf? In Cedars Creek gab es nicht einmal eine Autovermietung. Waren das Freunde von Adrian? Und wenn ja: des Juniors oder des Seniors?
Mein Blick wanderte vom Wagen zu den drei Gestalten, die sich auf die Haustür zubewegten. Ich kniff die Augen zusammen, um sie besser erkennen zu können, doch im Gegenlicht der Taschenlampen blieben es drei dunkle Silhouetten. Das Knirschen des Kieses wurde lauter, noch ein paar Schritte, dann hätten sie die Tür erreicht.
Ich huschte zu Nicholas zurück. »Wir müssen hier raus.«
Er schien mich nicht gehört zu haben. Sein Blick war konzentriert, als lausche er auf etwas, was mir verborgen blieb. Zum ersten Mal fragte ich mich, ob seine Sinne feiner waren als meine. Dass er im Dunkeln deutlich besser sehen konnte als jeder Lebende, wusste ich bereits. Aber konnte er auch besser hören?
»Da stimmt etwas nicht.« Noch immer konzentriert, kniff er die Augen zusammen, dann stieß er einen Fluch aus, bei dem ich nicht sicher war, ob es diese Worte in den 50er Jahren bereits gegeben hatte, und löste sich vor meinen Augen in Luft auf. Großartig, ausgerechnet jetzt ging ihm mein Atem aus!
Aber selbst wenn er nicht länger genug von meiner Lebenskraft in sich hatte, um materiell zu sein, so hätte ich ihn zumindest noch sehen müssen. Doch Nicholas war fort. Nicht langsam verblasst, wie er es für gewöhnlich tat, wenn der Tag anbrach, sondern urplötzlich verpufft.
»Nicholas?«, fragte ich in die Leere hinein.
Ich glaubte, ein Zischen zu hören, das wie »Verschwinde!« klang, doch es konnte ebenso gut der Luftzug gewesen sein, der durch den Türspalt hereinfuhr. Die Kälte, die selbst wenn ich ihn nicht sehen konnte, ein sicheres Zeichen für seine Anwesenheit war, war fort.
Die Schritte auf dem Kies verstummten, vor der Tür waren gedämpfte Stimmen zu vernehmen. Ich schob mich seitwärts in Richtung des Durchgangs, der zum Wohnzimmer und zur Küche führte.
»… schnell sein«, hörte ich die raue Stimme eines Mannes, als die Tür zur Seite geschoben wurde. »Wir holen, weshalb wir gekommen sind, und verschwinden wieder.«
Ich unterdrückte ein Stöhnen. Das konnte auch nur mir passieren, dass sich ein paar Einbrecher ausgerechnet das Haus aussuchten, in das ich unberechtigt eingedrungen war. Ganz sicher wären sie nicht begeistert, mich hier zu finden. Eine Verhaftung durch die Cops erschien mir harmlos im Vergleich dazu, was mich erwarten mochte, wenn ich dieser Horde Verbrecher in die Hände fiel.
»Mir gefällt das nicht.« Dieses Mal sprach eine Frau. »Sieh dir die Tür an! Hier stimmt was nicht!«
»Denkst du, es ist jemand im Haus?« Eine dritte dunklere Männerstimme.
Die Antwort darauf verstand ich nicht mehr. Ich hatte das Wohnzimmer erreicht. Glücklicherweise war die Tür nur angelehnt, sodass ich lautlos durch den Spalt schlüpfen konnte. Der Wunsch, die Tür hinter mir zu schließen, wurde lediglich von der Furcht übertroffen, dass mich ein Quietschen der Angeln verraten könnte. Obwohl ich mich mit der halb offenen Tür in meinem Rücken verwundbar fühlte, ließ ich sie, wie sie war. Da ich nicht wagte, meine Taschenlampe zu benutzen, tastete ich mich an der Couch und den antiken Tischchen entlang auf das Esszimmer zu. Über dem Kamin waren die Umrisse des großen Gemäldes auszumachen. Ich war erleichtert, dass mir die Dunkelheit den Anblick von Adrians Abbild ersparte.
Die Eindringlinge waren jetzt im Haus, ihre gedämpften Worte ein undeutliches Dröhnen in meinem Kopf. Ich konzentrierte mich darauf, versuchte herauszufinden, worüber sie sprachen, doch die Stimmen waren zu leise, als dass sie das Hämmern meines Herzschlags hätten übertönen können.
Dicke Teppiche dämpften meine Schritte, während ich mich langsam vorwärtsschob, darauf bedacht, nicht versehentlich gegen etwas zu stoßen und so die Aufmerksamkeit der Einbrecher auf mich zu lenken. Mit ein wenig Glück waren die drei bereits auf dem Weg nach oben, um die Schlafzimmer und das Arbeitszimmer nach Wertsachen zu durchsuchen. Bei meinem Glück in letzter Zeit war einer in der Eingangshalle geblieben, um Schmiere zu stehen. Zumindest befand ich mich im richtigen Teil des Hauses, sodass ich die Eingangshalle nicht noch einmal zu durchqueren brauchte – ich musste es nur bis in die Küche schaffen, dann konnte ich von dort durch die Hintertür verschwinden.
Jetzt nur keinen Fehler machen.
Obwohl ich am liebsten losgespurtet wäre, zwang ich mich, stehen zu bleiben und einmal tief durchzuatmen. Mein Herzschlag beruhigte sich ein wenig und auch das Blut rauschte nicht mehr ganz so laut in meinen Ohren, sodass ich die entstandene Stille nutzen und lauschen konnte.
Aus einiger Entfernung glaubte ich, ein Rumpeln zu hören, ich hätte jedoch nicht einmal für eine Million Dollar sagen können, ob es von oben, aus dem Keller oder von woher sonst kam. Zumindest hörte es sich an, als wären die Einbrecher weit genug fort, um mir nicht in die Quere zu kommen.
Wir holen, weshalb wir gekommen sind, und verschwinden wieder. Das klang nicht gerade so, als hätten sie sich dieses Haus zufällig ausgesucht. Einen Moment lang war ich versucht zurückzuschleichen, um herauszufinden, wonach die drei suchten. Die Angst, erwischt zu werden, hielt mich jedoch davon ab. Wer hätte gedacht, dass Angst einen nicht nur um Jahre altern lassen konnte, sondern auch positive Seiten hatte – zum Beispiel, jemanden davon abzuhalten, eine Dummheit zu begehen.
Ich kniff die Augen zusammen und suchte nach der Tür, die vom hinteren Teil des Wohnzimmers in die Küche führte. In Anbetracht all der Möbel, die ich auf dem Weg dorthin zu umrunden hatte, war die Gefahr groß, gegen etwas zu stoßen oder etwas umzuwerfen.
In der Eingangshalle knarrte eine Diele. Jemand rief etwas – die Stimme kam von oben, die darauf folgenden Schritte von unten. Sie hatten tatsächlich eine Wache unten zurückgelassen.
»Was?«, erklang es deutlich vom Fuß der Treppe.
»… Wohnzimmer«, kam die kaum verständliche Antwort von oben – die Frau. »Sieh nach … dort vielleicht … Tresor …«
Auch wenn ich nicht alles verstanden hatte, genügte mir das, was ich gehört hatte, um zu wissen, dass ich in der Klemme steckte. Jeden Moment würde einer der Kerle hier hereinkommen. Dafür, mich langsam und vorsichtig zwischen den Möbeln hindurchzutasten, blieb keine Zeit mehr.
Mein erster Gedanke war, dass ich ein Versteck brauchte. Allerdings wurde mir schnell klar, dass das nicht sonderlich hilfreich war angesichts der Tatsache, dass diese Leute vermutlich das ganze Haus auf den Kopf stellen würden.
Auf der Suche nach einem Ausweg ließ ich meinen Blick durch den Raum gleiten, bis er am Durchgang zum Esszimmer hängen blieb. Dort drin gab es ebenfalls eine Tür zur Küche und ich konnte mir den Spießrutenlauf zwischen den Wohnzimmermöbeln hindurch sparen!
Mit großen Schritten eilte ich an der Rückseite der Couch entlang. Ich passierte gerade den gemauerten Rundbogen, der ins Esszimmer führte, als hinter mir die Tür zum Wohnraum geöffnet wurde. Ich schlug einen Haken nach links, drückte mich neben dem Durchgang gegen die Mauer. Vorsichtig schob ich meinen Kopf an die Ecke heran und spähte ins Wohnzimmer. Auf der Schwelle zwischen Wohnzimmer und Eingangshalle ragte eine schattenhafte Gestalt auf, in der einen Hand eine Taschenlampe, in der anderen etwas, was im Gegenlicht verdächtig nach einer Pistole aussah.
Der Schein der Taschenlampe tastete sich an der Couch entlang auf den Durchgang zum Esszimmer zu. Ich zog den Kopf zurück und presste mich an die Wand. Das Licht bewegte sich, kam näher, begleitet von dumpfen Schritten.
Komm nicht hier rein!, flehte ich in Gedanken.
Vor dem Durchgang verstummten die Schritte. Der Lichtschein wurde schwächer.
»Hallo Adrian«, vernahm ich die dunkle Stimme von vorhin. »Wollen wir doch mal sehen, was für ein Geheimnis du verbirgst.«
Wieder Schritte.
Das Gemälde! Er war auf der Suche nach einem Safe und wo wäre so ein Ding besser versteckt als hinter einem Gemälde. Okay, es ging auch kaum offensichtlicher, trotzdem war ich heilfroh, als die Schritte sich wieder ein Stück entfernten, ehe sie erneut verstummten.
Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, ob es tatsächlich einen Safe hinter Adrians Abbild gab, und ich wollte definitiv nicht lange genug bleiben, um es herauszufinden. Meine Knie waren weich und mein Herzschlag verfiel erneut in ein heftiges Hämmern, als ich mich von der Wand löste und zwischen Esstisch und Anrichte hindurch auf die Schwingtür am anderen Ende des Raumes zuhielt.
Ich drückte einen der beiden Flügel auf und war erleichtert, von den Scharnieren nicht mehr als ein leises Klack zu hören. Rasch schlüpfte ich in die Küche und ließ die Tür hinter mir an ihren Platz zurückgleiten.
Aus dem Esszimmer war kein Laut zu hören.
Ich hielt auf die Hintertür zu. Fahles Mondlicht fiel durch die Verglasung und wies mir den Weg. Nur noch ein paar Schritte. Ich streckte die Hand nach dem Türknauf aus – und hielt inne.
Was, wenn ich beim Öffnen der Tür den Alarm auslöste? Nein! Die Alarmanlage war abgeschaltet – immerhin waren die Überwachungskameras tot und die Eingangstür aus den Angeln gerissen gewesen. Allerdings reichte mein technisches Wissen nicht aus, um hundertprozentig sagen zu können, ob es nicht verschiedene Alarmschleifen gab und ein Teil davon nicht doch scharf geschaltet war.
Da ich keinen Steuerungskasten für die Alarmanlage ausmachen konnte, blieb mir nichts anderes übrig, als es auf direktem Weg herauszufinden. Ich drehte den Türknauf, riss die Tür auf und stürzte ins Freie. Nicht der geringste Laut begleitete mich, als ich die wenigen Meter zu den ersten Baumreihen rannte und in die Schatten der Douglasien eintauchte. Wer auch immer das Haus von allen Spuren befreit hatte, hatte sich auch um den Alarm gekümmert.
2
Im Gegensatz zu ihren beiden Begleitern hasste Laura Martin es, in fremde Häuser einzudringen. Sie verabscheute das Gefühl der Latexhandschuhe auf ihrer Haut, die dafür sorgen sollten, dass sie keine Spuren hinterließ. Abgesehen davon fühlte sie sich schlecht dabei, in den Habseligkeiten eines Verstorbenen zu wühlen, in das Leben einzudringen, das er geführt hatte, und dabei Dinge ans Tageslicht zu bringen, die oft besser unentdeckt geblieben wären.
Sie wollte nicht erfahren, dass der Mann, den sie als erfolgreichen und knallharten Börsenmakler gekannt hatte, ein Bettnässer war, oder die nette Hausfrau und Mutter sich ein Zubrot mit Telefonsex verdiente. Das waren persönliche Dinge, die niemanden etwas angingen und von denen sich der Verstorbene sicher gewünscht hätte, das Wissen darum mit ins Grab nehmen zu können. Trotzdem war sie gezwungen, in die Privatsphäre dieser Menschen einzudringen.
Sie gab sich alle Mühe, die Würde der Verstorbenen zu wahren, was alles andere als einfach war, denn ihre Begleiter verhielten sich weit weniger respektvoll. Manchmal schien es ihr, als würden die beiden Männer es geradezu darauf anlegen, die kleinen und großen Geheimnisse der Menschen aufzudecken, in deren Häuser sie eindrangen. Nicht selten machten sie sich noch Wochen später darüber lustig. Ganz zu schweigen davon, dass sie es sich nicht nehmen ließen, überall herumzuerzählen, was sie gefunden hatten.
Sie hatte versucht, die beiden davon abzuhalten – mit mäßigem Erfolg. Der einzige Unterschied war, dass sie seitdem warteten, bis Laura den Raum verließ, ehe sie ihr Wissen wie billigen Klatsch weitertrugen.
Scheinheilige Heuchler!
Immerhin hatte sie beim Durchsehen von Adrian Crowleys Sachen bisher keine unangenehmen Überraschungen erlebt. Abgesehen von einer Vorliebe für Antiquitäten und alte Bücher schien der Mann keine Schwächen gehabt zu haben. Nichts, worüber sich ihre Begleiter lustig machen konnten. Dabei hätte sie gerade bei ihm schwören können, dass er etwas zu verbergen hatte. Andererseits war sie sich im Gegensatz zu Connor, dem Anführer ihrer Gemeinschaft, nicht einmal sicher, ob der Adrian, nach dessen Habseligkeiten sie suchten, tatsächlich tot war. Sie hatte jedoch im Laufe der Jahre gelernt, ihm zu vertrauen. Connor irrte sich nie. Nicht lange, nachdem er den Artikel über den Tod des greisen Unternehmers entdeckt hatte, hatte er Laura und ihren Begleitern aufgetragen, sich nach Cedars Creek aufzumachen.
»Dieser Mann war jenseits der siebzig«, hatte Laura eingewandt. Jener Adrian Crowley, der dem Zirkel des Blauen Mondes angehörte, war gerade einmal Anfang zwanzig gewesen.
»Das stimmt«, hatte Connor ihr recht gegeben. »Doch laut dem Zeitungsbericht ist der gleichnamige Neffe des Unternehmers seither spurlos verschwunden. Er lebt nicht mehr.«
Laura zweifelte nicht an seinen Worten. Connor war durch sein Blut mit den Mitgliedern des Zirkels verbunden. Es bedurfte lediglich eines simplen Rituals, um ihn spüren zu lassen, ob die Blutsverbindung noch existierte. Wenn sie erlosch, war derjenige, nach dem er suchte, nicht länger am Leben.
Laura hatte Adrian kaum gekannt. Er war nur unregelmäßig zu den Versammlungen erschienen und im letzten Jahr hatte er sich gar nicht mehr sehen lassen. Doch selbst bei den wenigen Begegnungen hatte ihn stets eine Aura von Wissen und Macht umgeben, wie Laura sie nur selten erlebt hatte.
Wann immer ein Mitglied vom Zirkel des Blauen Mondes starb, hoffte sie, Connor möge jemand anderen losschicken. Eine Hoffnung, die oft genug enttäuscht wurde, wenn erneut ihr Name fiel. Dieses Mal hatte sie sich allerdings freiwillig gemeldet. Sie wusste, dass Adrian Crowley ein Geheimnis hütete – etwas, was nichts mit körperlichen Unzulänglichkeiten oder geheimen Vorlieben zu tun hatte –, und zum ersten Mal wollte sie tatsächlich wissen, was es war.
»Hast du etwas gefunden?«
George war so unvermittelt hinter ihr im Türrahmen aufgetaucht, dass sie zusammenzuckte. »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du dich nicht so an mich heranschleichen sollst! Willst du, dass mir das Herz stehen bleibt?«
Von ihren Worten unbeeindruckt, richtete er den Strahl seiner Taschenlampe von unten auf sein Gesicht, sodass es in einen geisterhaft blauen Schein getaucht war. »Die Dämonen werden dich holen, Laura Martin.« Seine Stimme hallte auf eine Weise, bei der Laura nicht zu sagen vermochte, ob es an der Größe des Arbeitszimmers und den nahezu kahlen Wänden lag oder ob er tatsächlich ein talentierter Stimmenimitator war.
»Lass den Quatsch!« Sie drückte seinen Arm nach unten, bis der Lichtschein wieder auf den Raum gerichtet war. »Hast du was gefunden?«
»Keine Dämonen anwesend.«
»George!« Es war ihr ein Rätsel, wie sich ihr Bruder mit seinen beinahe dreißig Jahren noch immer wie ein Kindskopf im Ferienlager aufführen konnte. Dabei wirkte er mit seiner muskulösen Statur, dem raspelkurzen braunen Haar und den durchdringenden grünen Augen ganz und gar nicht wie ein Teenager. Schon eher wie ein Soldat im Kampfeinsatz. Ein Eindruck, der durch die komplett schwarze Kleidung noch verstärkt wurde. Laura war ganz ähnlich angezogen – Jeans, Rollkragenpullover und Sneakers, alles in Schwarz. Es war ein Wunder, dass Scott, der dritte im Bunde, nicht auch noch darauf bestanden hatte, dass sie sich die Gesichter mit Tarnfarbe beschmierten. »Wir sind nicht zum Spaß hier.«
»Zumindest nicht, wenn es nach Connor geht. Was mich zu meiner Frage zurückbringt: Bist du fündig geworden?«
Laura schüttelte den Kopf. »Alles hier ist so sauber.«
»Das kommt dir doch entgegen, du hasst es doch, im Dreck zu wühlen.«
»Schon, aber wenn du mich fragst, ist es zu ordentlich. Wenn jemand plötzlich stirbt, sollte dann nicht irgendwelches Zeug herumliegen? Klamotten, das Fernsehprogramm von vor drei Wochen, Essensreste oder wenigstens schmutziges Geschirr?« Doch von einer dünnen Staubschicht einmal abgesehen, die sich auf Böden und Möbeln abgesetzt hatte, war alles sauber und aufgeräumt.
»Vielleicht hatte er eine Haushaltshilfe, die nach seinem Tod aufgeräumt hat.«
Womöglich hatte George recht, in einem Haus wie diesem war eine Haushälterin nicht unüblich. Trotzdem fiel es ihr schwer, zu glauben, dass jemand nach dem Tod seines Arbeitgebers noch für derart gründliche Ordnung sorgen würde. Nicht ohne Bezahlung. »Wie viele Zimmer haben wir noch?«
»Höchstens ein paar Hundert.« Als er ihren strafenden Blick bemerkte, zuckte er die Schultern. »Zwei weitere Schlafzimmer und zwei Bäder, außerdem das Obergeschoss und den Dachboden. Bei unserem Glück gibt es auch noch einen Keller.«
Sie konnte nur hoffen, dass Scott in der Zwischenzeit nicht Däumchen drehte, sondern sich im Erdgeschoss umsah, andernfalls würden sie ewig brauchen. Wann immer sie mit Scott Thomas unterwegs waren, sah er sich als Anführer der kleinen Gruppe – unglücklicherweise schien er der Meinung zu sein, demzufolge bestünde seine Aufgabe in erster Linie darin, Laura und George herumzukommandieren.
Höchste Zeit, den Spieß einmal umzudrehen.
Laura schob sich an ihrem Bruder vorbei auf den Flur hinaus und ging zur Treppe. »Scott!«, rief sie nach unten.
»Was?«
Wie sie vermutet hatte, stand er am Fuß der Treppe, anstatt sich das Untergeschoss vorzunehmen. »Geh ins Wohnzimmer. Sieh nach, ob es dort vielleicht einen Tresor gibt.«
Das Knarren der Holzdielen sagte ihr, dass er sich tatsächlich in Bewegung setzte.
»Wenn du schon dabei bist«, fügte sie hinzu, »nimm dir den Rest des unteren Stockwerks gleich mit vor, wir werden hier oben noch eine Weile beschäftigt sein!«
Seine Antwort bestand aus einem unwirschen Brummen – er hatte es noch nie leiden können, wenn ihm jemand sagte, was er tun sollte – und Schritten, die sich entfernten.
Immerhin hatte er keine Diskussion angefangen.
Ein Blick von ihr genügte und George machte kehrt, um seine Suche in einem der anderen Zimmer fortzusetzen. Laura trat in den Raum zurück, schob das weiße Tuch zur Seite, das einen der großen Schränke abdeckte, und öffnete die Türen. Der Schrank war voll mit sorgfältig zusammengelegten Stapeln von Handtüchern und Bettwäsche. Sie ließ sich von der Ordnung nicht täuschen und begann, einzelne Haufen herauszunehmen, um dahinterzusehen und bis in die hintersten Ecken zu tasten. Sogar die Wände klopfte sie ab, auf der Suche nach einem doppelten Boden.
Adrian Crowley musste im Besitz von Büchern gewesen sein, deren Inhalt weit über das gewöhnliche Wissen über Kräuter und Rituale hinausging. Diese magischen Kostbarkeiten würden sie nicht im Bücherregal finden, sondern an einem sicheren Ort. Fragte sich nur, welchen Ort Adrian für sicher befunden hatte. In seinem Arbeitszimmer war Laura nicht fündig geworden. Weder in den Schüben und Schränken noch bei der Suche nach Geheimfächern oder einem Safe.
Sie konnte nur hoffen, dass sie bald etwas entdeckten, denn dieses Haus war ihr unheimlich. Ihr Bruder konnte über Dämonen witzeln, soviel er wollte – hier stimmte etwas nicht. Beim Betreten des Hauses hatte sie die Kälte gespürt, die wie ein Echo in der Luft hing. Ein Geist war hier gewesen und es war einzig und allein ihrem Schutzamulett zu verdanken, dass er sie nicht behelligte. Scott und George mochten über ihre Sicherheitsvorkehrungen lachen. Die beiden hatten es noch nie gespürt, wenn sich andere Wesen in ihrer Nähe aufhielten. Laura jedoch wusste, wie wirksam ihre Geisterabwehr war.
Natürlich bestand die Möglichkeit, dass es sich um Adrians Geist handelte. Sie hätte versuchen können, mit ihm zu sprechen und ihn nach dem Verbleib seiner Bücher zu fragen. Allerdings bezweifelte sie, dass er bereitwillig Auskunft gegeben hätte. Jemand, der zu Lebzeiten über derartige Macht verfügt hatte, würde alles tun, um sich diese auch über den Tod hinaus zu erhalten.
Für gewöhnlich brachten sie die Bücher und Kultgegenstände verstorbener Mitglieder an sich, um deren Wissen dem Zirkel zu erhalten. Dieses Mal jedoch ging es auch darum, zu verhindern, dass dieses Wissen jemandem in die Hände fiel, der nicht damit umzugehen verstand.
»Adrian zog seine Macht nicht aus sich selbst«, hatte Connor gesagt, »sondern aus Quellen, die im günstigsten Fall als finster bezeichnet werden können.«
Laura wusste nicht, ob er damit sagen wollte, dass die Bücher Adrians Quelle waren, oder ob er der Ansicht war, Adrian hätte einen Pakt mit finsteren Mächten geschlossen. Um ehrlich zu sein, wollte sie das auch gar nicht so genau wissen.
Sie schob gerade einen Stapel Handtücher in den Schrank zurück, da drangen von unten laute Rufe an ihr Ohr. Es war Scott, doch er war zu weit weg, als dass sie die Worte hätte verstehen können. Sie ließ die Handtücher fallen, riss ihre Taschenlampe von dem Regal, auf dem sie sie abgelegt hatte, und lief auf den Gang hinaus. Auch George hatte Scott gehört. Er war bereits an der Treppe angekommen.
»Was ist passiert?«, rief Laura ihm zu.
»Ich glaube, jemand ist im Haus!« Ohne sich nach ihr umzudrehen, lief er nach unten, immer zwei Stufen auf einmal nehmend.
Auf halbem Weg zum Wohnzimmer holte Laura ihn ein. »Sei vorsichtig!«
»Leuchte du mir den Weg.«
Sobald sie ihre Taschenlampe nach vorn gerichtet hatte, nahm er seine wie einen Knüppel in die Hand und betrat das Wohnzimmer. »Scott?«
Keine Antwort.
Laura folgte ihrem Bruder am Ledersofa vorbei durch den Raum, immer darauf bedacht, so viel wie möglich auszuleuchten. Ein Gemälde über dem Kamin hing schief, ansonsten deutete nichts darauf hin, dass hier ein Kampf stattgefunden hätte.
Vor ihnen knallte eine Tür.
Laura zuckte zusammen und hätte um ein Haar die Taschenlampe fallen lassen. Sie bekam sie gerade rechtzeitig wieder zu fassen, um zu sehen, wie die Schwingtür im Esszimmer aufgestoßen wurde und Scott hindurchschoss. Sein blondes Haar war zerzaust, als sei er in einen Sturm geraten, und der dunkle Schimmer in seinen blauen Augen verhieß nichts Gutes. Das Beunruhigendste war jedoch der Anblick der Pistole in seiner Hand.
»Die Polizei?«, wollte George sofort wissen.
Scott schüttelte den Kopf. Er sicherte die Waffe und steckte sie zurück in den Bund seiner Jeans. »Eine Frau. Sie muss die ganze Zeit im Haus gewesen sein. Vermutlich hat sie nur auf eine Gelegenheit gewartet, um abzuhauen. – Hör auf, mich zu blenden!« Vor Laura blieb er stehen und drückte ihren Arm mit der Taschenlampe nach unten. Schon wenn er gut gelaunt war, wirkte Scott nicht sonderlich freundlich. Schuld daran waren seine scharfen Gesichtszüge und die Hakennase, die seinem Gesicht etwas Raubvogelhaftes verliehen. Jetzt jedoch wirkte er wie ein tollwütiger Racheengel. »Warum haben wir sie nicht bemerkt!« Es war keine Frage, sondern ein offener Vorwurf in Richtung seiner Begleiter. Wir bedeutete in diesem Falle ihr.
Laura verkniff sich die Bemerkung, dass sie oben beschäftigt gewesen waren und er vermutlich die meiste Zeit auf der Treppe herumgesessen hatte, ehe sie ihn aufgefordert hatte, sich unten an die Arbeit zu machen.
Georges Blick wanderte immer wieder zur Eingangshalle, als erwarte er, dort würde jeden Moment ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando hereinstürmen. »Denkst du, sie wird die Cops rufen?«
»So, wie die gerannt ist? Eher unwahrscheinlich. Abgesehen davon«, fügte Scott hinzu, »müsste sie dann zugeben, dass sie selbst im Haus gewesen ist.«
»Sie könnte behaupten, uns von draußen gesehen zu haben«, gab Laura zu bedenken.
Scott dachte einen Moment darüber nach, schließlich schüttelte er den Kopf. »Da müsste sie immer noch erklären, was sie nach Einbruch der Dunkelheit so nahe an diesem einsam gelegenen Haus zu suchen hatte.«
Laura fragte sich, was die Frau hier wollte, doch ehe sie ihren Gedanken aussprechen konnte, kam George ihr zuvor.
»Hatte sie etwas bei sich, als sie davongelaufen ist?«
»Du meinst, die Bücher? Nein. Ich habe nichts gesehen. Ihre Hände waren leer.«
»Tasche oder Rucksack?«, hakte George nach.
»Nichts dergleichen.« Scott verlor langsam die Geduld. »Lasst uns weitermachen, bevor die Nächsten hier auftauchen.«
Die Nächsten konnten gut und gern die Cops sein. Trotzdem sagte Laura nichts dazu. Scott würde sich ohnehin nicht davon überzeugen lassen, das Unternehmen abzubrechen. Für ihn war ein Auftrag ein Auftrag und er würde den Teufel tun und Connor enttäuschen oder an dem Image des Zuverlässigen kratzen, das er in den Augen des Zirkels trug. Nach Connor war Scott die Nummer zwei, doch Laura wusste, dass ihm das schon lange nicht mehr genügte. Um Connor an der Spitze abzulösen, benötigte er allerdings die Unterstützung der anderen Mitglieder. Und die würde er nur durch zuverlässig erfüllte Aufgaben bekommen. Man konnte Scott Thomas einiges vorwerfen – mangelnder Ehrgeiz gehörte nicht dazu. Falls wirklich jemand kam, konnte sie nur hoffen, dass sie ebenso schnell verschwinden konnten wie diese Frau.
Auf dem Weg zurück zur Treppe streifte der Lichtschein ihrer Taschenlampe die Haustür. Einen Herzschlag lang dachte sie, dort stünde jemand, dann jedoch bemerkte sie die leeren Augen und die weiße Bemalung. Sie hielt die Lampe darauf. »Seht euch das an!«
»Eine Cúlen-Maske.« George stieß einen leisen Pfiff aus. »Leuchte mal auf den Boden«, wies er Laura auf dem Weg zur Tür an. »Ha! Und hier ist das Pulver!« Sein Blick folgte einer feinen grauen Pulverspur, die sich an der Wand entlangzog. »Ich wette, das geht ums ganze Haus.«
Geisterabwehr. Die Linie war durchbrochen, der Bann nicht mehr brauchbar. Sie hatte sich vorhin also nicht getäuscht – in diesem Haus war ein Geist gewesen. Ob es Adrians Geist oder der eines anderen war, vermochte sie nicht zu sagen. Sie vermutete jedoch, dass Adrian das Haus zu seinen Lebzeiten mit dieser Abwehr geisterfrei gehalten hatte und sie erst nach seinem Tod außer Kraft gesetzt worden war. Vermutlich hatte jemand aus Versehen die Linien verwischt, ohne überhaupt zu wissen, womit er es zu tun hatte.
»Lasst uns weitermachen!« George schob seine Schwester auf die Treppe zu und kurz darauf waren alle drei wieder damit beschäftigt, den Rest des Hauses zu durchsuchen. Vom Dachboden bis zum Keller stellten sie alles auf den Kopf, doch nirgendwo gab es auch nur den geringsten Anhaltspunkt, wo sich die Bücher befanden. Sie hatten nicht einmal ein Anzeichen dafür gefunden, dass Adrian überhaupt ihrem Zirkel angehört hatte. Kein Zeremoniengewand, kein Amulett mit dem Zeichen des Blauen Mondes. Nichts. Als sie sich kurz vor Tagesanbruch in der Eingangshalle trafen, waren sie ihrem Ziel keinen Schritt näher als zu Beginn des Abends.
»Es hat keinen Sinn, weiterzumachen.« Scott war die Frustration anzusehen. Es war das erste Mal, dass sie im Haus eines verstorbenen Mitgliedes keine Bücher und Kultgegenstände fanden. Es war auch das erste Mal, dass jemand anderes im Haus gewesen war. Von dem Geist ganz zu schweigen. »Vermutlich könnten wir hier alles bis auf die Grundmauern niederreißen und würden immer noch nichts finden. Crowleys Bücher sind nicht hier.«
George nickte. »Wir können unmöglich ohne sie nach Seattle zurückfahren. Connor wäre nicht begeistert.«
»Nicht begeistert?«, schnaubte Scott. »Er würde uns den Arsch aufreißen!«
»Was schlägst du vor?« Auch wenn Connor ihnen nicht den Arsch aufreißen würde, wie Scott behauptete, so wäre das Oberhaupt des Zirkels doch alles andere als glücklich. Adrian Crowleys Wissen war zu kostbar und vermutlich auch zu gefährlich, um es nicht dem Schutz des Zirkels zu unterstellen.
»Sieht so aus, als würden wir noch eine Weile in diesem Kaff bleiben müssen.« Scott rieb sich nachdenklich das Kinn, dann richtete er seinen Blick auf Laura. »Du kümmerst dich um den Sheriff. Finde heraus, wer nach Adrians Tod Zutritt zu seinem Haus hatte. George und ich hören uns in der Stadt um.«
3
Am nächsten Morgen hatte ich mich selbst nach der dritten Tasse Kaffee immer noch nicht vollends von dem Schrecken erholt. Allerdings war ich mir nicht sicher, was mich mehr schockierte: Die Tatsache, dass das Haus so sauber war wie ein desinfiziertes OP-Besteck, oder der Umstand, dass wir gestern dort oben nicht allein gewesen waren.
Selbst als ich längst im Schutz der Bäume untergetaucht war, hatte ich noch immer Angst gehabt, der Kerl würde mir folgen und jeden Moment hinter mir zwischen den Bäumen auftauchen, seine Pistole auf mich gerichtet.
Der Einzige, der aufgetaucht war, war Nicholas gewesen. Kurz hinter dem Waldrand war er plötzlich zwischen den Bäumen hervorgetreten und hatte mein Herz damit beinahe zum Stillstand gebracht. Er wollte, dass ich mich ausruhte, die Erwähnung meines Verfolgers überzeugte ihn jedoch davon, dass dies womöglich nicht der geeignete Zeitpunkt für eine Pause war. Seite an Seite liefen wir weiter. Während ich alle Mühe hatte, einen Fuß vor den anderen zu setzen und dabei noch zu atmen, strengte ihn unsere Flucht nicht einmal an. Es hatte durchaus seine Vorteile, ein Geist zu sein. Immer wieder hatte er sich ein Stück zurückfallen lassen, um sicherzugehen, dass wir nicht verfolgt wurden. Wer auch immer im Haus gewesen war, war auch nach meiner Flucht dort geblieben. Zumindest konnte Nicholas im Wald niemanden entdecken. Wir schafften es unbehelligt den Hügel hinunter zu meinem Haus.
»Warum bist du so plötzlich verschwunden?«, platzte ich heraus, kaum dass die Tür hinter mir ins Schloss gefallen war.
»Da war etwas«, erklärte er. »Erst fühlte es sich an wie ein Kribbeln – das seltsame Gefühl, das man manchmal hat, wenn man weiß, dass etwas nicht stimmt. Doch es wurde stärker. Schmerzhaft. Als würde jemand an mir zerren … Meine Substanz war diesem geradezu gewaltsamen Angriff nicht länger gewachsen.«
»Es hat dich aus dem Haus gezwungen?«
Er nickte.
»Adrians Geisterbann?«, fragte ich, obwohl mir klar war, dass das unmöglich sein konnte. Die Geisterabwehr war längst außer Kraft gesetzt, ich selbst hatte die Linie verwischt und die Maske heruntergerissen. Abgesehen davon hatte Nicholas sich davor längere Zeit im Haus aufgehalten, ohne dass etwas passiert war.
»Es hat sich anders angefühlt als Adrians Bann, aber die Wirkung war dieselbe.«
Wir waren uns darüber einig, dass es etwas mit der Ankunft dieser Leute zu tun haben musste. Nicholas vermutete, dass einer von ihnen einen Geisterbann bei sich getragen hatte.
Seufzend stand ich auf, spülte meine Kaffeetasse aus und ging nach oben ins Schlafzimmer. Ich schnappte mir einen Spachtel und machte mich über die letzten Tapetenreste her, die noch an den Wänden klebten.
Vergangene Nacht hatte ich nicht daran gedacht, Nicholas danach zu fragen, welche Formen so ein Geisterbann haben konnte. Womöglich wusste er darauf ebenso wenig eine Antwort wie ich, es wurmte mich jedoch, damit eine weitere offene Frage auf meiner Liste zu haben. Bevor ich es wieder vergessen konnte, stellte ich ihm die Frage jetzt. Ich wusste, dass er bei mir war, spürte den kühlen Hauch, der seine Anwesenheit begleitete, so deutlich, wie ich den herannahenden Winter spürte.
»Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas wie einen tragbaren Bann gibt«, schob ich meiner Frage hinterher. Für mich war klar gewesen, dass man sein Haus schützen konnte, vielleicht auch einen einzelnen Raum. Aber welcher normale Mensch hatte einen Geisterbann im Socken? Oder wo auch immer derjenige ihn getragen haben mochte.
Gleich nach unserer Rückkehr hatte ich Nicholas erzählt, was ich im Haus gehört und gesehen hatte, doch keiner von uns konnte sich einen Reim darauf machen, wer diese Leute waren oder was sie im Crowley-Anwesen gesucht hatten. Unglücklicherweise war Nicholas nicht in der Lage gewesen, sie auszuspionieren, da ihm der Bann nicht gestattete, nahe genug an sie heranzukommen.
Ich hätte mir gern eingeredet, dass es normale Diebe waren, aber wem wollte ich etwas vormachen? Es mochte Diebe geben, die ein Stück Fleisch für einen Wachhund oder ein Betäubungsmittel für eine menschliche Wache dabeihatten – aber einen Geisterbann?
Wonach hatten sie gesucht?