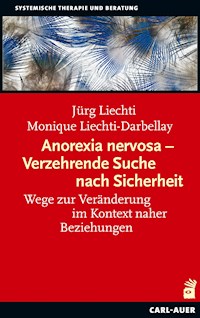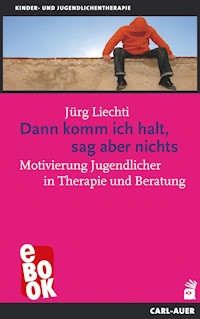
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kinder- und Jugendlichentherapie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Steigende Anforderungen in Schule und Alltag überfordern Kinder und Jugendliche immer mehr. Die Zahl der psychischen Störungen unter Heranwachsenden wächst im gleichen Tempo wie das Angebot an Therapien für diese Altersgruppe. Was den meisten Konzepten jedoch fehlt, ist der Blick für die Motivation der Jugendlichen, aktiv an der Beratung teilzunehmen. Wie es gelingt, die Therapiemotivation zu fördern, ist die zentrale Fragestellung dieses Buches. Der Schweizer Psychiater und Psychotherapeut Jürg Liechti verknüpft hier verschiedene theoretische Konzepte zur Therapiemotivation mit Methoden der systemischen Therapie zu einer systemischen Motivierungspraxis. Sie zielt unter anderem darauf ab, durch das Einbinden von Bezugspersonen aus dem Familienkreis die Bereitschaft der Jugendlichen zur Therapie zu stärken. Der Beratende selbst lernt seinen Anteil am Motivationsprozess kennen und die Signale der Jugendlichen zu empfangen und zu entschlüsseln. Zahlreiche Sitzungsprotokolle und Fallgeschichten erleichtern die Lektüre und geben Anregungen für die ambulante psychiatrische und psychotherapeutische Praxis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Julia, Rémy und Margot,die den Dreh raus haben, mich zu motivieren.
Jürg Liechti
Dann komm ich halt,sag aber nichts
Motivierung Jugendlicherin Therapie und Beratung
Vierte Auflage, 2022
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel
Umschlagfoto: © photocase, french_03, 2008
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Vierte Auflage, 2022
ISBN 978-3-89670-674-4 (Printversion)
ISBN 978-3-8497-8412-6 (ePub)
© 2009, 2022 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorwort des Autors
1.Einleitung
Weil ich keine Hilfe brauche
Eva S. – ein Hilferuf
Die Pubertät ist nicht an allem schuld
Wozu dient dieses Buch?
Drei klinische Einstiegskonstellationen
2.Ein stilles Leiden
Extreme verbinden – Der Ersttermin
Kooperation im therapeutischen Arbeitskontext
Eine empirische Abfolge von Phasen
Das Problemsystem
Zur Diagnostik
Probleme entwickeln sich
Der Ablösungskonflikt
Systemische Gesichtspunkte
3.Ein heikles Thema
Therapiemotivation im Jugendalter – ein heikles Thema
Psychologische Reaktanz
Idealszenario und Wirklichkeit
Hilflosigkeit fordert heraus
Beispiel 1: Javier A.
Kontext, Kontext, Kontext
Optionen erweitern
Relativität der Perspektiven
Beispiel 2: Fatlinda Z.
Variante 1:
Variante 2:
Motivation ist mehr als die halbe Miete
4.Jugendliche und Eltern
Wenn die Eltern schwierig werden
Jugendliche sind »etwas anders«
Von Pickeln und Timing
Familie als »therapeutische Einrichtung«
Was macht Familie aus?
5.Der systemische Therapieprozess und der konsultative Einbezug Jugendlicher
Therapiemotivation – Entwicklung im Kontext
Elterliche Hilflosigkeit
Konsultativer Einbezug Jugendlicher
1. Schritt: Die Klage (Perspektive) der Eltern akzeptieren
Beispiel 3: Leonardo U.
2. Schritt: Neurahmung der elterlichen Perspektive
Beispiel 4: Yannik V. – »Gemeinsam im Boot der Ratlosigkeit«
3. Schritt: Die Klage (Perspektive) des Jugendlichen akzeptieren
4. Schritt: Neurahmung der jugendlichen Perspektive
5. Schritt: Klärungsprozesse in Gang setzen
6. Schritt: Autonomieprozesse begleiten
Beispiel 5: Alex D. – Beispiel für einen »Ausstoßungsmodus« der erschwerten Ablösung
6.Aspekte der Therapiemotivation
Therapiemotivation: Die »pièce de résistance«
Leidensdruck und »ideales Selbst«
Wahre Familiendiagnostiker
Beispiel 6: Elisabeth B. – Störung des Sozialverhaltens
Lobbying für das erfahrene Leid
Menschen sind immer motiviert
Motivation hat zwei Seiten
Personelle Faktoren
Beispiel 7: Andrin B.
Beispiel 8: Priska T.
Beziehungskontextuelle Faktoren
Determinanten der Therapiemotivation
Beispiel 9: Leander F.
Bekannte Konzepte der Veränderungsmotivation
Motivationale Gesprächsführung
Motivation und Selbstmanagement
Motivation und kognitive Vorbereitung
Motivierende Gesprächsführung
Motivation und Selbstbestimmung
7.Hilfebeziehung und therapeutisches Handwerk
Mobilisierung von Selbstheilungssystemen
Systemisches Modell
Therapeutische Haltungen
Die allparteiliche Haltung
Die neutrale Haltung
Die Therapiebeziehung steht im Zentrum
Vier Helfermodelle
Das moralische Modell
Das Aufklärungsmodell
Das medizinische (Defekt-)Modell
Das kompensatorische Modell
Systemkompetenz
Systemische Problembeschreibungen
Strukturelle Äquivalenz
Beispiel 10: »Den Karren aus dem Dreck ziehen«
Signifikanz
Beispiel 11: Johann V.
Vernetztheit
Beispiel 12: Maja M. und »das alte Haus von Rocky Docky«
Patientin als Expertin
Positive Erfahrung
Attributionsgewohnheiten
Beispiel 13: Saskia P.
Mehrung von Optionen
Praktische Lösungen
Sieben Fragetypen
Ordealtechnik
Beispiel 14: Vera U.
Ritualisiertes Klagen
Anmeldung eines elterlichen Notstandes
Beispiel 15: Roland B.
8.Phasensensitive Modelle
Stufen der Veränderung
Beispiel 16: Janos R.
Stadium 1 – Fehlendes Problembewusstsein (»precontemplation«)
Stadium 2 – Nachdenklichkeit (»contemplation«)
Stadium 3 – Entscheidung/Vorbereitung (»preparation«)
Stadium 4 – Handeln (»action«)
Stadium 5 – Aufrechterhalten (»maintenance«)
Stadium 6 – Abschließen (»termination«)
Besucher, Klagende, Kunden
Besucher: Bereitschaft, in eine Sitzung zu kommen
Klagende: Die Bereitschaft, ein Problem zu beklagen
Kunde: Die Bereitschaft, ein Problem zu lösen
9.Zwei Beispiele für den Einstieg
Eine beunruhigende Zunahme
Erkenntnisrahmen
Systemischer Ansatz erster Ordnung
Beispiel 17: Pia C.
Systemischer Ansatz zweiter Ordnung
Fall 1: Ein Hilferuf aus dem Äther – Zu viel des Guten
Den Dialog in Gang halten
Öffnendes Fragen
Fall 2: Siehst du, Vater hasst mich! – Patchworkfamilie
Ein Anruf der Mutter
Eine integrale Sicht
Grund der Zuweisung
Anamnese und diagnostische Einschätzung
Exploration des Problemsystems
Aus dem Erstinterview
Risiken der Patchwork- oder Stieffamilie
Dreiecksprozesse
Dyadisch, triadisch
»Spill-over«-Effekte (Überschwappen)
Elterliche Allianz im Patchwork
Systemische Beziehungsgestaltung – Der Umgang mit Felix
10.Krisenintervention aus systemischer Sicht
Einbeziehung des Umfelds auch in der Krise
Was ist eine Krise?
Ein Notruf
Krisenintervention – eine systemische Perspektive
Einen weiterführenden Kontext herstellen
Abschätzen der Suizidalität
Aspekte einer Krisenbegleitung
Ein abschließendes Wort
Literatur
Über den Autor
Vorwort
Wer sind die jungen, in ihrem Leben emotional eingeschränkten Menschen, die durch therapeutische Hilfe nur gewinnen können, die sie aber nicht annehmen können und sich mit starken Gefühlen dagegen wehren? Und was können Therapeuten und Therapeutinnen tun, denen das eigentlich sonnenklar ist und die über eine Fülle professioneller Mittel verfügen, um diesen intensiven Widerstand gegen Hilfsangebote zu überwinden? Das ist, wie Jürg Liechti sagt, in der Tat ein »heikles Thema«. Dahinter steht bei allen davon Betroffenen nahezu immer ein stilles Leiden. Die Unfähigkeit wahrzunehmen, dass Hilfe gebraucht wird, die Unfähigkeit, Hilfe anzunehmen, weil das als Eingeständnis eigener Schwäche unerträglich ist, kennzeichnet vor allem Menschen, die sich von allem, was sie psychisch verunsichert, gefühllos distanzieren. Solange sie den Mangel an und das ungestillte Bedürfnis nach psychischer Sicherheit dadurch emotional im Schach halten, ist eine solche Reaktion kaum zu durchbrechen.
Jugendliche, die ihren Eltern das Leben schwer machen, haben – aus ihrer Sicht – schwierige Eltern. Denn, wie John Bowlby, dem wir die Bindungstheorie verdanken, festgestellt hat: »Menschen jeden Alters sind am glücklichsten und nutzen ihre Begabungen auf die vorteilhafteste Weise, wenn sie die Gewissheit haben, dass mindestens eine Person hinter ihnen steht, die ihr Vertrauen besitzt und ihnen zur Hilfe kommt, falls sich Schwierigkeiten ergeben« (Bowlby 1973, S. 359). Dies ersehnen sich Kinder von ihren Eltern, selbst wenn sie selbst schon erwachsen sind und eigene Kinder haben. Die Aufgabe von Eltern zeigt sich vor allem darin, wie sie ihre Rolle als schützend, stärker und weiser vorleben, mit dem Kind verhandeln, Kompromisse schließen und ihnen ein Vorbild sind entsprechend ihrem Alter, seinen Bedürfnissen und seinen notwendigen Erfahrungen. Deshalb sind Eltern für viele Jahre so gut wie unersetzlich.
Traumatische Verletzungen durch die Eltern selbst, wie etwa elterlicher Streit, der ungelöst bleibt, Gewalt, alkohol- und drogenbedingte Exzesse, aber auch durch lebensbedrohliche Situationen, Unfälle usw., ziehen oft intensivere Belastungssymptome als eigene Traumata bei den Kindern nach sich. Jürg Liechti weiß um die Reaktanz, die intensiven Gegenreaktionen Jugendlicher, deren Eltern Forderungen stellen, ohne ihnen selbst eine sichere Basis beim Erkunden der Welt zu bieten, und die auch kein sicherer Hafen sind zur Entspannung nach Konflikten, die dabei immer entstehen. Mit sicheren und starken Eltern können sich Jugendliche während und nach der Pubertät konstruktiv, lernend, abwägend, vergleichend und deshalb gewinnbringend auseinandersetzen. Mit unsicheren und schwachen Eltern dagegen gelingt das nicht, »denn die (psychologische) Funktion ihrer ›Störung‹ besteht gerade darin, dies zu vermeiden« (S. 104). Dabei geht es nicht in erster Linie um nachprüfbare Wahrheit, sondern um die Klarheit, mit der die Eltern – und ihre Sicht der Dinge – von den betroffenen Jugendlichen wahrgenommen werden. Jürg Liechti nennt dies eine »Neurahmung« der jugendlichen Perspektive; es ist, im Sinne von John Bowlby, ein Setzen neuer Arbeitsmodelle von sich und anderen an die Stelle alter und untauglicher.
Die Haltung »Dann komm ich halt, sag aber nichts« ist dafür nicht besonders ermutigend. Wie sollten, ohne Gespräch, neue Rahmen entstehen? Das tragende Grundmotiv ist das Interesse an starken, weil in ihren Beziehungen zum jugendlichen Kind sicheren Eltern. Daran lässt die Fülle an bindungstheoretisch inspirierten Forschungsergebnissen keinen Zweifel. In den praktischen therapeutischen Konzepten und Interventionen, die sich in jedem Fall, den Jürg Liechti vorstellt, als nützlich, aufschlussreich und spannend erweisen, ist dies der Schlüssel. Er öffnet langsam und vorsichtig die verschüttete Bereitschaft zur sprachlichen Klärung der lähmenden Hilflosigkeit gegenüber emotionalen Konflikten. Widerspenstige Jugendliche mit tief empfundener, aber vehement abgewehrter Anteilnahme an der Last, die ihre Eltern zu tragen haben, wurden so zur Mitarbeit gewonnen und als zukünftige Mitgestalter ihres familiären Schicksals gestärkt.
Für Eltern ist eine solche therapeutische Neurahmung extrem anspruchsvoll. Sie müssen nicht nur ihrer Tochter oder ihrem Sohn gegenüber die eigene Hilflosigkeit zugeben, sondern vor allem sich selbst gegenüber. Je länger ein Jugendlicher als Kind dieser Eltern Erfahrungen von fehlendem Schutz in bedrohlichen Situationen, von mangelhafter Unterstützung und von kränkenden Zurückweisungen gemacht hat, desto anspruchsvoller sind die Anforderungen an die Kompetenz des Therapeuten bei der Krisenbegleitung. Kritisch und vorrangig ist die Motivation zur Therapie, weil sich beim Übergang zum Erwachsensein die emotional tief wirkende, abgrenzende Schutzhaltung bereits stark verfestigt hat. Das Wissen um Bindungen, um die besondere Wirkung der Qualität therapeutischer Beziehungen und die therapeutische Kunstfertigkeit zusammen eröffnen trotz allem hoffnungsvolle Perspektiven im Umgang mit Menschen, deren Leben in Beziehungen beklemmend eng und emotional dürr geworden ist.
Wer je gesehen hat, wie bereits einjährige Kinder den Ausdruck ihrer Sehnsucht und ihrer Not nach Beistand, Nähe und Hilfe unterdrücken, wenn sie oft zurückgewiesen wurden, und wie die vermeidende Organisation ihrer Gefühle die ummittelbare Kommunikation mit ihren Schutzbefohlenen gerade dann verhindert, wenn sie Zuwendung am meisten brauchen, kann verstehen, was in Jugendlichen vorgeht, die solchen Gefühlen ohne Einsicht in die Zusammenhänge und ohne Aussicht auf Lösung ausgeliefert sind. Sie können sich nicht mehr helfen lassen. Die emotional verhärteten Personen sind deshalb auch in klinischen Stichproben außerordentlich unterrepräsentiert, obwohl sie in der Gesamtpopulation von allen bindungsunsicheren Personen die größte Gruppe darstellen. Ihr Lebensgefühl ist das einer Last, die zu ertragen ist, eine emotionale Leere, anstatt – wie bei Jugendlichen aus sicheren Bindungsbeziehungen – meistens erfreulich, emotional reich, mitteilsam, offen und lösungsorientiert auch gegenüber Lebenskonflikten. Sie dahingehend zu motivieren, dass sie Hilfe annehmen, ist die größte Herausforderung, noch vor der Therapie selbst.
Jürg Liechtis Buch öffnet den Blick und den Weg dahin, der in dieser erfolgreichen Klarheit bislang so noch nicht beschritten wurde. Er bringt Hoffnung für viele Jugendliche, die den verzweifelten Konflikt zwischen Autonomie und fehlender psychischer Sicherheit ohne die Stärkung ihrer Eltern, zu der sie selbst beitragen können, nicht lösen könnten.
Prof. em. Dr. phil. Klaus E. GrossmannInstitut für Psychologie, Universität Regensburg
Vorwort des Autors
Dieses Buch plädiert für ein beziehungsorientiertes Handeln, besonders wenn es um die Motivierung Jugendlicher in Therapie und Beratung geht. Wie von selbst bietet sich dabei ein systemisch-familientherapeutischer Ansatz an. Nicht von ungefähr hat er sich zeitgleich zur Bindungstheorie und mit vielen Querbezügen zu ihr entwickelt. Beide Disziplinen gehen davon aus, dass Beziehungsfähigkeit ein Kennzeichen psychischer Gesundheit ist und dass es in familiären Beziehungen – oft verzerrt als Ursache menschlichen Unglücks dargestellt – Selbstheilungskräfte für die Linderung von Leid zu entdecken und zu mobilisieren gilt.
Das Buch fokussiert auf Prozesse der Therapiemotivation, nicht auf die Therapie als Ganzes, und es steuert Ideen bei, wie das Gefüge intimer (Familien-)Beziehungen zur Stärkung der Therapiemotivation genutzt werden kann. Es ist voller Unsicherheiten und offen bleibender Fragen. Zwar versucht es aufzuweisen, dass bei der therapeutischen Navigation durch die Einzigartigkeit klinischer Konstellationen wissenschaftliche Informationen als Orientierungshilfen dienen können. Aber gerade die Therapie mit verhaltensauffälligen Jugendlichen beweist, dass im Einzelfall mit Wendungen zu rechnen ist, die keine Wissenschaft genau voraussagt. Stattdessen verlangt die Arbeit in diesem Bereich von Professionellen eine Fähigkeit, systemische Prozesse zu regulieren, und eine grosse Bereitschaft, Widersprüche auszuhalten.
Abschließend noch kurze Worte des Dankes. Mein innigster Dank gilt meiner Ehefrau, Dr. Monique Liechti-Darbellay. Auch sie arbeitet als Psychiaterin und Psychotherapeutin im gleichen Berufsfeld. Ihre Erfahrung und Ermutigung, aber auch ihre kritischen Beiträge haben das Buch durchgehend beeinflusst. Von Herzen danke ich allen Jugendlichen, ihren Eltern und Geschwistern, die mir bisher das Vertrauen geschenkt haben, obwohl ich nicht alle Erwartungen erfüllen konnte. Dem Lektorat schließlich, Frau Dr. Nicola Offermanns und Herrn Dr. Ralf Holtzmann sowie dem Carl-Auer-Verlagsteam danke ich für die sorgfältige Begleitung.
Jürg LiechtiAdelboden, 6. Januar 2009
1.Einleitung
»Während Soziologen Listen manifester, ›sichtbarer‹ Verpflichtungen zusammengestellt haben, interessieren wir uns mehr für die unsichtbaren. Zwischen jedem Individuum und seinem Beziehungssystem findet ein ständiger Austausch von Gebens- und Nehmens-Erwartungen statt. Wir pendeln unablässig hin und her zwischen diesen Positionen: teils erlegen wir selbst Verpflichtungen auf, teils erfüllen wir sie.«
Boszormenyi-Nagy u. Spark (1981, S. 42)
Weil ich keine Hilfe brauche
Anlässlich eines Workshops fragte ich eine Jugendpsychiaterin: »Sind in deinem Spezialfach Motivationsprobleme bei Jugendlichen ein Thema?« Ihre Antwort kam postwendend und sie war kurz: »Ein Dauerthema, aber man spricht nicht darüber; man ist allein damit!«
Erwachsene suchen unter dem Eindruck von psychischer Beeinträchtigung und Hoffnung auf Besserung von sich aus eine Beratung oder Psychotherapie auf. Um Kinder für eine Kinderpsychotherapie zu gewinnen, braucht man die Unterstützung der Eltern. Aber wie ist es mit seelisch leidenden Jugendlichen? Die lassen sich nicht so schnell in die Karten blicken. Und gerade jene, die am meisten gefährdet sind, neigen am wenigsten dazu, Hilfe zu suchen (Fortune et al. 2008). Stattdessen streiten sie ab, dass etwas nicht stimmt, lehnen Hilfe ab, geben sich undurchsichtig, arrogant, unbeteiligt, cool oder gleichgültig – ungeachtet aller Risiken, die sie dadurch für sich und andere in Kauf nehmen.
Eva S. – ein Hilferuf
An einem leuchtenden Septembertag, kurz vor der ersten Nachmittagssitzung, rief die verzweifelte Frau S. an und bat um Hilfe für ihre 15-jährige Tochter Eva.
Die Mutter hielt es einfach nicht mehr aus, einerseits zu wissen, dass Eva sich an beiden Unterschenkeln Schnittwunden zufügte, und andererseits mit niemandem darüber reden zu können. Als sie am Vormittag die Wäsche zum Waschen sortierte, hatte sie wieder blutige Pyjamahosen gefunden. Ihr getrennt lebender Ehemann und Vater von Eva glaube ihr nicht, obwohl sie ihm mehrmals von den blutigen Snoopy-Pyjamas erzählt habe. Stattdessen mache er ihr Vorwürfe, sie sei zu dominant und mische sich in übertriebener Manier in die persönlichen Angelegenheiten der Tochter ein (»Sie ist jetzt 15 und kein Kind mehr!«, so habe der Vater gesagt). Sie selber glaube aber eher, es sei ein Hilferuf! »Aber wenn ich Eva direkt darauf anspreche, so reagiert sie aggressiv und bestraft mich dann damit, dass sie tagelang kaum mit mir spricht und sich im Zimmer verschanzt!« Dann wiederum klammere sich Eva an sie, wie das in diesem Alter doch nicht normal sei. In der Beratungsstelle habe man ihr dringend eine Therapie empfohlen, doch Eva weigere sich hinzugehen.
Erschreckende 53 % der jungen Menschen, die sich selbst geschädigt hatten, waren nicht motiviert, Hilfe zu holen, ehe sie sich absichtlich verletzten; dies war das Ergebnis einer umfassenden und repräsentativen Studie an Schulen in England. In anonymen Selbstbeschreibungen gaben die Jugendlichen unter anderem folgende Gründe an, weshalb sie keine Hilfe aufsuchten (Hawton et al. 2006, S. 106):
•»Weil ich keine Hilfe wollte.«
•»Ich brauchte keine Hilfe. Ich konnte alleine damit fertig werden – und zwar besser, als wenn mir irgendjemand geholfen hätte.«
•»Hatte nicht das Gefühl, dass meine Probleme wichtig genug sind.«
•»Ich habe mich geschämt.«
•»Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir noch irgendjemand hätte helfen können.«
Haben selbstschädigende Handlungen stattgefunden, so wusste gemäß dieser Studie in fast 80 % der Fälle irgendeine andere Person darüber Bescheid – in der Reihenfolge der Häufigkeit waren das Freunde, Mütter und Geschwister. Dessen ungeachtet schien es keine Gelegenheit zu geben, entschieden einzuschreiten, ehe die Selbstverletzungen geschahen. Zeigen Jugendliche selbstverletzendes Verhalten, auch in schwerwiegendem Ausmaß, so heißt das offenbar noch nicht, dass sie professionelle Hilfe wünschen oder dass jemand durch hilfreiches Einschreiten etwas erreichen könnte. Auch wenn das schon traurig genug ist, so muss angenommen werden, dass die Ohnmacht des Umfelds einschließlich der Fachleute auch bei vielen anderen seelischen Störungen des Jugendalters verbreitet ist.
Die Pubertät ist nicht an allem schuld
Oft genug stoßen Eltern von pubertären oder adoleszenten Kindern mit ungewöhnlichen Entwicklungsverläufen an ihre Grenzen; sie ängstigen sich, fühlen sich überfordert, verunsichert, schuldig oder sehen sich zur Kapitulation gezwungen. Dasselbe Kind, das erst noch kummervoll in ihr Bett geschlüpft ist, sich dankbar umarmen ließ oder einen ihm erteilten Rat willig befolgte, erweist sich über Nacht als unnahbar und fremd. Allen gut gemeinten Hinweisen der Eltern zum Trotz demonstriert es lauten oder wortlosen Widerstand. Je mehr auf »Normalität« gepocht wird, umso abweichender verhält es sich, und je mehr die bangen Eltern auf professionelle Hilfe drängen, desto unwahrscheinlicher kommt sie zustande.
In Anbetracht eines passiv-renitenten, anarchischen oder aktivlärmigen Verhaltens von Jugendlichen sind Erwachsene rasch mit dem Etikett der Pubertät bei der Hand.
Der amerikanische Arzt und Psychiater James F. Masterson (1993, S. 184): »Noch vor wenigen Jahren war man der Ansicht, die Adoleszenz sei von ihrem Wesen her eine so tumultuöse und ärgerliche Periode, dass alle Teenager ernsthafte Probleme entwickeln müssten. Tatsächlich waren die Begriffe Teenager und Probleme nahezu synonym.«
»Er ist halt in der Pubertät«, entschuldigen Eltern das asoziale Verhalten ihres Sohnes. Oder sie trösten sich angesichts eines bizarren Essverhaltens ihrer Tochter mit der Hoffnung, »dass sich das wieder legen wird, sobald sie einmal erwachsen ist«. Das mag im einen oder anderen Fall auch zutreffen, doch heutzutage gibt es keinen Grund, es einfach darauf ankommen zu lassen; denn Fachleute verfügen sehr wohl über differenzierende Instrumente, um eine normale Entwicklung von einer krankhaften zu unterscheiden. Und je früher eine Fehlentwicklung einer jugendlichen Person entdeckt und einer möglichst passgenauen Hilfe zugeführt wird, desto besser steht es für ihre psychische Gesundheit – und für die Allgemeinheit, denn schließlich erwachsen ihr aus unzureichend behandelten psychischen Störungen und deren Folgen über eine lange Lebensspanne hohe Gesundheitskosten.
Bei den meisten emotionalen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten im Jugendalter wird von einer Multikausalität der Entstehung ausgegangen. Demzufolge setzen sich multimodale Therapiekonzepte mit unterschiedlichen Chancen und Risiken durch. In jedem Einzelfall muss nach einer passenden Indikation (= plausibler Grund für den Einsatz eines bestimmten Verfahrens bei einer bestimmten Störung) gesucht werden.
Dabei werden zwei verschiedene Indikationsbegriffe unterschieden:
•Die individuelle (methoden-, expertendefinierte) selektive Indikation ordnet einer spezifischen Störung das aufgrund empirischer oder klinischer Erkenntnisse bestgeeignete Verfahren zu (Ist bei einem bestimmten Patienten mit einer spezifischen Problematik Psychotherapie überhaupt indiziert? Ist die von der Therapeutin vertretene Therapierichtung indiziert? Ist systemische, Verhaltens- oder Gesprächspsychotherapie etc. indiziert? Sind unabhängige oder ergänzende Hilfeleistungen indiziert?) (vgl. Fiedler 2003).
•Die prozessorientierte (kooperations-, klientenorientierte) adaptive Indikation richtet sich nach den wechselnden Bedürfnissen eines sich entwickelnden therapeutischen Systems sowie nach flexiblen Therapiezielen (Was kann eine Mutter tun, um ihrem Sohn einen motivierenden Kontext zu schaffen? Wann ist der »richtige Zeitpunkt« bzw. welches sind die Voraussetzungen, um das Therapiesystem zu erweitern? Findet eine Sitzung trotzdem statt, wenn ein Vater sich abmeldet, weil er vielleicht davon ausgeht, dass Therapie ohnehin eine »Muttersache« sei?) (vgl. Bastine 1981; Mattejat 1997; Schweitzer u. von Schlippe 2006).
Wozu dient dieses Buch?
Das vorliegende Buch richtet den Brennpunkt hauptsächlich auf (familien-)systemische Passungsprozesse (adaptive Indikation), die eine frühzeitige Motivierung Jugendlicher in Therapie und Beratung bezwecken. Es ist von der Überzeugung beseelt, dass Psychotherapie primär die Aufgabe hat, emanzipierende Rahmenbedingungen für die Selbstorganisation der Menschen zu schaffen (und nicht sie zu »reparieren«), und dass speziell bei Jugendlichen der Familienkontext mit zu berücksichtigen ist. Der hier vertretene Ansatz geht davon aus, das die Stimme des Jugendlichen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gehört, und nicht dessen Störung. Gewiss: Störungen dürfen nicht unterschätzt werden – besonders, wenn sie eine Eigendynamik entwickeln und das Umfeld in ihren Bann ziehen. Dazu hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende Menge an Wissen angereichert, und es stehen mittlerweile wissenschaftlich perfekt ausgelotete Therapieprogramme für gut definierte Störungen bereit. Ungeachtet dessen kommen die Hilfen nicht überall zum Zug, da Jugendliche sie oft vermeiden. Darüber hinaus besteht bei der Anwendung eines »diagnoselastigen« Ansatzes bei emotionalen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten im Jugendalter die Gefahr von subtilen Etikettierungsprozessen.
In einer nuancierten Formulierung, wie wir sie von Magersüchtigen kennen, sagte eine anorektische Jugendliche wörtlich (Liechti 2008):
»Es klingt vielleicht unglaubhaft, aber genau so ist es. Wenn man mir nicht vertraut, wird es nicht gehen. Meine Magersucht ist vielleicht ein bisschen speziell, anders als bei anderen. Jeder Fall ist anders, das hab ich im Spital gesehen. Die Leute dort haben sich Mühe gegeben. Aber für mich ist es einfach nicht der richtige Weg gewesen. Es ist nicht so, dass ich einfach abnehmen will. Ich spüre einfach, dass sich zuerst die Beziehungen in der Familie ändern müssen, dann wird es mir besser gehen, und ich werde essen können. Für mich ist es wie ein Rätsel in der Mitte eines Labyrinths. Zuerst muss man den Weg durch das Labyrinth finden, bevor man das Rätsel lösen kann. Umgekehrt geht es nicht. Ich komm gar nicht ans Rätsel heran, bevor ich nicht den Weg gefunden habe.«
Die »physiologischen« Ambivalenzen des Jugendalters, die vom Ringen um eine eigene Identität angesichts einer widersprüchlichen Welt geprägt sind, machen Jugendliche – und ganz besonders solche mit nicht geradliniger Entwicklung – hellhörig für die Beachtung und Anerkennung als ganze Menschen. Das Bedürfnis, von anderen Menschen be- und geachtet zu werden, gilt für alle und ist bei Jugendlichen besonders stark ausgeprägt. Beachtung ist ein Bestandteil der jugendlichen Existenz: »Ich werde beachtet, also bin ich« (Tarr Krüger 2001). Infolgedessen ist die Idee, verhaltensauffällige Jugendliche stets als Experten der eigenen Lebenssituation zu verstehen, nicht nur eine Sache des Respekts; vielmehr ist sie eine Sache der klinischen Notwendigkeit, wenn es darum geht, sie für die Therapie zu gewinnen. Deshalb gehen erfahrene Therapeuten davon aus, dass Jugendliche immer »gute« – das heißt anerkennenswerte – Gründe für ihr Verhalten haben, auch wenn es von außen betrachtet »auffällig«, »schlecht« oder »gestört« erscheint.
Das Buch richtet sich vor allem an beratend oder therapeutisch Tätige, die sich an der konkreten Praxis orientieren und umso empfänglicher für Ideen aus der Werkstatt sind (»Das systemische Denken ist ja ganz faszinierend, aber hier habe ich einfach das praktische Problem, dass Mario sich weigert zu kooperieren, und solange sein Vater nicht mitmacht, wird sich das nicht ändern, und ich weiß einfach nicht, was ich noch tun kann, um diesen Vater zur Zusammenarbeit zu gewinnen.«).
In den 25 Jahren meiner Tätigkeit als Ausbilder in Masterkursen, Workshops, Seminaren und auch in der Supervision stellen sich im Zusammenhang mit Jugendlichentherapien immer wieder dieselben praktischen Fragen:
•Wie kann man Jugendliche erreichen, die von einer psychotherapeutischen Behandlung profitieren könnten, sich dieser aber aktiv bzw. passiv widersetzen?
•Kann man überhaupt »Therapie machen«, wenn eine jugendliche Person »nicht will«, und wenn »ja«, wie denn?
•Ist es ethisch vertretbar, Jugendliche »zu ihrem Glück zu zwingen«?
•Gibt es keine Alternative zur (elterlichen, staatlichen, professionellen) Fremdkontrolle bei gleichzeitigem Vorhandensein offensichtlicher Hilfebedürftigkeit und Widerstand gegenüber einer Behandlung (z. B. Zwangseinweisung in eine Einrichtung)?
•Wie kann man Eltern begegnen, die sich ihren offensichtlich hilfebedürftigen Kindern gegenüber (scheinbar?) machtlos, hilflos, gleichgültig oder distanziert zeigen?
•Dürfen, sollen, müssen Eltern auch gegen den Willen von Jugendlichen in die Therapie einbezogen werden, sofern auf anderem Weg keine Aussicht auf Erfolg besteht?
Das Buch dient dazu, einige Antworten auf diese Fragen zusammenzutragen. Beim Schreiben hatte ich insbesondere das Ziel vor Augen, Anregungen für systemische Lösungen von Motivationsproblemen in der Therapie mit verhaltensauffälligen Jugendlichen zu geben. Demzufolge richtet es den Blick auf die Optimierung familiärer Therapiekontexte. Es verbindet verschiedene theoretische Konzepte zur Therapiemotivation mit Methoden der systemischen Therapie zu einer systemischen Motivierungspraxis.
Drei klinische Einstiegskonstellationen
Praktische Ansätze für die Therapiemotivierung Jugendlicher sind das Thema dieses Buches. Gemäß der berühmten Maxime – »Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind … Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken« (Kant 1920, S. 50) – verwende ich »sinnliche« Fallbeispiele, Therapiegeschichten, Anekdoten sowie »begriffliche« Konzeptansätze und wissenschaftliche Informationen. Zahlreiche Dialogbeispiele sollen die therapeutischen Interventionen konkretisieren und illustrieren. Damit ausgerüstet fokussiere ich vorwiegend auf drei klinische Konstellationen, die ich in meiner Praxis häufig antreffe:
1.Eine alleinerziehende Mutter (ein Vater, Eltern) ruft an oder kommt in die Sprechstunde und erzählt, dass eine Tochter (ein Sohn) offensichtlich ein besorgniserregendes Verhalten an den Tag legt, sich aber weigert, therapeutische Hilfe anzunehmen.
2.Eine alleinerziehende Mutter (ein Vater, Eltern) hat es geschafft, die Tochter (den Sohn) in die Sprechstunde »zu schleppen«, und erwartet nun, dass der Therapeut »den Fall« übernimmt.
3.Die Jugendlichen selbst werden von ihren Eltern (oder Hausärztin, Jugendgericht etc.) in die Therapie »geschickt«.
Alle drei Konstellationen haben viel miteinander zu tun und können sich bei ein und demselben Jugendlichen auch als »motivationale Stadien« entpuppen (von der elterlichen Aussage »Unser Sohn sagt, er werde ganz bestimmt nicht mitkommen« bis zum jugendlichen Kooperationsangebot »Dann komm ich halt, sag aber nichts«).
Obwohl sich der Prozess der Therapiemotivation zweifelsohne durch die ganze Therapie durchzieht, stelle ich hier die Optik auf den Einstieg in die Therapie – da, wo Jugendliche »einfach nicht kommen« oder kommen, aber aktiven oder passiven Widerstand zeigen.
Noch ein Wort zu meinem Verständnis des Praktikers. Ich kann mich gut mit folgender Definition identifizieren (Flammer 1988, S. 14): »Der erfolgreiche fachpsychologische Praktiker zeichnet sich wahrscheinlich dadurch aus, dass er (oder sie) eine Auswahl von wissenschaftlichen Theoriebeständen in seine Alltagspsychologie integriert hat, dass er seine Alltagspsychologie im Lichte wissenschaftlichen Wissens mehr als ein psychologischer Laie verfeinert und korrigiert hat. Soweit ihm dies gelungen ist, darf er sich auf seine Alltagspsychologie verlassen, wodurch er relativ frei, spontan und offen auf die gegebene Situation eingehen kann.«
Praxis und Theorie scheinen sich wechselseitig zu »befruchten«, allerdings kenne ich einige hervorragende Praktiker, die ohne viel Theorie auszukommen scheinen.
Von meiner konzeptuellen Herkunft fühle ich mich im systemischen Denken und Handeln beheimatet, allerdings ohne »feste« Bindung an eine Leitfigur oder an eine bestimmte Therapiedoktrin. In den vergangenen Jahren arbeitete ich zunehmend bewusster »schulenübergreifend«. Beruflich fühle ich mich vorrangig den Hilfesuchenden verpflichtet, aber auch den Leistungszahlern, die es mir erlauben, einen Beruf auszuüben, der umso anspruchsvoller und spannender ist, je mehr Erfahrungen dazukommen, und der mir materielle Autonomie gewährt. Den professionellen Nährboden bieten mir meine Kollegen am ZSB Bern1.
Die berühmte Metapher der Zirkularität, die ich 1983 zum ersten Mal gelesen habe und die mich sofort frappiert hat, war eine der Leitideen, die mich in die systemische Richtung gewiesen haben. Sie stammt von Mary Catherine Bateson, der Tochter des Anthropologen und philosophischen »Vaters« der Familientherapie, Gregory Bateson (in Hoffman 1982, S. 5): »Ein Mann mit einer Sense wird eingeschränkt durch die Form der Sense; sogar seine eigene Körperbewegung erhält Instruktionen durch die Krümmung seines Werkzeugs: eine über Generationen reichende konkrete Proposition über die Einheit der Bewegung von Mensch und Werkzeug durch hochgewachsene Felder; im Laufe der Zeit wird seine eigene Muskulatur das darstellen, was ihn die Sense gelehrt hat, erst durch Steifheit, dann durch sich langsam herausbildende Anmut und Geschicklichkeit. Wir brauchen Zeit, um dieses System zu verstehen und in ihm mehr als nur die instrumentelle Seite zu sehen.«
Im Zentrum des folgenden zweiten Kapitels stehen die Therapie bei einer Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten und die Frage, inwiefern die Therapie nach systemischen Gesichtspunkten geschieht. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit im Umgang mit der Motivierung sowie mit einer »ersten Annäherung« an das Modell des »konsultativen Einbezugs Jugendlicher«. Das vierte Kapitel behandelt einige grundsätzliche Themen zu Jugendlichen und Familie. Das fünfte Kapitel beschreibt das Modell des »konsultativen Einbezugs Jugendlicher« anhand praktischer Beispiele. Im sechsten stehen konzeptuelle Aspekte der Therapiemotivation im Brennpunkt und im siebten einiges zur Praxis der Psychotherapie und zu dem Handwerkszeug, das sich im Umgang mit Motivierungsproblemen im Jugendalter bewährt hat. Das achte Kapitel fokussiert auf den Entwicklungsaspekt von Therapiemotivation. Im neunten Kapitel werden zwei Therapien unter dem Aspekt der Motivierung der/des Jugendlichen dargestellt. Das zehnte Kapitel schließt mit dem Thema der Krisenintervention bei Jugendlichen.
Um der besseren Lesbarkeit willen habe ich auf die gleichzeitige Nennung der männlichen und weiblichen Form verzichtet, obwohl ich beide Geschlechter in gleichem Maße ansprechen möchte.
1Das Zentrum für Systemische Therapie und Beratung, ZSB Bern, integriert unter demselben Dach sowohl eine Praxisgemeinschaft (psycho-sozio-medizinische Grundversorgung) wie auch ein Fort- und Weiterbildungsinstitut mit anerkannten Curricula und Masterkursen. Die Einrichtung ist rechtlich als eidgenössische Stiftung verankert und bezweckt die Förderung von beziehungsorientierten Hilfen bei psychosozialen Belastungen in Partnerschaft, Familie und Organisationen. Insgesamt sind über 30 Kollegen aus Medizin, Psychologie und sozialen Berufen direkt involviert, teils als praxisführende, teils als ausbildende Therapeuten oder beides (www.zsb-bern.ch).
2.Ein stilles Leiden
»Insofern ist es eine Zeit, in der sich Menschen schwertun mit Bindungen. Freiheit ist leichter zu verteidigen, wenn sie eingebettet ist in eine Welt von normalen menschlichen Bindungen, und man könnte argumentieren, dass eine der schwierigsten Aufgaben, die wir heute haben, darin liegt, dafür zu sorgen, dass solche Bindungen nicht mutwillig zerstört werden und dass wohl neue entstehen …«
Sir Ralf Dahrendorf (Interview in Radio DRS 2, 2006)
Extreme verbinden – Der Ersttermin
Für Evas Mutter, Frau S. (vgl. Kap. 1), ergab sich wegen einer kurzfristigen Terminabsage am gleichen Nachmittag ein Gesprächstermin, den sie ohne zu zögern wahrnahm, obwohl sie dafür einen eigenen Arzttermin umlegen musste. Es erschien eine geschmackvoll gekleidete Frau, die, ursprünglich aus Polen stammend, perfekt Deutsch sprach. Dass sie unter großem Druck stand, zeigte sich in ihren angestrengten Versuchen, das Weinen zu unterdrücken.
MUTTER: Die Schnitte müssen tief sein, weil immer viel, zum Teil vertrocknetes, zum Teil frisches Blut am Pyjama klebt. Auch habe ich im Papierkorb in Evas Zimmer mit Merfen2 getränkte Wattebausche gefunden. Das ist doch gefährlich, da kann sich doch eine Infektion ergeben, und das muss doch wenigstens von einem Arzt kontrolliert werden.
THERAPEUT: Das ist einleuchtend.
MUTTER: Aber Eva weigert sich vehement, zu einer Beratungsstelle zu gehen. Sie sagt immer, sie brauche keine Hilfe, man solle sie in Ruhe lassen.
THERAPEUT: Und das sehen Sie anders?
MUTTER: Auch mein Mann sagt, ich mische mich zu sehr ein. In letzter Zeit habe ich mir Mühe gegeben, nichts mehr zu sagen. Aber das hat eigentlich auch nichts gebracht.
THERAPEUT: Nichts gebracht? Wie meinen Sie das?
MUTTER: Die blutigen Pyjamahosen sind nicht seltener geworden.
THERAPEUT: Aha.
MUTTER: Und ich mache mir Vorwürfe, was ich als Mutter alles falsch gemacht habe. Ich bin relativ früh von zu Hause weg, aus Polen, mein Vater war ein hoher Berufsmilitär, jetzt ist er pensioniert und etwas milder geworden …
THERAPEUT (unterbricht höflich): Sie meinen, die blutigen Pyjamahosen sind nicht seltener geworden, obwohl Sie sich zurückgehalten haben?
MUTTER: Ja, genau.
THERAPEUT: Sie haben angenommen, es gebe einen Zusammenhang zwischen Ihren Fragen an die Tochter und den blutigen Pyjamahosen?
MUTTER: Ja, das heißt, mein Mann hat immer gesagt, Eva mache das absichtlich, um sich von mir abzugrenzen, damit ich sie endlich würde erwachsen werden lassen.
THERAPEUT: Und das hat sich jetzt als Irrtum herausgestellt? Verstehe ich das richtig?
MUTTER: Auch eine meiner Freundinnen hat gesagt, ich solle mich vielleicht zurückhalten. So habe ich es auch gemacht. Ich habe mich sehr zurückgehalten. Aber die blutigen Pyjamahosen sind nicht seltener geworden. Im Gegenteil.
THERAPEUT: Das heißt also, Ihr Mann und Ihre Freundin haben sich in dieser Vermutung geirrt?
MUTTER: Irgendwie ja, auf jeden Fall habe ich es heute Mittag nicht mehr ausgehalten, einfach nichts zu sagen.
THERAPEUT: Sie meinen unser Telefonat?
MUTTER: Das war später, zuerst habe ich Eva gesagt, nachdem sie von der Schule kam, es müsse doch endlich etwas geschehen, so gehe es einfach nicht mehr weiter.
THERAPEUT: Und dann hat sich dasselbe wiederholt wie immer, so wie Sie es kennen?
MUTTER: Eva hat mich angeschrieen … [weint] ich darf den Ausdruck gar nicht wiederholen, bei mir zu Hause wäre ein solches Wort unmöglich gewesen. Sie hat die Türe zugeknallt und ist verschwunden. Später habe ich versucht, mit ihr zu reden. Sie hat aber die Zimmertür abgeschlossen. Dann habe ich herumtelefoniert, aber niemanden erreicht. Erst dann kam das Telefonat mit Ihnen.
THERAPEUT: Aha [lange Pause] … Nehmen wir einmal an, Eva würde jetzt hier mit uns zusammen sitzen. Ich würde sie fragen, wer hat eigentlich das größere Problem, die Mutter oder Eva?
MUTTER: Sie würde natürlich sagen, die Mutter. Das sagt sie mir immer: Du hast Probleme, nicht ich! Auch Papa sage das, hat sie mir auch schon an den Kopf geworfen.
THERAPEUT: Gibt’s da Ihrer Meinung nach was Wahres dran?
MUTTER: Klar habe ich Probleme, ich bin ja auch bei einer Psychiaterin in Behandlung und nehme Medikamente. Seit mein Mann ausgezogen ist, ist es nicht einfacher geworden. Aber ich wäre schon viel ruhiger, wenn Eva sich wenigstens von einer Fachperson helfen ließe.
THERAPEUT: Und Eva will nicht?
MUTTER: Sie will nicht, und das verschafft mir schlaflose Nächte. Ich träume auch davon, wie sie sich schneidet. Ich halt’ das nicht mehr aus, obwohl sie sich ja nie beklagt.
THERAPEUT: Gesetzt den Fall, Eva hätte gute Gründe, keine Hilfe anzunehmen, zumindest zum heutigen Zeitpunkt und schon gar nicht von Fachpersonen, gesetzt den Fall, sie säße jetzt gerade hier und würde diese guten Gründe vorbringen, und es wären irgendwie einleuchtende Gründe, würden Sie ihr vertrauen, dass sie damit ihre eigene Wahrheit sagt?
MUTTER: Das würde mir schwerfallen in Anbetracht der blutigen Pyjamahosen.
THERAPEUT: Heißt das, Eva hätte nicht die geringste Chance, Sie von ihrer eigenen Sicht der Probleme zu überzeugen?
MUTTER: Nein, so meine ich es natürlich nicht. Ich kann mir vernünftige Gründe einfach nicht vorstellen. Ohnehin will sie ja gar nicht herkommen.
THERAPEUT: Gesetzt den Fall, Eva würde zu einer Sitzung eingeladen, nicht als Patientin, die sich Schnittwunden zufügt, sondern als junge Frau, die ihre eigene Wahrheit, ihre eigene, vielleicht verrückte, aber aufs Innigste empfundene Wahrheit vorträgt, und sie hätte das Vertrauen, dass man ihr zuhört, wirklich aufmerksam zuhört – denken Sie, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Eva zu einer Sitzung erscheint, größer oder kleiner würde?
MUTTER (überlegt): Ich denke, dass es wahrscheinlicher wäre.
THERAPEUT: Sie glauben, dass es Eva wichtig genug wäre, ihre Mutter über die eigene, innere Sichtweise aufzuklären, der Mutter irgendwie nachvollziehbar zu machen, weshalb sie sich schneidet? Sie denken, das wäre für Eva wichtig genug, um herzukommen?
MUTTER: Das wäre einmal etwas anderes, aber irgendwie auch eine verkehrte Welt.
THERAPEUT: Könnte es sein, dass der Grund des aggressiven Verhaltens darin liegt, dass Eva Ihnen gegenüber Schuldgefühle hat?
MUTTER: Ja, das hat sie mir auch schon einmal gesagt. Wir haben ja auch gute Stunden, dann schlüpft sie sogar in mein Bett.
THERAPEUT: Könnten Sie sich vorstellen, Eva an eine Sitzung einzuladen, diesmal nicht als Patientin, die sich schneidet, sondern als Tochter, die beitragen kann, die schwierige Situation besser zu verstehen?
MUTTER: Was müsste ich denn anders machen?
THERAPEUT: Eigentlich nicht viel; denn das Allerwichtigste tun Sie ja bereits. Sie stehen das alles durch, trotz aller Belastungen. Sie halten Ihrer Tochter die Treue. Sie hegen ein tiefes Vertrauen in sie. Sie geben nicht auf. Sie suchen Hilfe. Sie bauen Brücken. Das ist alles zusammen weit mehr als die halbe Miete. Dass ein junger Mensch Probleme hat, wenn er sich mehrmals absichtlich und gefährlich schneidet, ist kein Zweifel. Zum Glück hat Eva eine Mutter, die sich dabei nichts vormachen lässt. Vielleicht ist für Eva aber das, was für uns das Problem bedeutet, nämlich das Schneiden, eine Art Lösung eines seelischen Problems. Zum Beispiel ein vielleicht noch unreifes, immerhin aber funktionierendes Ventil für Pubertätsspannungen. Konkret heißt das, Eva würde unter diesen Bedingungen nie freiwillig herkommen, um zu hören, dass sie das Ventil ersatzlos aufgeben soll. Warum sollte sie auch, wo sie gerade eine Methode gefunden hat, um sich einigermaßen in seelischer Balance zu halten. Sie wird möglicherweise aber dafür zu gewinnen sein herzukommen, wenn sie das Vertrauen hat, dass wir uns für das Ventil ausgesprochen interessieren, statt es zu kritisieren. So wie ein Erfinder seine Erfindung vorträgt. Vielleicht kann so auch ihr Interesse für andere, weniger destruktive Ventile geweckt werden. Doch den Zeitpunkt, wo es soweit ist, alte Ventile durch neue zu ersetzen, wird sie selbst bestimmen wollen. Vorerst zählt einzig, dass wir mit ihr ins Gespräch kommen. Offene Gespräche führen zu neuen Möglichkeiten, es sind Brücken, die Extreme verbinden. Das ist unsere Erfahrung.
Kooperation im therapeutischen Arbeitskontext
Leopold Szondi bezeichnete eine besondere Reifestufe des Ichs, das die Gegensätze zwischen Trieb- und Affektnatur, der sozialen und geistigen Umwelt zu überbrücken vermag, als »Überbrücker der Gegensätze« (Pontifex oppositorum, vgl. Szondi 1968, S. 23). So gesehen erklimmt die reife Person eine Entwicklungsstufe der Metakommunikation, die folgende Optionen erlaubt: Entweder entscheidet sich die Person dafür, die (unüberbrückbaren) Gegensätze auszuhalten und sie als Teil des eigenen Schicksals zu akzeptieren (Versöhnung mit dem eigenen Schicksal), oder aber sie tritt an, um zwischen (unerträglichen) Gegensätzen Brücken zu bauen und sie als Quelle kreativer Variation zu nutzen. Demgegenüber bleibt dem unreifen Ich diese Entscheidungsebene unzugänglich und es verheddert sich stattdessen in den Fallstricken unversöhnlicher Positionen und baut Brücken ins Nichts. In der Theorie der menschlichen Kommunikation werden zwei Formen der Eskalation beschrieben, die beide im Extrem die Beziehung und ihre Entwicklung gefährden (Watzlawick 1969):
•Symmetrische Beziehungsstruktur: Typisch ist, dass die wechselseitigen Beiträge sich ähnlich sind (»Ich gebe dir die Hand, du gibst mir die Hand«), wobei wiederum zwei Formen unterschieden werden können, nämlich
1) eine eher »zornmotivierte« Symmetrie mit dem Motto: »So wie du mir, so ich dir«, »Auge um Auge, Zahn um Zahn«, das heißt, die Dynamik ist aufschaukelnd, die Beziehung wird dadurch labilisiert, und es droht Beziehungsabbruch oder Gewaltausbruch, sowie
2) eine eher »angstmotivierte« Symmetrie mit dem Motto: »Du machst mir nichts, ich mach dir nichts«, das heißt, die Dynamik ist wenig bewegt, man schont sich wechselseitig, die Beziehung bleibt daher auch eher labil, und es drohen Langeweile und Stillstand.
•Komplementäre Beziehungsstruktur: Typisch ist, dass sich die wechselseitigen Beiträge ergänzen: »Gibst du mir die Wurst, so lösch ich dir den Durst«, das heißt, die Dynamik ist abschaukelnd, die Beziehung wird stabilisiert, und es drohen die Erstarrung und »Herrschaftsverhältnisse« (der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas [1971] sah darin die Gefahr der Herrschaftsbildung und äußerte sich dahingehend, dass die Symmetrie eine Voraussetzung für herrschaftsfreie Kommunikation sei).
Eine wirkungsvolle Psychotherapie beinhaltet als »Kommunikationstherapie« im Sinn des »Pontifex-Ichs« einen intelligenten und versöhnlichen Brückenschlag zwischen miteinander verstrickten Menschen, Positionen und Inhalten. Es bedeutet einen wichtigen Schritt für eine Familie zu erkennen, dass das Problem in den Kommunikationsmustern liegt, nicht in den Menschen (Metakommunikation):
•Reziproke Beziehung: Flexibler (zielregulierter) Wechsel von symmetrischer und komplementärer Kommunikation, je nach Situation und Thematik (z. B. flexibles Verhandeln der Rollen, Rechte und Pflichten).
In zwei weiteren Einzelsitzungen zeigte sich Evas Mutter, Frau S., umso nachdenklicher, je intensiver sie sich mit der Frage auseinandersetzte, wie sie ihre Tochter zur Zusammenarbeit gewinnen könnte. War sie am Anfang davon überzeugt, dass sie als Mutter (und auch als Ehefrau) alles falsch gemacht hat und daher allein die Schuld an Evas Leid und an der Auflösung der Familie trägt, so tauschte sie diese deprimierende Sicht bald gegen eine Neugier auf unerwartete Perspektiven ein. Sie stellte viele Fragen, sprach Ängste aus und erprobte konkrete Sätze – bald sprach sie von den »Wundersätzen« –, die sie ihrer Tochter gegenüber in den heiklen Situationen ins Spiel brachte, wo sie sich angegriffen oder respektlos behandelt fühlte:
•»Ich empfinde es als sehr aggressiv, wie du mich behandelst, und ich möchte dir sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin.«
•»Wenn ich dazu schweige, so verstehe es als einen respektvollen Versuch, nicht in gleicher Münze zurückzuzahlen.«
•»Ich würde gerne deine Meinung besser verstehen, dazu brauche ich aber deine Hilfe. Der Therapeut sagt, du könntest mir helfen, die Situation besser zu verstehen.«
•»Wenn Papa das so sagt, dann wird er seine Gründe haben. Er kann es mir ja persönlich sagen, wenn es ihm wichtig genug ist.«
•»Du bist meine Tochter, und du musst einfach wissen, dass ich dich lieb habe und dass sich daran nichts ändert, was auch immer du tust.«
•»Du kannst mich nicht verletzen, du bist meine Tochter, es ist vielmehr dein Verhalten, das mich verletzt.«
•»Bestimmt hast du deine Gründe, wenn du mich ohne Respekt behandelst. Ich würde sie gerne verstehen, um mein Verhalten vielleicht zu ändern.«
•»Ich kann dir höchstens anbieten, zusammen mit dir in die Beratung zu gehen, damit ich lerne, dich besser zu verstehen.«
•»Der Therapeut sagt, es wäre für ihn hilfreich, mit dir zu sprechen, damit er mir besser helfen kann.«
Die Mutter gab mehrmals die Rückmeldung, dass sie sich in der Beratung verstanden und unterstützt erlebte. Die Vorstellung, dass sie nicht Urheberin aller Probleme war, sondern umgekehrt die Chance hatte, als Architektin neuer Kontexte Lösungsoptionen ins Spiel zu bringen, schien sie zu beflügeln. Die Aufgabe des Therapeuten bestand darin, sie in ihren Aktivitäten »als Coach« zu begleiten, zu ermutigen und ihr beizustehen, in den konkreten Widersprüchlichkeiten des alltäglichen Umgangs mit ihrer Tochter den roten Faden nicht zu verlieren. Nicht unwesentlich war dabei auch die Orientierung an »wissenschaftlich informierten« Ratschlägen, etwa in Bezug auf die Besonderheiten von gefährdeten weiblichen Jugendlichen (Essau u. Petermann 2002, S. 302):
•Mädchen weisen eher ungünstige Selbstbewertungsmuster als Jungen auf und haben eine geringere Erfolgserwartung, sodass sie in der Folge davon ein niedrigeres Selbstwertgefühl entwickeln.
•Bei Mädchen treten selbstbewertende Kognitionen im Vergleich zu Jungen scheinbar häufiger schon präadoleszent auf.
•Das Selbstwertempfinden und der Identitätsaufbau erfolgen bei Mädchen mehr über soziale Beziehungen als bei Jungen, und hierbei spielen Angst vor Ablehnung und Suche nach Zuwendung eine Rolle.
•Mädchen sind für familiäre Konflikte sensitiver und erleben diese deshalb belastender und anforderungsreicher.
•Bei Belastungen zeigen Mädchen im Vergleich zu Jungen eine erhöhte Reaktivität, zum Beispiel negativere Reaktionen und ungünstigere Attributionen bei Misserfolg.
•Die Selbstbehauptungsfähigkeit von Mädchen ist geringer als die von Jungen.
Insgesamt vergingen kaum drei Wochen, bis Eva als »Besucherin« zur ersten Sitzung erschien. Dabei wirkte sie erst zögerlich und misstrauisch, aber auch gespannt darauf, ob sie als »Klagende« auch »nichts« sagen oder ihre Geschichte frei erzählen darf, ohne zugleich bewertet, in die Schranken gewiesen, zur Vermittlerin oder sonst wie in ihren Grundbedürfnissen verletzt zu werden. War der »Wandel« der Mutter nur ein Trick, um sie in die Falle zu locken?
Zu ihrer Überraschung meinte es die Mutter ernst mit dem Wechsel der Perspektive (das Problem ist nicht die Tochter, sondern die Schwierigkeit, sie zu verstehen). Unterstützt vom Therapeuten gab sich Frau S. alle erdenkliche Mühe, einen »Wechsel der Präferenzen« (Ludewig 2000) vorzunehmen, sich »anders« als bisher zu verhalten und vieles neu zu verhandeln, was bisher als tabu gegolten hatte. In Bezug auf die blutigen Snoopys wurde vereinbart, dass die Verantwortung für das Waschen ab sofort Eva zufiel, während die Mutter als Gegenleistung versprach, den »Ich-weiß-ich-bin-eine-schlechte-Mutter-Blick« und entsprechende Bemerkungen zu unterlassen. Die Entscheidung, ob und wann der Vater in die Sitzungen einbezogen werden soll, wurde verhandelbar und Mutter und Tochter überantwortet. Mithin zielte die Therapie darauf ab, im stagnierenden familiären Entwicklungsprozess (kognitive, affektive, kommunikative) Hindernisse zu erkennen und auszuräumen. Infolgedessen wurden Veränderungen nicht nur »im Kopf« der Menschen angeregt, sondern ebenso in der Tat »live« in ihren zwischenmenschlichen Verhaltensweisen und Lebensumständen; denn »Veränderungen von Erwartungen können besonders wirksam durch Veränderung der faktischen Verhältnisse herbeigeführt werden« (Grawe 1998, S. 70). Der Therapeut setzte dabei auf eine Politik der kleinen Schritte sowie auf die Macht des Faktischen, die eine Spirale wechselseitiger Zugeständnisse und reziproker Verpflichtungen in Gang setzt.
Als Nächstes wünschte Eva, den Vater in die Therapie einzubeziehen, während die Mutter, aus Angst vor weiteren Verletzungen, nur zögerlich einwilligte.
Die »Zusammenführung« einer Familie, die sich durch Distanznahme, Mauern oder Kontaktabbruch ein schmerzliches aber immerhin lebbares Gleichgewicht eingerichtet hat, darf sich nicht darin erschöpfen, ihr die pathologischen oder dysfunktionalen Familienmuster vor Augen zu führen. Angehörige haben nicht nur Pflichten, sie haben auch Rechte. Obwohl es heute in vielen Fachstellen und Kliniken zur Routine gehört, Angehörige einzubeziehen, ist die Kritik von Familien nicht ganz verstummt, dass Angehörige wegen eines erkrankten Mitglieds zu einem Gespräch eingeladen würden, sich dann aber als reine »Informanten« ausgenützt oder sogar im Stich gelassen fühlten und dass statt Hoffnungen, etwas zur Besserung beizutragen, Gefühle der Verunsicherung und Schuld zurückblieben. Diese Tatsache beeinflusst den jugendlichen Patienten, denn er oder sie bleibt trotz allem ein Teil seiner Familie. Zusätzlich vernachlässigt ein solches Vorgehen gewachsene Loyalitäten. Als Begründung für die vehemente Ablehnung, ihre Eltern zu einer Sitzung einzuladen, gab eine Jugendliche an: »Als ich in der Klinik war, wurden meine Eltern zu einem Familiengespräch eingeladen. Danach haben sie den Kontakt zu mir abgebrochen. Ich fühlte mich sehr verzweifelt und schuldig. Ich dachte auch daran, mir das Leben zu nehmen. Später habe ich von den Eltern erfahren, sie hätten nur die Richtlinien der Ärzte befolgt, die ihnen geraten hätten, meine Selbstständigkeit zu unterstützen und auf Distanz zu gehen.«
Neben rein juristischen Gesichtspunkten (»Die Eltern haben von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge«, ZGB, Art. 304) ist der Einbezug von Angehörigen noch dringlicher von klinischer Seite her legitimiert. Allerdings sollte er einerseits aufgrund eines besserungsorientierten Konzepts geschehen und andererseits auf echter, das heißt aufgeklärter Freiwilligkeit (ein »plébiscite de tous les jours«, vgl. Renans 1882; es impliziert den deutlich artikulierten Wunsch, an einer Therapie festzuhalten oder auch nicht). Im besten Fall werden dadurch »neue und nie dagewesene« Rahmenbedingungen geschaffen, die es der Familie ermöglichen, beklagte Probleme zu lösen, statt sie zu vermeiden. »Der Therapeut muss die Personen zusammenführen, um sie unabhängiger zu machen«, schrieb Jay Haley (1979, S. 20) in einer Sprache, die Pionieren vorbehalten ist.
Wieweit indessen der Vater von Eva, Herr S., seinerseits überhaupt den Wunsch hat, Mitglied eines therapeutischen Teams zu werden, ist eine ganz andere Frage. Warum sollte er auch? Vielleicht liegt ihm viel mehr daran, Befürchtetes zu vermeiden. Es ist ein verbreiteter Irrtum zu glauben, Familienangehörige hätten allesamt nur darauf gewartet, dass Therapeuten endlich bei ihnen anklopften. Das Gegenteil ist oft der Fall: Je mehr in einer polarisierten Situation die eine Seite auf eine Therapie drängt, umso wahrscheinlicher ist es, dass die andere darin nur Nachteile sieht.
Es gehört zu den heikelsten und anspruchvollsten Aufgaben der systemischen Therapie, den in ein Leidensproblem verstrickten Menschen ein allseits anschlussfähiges Erklärungs- und Veränderungsmodell (eine therapeutische Problembeschreibung als verbindender Verstehensrahmen) anzubieten.
Der Friedensnobelpreisträger 2008, Martti Ahtisaari, beschrieb seine Taktik des Friedenstiftens scheinbar einfach: »Zuhören, zuhören, zuhören«. Seine Fähigkeit, aus dem Gehörten die richtigen Schlüsse zu ziehen und für beide Seiten den richtigen Faden zu finden und weiterzuspinnen, zeichneten ihn aus (Gamillscheg 2008, S. 5). Professionelle Streitschlichter, Friedensstifter und Vermittler verfügen über ein umfangreiches Repertoire an Mitteln und Strategien, um zwischenmenschliche Polarisierung, Eskalationen und fundamentalistische Erstarrungen zu überwinden. Anders als in unserer aggressiven Gesellschaft zeichnen sich friedfertige Kulturen dadurch aus, dass sie diesen Berufssparten hohes gesellschaftliches Ansehen zugestehen. In gewissen Stämmen Neuguineas wurden jene Leute, die Frieden zu stiften wussten, als »große Männer« hoch geachtet. Im Volk der Ladakh, wo lange Zeit kaum Kriminalität herrschte und wo die Menschen untereinander einen betont liebevollen Umgang pflegten, genießt Schlichten und Vermitteln ein hohes Prestige und großen Respekt (Pirie 2005).