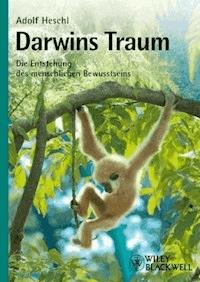
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Nach seinem erfolgreichen Werk "Das intelligente Genom" befasst sich Adolf Heschl in seinem neuen Buch mit der Entstehung des Bewusstseins während der Evolutionsgeschichte. Unterhaltsam und leicht zugänglich geschrieben wartet der Autor nicht nur mit neuen Erkenntnissen aus der Primatenforschung auf, sondern verbindet sie mit Einsichten aus der Verhaltensforschung, Psychologie und Molekularbiologie. Insbesondere die Bedeutung des Lebensraumes der Primaten sowie der Anpassung an verschiedene ökologische Nischen für die Entwicklung des Bewusstseins und unseres Sozialverhaltens werden erläutert und der Autor kommt zu überraschenden Schlussfolgerungen, die ein neues Licht auch auf Theorien der Psychologie, wie die Freudsche Bewusstseinstheorie, werfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1071
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Die zehn Gebote der Evolutionstheorie
Versuch einer Naturgeschichte der Intelligenz
Vom Greifen zum Begreifen
Die „Sprache“ der Affen
Der Ursprung von Traditionen
Affen als Techniker
Ein erster Griff nach der Logik
Kleine Menschenaffen ganz groß
Ich klettere, also bin ich
Ohne Spiel kein Bewusstsein
Nachahmung und Vorstellungsvermögen
Paradiesische Zustände
Im Spiegel der Evolution
Eine große Familie
Die Vertreibung aus dem Paradies
Davonlaufen ist zwecklos
Ohne sichere Vaterschaft keine fürsorglichen Väter
Vom Wesen her ein zweiter Gorilla
Kampf ums nackte Überleben
Aus Angst geboren
Darwin und Freud – Hand in Hand
Vom Egoismus zu Mitgefühl und Kooperation
Die einigende Kraft des Ritus
Was Sie schon immer über Sex wissen wollten
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
Vom Gejagten zum Beherrscher der Welt
Wozu überhaupt miteinander reden?
Das zwiespältige Gehirn
Triumph der Technik
Masse, Macht und Ohnmacht
Kausalität und der Zwang animistischen Denkens
Entmystifizierung der Natur
Anhang 1: Die angeborene Lust am Klettern (für Zweifler an der Evolutionstheorie)
Anhang 2: Eine kurze Geschichte der vergleichenden Verhaltensforschung
Anhang 3: In evolutionärer Hinsicht besonders interessante Populationen
Literatur
Internet
Bildnachweis
Stichwortverzeichnis
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
M. Ruse
Charles Darwin
2008
ISBN: 978-1-4051-4913-6 (broschiert)
ISBN: 978-1-4051-4912-9 (gebunden)
W. Schaumann
Charles Darwin – Leben und Werk
Würdigung eines großen Naturforschers und kritische Betrachtung seiner Lehre
2002
ISBN: 978-3-527-32123-0
Autor
Dr. Adolf Heschl
Institut für ZoologieUniversität GrazUniversitätsplatz 28010 GrazÖsterreich
Titelbild
Ein junger Weißhandgibbon (Hylobates lar) entdeckt während des Hangelns im Geäst seine Füße und bemerkt dabei, dass diese seinem Willen genau so gehorchen wie seine Hände. Damit entsteht eine neue Ebene an Selbstbewusstheit, die die Basis ist für räumliches Vorstellungsvermögen, echte Nachahmung, symbolische Kommunikation und Kausalverständnis.(Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Norbert Potensky, Tiergarten Schönbrunn, Wien; Besucherfoto).
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Umschlaggestaltung Adam-Design, WeinheimSatz TypoDesign Hecker, LeimenDruck betz-druck GmbH, DarmstadtBindung Litges & Dopf GmbH, Heppenheim
ISBN: 978-3-527-32433-0
Vorwort
„Es besteht kein Zweifel, dass der Unterschied zwischen dem Denken des niedrigsten Menschen und jenem des höchsten Tieres immens ist. Nichtsdestotrotz ist der geistige Unterschied zwischen dem Menschen und den höheren Tieren, so groß er auch sein mag, sicherlich ein gradueller und kein wesensmäßiger. Unzweifelhaft wäre es interessant, die Entwicklung jeder einzelnen Fähigkeit nachzuzeichnen, vom Zustand wie sie bei niederen Tieren existiert bis zu jenem wie sie beim Menschen existiert; aber weder meine Möglichkeiten noch mein Wissen erlauben mir diesen Versuch.“
Charles Darwin (1871)
Es war 1871, genau zwölf Jahre nach Erscheinen des berühmten Buches „Die Entstehung der Arten“ (1859), als Charles Darwin sein Spätwerk über „Die Abstammung des Menschen“ publizierte, in welchem er erstmals versuchte, eine etwas umfassendere Antwort zu geben auf die Frage nach der wahren biologischen Herkunft unserer Spezies. Während jedoch zu Zeiten von Darwin die Frage der Abstammung des Menschen von affenartigen Vorfahren noch eine grundsätzliche war und es dabei im Wesentlichen um die Unterschiede und Ähnlichkeiten in Körperbau (Anatomie) und Aussehen (Morphologie) ging, ergeben sich heute durch die inzwischen auf allen Gebieten der Biologie erzielten Fortschritte gleich eine ganze Reihe von überraschenden Antworten auf bislang ungelöste Problemstellungen der Evolution des menschlichen Bewusstseins. Es handelt sich im Folgenden aber nicht nur um eine fachlich geordnete Auflistung möglichst vieler Details aus möglichst vielen verschiedenen Forschungsrichtungen, sondern vielmehr um die Klärung der weit interessanteren Frage nach dem ursächlichen Zusammenhang zwischen den kaum mehr überschaubaren Daten aus Verhaltensforschung, Psychologie, Neurobiologie und molekularer Systematik. Bedingt durch die Komplexität einer Entwicklung, die mehrere Jahrmillionen umfasst, hinterlässt eine jede solche Darstellung notwendigerweise eine Menge von Lücken, aber es sind gerade die noch ungeklärten Leerstellen, die die Erforschung unserer Evolution so überaus spannend machen. Dieses immer noch vorhandene Nichtwissen in Bezug auf manche zentralen Übergänge in der Entwicklung der Primaten zeigt aber andererseits auch, dass die Evolution nicht immer graduell und kontinuierlich verläuft, sondern gelegentlich sehr turbulente Phasen durchmacht, sogenannte Punktuationen, wo in nur wenigen Jahrhunderttausenden unter Umständen tiefgreifende Umwälzungen stattfinden – oder eben auch ganze Artengruppen wie spurlos vom Erdboden verschwinden. Wie sich heute herausstellt, war es ein reiner Glücksfall, dass unsere Spezies noch existiert und nicht wie die meisten anderen Arten wieder vom Erdball verschwunden ist.
Graz, Oktober 2008
Adolf Heschl
Die zehn Gebote der Evolutionstheorie
Im Gegensatz zur Schöpfungslehre schreibt die Evolutionslehre nicht vor, wie etwas zu sein hat, sondern versucht einfach zu verstehen, wie überhaupt das Wunder des Lebens hat entstehen und dann so lange Zeit über fortbestehen können. Ihre zehn Gebote sind daher auch eher zehn immer wieder beobachtbare Gesetzmäßigkeiten, genannt „Naturgesetze“, und rühren nicht ganz zufällig daher, dass die Evolution eben nicht von einem allwissenden Schöpfer gemacht worden ist. Leben wusste vor seiner Existenz noch nicht, wie es auszusehen hatte. Dieses Wissen, niedergelegt als DNA-Molekül, entstand erst mit der Entstehung des Lebens selbst. Da vor vier Milliarden Jahren keinerlei Informationen über das Wie und Womit lebender Systeme vorhanden waren, mussten diese Informationen erst langsam erworben werden. Genau dasselbe gilt aber auch für die gesamte Evolution bisher. Ein jeder einzelne Schritt, den eine Spezies in Neuland hinein wagte, war ein nicht vorhersehbarer Schritt mit unsicherem Ausgang. Diese Situation eines grundsätzlichen Nichtwissens über das, was man am besten tun sollte, um sich neuartigen Umweltbedingungen anzupassen, ist genau jene Situation, vor der sich ein evolvierender Organismus immer wieder befindet. Aus der offensichtlichen Abwesenheit eines intelligent, d. h. vorausschauend agierenden Designers folgt auch schon die einfachste und doch allerwichtigste Grundregel der Evolution. Jede Änderung eines Organismus muss notwendigerweise vollkommen zufallsartig vonstatten gehen, da das zusätzliche Wissen, das gewonnen werden soll, genau aus diesem Grund noch nicht vorhanden sein kann (Heschl 1990). Wäre nämlich eine gerichtete, das heißt durch ein intelligentes Wesen angeleitete Änderung möglich, dann müsste dies grundsätzlich für alle weiteren Evolutionsschritte genauso gelten. Allwissenheit gekoppelt mit Unsterblichkeit wäre dann die unvermeidliche logische Konsequenz. Aus diesem Grund hätten beispielsweise Menschen rein theoretisch schon vor vier Milliarden Jahren, also kurz nach der Entstehung beziehungsweise „Erschaffung“ des Lebens, entstehen können. Da aber kein derartiger allwissender Gott zur Verfügung stand, musste die Evolution auf das einzige Verfahren zurückgreifen, das in Situationen der absoluten Unwissenheit die einzige Option auf Erfolg beinhaltet und das ist die zufallsartige Änderung der eigenen Struktur. So entstand das, was heute als genetische Mutation den zentralen Grundpfeiler der Evolution darstellt, die vollkommen ungerichtete Veränderung der Basensequenz des Erbmoleküls DNA. Ungerichtetheit ist so nichts anderes als die zwingende Konsequenz von Unwissenheit und diese die zwingende Konsequenz des Fehlens eines allwissenden Schöpfers.
Manche genetischen Mutationen, die durchschnittlich nur einmal pro einer Million Verdopplungen eines bestimmten DNA-Abschnitts auftreten, bringen gelegentlich eine entsprechende Veränderung des Aussehens und Verhaltens des betroffenen Tieres mit sich. An diesem Punkt setzt das zweite „Gebot“ der Evolutionstheorie ein und das ist die natürliche Auslese oder Selektion. Charles Darwin hat ihre Wirkung als Erster entdeckt und sie zum zweiten zentralen Grundpfeiler der heutigen Evolutionstheorie gemacht. Obwohl im technischen Fachjargon etwas bombastisch als „differentielle Reproduktion“ bezeichnet, ist ihr Wesen einfach zu verstehen: Jene Organismen, die sich langfristig am stärksten vermehren, setzen sich in der Evolution durch. Schlaue Gemüter aus der philosophischen Ecke haben an dieser Formulierung auch gleich eine nichtssagende Tautologie (altgriech.: „derselbe Sinn“) erkannt, die angeblich nichts erklärt, und in der Tat ist sie auch nicht viel mehr als eine einfache, rein zahlenmäßige Selbstverständlichkeit. Je mehr Nachwuchs ein bestimmter Organismus in die Welt zu setzen vermag und je mehr von diesem Nachwuchs sich wiederum selbst vermehrt, umso stärker wird das Wesen dieses Organismus in Form seiner Gene in der Population vertreten sein. Dieser Zusammenhang ist so einfach, dass er von jedermann verstanden werden kann, auch ohne viel Mathematik. Diffizile Berechnungen sind hier im Wesentlichen nur dazu da, um zu zeigen, dass oft schon sehr geringe Unterschiede in der Fortpflanzungsrate verschiedener Individuen langfristig trotzdem zu bedeutsamen Veränderungen führen können. Da Zeit in der Evolution im Übermaß vorhanden ist, wird sofort verständlich, wieso selbst kleinste Veränderungen sich unter günstigen Voraussetzungen zu nicht vorhersehbaren Umwälzungen wandeln können. Wichtig am Verständnis der natürlichen Selektion ist ihre vollkommene Unabhängigkeit von der spezifischen Art der Selektionsfaktoren, die eine Tierart beeinflussen. Es ist dabei vollkommen egal, ob ein Tier von Raubfeinden gefressen, von Parasiten geschwächt, vom Klima zermürbt, von Futterknappheit geplagt wird oder, positiv betrachtet, frei ist von allen Fressfeinden und Parasiten, bestens angepasst an das Klima, und darüber hinaus noch gesegnet mit permanentem Nahrungsüberfluss. Entscheidend ist allein der langfristige Fortpflanzungserfolg und dieser kann das Ergebnis von ganz unterschiedlichen Umwelteinflüssen sein. Das sogenannte „Überleben des Stärkeren“, wie der englische Ausdruck „survival of the fittest“ oft irreführend übersetzt wird (fit, engl.: „passend“), muss keineswegs mit dem Erfolg des physisch Stärkeren verknüpft sein, sondern kann ganz andere Ursachen haben. Was allein zählt in der Evolution, ist der rein zahlenmäßige Anteil bestimmter Individuen und deren Gene an der jeweils nächsten Generation, gänzlich unabhängig davon, wie dieser Anteil zustande gekommen sein mag, ob durch physische Stärke, Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, Anspruchslosigkeit in Bezug auf die Nahrung, Sparsamkeit im Umgang mit Ressourcen, Lernvermögen kombiniert mit technischer Intelligenz, soziale Verträglichkeit, oder was auch immer.
Auf der anderen Seite erklärt uns das Prinzip der natürlichen Auslese auf einfache Weise, wieso es keinen echten genetischen Altruismus geben kann. Unter einem solchen versteht man ein Verhalten, das anderen, nicht verwandten Individuen einen Vorteil auf Kosten des eigenen Fortpflanzungserfolgs verschafft. Ganz unabhängig von ethischen Debatten zu diesem Thema erklären hier einfache zahlenmäßige Serien das, was in einem solchen Fall unweigerlich passieren muss, nämlich das unausweichliche Aussterben der ein solches Verhalten praktizierenden Individuen und mit ihnen die Strategie des echten Altruismus. Echter Altruismus ist in diesem Sinne nichts anderes als der Vorsatz, so bald wie möglich auszusterben, und hat sich offensichtlich genau aus diesem Grund bis auf den heutigen Tag bei keiner Art durchsetzen können. Ganz im Gegenteil, egal ob eigennützig oder sozial, alles jemals registrierte Verhalten bei Tier und Mensch muss in irgendeiner Form zum Fortpflanzungserfolg beigetragen haben, ansonsten würden wir es heute nicht mehr beobachten können. Zumindest sollte es in jedem Fall keinen auch nur irgendwie wirksamen Nachteil in Bezug auf die eigene biologische Fitness besitzen.
Zufallsartig ungerichtete Mutation und natürliche Selektion sind die beiden theoretischen Grundpfeiler der Evolutionstheorie, ohne die die Entwicklung des Lebens, so wie es sich uns heute darstellt, nicht erklärt werden könnte. Daneben gibt es aber noch eine Reihe weiterer, speziellerer Gesetzmäßigkeiten, die für ein tieferes Verständnis der belebten Natur von Bedeutung sind. Und wieder ist es dabei ganz offensichtlich das Fehlen eines persönlichen Schöpfers, was die Art der feststellbaren Prinzipien erklärt. Da wäre zuerst das Prinzip des Gradualismus, das besagt, dass jegliches Verhalten, menschliches mit eingeschlossen, durch stufenweise Übergänge lückenlos von früheren Formen hergeleitet werden kann. Konsequent angewandt ist dieses Prinzip eines der stärksten zugunsten der Evolutionstheorie. Dabei ist es nichts anderes als die logische Konsequenz der Notwendigkeit lebender Systeme, neue Eigenschaften durch Zufallsänderungen ihres Erbgutes erwerben zu müssen. Da ungerichtete Veränderungen immer ein Risiko für ein lebendes System darstellen, wird das Ausmaß derselben möglichst klein ausfallen, um die ohnedies geringen Chancen auf Erfolg zu wahren. Je kleiner also eine Änderung, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass das davon betroffene Lebewesen weiterhin im Rennen bleibt. Auf der anderen Seite steigt durch die zunehmend komplexere Organisation des Genoms die Möglichkeit, schon durch kleine genetische Veränderungen vergleichsweise große Änderungen in Aussehen und Verhalten zu erreichen. Dies bewirkt, dass die Evolution, je länger sie andauert, immer kompliziertere Lebewesen entstehen lässt, ohne deswegen gegen das Zufallsprinzip zu verstoßen. Auf den Menschen angewandt wird uns dieser Zusammenhang in späteren Abschnitten noch zeigen, wie selbst hochkomplexe und scheinbar einzigartige menschliche Fähigkeiten ohne große Probleme auf einfachere tierische Vorstufen zurückgeführt werden können. Auch der Glaube an einen intelligenten Schöpfer ist davon nicht ausgenommen. Er stellt sich in evolutionärer Perspektive keinesfalls als Voraussetzung der Menschwerdung heraus, sondern ganz im Gegenteil als bloße Konsequenz der spezifischen Selektionsbedingungen während der Entstehung von menschenähnlichen Wesen. Gott hat also nicht den Menschen erschaffen, sondern der Mensch hat sich seine Götter geschaffen.
Eine weitere Konsequenz der Evolutionstheorie ist die nicht triviale Tatsache, dass ausnahmslos alle Lebensformen physisch miteinander verwandt sind und allein schon durch ihre Existenz anzeigen, dass sie – zumindest, solange sie nicht aus der Evolution ausscheiden – gleich gut angepasst sind. Dieser Umstand verbietet uns wiederum die Aufrechterhaltung eines Ausnahmestatus für unsere eigene Art, Homo sapiens, obwohl wir uns daran schon mehr als gewöhnt haben. Die enge Verwandtschaft mit allen anderen Geschöpfen dieser Erde zeigt sich unter anderem auch in einer teilweisen Rekapitulation unserer äonenlangen Stammesgeschichte in der Embryonalentwicklung, wo wir der Reihe nach unsere biologische Vergangenheit als einfacher Vielzeller, primitives Wirbeltier (Amphioxus), Fisch, Lurch, Reptil und schließlich Säuger und Affe wiederholen. Nicht dass diese Wiederholung eine absolut exakte wäre, aber sie zeigt uns heute noch Tag für Tag, woher wir stammen und wer unsere Vorfahren oder, besser gesagt, unsere eigentlichen Schöpfer waren.
Gesetz Nummer 6 hat eher rein zufällig mit Sexualität zu tun. Informationszuwachs ist die Quintessenz der Evolution, da mehr Wissen zugleich auch mehr Erfolg im täglichen Überlebenskampf bedeutet. Nun haben genetische Mutationen den großen Nachteil, dass man meist relativ lange auf sie warten muss und sie dazu noch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von Vorteil für das betroffene Lebewesen sind. Wie kann man also in einer kompetitiven Welt von annähernd gleich guten Konkurrenten doch ein klein wenig schneller zu überlebensnotwendigem Wissen kommen? Nicht ein allwissender Schöpfer, sondern die Schöpfung selbst hat sich zu diesem Zweck etwas Besonderes ausgedacht. Sie erfand durch eine Reihe von Mutationen die Sexualität, um sich damit weiteres Wissen in Form von bereits bewährten Mutationen von anderen Artgenossen zu holen. Diese Erfindung, ein wahrer Geniestreich der Evolution, beschleunigte die Entwicklung der Organismen gleich um einige Dimensionen, da es nun erstmals möglich wurde, Anpassungen, die in verschiedenen Merkmalsbereichen stattgefunden hatten, miteinander zu kombinieren. Sexualität wurde somit zum privilegierten Medium der Übertragung von Information. Sie ist aber zugleich als solches kein rätselhaftes Wunder der Natur und hat vor allem nichts, wie gelegentlich behauptet, mit der Neuschaffung von Leben zu tun. Ein Jungtier oder ein Kind ist zwar ein neues Individuum, aber es entsteht aus der Verschmelzung von zwei bereits im Prinzip seit der Entstehung des Lebens existierenden Keimzellen, von Eizelle und Samenzelle.
Was allerdings erstaunt, ist die Tatsache, dass die Evolution es fertig gebracht hat, zwei fremde Zellen miteinander verschmelzen zu lassen. Immerhin besitzen Zellen mit unterschiedlicher Herkunft in der Regel auch Genome (= Summe aller Gene) mit unterschiedlichen Basensequenzen. Dies könnte zu einem Konflikt zwischen beiden Genomen führen, wenn es nach erfolgter Befruchtung darum geht, in koordinierter Weise ein neues funktionierendes Individuum wie beispielsweise einen heranwachsenden menschlichen Embryo aufzubauen. In der Natur gibt es tatsächlich solche Konflikte, die letztlich die Fusion zweier Geschlechtszellen unmöglich machen können. In einem solchen Fall spricht man von der Existenz zweier getrennter Arten, was nichts anderes besagt, als dass zwei Individuen aus zwei verschiedenen Populationen nicht mehr fruchtbar miteinander gekreuzt werden können. Die Gesamtheit der biologischen Information unterscheidet sich dann bereits so stark, dass ein genetischer Austausch nicht mehr möglich ist. Eine derartige Barriere existiert zwischen allen sogenannten „guten“ Arten, wie beispielsweise auch zwischen Mensch und Schimpanse.
Die Entstehung einer neuen Art kann man sich in der Weise vorstellen, dass Teile der Gesamtpopulation einer Spezies im Laufe der Zeit immer unterschiedlicher werden, bis zuletzt eine Mischbarkeit nicht mehr gegeben ist. Dabei können klimatische oder geologische Prozesse diesen Artbildungsvorgang oft nicht unwesentlich beschleunigen. Wie schwierig die Entstehung einer neuen Art sein kann, zeigt der Fall unseres Haushundes. Obwohl nach neueren genetischen Untersuchungen wahrscheinlich schon seit mehr als 100 000 Jahren domestiziert (Vilà 1997), lässt er sich immer noch ohne größere Probleme mit seinem natürlichen Stammvater, dem Wolf, kreuzen. In der Tat ist es bis heute noch nicht gelungen, trotz der vielen gezüchteten Haustier- und Pflanzenrassen eine einzige neue Spezies zu erschaffen. Dies soll aber nicht heißen, dass es hierfür einen allwissenden Schöpfer geben muss, der weiß, wie so etwas gemacht wird, sondern führt uns vielmehr den eingeschränkten zeitlichen Horizont vor Augen, in dem wir agieren.
Als nächste Gesetzmäßigkeit der Evolution folgt der Umstand, dass die im Laufe von Jahrmillionen entstehenden Arten nicht das Ergebnis weiser Voraussicht eines bereits von Anbeginn existierenden allwissenden Schöpfers sind, sondern ganz im Gegenteil eine jede einzelne Spezies, egal ob Tier oder Pflanze, das beeindruckende Resultat einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit einer sich permanent verändernden Umwelt darstellt. Am Beispiel der Entstehung des Menschen, die ganz und gar nicht eine urplötzliche „Menschwerdung“ war, lässt sich dies anschaulich dokumentieren. Die besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten, die uns gegenüber anderen Tierarten auszeichnen, mussten gleichsam erst Schritt für Schritt mühsam erworben werden. So sind beispielsweise die meisten der kognitiven Fähigkeiten, auf die wir heute so stolz sind, erst langsam im Laufe von nicht weniger als 60 Millionen Jahren Primatenevolution entstanden. Wobei, wie wir später noch sehen werden, unsere zahlreichen Vorgängerarten eine ganze Reihe von unvorhersehbaren Umwegen gehen mussten, um letztlich zufälligerweise da zu landen, wo wir uns heute befinden.
Die Ökologie bestimmte also die Evolution unserer Vorfahren und sie tut dies auch heute noch mit dem bisherigen Endergebnis in unserer Erblinie, der Spezies Homo sapiens. Je länger eine Art dabei bestehen bleibt, umso mehr Informationen sammeln sich in der Regel in ihrem Genom an. Dies beschleunigt einerseits die Möglichkeiten der Evolution, da die Strukturen immer komplexer werden und damit auf ihnen aufgebaut werden kann, zugleich aber wird ihr dadurch auch immer stärker eine gewisse Richtung vorgegeben. So brauchte es ganze 2,5 Milliarden Jahre seit der Entstehung des Lebens vor ca. 4,5 Milliarden Jahren, um die erste vollständige Zelle mit Zellkern zu entwickeln, weitere 1,2 Milliarden Jahre, um die ersten Vielzeller zu entwickeln, 500 Millionen Jahre, um die ersten Wirbeltiere zu entwickeln, 200 Millionen Jahre, um die ersten primitiven Säugetiere zu entwickeln und schließlich „nur“ mehr ca. 60 Millionen Jahre, um aus einem Urprimat den Menschen zu entwickeln. Auf der anderen Seite bedeutet dies für uns, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit auf ewig weiterhin Lebewesen mit einem ganz bestimmten Zell- und Bauplantypus, nämlich dem eines höheren Säugers und Primaten, bleiben werden – oder eben irgendwann einmal aussterben. Nur in diesem Sinne ist die Evolution einer Art sehr wohl auch ein gerichteter oder vielmehr ein im Laufe der Zeit sich selbst eine Richtung gebender Prozess. Die Anhäufung von erfolgreichen Zufallsschritten führt so letztlich dazu, dass jedes Lebewesen seine eigene Geschichte im Sinne einer einzigartigen Historizität entwickelt, die zwar einerseits immer komplexere Phänomene möglich macht, aber gleichzeitig den Spielraum der Möglichkeiten durch die unweigerlich sich ergebenden evolutionären Constraints (engl.: „Zwänge“) der inneren Organisation, wie sie bestimmte Typen von Kreislauf, Skelett und Nervensystem nun einmal festlegen, auch immer stärker einschränkt (Riedl 1975).
Die Umwelt, an die sich Organismen im Laufe ihrer Evolution anpassen müssen, besteht aus vielen fremden und meist auch feindlichen Elementen, aber zumindest auch aus einem sehr vertrauten Faktor: dem Artgenossen. Das Sozialleben einer jeden Art scheint einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Evolution des Verhaltens zu haben. Insbesondere die Entwicklung von so außergewöhnlichen Fähigkeiten wie Einsicht und Intelligenz wird oft gerne auf die selektive Wirkung eines komplizierten Gruppenlebens zurückgeführt. Das Verhältnis zwischen natürlicher und innerartlicher, den Artgenossen betreffender Selektion erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als grundsätzlich asymmetrisch. Es ist in erster Linie die unbarmherzige Wirkung der natürlichen Selektion, die in Form von Klimaveränderungen und daraus resultierender Lebensraumumgestaltung neuartige Anpassungen erzwingt. Die innerartliche Konkurrenz durch den Artgenossen kann hingegen immer wieder durch genetische Austauschprozesse gemildert werden, da sich in der Regel eine jede Neuerung vergleichsweise schnell in der Population „herumspricht“ bzw. durch die sexuelle Fortpflanzung verbreitet. So erklärt sich das interessante Phänomen, dass viele der bedeutsamsten Bauplanänderungen, aber auch neuartige Verhaltenstypen oft zuerst bei Arten entstehen, die die meiste Zeit über als Einzelgänger verbringen. Erst nachdem sich ein neuartiger Typ von Lebewesen erfolgreich etabliert hat, kommt es dann in der Folge – wenn überhaupt – zur Bildung sozialer Formen. So gab es schon solitär (= einzeln) lebende Bienen lange vor der ersten Honigbiene, aber auch solitär oder höchstens paarweise lebende Arten am Anfang vieler Wirbeltierfamilien. Das, was uns heutigen Menschen so besonders am Herzen liegt und zugleich aber auch die größten Probleme verursacht, nämlich ein durch und durch kompliziertes Sozialleben, entstand erst ganz am Ende einer langen evolutionären Odyssee. Was uns aber schon zuvor und um vieles stärker als alles andere geprägt hat, das war ein höchst anspruchsvolles Leben im verwirrenden Geäst von Bäumen, was letzten Endes unsere Mentalität geprägt hat. Das bei vielen Primatenarten wichtig gewordene Zusammenleben mit Artgenossen hat natürlich auch seine Spuren in einer gesteigerten Intelligenz hinterlassen, aber dies erst immer nach dem Erwerb der dazu nötigen geistigen Grundlagen. So ist es nicht weiter erstaunlich, dass viele sozial lebende Primaten einen durchschnittlich etwas größeren Neokortex (= modernster Teil des Wirbeltiergehirns) besitzen als ihre nahen, aber solitär gebliebenen Verwandten (Dunbar 1998), denn zusätzlich zur Umwelt müssen diese sich auch noch mit ihrer Mitwelt auseinandersetzen. Genau aus diesem Grund hat auch die Honigbiene deutlich größere Pilzkörperchen und somit ein größeres modernes Insektenhirn als vergleichbare einzeln lebende Bienenarten (Strausfeld et al. 1998). Dabei kann sich eine jede heute lebende Bienenart ausgezeichnet nach dem Sonnenkompass orientieren und auch komplizierte Waben für den Nachwuchs herstellen, aber darüber mit Stockgenossen bei einem gemütlichen Schwänzeltanz „reden“, das wollen eben viele nicht. Das ist in etwa vergleichbar mit menschlichen Autisten, die als sogenannte Savants (franz.: „Gelehrte“) oft mit einer gesteigerten Wahrnehmungsfähigkeit und Logik (Baron-Cohen et al. 2007) ausgestattet sind und trotzdem wenig Bedürfnis verspüren, das was sie alles wissen oder entdeckt haben, an irgendjemanden weiterzugeben (Happé und Frith 2006; Mottron et al. 2006). Manche Bienen verzichten für ihr einzelgängerisches Leben sogar auf ein bisschen mehr an Gehirnmasse, weil es, und dies wiederum aus ökologischen Gründen, für ihr Überleben einfach nicht notwendig ist. Beim Menschen scheint dies nicht viel anders zu sein. So gibt es deutliche Hinweise, die das genaue Gegenteil der These vom besonders großen, da sozialen Gehirn nahelegen. Eine Reihe von Schädelfunden zeigen nämlich, dass seit ungefähr 30 000 Jahren das Hirnvolumen von Homo sapiens nicht, wie zu erwarten, zu- sondern ganz im Gegenteil kontinuierlich abgenommen hat (Frauen: 1416→1241 ccm, Männer: 1569→1436 ccm; Daten aus Martin 2004). Dieser Trend hat bis zum heutigen Tag angehalten und dies, obwohl wir zurzeit sicher nicht in einer Periode abnehmender sozialer Komplexität leben. Eine denkbare Interpretation wäre die, dass ein mit der zunehmenden gesellschaftlichen Organisation einhergehendes Spezialistentum die durchschnittliche Intelligenz hat sinken lassen, was auch die außergewöhnlich hohe Variabilität der gemessenen Werte erklären würde (Frauen: 1129→1510 ccm, Männer: 1246→1685 ccm; nach Schultz 1972).1
Bleiben zuletzt noch zwei miteinander sehr eng verbundene „Gebote“ oder Zusammenhänge, die die Evolution des Menschen gerade deshalb besser verständlich machen, weil sie diametral unserer alltäglichen Intuition entgegengesetzt sind. Die menschliche Sprache wird gemeinhin als jenes einzigartige Medium dargestellt, mithilfe dessen wir geistig miteinander kommunizieren können. Die Betrachtung der Evolution der Sprache zeigt jedoch, dass Sprache nichts mit einer Übertragung von Information zu tun hat, sondern vielmehr eine Form von Verhaltensabstimmung darstellt, die einen bestimmten Grad an Intelligenz und Selbstbewusstsein voraussetzt. Daraus folgt, dass auch Kultur nicht eine von der Biologie gänzlich unabhängige Tradition von rein geistigen Anschauungen, sondern ganz im Gegenteil direkter und unmittelbarer Ausdruck unserer genetischen Ausstattung ist. Woraus wiederum folgt, dass auch der überzeugteste Glaube an Gott nur als Konsequenz unserer vielschichtigen Biologie verstanden werden kann. Der interessierte gläubige Leser möge das Buch also nicht schon an dieser Stelle – trotz aller berechtigter Skepsis – beiseite legen.
____________________
1 Darüber hinaus gab es in der Geschichte immer wieder offen antiintellektuelle Strömungen, die dem Überleben intelligenter Menschen nicht sehr förderlich waren. Beispiele des 20. Jahrhunderts sind die NS-Diktatur Hitlerdeutschlands, wo das Motto galt „Der kommende Mensch wird nicht ein Mensch des Buches sein, er wird ein Mensch des Charakters sein“ (Joseph Goebbels, anlässlich der ersten von den Nazis verordneten Bücherverbrennungen) und die groß angelegte „Kulturrevolution“ von Mao Tse-tung, die als fortschrittliches Programm der „permanenten“ kulturellen Erneuerung 1966 begann und bis zu seinem Ende 1976 fast die gesamte Bildungsschicht eines Landes vernichtete.
Versuch einer Naturgeschichte der Intelligenz
Vom menschlichen Bewusstsein wird ganz allgemein immer noch angenommen, dass es von den Naturwissenschaften wohl nie restlos erforscht und somit kausal verstanden werden wird. Insbesondere die Befähigung zu einem ausgeprägten Selbstbewusstsein wird dabei als etwas weitgehend Mysteriöses behandelt, das oft noch als grundsätzlich unerklärlich gilt. Diese mysteriöse „Seele“ wird dem Menschen gleich nach der Geburt in einem eigenen Akt von Gott eingehaucht. So geschieht es nach gängiger christlicher Vorstellung, aber auch vielen anderen religiösen Anschauungen. Erst die selbstbewusste Seele belebt den Körper und macht ihn zu seinem Instrument, ein ganzes langes Leben lang. Am Ende desselben verlässt sie ihren Körper wieder, um vielleicht in einem anderen oder auch im selben, dann nur vorübergehend toten Körper wieder zu neuem Leben zu erwachen. Diese oder ähnliche Vorstellungen beherrschen unser Denken zu einem erstaunlich großem Ausmaß bis auf den heutigen Tag. Sie tun dies sogar oft noch trotz modernster Technik und Wissenschaft, die sich darüber vorsichtshalber gar nicht äußert. Wie aber ist diese Allmacht des Glaubens entstanden und, was uns hier in erster Linie interessiert, was kann die Darwinsche Evolutionstheorie schon zu einem derartig schwierigen Thema beisteuern?
Die Zeiten haben sich offensichtlich geändert. Das Wissen der modernen Biologie ist wie kein anderes dazu geeignet, uns Aufschluss zu geben über das, was bislang noch immer als ein Wunder der Natur beschrieben wird. Ein gesteigertes Selbstbewusstsein und davon abgeleitetes bewusstes Handeln ist nicht etwa ein überflüssiger Luxus, den wir Menschen uns leisten, um irgendwann einmal unsterblich zu werden, sondern hat ganz handfeste biologische Hintergründe. Weit davon entfernt, ein Mysterium darzustellen, das zu seiner Entstehung der Hilfe eines intelligenten Designers bedarf, sind die diversen Stufen tierischen und menschlichen Bewusstseins direkte Zeugen der Anpassung an unterschiedliche Lebensweisen in einem komplexen Lebensraum. Dieser komplexe Lebensraum war für viele Millionen Jahre der Wald (Abb. 1) und es ist uns heute zumindest in groben Zügen möglich, zu zeigen, welche unglaublichen Umwege die unzählbar vielen Seelen all unserer Vorfahren durchlaufen mussten, um dann in vollkommen ungeplanter Weise genau das zu werden, was wir heute sind, nämlich Affen mit einem besonders hohen Grad an Selbstbewusstsein. Darüber hinaus spiegelt die Entwicklung eines jeden neugeborenen Kindes in komprimierter Form die Abfolge der meisten Stadien seiner Vorfahren wider, was es uns erlaubt, im alltäglichen Leben nach Zeugen unserer Evolution Ausschau zu halten.
Abb. 1 Moderne Primaten entstanden vor ca. 60 Millionen Jahren im geschlossenen Kronendach riesiger tropischer Regenwälder. Will man sich darin von Ort zu Ort bewegen, so ist man mit dem Problem konfrontiert, die permanent auftretenden Strukturveränderungen zu berücksichtigen. Dies erklärt, wieso es nur wenigen größeren Tieren gelungen ist, diesen Lebensraum dauerhaft zu besiedeln. Insbesondere die Überwindung der Kluft zwischen den Baumkronen stellt eine beachtliche Herausforderung dar. Dies macht verständlich, wieso unsere nächsten Verwandten im Tierreich, die südostasiatischen Riesenbeutler (rechts unten: mit Jungtier), einen häutigen Gleitschirm entwickelt haben, während nur Primaten dasselbe Problem mithilfe von Greiffuß (rechts oben: große Zehe mit Nagel) und Greifhand meisterten, mit völlig unterschiedlichen Perspektiven für die Evolution von Intelligenz.
Bevor wir mit unserem Gang durch die lange Geschichte unserer Vorfahren beginnen, muss zuvor aber noch kurz geklärt werden, weswegen eine scheinbar so elitäre Eigenschaft wie Selbstbewusstsein eine derartig wichtige Rolle im Evolutionsgeschehen spielen kann. Dieser Zusammenhang ist relativ einfach erklärt. Bewusstsein entsteht da, wo sich ein Tier zu überlegen beginnt, welche von mehreren möglichen Optionen es auswählen soll, um erfolgreich zu sein. Das dabei eingesetzte Wissen um das eigene Verhalten ermöglicht einem solchen Wesen erst das, was man gemeinhin als freien Willen bezeichnet. Die biologische Funktion von Bewusstsein ist somit schnell verstanden: Je mehr bewusste Wahlmöglichkeiten einem Lebewesen zur Verfügung stehen, umso flexibler und damit intelligenter wird es handeln können. Eine solche Fähigkeit geht über reines Lernen weit hinaus, denn sein Verhalten aufgrund von Umwelteinflüssen ändern kann schon der primitivste Strudelwurm (z. B. Dugesia gonocephala; ∼10 mm, in klaren Bächen unter Steinen), Fadenwurm (z. B. Caenorhabditis elegans; ∼1 mm, massenhaft im Boden lebend) und auch jede Schnecke (z. B. Aplysia californica.; ∼30 cm, Meeresbewohner: Seehase)2, ohne deswegen schon gleich zu den intelligentesten Tieren gerechnet zu werden. Es ist also nicht allein entscheidend, dass etwas gelernt wird, sondern vielmehr auf welchem Niveau gelernt wird. Echte Intelligenz aber zahlt sich in einer Welt, wo oft schon die unscheinbarsten Vorteile in die evolutionäre Waagschale geworfen werden, in jedem Fall aus. Bewusstsein und Selbstbewusstsein werden somit zu ursächlichen Indikatoren von Erfolg im Darwinschen Überlebenskampf. Unsere eigene Verwandtschaft, die Gruppe der „Herrentiere“ oder Primaten, zeigt dies auch in ihrem irdischen Vorkommen. Man findet sie fast überall, wo es noch einigermaßen intakte Lebensräume gibt und wo, wenn wir vom dicht bepelzten Japanmakaken (Macaca fuscata) und den chinesischen Stumpfaffen (Rhinopithecus sp.), die auch schneebedeckte Gebirgswälder bewohnen, einmal absehen, nicht allzu tiefe Temperaturen herrschen. Und das immerhin in der durchaus respektablen Vielfalt von mindestens 234 bislang nachgewiesenen Arten (Rowe 1996).
Ein spezifischer Aspekt von Bewusstsein verdient gleich am Beginn besondere Beachtung. Es geht dabei um die Art der Sinnesmodalität, die sich am besten für die Entwicklung von Bewusstseinsprozessen eignet. Ein Vergleich unter den Wirbeltieren zeigt, dass hierbei ganz offensichtlich der visuelle Sinn eine vorherrschende Rolle spielt. An zweiter Stelle folgt das Hören und erst dann die sogenannten Nahsinne, also Riechen, Schmecken und Tasten. Die generelle Dominanz von Sehen und Hören ist noch relativ einfach zu erklären, denn im Gegensatz zu jenen uralten Sinnesorganen, die nur auf den möglichst direkten Kontakt mit materiellen Objekten (Geruch; Geschmack, Berührung) ansprechen, sind sie als Fernsinnesorgane in der Lage, schon auf größere Distanzen wichtige Informationen über die Umwelt einzusammeln. Man muss sich trotzdem fragen, wieso gerade die Augen für das bewusste Handeln eine derartig wichtige Rolle spielen und zwar weit mehr noch als die Ohren. Die Ursache ist offenbar in den unterschiedlichen Eigenschaften von Licht und Schall zu suchen. Ist Letzterer mit einer durchschnittlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit von 340 Metern in der Sekunde noch einigermaßen schnell in der Luft unterwegs, so vermittelt das Licht mit der unvorstellbar hohen Geschwindigkeit von 300 000 Kilometern pro Sekunde (= 7,5 Erdumrundungen pro Sekunde) den Eindruck eines instantanen Phänomens. Dies bedeutet nichts anderes, als dass ein Lichtpunkt für unsere irdischen Verhältnisse praktisch zur selben Zeit am Objekt wie auf unserer Netzhaut erscheint und somit einen außergewöhnlich hohen Realitätscharakter mit sich bringt. Auf unser sinnliches Erleben wirkt sich dieser Umstand so aus, dass weit mehr noch als bloß gehörte Objekte, Dinge, die wir sehen, als absolut real betrachtet werden. Dieser Eindruck ist so stark, dass man ihn, wenn überhaupt, dann nur mit großem geistigen Aufwand beziehungsweise mithilfe von psychogenen Drogen reduzieren kann. Die hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes bringt es auch mit sich, dass wir ein ziemlich exaktes strukturelles Abbild eines jeden Gegenstandes dieser Welt erhalten, da von jedem Punkt seiner Oberfläche immer zeitgleich die entsprechenden visuellen Reize in unsere Augen gelangen.
Beim Hören ist dieser Realitätscharakter schon ein deutlich geringerer, da das Medium Luft, das sich die Schallwellen zunutze machen, durch seine geringe Stabilität zu einer Reihe von Störungen führen kann. So ist es nichts Besonderes, dass viele Tiere, darunter auch wir Menschen, als erste Reaktion auf etwas Gehörtes sofort nach der Ursache des Geräusches oder Klanges Ausschau halten. Töne übermitteln zwar sehr wohl den Eindruck einer realen Welt von Objekten, aber die beinahe unaufhörlichen Bewegungen ihres Mediums in Form von unterschiedlich starken Luftströmungen, von der kaum spürbaren Brise bis hin zum tobenden Sturm, machen sie zu eher unzuverlässigen Reizen. Darüber hinaus können Schallwellen auch niemals ein punktgenaues strukturelles Abbild ihrer Quelle liefern, da meistens nur Teile eines Objektes für die Schallproduktion verantwortlich sind. So können wir beispielsweise aus der Stimmlage eines Mitmenschen dessen Körpergestalt nur erahnen. Wenn wir wirklich wissen wollen, wie eine Stimme tatsächlich „aussieht“, müssen wir wieder die Augen zu Hilfe nehmen.
Sehen hat aber nicht nur Vorteile, sondern ist auch mit bestimmten Nachteilen behaftet. Da die meisten Festkörper nicht durchscheinend sind, können wir nur wenig bis gar nichts über deren Innenleben erfahren, ohne sie zuvor in ihre Teile zu zerlegen. Darüber hinaus verstellen uns die meisten Objekte den direkten Blick auf die Welt um uns, sodass wir gezwungen sind, unsere Position zu verändern, wenn wir den Dingen auf den Grund gehen wollen. Im Gegensatz zu Licht werden Schallwellen auch relativ gut und meist wenig verändert von verschiedensten Oberflächen reflektiert, was es uns erlaubt, gleichsam um die Ecke zu hören. Diese spezifische Überlegenheit des Hörens über das Sehen wird dementsprechend häufig in Situationen mit optischen Hindernissen eingesetzt. Der überlegene Realitätscharakter des Sehens hat aber auch ohne Hindernisse seine Grenzen und zwar in dem Moment, wo wir die gewohnten irdischen Dimensionen verlassen. Wenn wir beispielsweise frühmorgens im Freien auf einen Sonnenaufgang warten, steht die Sonne oft schon über dem Horizont, ohne dass wir dessen gewahr werden. Licht braucht trotz seiner enormen Ausbreitungsgeschwindigkeit ungefähr acht Minuten, um von der Oberfläche der Sonne zur Erde zu gelangen (Entfernung: ca. 150 Millionen Kilometer). In dieser Zeit hat sich die Erde bereits so weit um ihre Achse weitergedreht, dass die reale Position der Sonne immerhin schon ganze vier Sonnendurchmesser weiter gewandert ist, als wir sie sehen, wenn nach acht Minuten die ersten Strahlen bei uns ankommen. Die Fehlinterpretation oder, technisch formuliert, „Missweisung“, die uns dabei passiert, beträgt ungefähr die Breite einer Faust bei ausgestreckter Hand (Berechnung des Winkels: 360° durch 24 h ergibt 15°/h scheinbare Bewegung der Sonne am Himmel, nach acht Minuten also 2°; H. Ganzberger, pers. Mitt.). Beim Sonnenuntergang ergibt das den genau umgekehrten Effekt. Wir sehen dann die untergehende Sonne noch immer, obwohl sie in Wahrheit schon längst hinter dem Horizont verschwunden ist. Als Trost mag helfen, dass das besondere Erlebnis in jedem Fall davon unberührt bleibt. Die Sonne erscheint uns trotzdem als überdimensionales, wenn auch kaum fassbares und doch sehr reales Phänomen. Ohne diesen ausgeprägten Realitätscharakter des Visuellen hätte es auch nie so etwas wie die moderne Raumfahrt gegeben. Seitdem Menschen in dunkler Nacht den Vollmond am Himmel haben leuchten sehen, waren sie immer schon überzeugt davon, dass da etwas sehr Reales über unserer kleinen irdischen Welt seine Bahn zieht, auch wenn die wahren Zusammenhänge zwischen den Bewegungen von Sonne, Mond und Sternen für die meisten unserer Vorfahren noch ein absolutes Rätsel waren. Die Gewissheit, dass man irgendwie doch zu jenem berühmten „Mann im Mond“ von Wilhelm Hauff (1802–1827) gelangen könnte, war von Anfang an da und wäre uns ohne das realitätsbetonende Zutun unserer Augen nie in den Sinn gekommen. Wie heißt es doch so treffend: „Ich habe es mit den eigenen Augen gesehen!“ Und das muss genügen, denn verhören kann man sich schon einmal, aber das, was man sehen kann, nahm man immer schon als gegeben an.
Die Dominanz des Visuellen in Bezug auf die Entwicklung von Intelligenz und Selbstbewusstsein zeigt sich auch in der entsprechenden Veränderung der dazugehörigen Gehirnareale im Laufe der Wirbeltierevolution. So zeigt sich, dass ein Großteil der Hirnvergrößerung bei Primaten und vielen anderen intelligenten Tieren (z. B. Raubtiere) in erster Linie auf eine Ausdehnung der visuellen Areale und der damit verbundenen assoziativen Zentren zurückgeführt werden kann (Kirk 2006). Sehen hat also im Laufe der Evolution durchaus auch zu einer Steigerung der „seherischen“ Qualitäten seiner Mitstreiter geführt und es ist gerade die Gruppe der Primaten, in der die biologische Bedeutung des Sehsinnes stärker als bei vielen anderen Tierfamilien deutlich gemacht werden kann. Dies auf möglichst einfache Weise „anschaulich“ zu machen, ist das Ziel der folgenden Kapitel.
____________________
2 An diesen Tieren, die eine überschaubare Zahl (∼20 000) von besonders großen Nervenzellen besitzen, wurden erstmals die molekularen Grundlagen des Gedächtnisses untersucht (Kandel 2006).
Vom Greifen zum Begreifen
Schon die Entstehung der ersten echten Affen aus sogenannten „Halbaffen“3 vor ca. 45 Millionen Jahren (Xing et al. 2007) beginnt mit einem Mysterium. Wie so oft in der Evolution fehlen gerade jene Zwischenstufen, die uns den Übergang von einem Organisationstypus zu einem anderen besser verständlich machen könnten. Dies beweist, dass bestimmte schwierige Übergänge in der Evolution der Arten durch eine Art Flaschenhals hindurch mussten. An solchen kritischen Stellen gelangte immer wieder die Variabilität der betroffenen Artengruppen an die Grenze ihrer Anpassungsmöglichkeiten. Solche Engstellen der Evolution werden durch die zunehmende innere Komplexität der Organismen verursacht, die nur innerhalb eines bestimmten Rahmens eine Diversifikation, also Aufspaltung in neue Arten erlaubt (Riedl 1975). So gab es in früheren Zeiten zahlreiche Spezies an Halbaffen, aber als es darum ging, gleichsam aus einem halben Affen einen ganzen Affen zu machen, da begannen die Schwierigkeiten. Faktum ist, dass wir in der Jetztzeit auf zwei ziemlich weit voneinander entfernten Kontinentalmassen echte Affen vorfinden. In Südamerika sind dies die Neuweltaffen, während Afrika und Asien von diversen Altweltaffen bewohnt wird. Das ist zwar nicht die gesamte belebbare Welt, aber zumindest ein recht großer Teil davon. Nur Madagaskar und Australien sind niemals von Affen besiedelt worden. Madagaskar konnte so seine spezielle Vielfalt an Halbaffen (Lemuren) entwickeln, während Australien anstatt Primaten einige seiner agileren Beuteltiere (z. B. Koalabär) auf die Bäume klettern ließ.
Die auffälligsten äußeren Merkmale, die wir schon beim ersten Blick als Unterschied zwischen Halbaffen und echten Affen erkennen können, sind das Fehlen einer feuchten Nase und eine gleichzeitige deutliche Verkürzung der Schnauzenlänge bei Letzteren. Noch einfacher beschrieben könnte man sagen, dass echte Affen die ersten Primaten mit einem richtigen „Gesicht“ sind. Dieses flache Gesicht ist es, das uns Menschen sofort anspricht und worin wir auch sogleich, ohne viel von Evolution zu wissen, eine Art von Seelenverwandtschaft verspüren. Die enge Beziehung zu den Affen liegt so auch für den zoologischen Laien auf der Hand und wird darüber hinaus durch die Gesamtheit der Anatomie in allen Details bestätigt. Keine Frage, Menschen und Affen gehören beide zusammen zur großen Gruppe der „eigentlichen Affen“ oder Anthropoidea. Innerhalb der Affen sind wir als Vertreter der Altweltaffen ausgewiesen, die dadurch charakterisiert sind, dass sie im Gegensatz zu den Neuweltaffen schmale Nasen besitzen und deswegen Catarrhini (griech.: „enge Nasen“) heißen. Dieses Merkmal entsteht durch besonders eng nebeneinander liegende Nasenlöcher, was – abgesehen vielleicht vom einfacheren Nasenputzen – ansonsten noch keinen irgendwie bekannten Anpassungsunterschied ausmacht. Bei den neuweltlichen oder Breitnasenaffen hingegen sitzen die Nasenlöcher relativ weit auseinander an den äußeren Ecken der Nase.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























