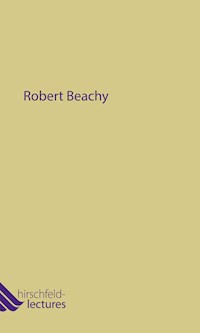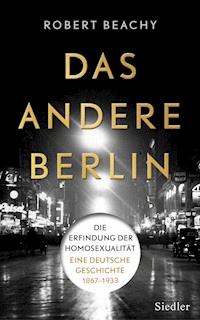
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwischen Repression und Freiheit: Die Geschichte der Homosexualität in Deutschland
Homosexualität ist eine deutsche Erfindung – zu dieser überraschenden Erkenntnis kommt Robert Beachy in seiner Geschichte der Homosexualität in Deutschland. In seinem Buch erzählt er von den Pionieren der Sexualwissenschaft, den Debatten um gesellschaftliche Anerkennung im Kaiserreich sowie vom schwulen Eldorado Berlins in der Weimarer Zeit und holt damit ein in Vergessenheit geratenes Kapitel deutscher Geschichte ans Tageslicht.
Welche einzigartigen Bedingungen im Deutschland des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts herrschten, die es zum Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der menschlichen Sexualität machten, zeigt der Historiker Robert Beachy anhand einer Fülle an Figuren und Episoden. Vor allem Berlin mit seinem berühmten Nachtleben entwickelte sich in dieser Zeit zum Magneten für eine lebendige, internationale schwule Szene und zog Künstler wie Christopher Isherwood und W.H. Auden an, die der Zeit in ihren Werken ein Denkmal setzten. Mit seiner Geschichte der Homosexualität in Deutschland verändert Robert Beachy das Bild von Kaiserzeit und Weimarer Republik und fügt unserem Verständnis dieser Epoche eine wichtige Facette hinzu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ROBERT BEACHY
Das andere Berlin
DIE ERFINDUNG DER HOMOSEXUALITÄT EINE DEUTSCHE GESCHICHTE 1867–1933
Aus dem Englischen von Hans Freundl und Thomas Pfeiffer
Siedler
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Gay Berlin. Birthplace of a Modern Identity« bei Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Random House, New York.
Erste AuflageJuni 2015
Copyright © 2014 by Robert BeachyCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Grafik: Peter Palm, Berlin
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Reproduktionen: Aigner, BerlinISBN 978-3-641-16574-1
www.siedler-verlag.de
Für Ada(1925–2005)
Inhalt
Einleitung
KAPITEL 1 Die deutsche Erfindung der Homosexualität
KAPITEL 2 Die polizeiliche Kontrolle der Homosexualität in Berlin
KAPITEL 3 Die erste Bewegung für die Rechte der Homosexuellen und die Suche nach Identität
KAPITEL 4 Die Eulenburg-Affäre und die Politik des Outings
KAPITEL 5 Hans Blüher, die Wandervogel-Bewegung und der Männerbund
KAPITEL 6 Sexualreform in der Weimarer Republik und das Institut für Sexualwissenschaft
KAPITEL 7 Sextourismus und männliche Prostitution im Berlin der Weimarer Zeit
KAPITEL 8 Die Weimarer Politik und der Kampf um die Strafrechtsreform
Epilog
Dank
ANHANG
Abkürzungen
Quellen und Literatur
Personenregister
Einleitung
»Schaut mich nur an!«, schmetterte die deutsche Kapitale, prahlerisch noch in der Verzweiflung. »Ich bin Babel, die Sünderin, das Ungeheuer unter den Städten. Sodom und Gomorra zusammen waren nicht halb so verderbt, nicht halb so elend wie ich! Nur hereinspaziert, meine Herrschaften, bei mir geht es hoch her, oder vielmehr, es geht alles drunter und drüber. Das Berliner Nachtleben, Junge-Junge, so was hat die Welt noch nicht gesehen! Früher einmal hatten wir eine Armee; jetzt haben wir Perversitäten! Laster noch und noch! Kolossale Auswahl!
KLAUS MANN, Der Wendepunkt, Berlin und Frankfurt am Main 1953, S. 133.
Im Oktober 1928 zog der 21 Jahre alte Wystan Hugh Auden nach Berlin, vorgeblich um Deutsch zu lernen. Im März des folgenden Jahres kam sein Freund Christopher Isherwood zu einem einwöchigen Besuch nach Berlin. Später zog auch Isherwood nach Berlin und wohnte dort bis Frühjahr 1933. Isherwoods Besuch, erklärte Auden später, veranlasste ihn, sein Berliner Tagebuch zu beginnen. Im allerersten Eintrag skizzierte Auden unter der Überschrift »Ein straffer Samstag« die Einführungsrunde, auf die er seinen Freund mitnahm. »Es beginnt mit dem Hirschfeld-Museum. Wir warteten in einem Salon aus dem 18. Jahrhundert mit älteren Damen und liebenswürdigen jungen Männern.« Das Hirschfeld-Museum gehörte zum berühmten, am nördlichen Rand des Tiergartens gelegenen Institut für Sexualwissenschaft, das der Pionier im Kampf für die Rechte von Homosexuellen, Dr. Magnus Hirschfeld, 1918 dort gegründet hatte. Neben dem Museum mit seinen sexuellen Artefakten und farbenprächtigen Darstellungen waren in dem Institut medizinische Untersuchungs- und Behandlungsräume, ein Vortragssaal, Büros, eine Bibliothek und Wohnungen für Mitarbeiter untergebracht. Das Institut zog nicht nur neugierige Touristen an, es diente auch als Treffpunkt für Berliner mit gewissen Neigungen. Dass es sich bei den »älteren Damen« im Salon nicht um Frauen, sondern um Männer in Frauenkleidung gehandelt hatte, ging Auden und Isherwood erst später auf.1
Von dem Institut aus begaben sich Auden und Isherwood zum Essen in ein Restaurant knapp südlich von Unter den Linden. Nach dem Essen machten sie sich auf zu Audens bevorzugtem Treffpunkt – dem Cosy Corner, einer vor allem für männliche Prostitution bekannten Bar. Um es nicht so weit zu seiner Lieblingsbar zu haben, hatte Auden sich einige Monate zuvor eigens eine Wohnung ganz in der Nähe genommen. Die südöstlich vom Cosy Corner gelegene Gegend um das Hallesche Tor war proletarisch geprägt und galt als hartes Pflaster. »Ich bin«, wie Auden in einem Brief ganz offen schrieb, »in einen Slum gezogen … fünfzig Meter von meinem Bordell.« In einem weiteren, kurz danach verfassten Brief berichtete er: »Ich verbringe den Großteil meiner Zeit mit jugendlichen Straftätern … Berlin ist der Tagtraum des Arschfickers.«2
Auch wenn nur wenige Zeitgenossen derart offenherzige schriftliche Zeugnisse wie Auden hinterlassen haben, kann kaum Zweifel daran bestehen, dass das Weimarer Berlin für viele erstmalige Besucher eine atemberaubende Offenbarung war. Nachdem sie die Stadt für sich selbst entdeckt hatten, wurden Auden und Isherwood zu Aposteln der ungehemmten Sexualität Berlins und lockten einen breit gefächerten Zirkel britischer Autoren, Poeten und Abenteurer in die deutsche Hauptstadt. In seinem eigenen autobiographischen Bericht über die Zeit schreibt Isherwood darüber, wie ihn die Offenheit Berlins nicht nur dazu ermutigte, seine eigene Homosexualität zu erkunden, sondern schlussendlich auch das zu akzeptieren und begrüßen, was er als seine sexuelle Orientierung und Identität zu sehen lernte. Über sich selbst in der dritten Person sprechend, beschrieb er die Offenbarung, die Berlin für ihn war: »Er war beschämt, weil, zu guter Letzt, er sich Aug in Aug seinem Stamme gegenübersah. Bisher hatte er sich so verhalten, als gäbe es diesen Stamm nicht und als sei die Homosexualität eine Lebensweise, die er und ein paar Freunde für sich selbst entdeckt hatten. Natürlich hatte er seit jeher gewusst, dass dies nicht stimmte. Doch nun sah er sich gezwungen, sich seine Verwandtschaft mit diesen monströsen Stammesmitgliedern einzugestehen.«3
Isherwood brachte seine Erinnerungen an dieses offenkundige »Coming-out« Jahrzehnte später zu Papier und dürfte darin seine Erlebnisse idealisiert haben. Audens Berliner Tagebuch dagegen bietet unmittelbare, zeitgenössische Einblicke und zeigt deutlich auf, wie Berlin die sexuelle Identität formte. In einem bemerkenswerten Eintrag vom 6. April 1929 beschreibt der aufstrebende Dichter einen scheinbar trivialen Vorfall. Auf dem Weg zum Bahnhof, wo er mit seinem aktuellen Geliebten Gerhart zu einem gemeinsamen Ausflug nach Hamburg verabredet war, hatte Auden in der Straßenbahn eine kurze Begegnung mit einer jungen Frau. Er beschreibt, wie sie Augenkontakt zu ihm aufnahm, sich ihm näherte und flirtete. »Sie kam und stand neben mir, bis ich ausstieg. Am liebsten hätte ich eine Verbeugung im Stil des 18. Jahrhunderts vor ihr gemacht und ›Entschuldigen Sie, Madame, aber ich bin schwul‹ gesagt.« Was für eine unglaubliche Replik das gewesen wäre! Statt Verachtung für seine Bewunderin zu empfinden oder sich amüsiert zu fühlen, war Auden überzeugt, dass ihr Annäherungsversuch auf einer Fehleinschätzung beruhte; sie hielt Auden für einen Mann, der sich von Frauen angezogen fühlt. Und obgleich Audens Deutschkenntnisse nach eigenem Bekunden niemals sonderlich gut waren, hatte er – zumindest im Kopf – eine angemessene Antwort formuliert, die seine deutsche Bewunderin verstanden hätte.
Bemerkenswert auch Audens Gebrauch des Ausdrucks »schwul«. Einem etymologischen Wörterbuch zufolge ist der Begriff eine Berliner Schöpfung; er geht auf das Wort »schwül« zurück und spielt mutmaßlich auf den Ausdruck »warme Brüder« an, der in der deutschen Umgangssprache Männer bezeichnet, die Männer lieben. Darüber hinaus wurde der Ausdruck mit Kriminalität assoziiert. In einer Schrift aus dem Jahr 1847 mit dem Titel Die Diebe in Berlin definierte ein vormaliger Berliner Polizeikommissar »Schwule« als Gauner »mit einer Vorliebe für gewisse Unsittlichkeiten«.4 Ungeachtet dieser herabsetzenden Assoziation wurde der Begriff von Homosexuellen, die sich selbst als solche identifizierten, adoptiert. In der dritten Ausgabe einer medizinischen Studie, die sich ausschließlich mit der Homosexualität befasste – und auf ethnographischen Forschungen in Berlin basierte –, behauptete der Psychiater Albert Moll 1899, dass die Angehörigen der homosexuellen Subkultur in Berlin (und zwar Männer wie Frauen) den Ausdruck »schwul« verwendeten, um sich selbst zu beschreiben.5 (Ende des 19. Jahrhunderts verlief durch einen Teil des Tiergartens, den Männer schon seit langem auf der Suche nach Sex frequentierten, ein schmaler Pfad mit dem Spitznamen »schwuler Weg«.6) Obwohl die schriftliche Quellenlage wenig ergiebig ist, hatte der Begriff in den Zwanzigerjahren unter jungen Berliner Homosexuellen eindeutig neutrale oder sogar positive Konnotationen, und sie bezeichneten sich selbst und gegenseitig gewohnheitsmäßig als »schwul«.7 Zugleich verlief in dieser Hinsicht offenbar eine Trennlinie zwischen den Generationen. Zumindest berichtet der Historiker Manfred Herzer in seiner Biographie des Sexualwissenschaftlers und Streiters für die Rechte von Homosexuellen Magnus Hirschfeld davon, dass Hirschfeld einen homosexuellen Jugendlichen dafür schalt, das Wort zu benutzen, obwohl es eindeutig dem Berliner Dialekt des Jugendlichen entstammte.8
Das im Berliner Sprachgebrauch entstandene »schwul« ist die beste deutsche Entsprechung für das englische »gay«. Hätte Auden eine ähnliche Situation in London erlebt, er hätte zu der Zeit auf kein passendes englisches Pendant zurückgreifen können. Sein Wortschatz umfasste 1928 englische Ausdrücke wie »queer« (sonderbar), »bugger« (Arschficker), »pederast« (Päderast), »sodomite« (Sodomit), »molly« (Weichling), »queen« und »fairy« (Schwuchtel, Tunte) oder »pansy« (Bubi). Manche davon wurden eindeutig zur Selbstidentifikation verwendet – immerhin bezeichnete Auden Berlin als den »buggers daydream«, den »Tagtraum des Arschfickers« –, aber sie waren auch herabsetzend. Ein paar Monate später, während eines kurzen Besuchs zu Hause, beendete Auden seine langjährige Beziehung mit einer Frau. »Niemals–Niemals–Niemals wieder«, notierte er in seinem Tagebuch.9 Audens Berliner Erweckung ist frappierend, und in den späten Zwanzigerjahren konnte er seine Sexualität selbst in holperigem Deutsch besser beschreiben, als ihm das auf Englisch je möglich war.
Die Erlebnisse, die Auden dabei halfen, seine dramatische Verwandlung zu vollziehen, sind natürlich bedeutsam, aber gleichermaßen von Interesse sind die Konturen der Terminologie, die sich zur Beschreibung der sexuellen Minderheit herausbildete, der er sich nun zugehörig fühlte. Ein zentrales Argument dieses Buches lautet, dass die Entstehung einer auf einer unverrückbaren sexuellen Orientierung basierenden Identität ursprünglich ein deutsches und insbesondere ein Berliner Phänomen war. Die Berliner Etymologie von »schwul« ist demnach umso signifikanter, als die Sprache uns dabei helfen kann, die Entstehung einer neuen Gruppenidentität zu kartieren.
Das Wort »schwul«war allerdings weder der erste noch der einzige deutsche Ausdruck, der moderne Konzepte sexueller Orientierung prägte. Auch der Begriff »Homosexualität« war eine deutsche Erfindung und tauchte zum ersten Mal 1869 in einem deutschsprachigen Pamphlet auf, das gegen das preußische Sodomiegesetz polemisierte.10 Der Begriff, ein sonderbares Amalgam aus Latein und Griechisch, setzte sich als dauerhafte Bezeichnung für gleichgeschlechtliche erotische Liebe durch, wobei seine exakte Definition Veränderungen unterworfen war. Während aufgeschlossene Ärzte und Schwulenrechtsaktivisten den Ausdruck auf eher neutrale Weise zur Benennung einer festgelegten sexuellen Orientierung verwendeten, deutete er für andere darauf hin, dass gleichgeschlechtliches Begehren durch Krankheit oder Degeneration verursacht werde.11
Ungeachtet der Behauptung eines deutschen Ursprungs des Begriffs hat es natürlich zu allen Zeiten und Orten Männer und Frauen gegeben, die die erotische Liebe zu ihrem eigenen Geschlecht praktizierten.12 So hat die schwule Geschichtsforschung ganze Netzwerke vormoderner Männer identifiziert, die Sex mit anderen Männern suchten. Im Florenz des 15. Jahrhunderts gab es eine eigene Polizei zur Überwachung der männlichen Prostitution in der Stadt.13 Im frühmodernen Spanien und Deutschland war Sodomie verboten und wurde schwer bestraft.14 Einige Historiker verorten die Ursprünge der modernen Homosexualität sogar im frühen 18. Jahrhundert, in dem, so ihre These, vormoderne gleichgeschlechtliche Subkulturen die Entstehung von Minderheitenidentitäten förderten, die sich von der »heterosexuellen« Mehrheit klar unterschieden. In den Jahrzehnten nach 1700 gab es in London spezielle Wirtshäuser oder »Molly Houses«, die ausschließlich von »Mollies« genannten Männern frequentiert wurden, die sexuelle Kontakte zu anderen Männern suchten.15 In den Niederlanden des 18. Jahrhunderts gab es ein vergleichbares Phänomen männlicher »Sodomiten«, die sich auf der Grundlage erotischer gleichgeschlechtlicher Neigungen in geheimen Netzwerken zusammenfanden.16 Und auch im Paris der Aufklärung fanden sich große Gruppen männlicher »Päderasten«, die sexuelle Kontakte zu anderen Männern pflegten und, so lässt sich annehmen, die Identität einer sexuellen Minderheit entwickelten.17 Diese Subkulturen in den Niederlanden, Frankreich und England sind in zeitgenössischen Druckwerken sowie in Polizei- und Gerichtsakten ausführlich dokumentiert worden; ob sie allerdings moderne sexuelle Identitäten beeinflussten oder gar konditionierten, bleibt eine noch zu beantwortende Frage.18
Gemeinhin werden die Ursprünge der modernen homosexuellen Identität im 19. Jahrhundert verortet. Seit 1976 der erste Band von Michel Foucaults Sexualität und Wahrheit erschien, vertreten viele Historiker die Ansicht, dass eine Binarität von Hetero- und Homosexualität sich erst nach der Prägung des Begriffs »Homosexualität« nach 1869 entwickelte, wodurch laut Foucault der Homosexuelle als eine neue »Spezies« eingeführt wurde. In manchen Interpretationen von Foucaults Arbeit wird der exakte Zeitpunkt betont, in welchem der »Homosexuelle« einen radikalen Bruch im westlichen Verständnis sexueller Abweichung bewirkte. Dieser Sichtweise zufolge war die Entstehung von ausschließlich auf gleichgeschlechtlicher erotischer Anziehung basierenden sozialen und kulturellen Identitäten vor dem 19. Jahrhundert praktisch unmöglich.19
Andere Sexualhistoriker unterstützen zwar Foucaults Periodisierung, stellen aber seine ausschließliche Fokussierung auf die Medikalisierung in Frage. In seiner Studie zu Schweden konstatierte Jens Rydström einen »Paradigmenwechsel«, mit dem eine Unterscheidung der Sodomie von der Bestialität (der Zoophilie) begann – bewirkt ohne den Einfluss der Psychiatrie – und mit dem das Wachstum einer städtischen gleichgeschlechtlich orientierten Subkultur in Stockholm ab den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts einherging.20 Dan Healeys Arbeiten zu Moskau und St. Petersburg dokumentieren eine Verschiebung in den gleichgeschlechtlichen Beziehungen um 1900 von einem Modell, bei dem erwachsene Männer Verkehr mit jüngeren männlichen und weiblichen Prostituierten pflegten, hin zu einer Subkultur von Männern, die ausschließlich Verkehr mit anderen Männern hatten.21 Neuere Studien über das viktorianische London und Paris belegen auch für diese Städte die Entstehung erotischer gleichgeschlechtlicher Subkulturen von Männern, die an festen Treffpunkten sexuelle und soziale Beziehungen zu anderen gleichgeschlechtlich orientierten Männern unterhielten.22 Dass sich diese Netzwerke im späten 19. Jahrhundert aus den »Molly Houses«, »Sodomiten« und »Päderasten« des 18. Jahrhunderts entwickelten, ist theoretisch zwar denkbar, allerdings gibt es kaum nachweisbare Kontinuitäten.
Ohne Zweifel erlaubte die mit der Urbanisierung Europas im 19. Jahrhundert einhergehende kosmopolitische Kultur und Anonymität die Entstehung von Gemeinschaften sexueller Minderheiten. Wenn wir allerdings von einer qualitativen Veränderung und nicht nur einem numerischen Wachstum ausgehen, müssen wir auch eine konzeptionelle Transformation der Art in Betracht ziehen, wie Foucault sie ansprach. Ein zentrales – wenn nicht das zentrale – Element, das die moderne Homosexualität charakterisiert, ist die Akzeptanz der erotischen gleichgeschlechtlichen Anziehung als einen grundlegenden Bestandteil der biologischen oder psychologischen Veranlagung des Individuums. Homosexualität wird demzufolge definiert und konstruiert im Rahmen der Debatte um den innewohnenden Charakter der sexuellen Identität, unabhängig davon, ob sie nun durch Geburt oder Erziehung bestimmt ist, durch Biologie oder Kultur, durch Genetik oder die Umwelt. Wie die Geschichte dieser Debatte weiter andeutet, ist die Vorstellung von einer (homo)sexuellen Persönlichkeit ein relativ neues Konzept.
In diesem Buch vertrete ich die Ansicht, dass sich die homosexuelle »Spezies« ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland durch die Zusammenarbeit von Berliner Medizinwissenschaftlern und sexuellen Minderheiten herausbildete. Dieser Zusammenfluss von biologischem Determinismus und subjektiven Bekundungen sexueller Persönlichkeit war darüber hinaus ein einzigartig deutsches Phänomen und liegt eindeutig den modernen Konzeptionen sexueller Orientierung zugrunde.
Foucault unterließ es jedoch, den deutschen Kontext seiner eigenen Beobachtungen in Betracht zu ziehen. Obgleich er den Begriff »Homosexualität« und die Arbeit des Berliner Psychiaters Carl Westphal hervorhob, identifizierte er an keiner Stelle die dem urbanen Kontext zugehörigen Quellen, die diesen Neologismus und die darauf bezogene Wissenschaft hervorbrachten, als spezifisch deutsch. Dieses offenkundige Versäumnis Foucaults erscheint umso eklatanter, wenn wir in Betracht ziehen, dass der Begriff Homosexualität nur einer aus einer ganzen Reihe von deutschen Ausdrücken ist, die erfunden wurden, um die erotische gleichgeschlechtliche Liebe als eine unveränderliche Kondition und soziale Identität zu beschreiben. Die Schöpfer dieser deutschsprachigen Terminologie waren Leute, die für Gesetzesreformen eintraten – Ärzte, die gleichgeschlechtliches erotisches Verhalten studierten, und ihre Subjekte –, alle daran beteiligt und darin vereint, eine Wissenschaft der Homosexualität zu entwickeln. Das von Foucault entworfene Bild von einem Reagenzglas, in dem Mediziner und Naturwissenschaftler neue sexuelle Identitäten zusammenbrauten, ist einseitig und irreführend.
Mein Anliegen ist es deshalb, die Erfindung des Homosexuellen zu historisieren und diese sexuelle Identität fest innerhalb des deutschen Milieus zu verorten, in dem sie auftauchte. In meiner Analyse führe ich vier breit gefasste Vektoren der deutschen Geschichte an: die Kriminalisierung des männlichen gleichgeschlechtlichen Erotismus und die Aufnahme des preußischen Sodomiegesetzes, Paragraph 143, nach 1871 als Paragraph 175 in das neue deutsche Strafgesetzbuch; die Forschungsmethodologien der forensischen und psychiatrischen Berufe im Deutschland des 19. Jahrhunderts; das öffentliche Engagement deutscher Bildungsbürger, die offen gegen den Paragraphen 175 protestierten; und zuletzt die relativ freie Presse. Sowohl das preußische Sodomiegesetz wie auch der darauf fußende Paragraph 175 des Kaiserreichs lösten öffentliche Bekenntnisse zur sexuellen Andersartigkeit (seitens selbstidentifizierter sexueller Minderheiten) aus und veranlassten deutsche Psychiater dazu, Theorien aufzustellen, denen zufolge die sexuelle Orientierung auf irgendeine Weise angeboren oder »festgeschrieben« sei.23 Wissenschaftler wie der oberste Berliner Medizinalrat Johann Ludwig Casper, der in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts die sexuellen »Abweichler« der Stadt untersuchte, gelangten zu dem Schluss, dass die gleichgeschlechtliche Liebe eine natürliche, angeborene Eigenschaft und nicht lediglich eine Perversion der »normalen« sexuellen Neigung war.
1908 enthielten die beiden maßgebenden und in hoher Auflage verbreiteten deutschsprachigen Enzyklopädien, Meyers und Brockhaus, welche die aufblühende deutsche Mittelschicht mit zuverlässigen, aktuellen Informationen versorgten, Einträge zum Stichwort »Homosexualität«. Wie der Artikel im Meyers erklärte, litten männliche und weiblich Homosexuelle unter einem »angeborenen und perversen Gefühl« und konnte man sie in allen gesellschaftlichen Klassen finden.24 Im Brockhaus enthielt der Eintrag »Homosexuell« einen Querverweis auf »conträre Sexualempfindung«.25 Beide Enzyklopädie-Einträge vertraten direkt oder indirekt die Auffassung, dass gleichgeschlechtlicher Erotismus ein zwar abweichendes, aber natürlich auftretendes Phänomen war, das einen kleinen Prozentsatz der allgemeinen Bevölkerung betraf. Ob neutral oder negativ besetzt, der Neologismus »Homosexualität« trug mit dazu bei, die gleichgeschlechtliche Liebe als einen unveränderlichen Zustand zu beschreiben, der nicht behandelbar oder heilbar war.
© Peter Palm, Berlin
Selbst wenn man den linguistischen Determinismus Foucaults ablehnt, ist es unverkennbar, dass der Begriff in Deutsch weitaus gebräuchlicher war als in irgendeiner anderen Sprache. Obwohl er um das Jahr 1900 herum in französischen, englischen und italienischen Übersetzungen auftauchte, wurde er in diesen Sprachen vergleichsweise wenig und sehr uneinheitlich verwendet. Dank der Pionierarbeit deutscher Sexologen war der Ausdruck in deutschen Texten sehr viel verbreiteter. Das Google-Books-Projekt, für das viele Millionen Bücher der weltweit führenden Forschungsbibliotheken digitalisiert wurden, bietet eine immense Datenbank für die Messung der linguistischen Verwendung von Begriffen. Basierend auf diesen Daten belegt die oben abgebildete Ngram-Grafik, dass der Ausdruck »Homosexualität« und abgeleitete Formen in der Zeit von 1870 bis 1930 in deutschen Texten sehr viel häufiger auftauchten als ihre Entsprechungen in französischen, englischen und italienischen Texten. Der angegebene Prozentsatz entspricht dabei dem Verhältnis der Publikationen, die einen dieser Begriffe enthalten, zu den gesamten in der Datenbank enthaltenen Publikationen der jeweiligen Sprache.
Da es sich bei dem Wort um eine deutsche Erfindung handelt, ist das wenig überraschend. Vor allem aber belegt die Grafik, wie in Berlin und Leipzig verlegte deutschsprachige Publikationen den Begriff unter Deutschsprachigen populär machten. Die Zuweisung neuer Begriffe und die Häufigkeit (beziehungsweise Seltenheit) ihrer Verwendung ist ohne Zweifel ein Indikator für die Verbreitung einer neu entstehenden Identität.
Wie andere deutsche Begriffe, die eine essentielle, gleichgeschlechtliche erotische Identität bezeichneten, bezog sich das Wort »homosexuell« auf gleichgeschlechtlich liebende Männer und Frauen. Aber in Deutschland war (nach 1871) nur die männliche Homosexualität kriminalisiert und das hatte entscheidenden Einfluss auf die Strafverfolgung, die Bewegung für Homosexuellenrechte und auch auf die entstehende Disziplin der Sexualwissenschaft. Gewiss hat sich die Geschichte gleichgeschlechtlich liebender Männer in Berlin mit der Berliner Lesben berührt und überschnitten. Jedoch unterscheidet sich die Geschichte homosexueller Männer und Frauen in vielen Aspekten. Dieses Buch konzentriert sich auf die Männer. Die Kultur lesbischer Frauen verdient eine gesonderte Darstellung. Eine solche bietet das exzellente englische Buch des Historikers Marti Lybeck Desiring Emancipation: New Women and Homosexuality in Germany, 1890–1933, das wenige Monate vor Das andere Berlin erschien.
Das erste Kapitel dieses Buches befasst sich mit dem Leben und Werdegang von Karl Heinrich Ulrichs (1825–1895), einem deutschen Aktivisten, der von manchen als der erste offene Homosexuelle bezeichnet wird. Anfang der Sechzigerjahre des 19. Jahrhunderts startete Ulrichs eine sehr öffentliche, zugleich aber sehr einsame Kampagne zur Aufhebung des preußischen Sodomiegesetzes. Im Laufe dieser Kampagne untersuchte und theoretisierte er in einer Serie veröffentlichter Druckschriften seine eigene sexuelle Verfassung und argumentierte, dass seine erotische Neigung zu Männern angeboren sei. Um seine Identität zu beschreiben, prägte Ulrichs den Ausdruck »Urning«und behauptete, dass Männer mit seinen sexuellen Instinkten die im Körper eines Mannes gefangene Seele einer Frau besäßen. Am Ende gelang es Ulrichs zwar nicht, eine Gesetzesreform zu bewirken, doch seine Kampagne erregte das Interesse von Richard von Krafft-Ebing, der die Erforschung der Sexualität (und Homosexualität) vorantrieb und die Sexualwissenschaft mitbegründete. Wiewohl schwierig, stand die Beziehung zwischen Ulrichs und Krafft-Ebing beispielhaft für den »Rückkoppelungsmechanismus«, der die »homosexuelle Straße« mit den medizinischen Professionen verband, ein Wechselspiel subjektiver Selbstbekenntnisse und medizinischer Studien, aus dem eine neue sexuelle Identität hervorging.26
In Kapitel zwei geht es um die homosexuellen Subkulturen im damaligen Berlin und ihre Beziehung zur Polizei. Unter der Führung eines innovativen Kriminalinspektors verfiel das Dezernat für Homosexuelle und Erpresser, eine besondere Dienststelle der Berliner Polizei, auf kreative Methoden zur Durchsetzung des Paragraphen 175. Da darin nur konkrete sexuelle Handlungen und nicht homosexuelle Verbindungen als solche unter Strafe gestellt wurden, überwachte, kontrollierte und schlussendlich tolerierte die Polizei in Berlin einschlägige Lokale und Veranstaltungen. Zugleich jedoch eröffnete das Sodomiegesetz die Möglichkeit für sexuelle Erpressung, und so nahm die Polizei männliche Prostituierte ins Visier und versuchte zunehmend, die Opfer der Erpresser zu unterstützen. Gleiche, wenn nicht noch größere Bedeutung kam der relativ toleranten Handhabung des Paragraphen 175 darin zu, wie sie eine zuvor schattenhafte und unbestimmte Gruppe sexueller Minderheiten sichtbar machte und definierte. Indem die Berliner Polizei den gleichgeschlechtlichen erotischen Umgang tolerierte, ermöglichte sie es homosexuellen Männern und Frauen, zusammenzukommen und eine Gemeinschaft zu bilden. Das wiederum erleichterte Medizinwissenschaftlern, Literaten und Journalisten den Zugang zu dieser Gemeinschaft, deren sich entfaltende Identität sie beschrieben und verbreiteten. Mit anderen Worten, das Verhalten der Berliner Polizei spielte eine entscheidende Rolle für die Entstehung der homosexuellen Szene und Identität, für die das Vorkriegsberlin bekannt wurde.
In Kapitel drei wird die Gründung der weltweit ersten Organisation für die Rechte von Homosexuellen untersucht, des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) in Berlin. Unter Leitung des bahnbrechenden Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld vereinte das WhK innovative Methoden zum Studium der menschlichen Sexualität mit einem aktiven Eintreten für eine Gesetzesreform. Durch die Veröffentlichung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse – sowie allgemeinverständlicher Literatur zur Homosexualität – hoffte die Organisation, die deutsche Öffentlichkeit zu informieren und aufzuklären. Aktivitäten, durch die langfristig viele der von dem WhK vertretenen Theorien zur Homosexualität und sexuellen Orientierung populär wurden.
Kapitel vier befasst sich mit der Rolle eines 1907 beginnenden großen Sexskandals, in dessen Folge der Hof von Kaiser Wilhelm II. in den Verdacht der »Perversion« geriet. Wie sich nach und nach herausstellte, waren einige der engsten Freunde und Berater des Kaisers homosexuell oder bisexuell. Das hatte man in Kreisen politischer Beobachter seit langem gewusst oder zumindest vermutet, wurde dann aber von dem einflussreichen Enthüllungsjournalisten Maximilian Harden ausgenutzt, der gezielt politische Entscheidungsträger ins Visier nahm. In den ausufernden Verleumdungs- und Meineidsprozessen, die auf Hardens Anschuldigungen folgten, sagten Magnus Hirschfeld und andere prominente Sexualwissenschaftler als Experten für Homosexualität aus. Obwohl der Skandal eine massive und – zumindest für Homosexuellenaktivisten – destruktive Gegenreaktion auslöste, sorgte er doch dafür, dass das Wort Homosexualität zumindest in Deutschland zu einem geläufigen Begriff wurde.
Gegenstand von Kapitel fünf ist, wie konkurrierende Paradigmen des Erotismus zwischen Männern vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg popularisiert wurden. Inspiriert von so genannten »maskulinistischen« Dissidenten von Hirschfelds WhK, entwarf Hans Blüher die deutschnationalistische und antisemitische Theorie des homoerotischen Männerbundes, die in Teilen auf seinen eigenen Erfahrungen als Heranwachsender in der sich entfaltenden Berliner Jugendbewegung basierte. In den Zwanzigerjahren entwickelte sich Blühers Männerbund-Konzept weiter zu einer allumfassenden populärsoziologischen Theorie und Trope zur Erklärung der rein männlichen Geselligkeit, die neben Vereinen und Verbindungen Heranwachsender und Erwachsener auch politische Parteien und Milizgruppen umfasste. Für manche Antisemiten und Nationalisten bot Blühers Männerbund-Konzept eine rechtsgerichtete Alternative zu Hirschfelds Erklärung der Homosexualität, die als »verweichlicht« und »jüdisch« galt.
Im Zentrum von Kapitel sechs stehen die Gründung von Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft im Jahr 1918 und dessen Aktivitäten. Als erste Einrichtung seiner Art führte das Institut die vor dem Krieg vom WhK betriebene sexualwissenschaftliche Forschung fort und weitete zugleich das Wirkungsfeld dieser Organisation über das Engagement für gesetzliche Reformen im Interesse von sexuellen Minderheiten hinaus aus auf Bildungsangebote zur »normalen« Sexualität einschließlich Ehe, Geburtenkontrolle und Abtreibung. Das Institut leistete auch Pionierarbeit zu Theorien der Transsexualität, wandte Hirschfelds »Anpassungstherapie« auf sexuelle Minderheiten an und führte mit die ersten chirurgischen Eingriffe zur Geschlechtsumwandlung überhaupt durch.
Kapitel sieben lotet die sexualisierte Kultur des Weimarer Berlin in den Zwanziger- und frühen Dreißigerjahren mit Blick auf die männliche Prostitution und den Sextourismus aus. Schon vor Ankunft des Auden-Isherwood-Zirkels Ende der Zwanziger eilte Berlin der Ruf für ein hedonistisches Nachtleben und eine exzessive Partykultur voraus. In der vergleichsweise offenen Homosexualität der deutschen Hauptstadt gedieh eine extensive homosexuelle Clubkultur, die sich in gleichgeschlechtlichen Bars, Unterhaltungen und anderen Formen der Geselligkeit austobte. Mit getragen wurde dieses Clubleben von einer breit aufgestellten Kulturszene, die nicht nur schwulen Themen gewidmete Filme, Bühnenstücke und Groschenliteratur sowie Dutzende von einschlägigen Zeitschriften umfasste, die ganz offen in Zeitungskiosken vertrieben wurden, sondern auch populäre Kulturschaffende, die der Weimarer Kultur mehr oder weniger diskret einen »queeren« Stempel aufdrückten. Zusammen mit der Männerprostitution förderte dieses Spektakel den Sextourismus und zog neben Abenteuerlustigen und Voyeuren auch Homosexuelle an, die hier ihre sexuellen Gelüste auslebten.
Das achte und letzte Kapitel konzentriert sich auf die politischen Strategien, Aktivitäten und internen Auseinandersetzungen der drei bedeutendsten Homosexuellenorganisationen in Berlin. Die älteste darunter, Hirschfelds WhK, setzte unter dem institutionellen Schirm des Instituts für Sexualwissenschaft seine Vorkriegsagenda der Gesetzesreform fort, wie zuvor schon im Verein mit der Sozialdemokratischen Partei. Unter der erratischen Führung von Adolf Brand verbündete sich die Gemeinschaft der Eigenen (GdE) anfangs mit dem WhK, driftete dann aber in Richtung Antisemitismus ab und verleumdete Hirschfeld als jüdischen Außenseiter, bevor sie sich schließlich von allen Bindungen lossagte. Der neu gegründete Bund für Menschenrecht (BfM), der schnell zur größten Homosexuellengruppierung aufstieg, steuerte einen zentristischen Kurs und flirtete hin und wieder mit den faschistischen Parteien der radikalen Rechten. 1930 hätten diese Gruppen zusammen um ein Haar das Sodomiegesetz zu Fall gebracht, doch die parlamentarische Krise, die 1933 schließlich zum Sturz der Weimarer Republik führte, verhinderte eine Reichstagsabstimmung, mit der das Gesetz eliminiert oder doch zumindest reformiert hätte werden können. Angefangen mit den Wahlerfolgen der NSDAP ab 1930 und schließlich Hitlers Ernennung zum Reichskanzler im Januar 1933 war das Schicksal der ersten Bewegung für die Rechte homosexueller Menschen und das der offenen, urbanen Kultur Berlins besiegelt.
1 New York Public Library, Berg Collection, W. H. Auden, »Berlin Journal«, Fol. 2r.
2 Carpenter, W. H. Auden, zitiert nach S. 90.
3 Isherwood, Christopher and His Kind, S. 16.
4 Zimmermann, Die Diebe in Berlin oder Darstellung ihres Entstehens, ihrer Organisation, ihrer Verbindungen, ihrer Taktik, ihrer Gewohnheiten und ihrer Sprache, Berlin 1847; Nachdruck 1987, S. 163; siehe auch Herzer, Die Geschichte des § 175 (1990), S. 30–41.
5 Moll, Die conträre Sexualempfindung, Berlin 1899, 3. Aufl., S. 526.
6 Hirschfeld, Homosexualität des Mannes und des Weibes, S. 698.
7 Mit die besten Belege stammen aus der homoerotischen Literatur der damaligen Zeit. Siehe Stefan Müller, Ach, nur ’n bisschen Liebe: Männliche Homosexualität in den Romanen deutschsprachiger Autoren in der Zwischenkriegszeit 1919 bis 1939, Würzburg 2011, S. 42f., 503f.
8 Herzer, Magnus Hirschfeld, S. 14.
9 New York Public Library, »Berlin Journal«, Fol. 8r.
10 Siehe Kertbeny, § 143 des preußischen Strafgesetzbuches und Das Gemeinschädliche des § 143. Kertbenys Autorschaft dieser Pamphlete wurde früher schon vermutet, aber erst 1905 definitiv bestätigt. Siehe Manfred Herzers biographische Einführung in Karl Maria Kertbeny, Schriften zur Homosexualitätsforschung, Berlin 2000, S. 7–61.
11 Ostwald, Rinnsteinsprache, S. 142.
12 Greenberg, The Construction of Homosexuality; Crompton, Homosexuality and Civilization; oder die Essays in Herdt (Hg.), Third Sex, Third Gender.
13 Rocke, Forbidden Friendships.
14 Berco, Sexual Hierarchies, Public Status; Puff, Sodomy in Reformation Germany and Switzerland 1400–1600.
15 Siehe Bray, Homosexuality in Renaissance England, S. 16f., 88–93; Norton, Mother Clap’s Molly House; Trumbach, »Modern Sodomy«, S. 77–106, und Sex and the Gender Revolution, S. 3–8, 53–59.
16 Van der Meer, »The Persecutions of Sodomites in Eighteenth-Century Amsterdam«, S. 263–310, 286; und L. J. Boon, »Those Damned Sodomites«, S. 237–248.
17 Rey, »Parisian Homosexuals Create a Lifestyle, 1700–1750« und »Police and Sodomy in Eighteenth-Century Paris«; sowie die Essays in Merrick und Ragan (Hg.), Homosexuality in Early Modern France.
18 Wie Valerie Traub argumentiert, hat die frühmoderne gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Frauen keine moderne lesbische Identität hervorgebracht, sondern vielmehr »die Bedingungen für das Aufkommen einer solchen Identität« demonstriert. Ähnlich könnte man vielleicht mit Blick auf die »Mollies« im London der Aufklärungszeit argumentieren. Zitiert nach Traub, »The Psychomorphology of the Clitoris«, S. 85.
19 Foucault, Sexualität und Wahrheit, Band 1, Der Wille zum Wissen, S. 58. Die Literatur zu dieser Frage ist voluminös und ich zitiere hier sehr zurückhaltend. Zur »konstruktivistischen« Position bezüglich der »Medikalisierung« der Homosexualität siehe Arnold Davidson, »Sex and the Emergence of Sexuality« und »How to Do the History of Psychoanalysis: A Reading of Freud’s Three Essays on the Theory of Sexuality«, Critical Inquiry 14 (1987), S. 252–277. Siehe auch die Essays in Jan Goldstein (Hg.), Foucault and the Writing of History, Oxford 1994. Eine nuancierte Interpreation von Foucaults These liefert David Halperin in »Forgetting Foucault«.
20 Rydström, Sinners and Citizens, S. 43–54, 320f.
21 Healey, Homosexual Desire in Revolutionary Russia.
22 Siehe Revenin, Homosexualité et prostitution masculines à Paris 1870–1918; Peniston, Pederasts and Others; Chauncey, Gay New York; Cook, London and the Culture of Homosexuality, 1885–1914; Cocks, Nameless Offences; sowie Abraham, Metropolitan Lovers.
23 Zur Geschichte des Paragraphen 175 siehe Weber, Der Trieb zum Erzählen; Mildenberger, »… in der Richtung der Homosexualität verdorben«: Psychiater, Kriminalpsychologen und Gerichtsmediziner über männliche Homosexualität 1850–1970; Sommer, Die Strafbarkeit der Homosexualität von der Kaiserzeit bis zum Nationalsozialismus; Frank, Die Strafbarkeit homosexueller Handlungen; Hutter, Die gesellschaftliche Kontrolle des homosexuellen Begehrens; Sievert, Das Anomale Bestrafen; und Gollner, Homosexualität.
24Meyers Großes Konversations-Lexikon, 16 Bde., Leipzig 1908, Bd. 9, S. 526.
25Brockhaus Konversations-Lexikon, 17 Bde., Leipzig 1908, Bd. 9, S. 315; Bd. 10, S. 599; Bd. 16, S. 127. Carl Westphal hatte in einer Fallstudie von 1869 den sperrigeren Ausdruck conträre Sexualempfindung geprägt, definiert als die »pathologische Umkehrung« der geschlechtlichen sexuellen Anziehung. Siehe Westphal, »Die conträre Sexualempfindung«.
26 Scott Spector, »The Wrath of the ›Countess Mervida‹«.
KAPITEL 1Die deutsche Erfindung der Homosexualität
Für uns Urninge ist somit lediglich unsere eigene Natur maßgebend, nicht die eure. Nach unserer eigenen Natur verlangen wir nun aber auch beurtheilt zu werden.
KARL HEINRICH ULRICHS, Vindex. Social-juristische Studien über mannmännliche Geschlechtsliebe, Leipzig 1864, S. 8.
An einem sonnigen Donnerstagmorgen Ende August 1867 näherte sich der deutsche Anwalt Karl Heinrich Ulrichs, vormals Beamter im Königreich Hannover, dem Odeon-Konzerthaus in München. In dem beeindruckenden neoklassischen Bauwerk tagte seit Wochenbeginn der deutsche Juristentag, um Fachvorträgen zu lauschen und aktuelle juristische Fragen zu debattieren. Die teilnehmenden Anwälte, Richter, Juristen und Rechtswissenschaftler kamen aus den 39 Staaten und freien Städten des ehemaligen Deutschen Bundes, einer losen Staatenvereinigung, die 1815 auf dem Wiener Kongress geschaffen worden war. Dieses beeindruckende Gremium von Ulrichs’ Kollegen bildete so etwas wie die juristische Elite des im Entstehen begriffenen Deutschen Reiches. Selbst jetzt, im Hochsommer, formell gekleidet, hatten sie sich zum ersten Mal 1860 zusammengefunden, um die gesetzlichen Grundlagen für ein vereintes Deutschland zu schaffen, und als ausgewiesene Nationalisten ging es ihnen darum, schon vor dem Entstehen eines Nationalstaats die deutsche Rechtseinheit zu fördern.27 Das politische Programm der Juristen sollte wichtige Folgen für den kommenden deutschen Staat haben, doch Ulrichs’ Auftritt im Odeon markierte eine ganz eigene Revolution. Ulrichs war erschienen, um vor seinen Standeskollegen ein Tabuthema anzusprechen, die gleichgeschlechtliche Liebe, und um seinen Protest gegen die diversen sie kriminalisierenden deutschen Sodomiegesetze zu bekunden.28
Am Tag zuvor hatte Ulrichs seinen 42. Geburtstag gefeiert, und nun hoffte er, eine Rede halten zu können, auf die er sich, so könnte man sagen, den Großteil seines Erwachsenenlebens vorbereitet hatte. Als Student an der Universität hatte er erkannt, dass er sich zu Männern hingezogen fühlte. Diese sexuelle Besonderheit und Gerüchte über eine intime Affäre hatten ihn gezwungen, von dem einzigen offiziellen Posten zurückzutreten, den er je innegehabt hatte, dem eines Gerichtsassessors im Königreich Hannover. Schließlich wagte er den enorm mutigen Schritt und offenbarte seinen engsten Verwandten sein Geheimnis. Aufgewachsen in einer sehr gläubigen pietistischen Familie, zu deren weiteren Kreis auch zahlreiche lutherische Geistliche gehörten, kämpfte Ulrichs viele Jahre emotional wie intellektuell darum, sich einen Reim auf seine scheinbar inakzeptablen Gefühle zu machen. Waren sie widernatürlich? Hatte er sie auf irgendeine Weise durch sein Verhalten selbst verschuldet? Mit großer Sorgfalt erkundete er seine Beweggründe und Sehnsüchte und studierte juristische sowie wissenschaftliche Schriften zu dem Thema. In der Tradition des großen protestantischen Reformators Martin Luther stellte Ulrichs die vorherrschenden Glaubenssätze in Frage und entwickelte eine Theorie seiner Eigenpersönlichkeit – definiert jedoch in sexueller, nicht in spiritueller Hinsicht –, wodurch er zu der Überzeugung gelangte, dass er der dominanten Autorität die Stirn bieten und gegen Jahrhunderte der Vorurteile ins Feld ziehen musste. Zu diesem Zweck gab er seit 1864 unter einem Pseudonym Broschüren heraus, in denen er argumentierte, dass sexuelle Abweichung eine Gabe der Natur sei und respektiert werden müsse.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!