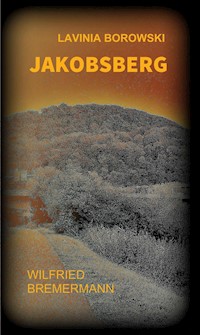3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Hommage an H. P. Lovecraft und seinen unübertroffenen Arkham-Zyklus (auch als Cthulhu-Mythos bekannt).
Das E-Book Das Arkham-Manuskript wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Lovecraft, Cthulhu, Arkham, Miskatonic-Universität, Peaslee, Wilmarth
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Wilfried Bremermann
Das Arkham-Manuskript
Thriller
www.tredition.de
© 2015 Wilfried Bremermann
Umschlag, Illustration: pswgraphics - Fotolia
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7323-6948-5(Paperback)
978-3-7323-6949-2(Hardcover)
978-3-7323-6950-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn
(Inschrift Gatambahöhle, Berge des Wahnsinns)
Das ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt.
Prolog
Die graue Sonne, die kraftlos vom Himmel strahlte in dem verzweifelten Bemühen, Wärme zu spenden, schien nur einen Zweck zu erfüllen: den einsamen Wanderer, der schlapp und lustlos durch die endlose Eiswüste stapfte, zu blenden und ihn langsam aber sicher in die Blindheit zu führen. Die Wärme ihrer Strahlen schien irgendwo in der Atmosphäre hängen zu bleiben, und einzig ihre stechende Helligkeit drang durch die eisige Luft, tausendfach reflektiert durch die unendlichen Eismassen, die sich bedrohlich vor dem Mann auftürmten und kein Ende zu nehmen schienen.
Das Eis war überall: links von ihm, rechts von ihm, vor, hinter und unter ihm. Eis, soweit das Auge reichte. Sogar in der Luft schien es zu schweben und ihn mit unzähligen winzigen Stichen in das dick vermummte Gesicht zu foltern und ihn allmählich in den Wahnsinn zu treiben. Dennoch schritt der Wanderer tapfer weiter.
Die Zivilisation lag weit hinter ihm, sowohl körperlich als auch in seiner Vorstellungskraft. Gab es wirklich eine andere Welt jenseits des Eises? Er hätte auf einem anderen Planeten sein können, seine Einsamkeit wäre nicht größer gewesen. Zwar gab es dreißig Meilen zurück eine Forschungsstation, eine Ansammlung von einem halben Dutzend wetterfesten Nissenhütten, die ein Dutzend rauer, vierschrötiger Wissenschaftler beherbergte und die für ein paar Tage auch sein Zuhause gewesen war. Von dort war er aufgebrochen und dorthin würde er zurückkehren, wenn er sein Ziel gefunden hatte. Aber dreißig Meilen waren in dieser Ödnis eine Reise zum Mond, verbunden mit der Gefahr, nicht wiederzukommen. So war es auch kein Wunder, dass niemand ihn hatte begleiten wollen, zumal sie sich über das Ziel seiner Reise lustig gemacht hatten. Sollten sie, er würde es ihnen schon zeigen. Allein hatte er sich schließlich auf den Weg gemacht, begleitet nur von einem Rudel hungriger, aggressiver Huskys, die seinen Schlitten zogen, die er aber nur mühsam unter Kontrolle hielt und die er genauso verfluchte wie die antarktische Eiswüste, deren Stürme und Schneeverwehungen ihm die Sicht nahmen und eine Orientierung nahezu unmöglich machten. Ohne Kompass und Sextanten, die ihm die Richtung vorgaben und in einer feindlichen, tödlichen Umgebung die einzige Sicherheit für ihn darstellten, hätte er sich längst hoffnungslos verirrt. Und Verirren bedeutete hier, wo jeder Quadratmeter gleich aussah und sich das Eis in alle Richtungen bis in die Unendlichkeit fortsetzte, den sicheren Tod.
Doch seine augenblickliche Situation war nur unwesentlich angenehmer als der Tod. Er wusste nicht, wie lange er schon marschierte, wie viele Stunden er schon unterwegs war. Das trostlose Eis nahm einem jedes Zeitgefühl, und seine Uhr steckte unter dem Ärmel seines dicken Parkas. Ohne den Schlitten anzuhalten, würde er die Uhr nicht betrachten können. Aber er wusste, dass jeder Schritt, den er tat, ein Schritt weiter in den Wahnsinn war, dass er kurz vor der Grenze stand, dem Punkt ohne Wiederkehr. Viel weiter würde er nicht vordringen können, ohne sein Leben oder das der Hunde zu gefährden. Eine halbe Stunde vielleicht noch, dann musste er aufgeben und wohl oder übel den Rückweg antreten. Daran wollte er aber lieber nicht denken, denn es hätte für ihn die totale Niederlage bedeutet, ein Umstand, der für ihn gleichbedeutend mit dem Tod war. Denn eine zweite Chance würde er nicht bekommen. Wenn er sein Ziel jetzt nicht fand, war es aus und vorbei. Es war schwierig genug gewesen, die Hunde zu bekommen. Sie waren zu wertvoll für die Station, unverzichtbar. Für eine weitere Sonderexpedition würden die Wissenschaftler sie nicht hergeben.
Heute oder nie.
Trostlos ging die Reise weiter und der point of no return näherte sich unaufhaltsam. Die Frustration ging allmählich in Verzweiflung über, und er begann sich zu fragen, ob all die Jahre der Forschung, des endlosen Studiums der Quellen und Dokumente und der an Hindernissen nicht armen Vorbereitung umsonst gewesen waren. Die Hunde schienen seine Verzweiflung zu spüren. Sie jaulten und ließen die Köpfe hängen, und dennoch rissen sie den Schlitten immer weiter vorwärts, als wüssten sie, dass es keine Alternative gab.
Dann war es genug. Die Eiswüste nahm kein Ende. Sie waren weit genug gegangen. Der Wanderer hielt den Schlitten an und ließ den Blick traurig in die Weite schweifen. Hier würde seine Reise also enden, ohne Ergebnis, unbefriedigend und mit der eindeutigen Gewissheit, dass sein Ruf in der Fachwelt nachhaltig leiden würde.
Gerade wollte er den Hunden das Kommando zur Umkehr geben, als seine Augen in der weißen Monotonie des Eises etwas Seltsames wahrnahmen, eine kleine Unregelmäßigkeit, die nicht hierher zu passen schien. Er stutzte und legte die Hände an die Augen, um einen schärferen Blick zu erzielen. Sein Herz begann schneller zu schlagen. Es war nur ein winziger dunkler Punkt, für das menschliche Auge kaum erkennbar, doch für ihn, der seit Stunden nichts als Eis gesehen hatte, ein Hoffnungsschimmer, etwas Greifbares, das seine Motivation noch einmal anstachelte. War es das? Hatte er sein Ziel am Ende doch noch gefunden?
Die Entdeckung der Unregelmäßigkeit beflügelte seine Kräfte, putschte ihn geradezu auf. Mit lautem Geschrei trieb er die Huskys an, die zu spüren schienen, dass etwas Entscheidendes geschah. Auch sie bewegten sich mit neu erworbener Kraft vorwärts, und je näher sie dem Ziel kamen, desto größer wurde ihre wie auch seine Aufregung. Er ignorierte den scharfen Wind und die wirbelnden Schneeverwehungen, trieb die Huskys vorwärts, immer weiter, immer schneller. Immer härter wurden seine Kommandos, während seine Ungeduld wuchs und die Hunde in seinen Augen immer noch zu langsam liefen.
Plötzlich heulten die Huskys auf und stoppten ihren Lauf. Mitten in der Bewegung blieben sie einfach stehen. Der Schlitten, auf den die physikalischen Beharrungskräfte noch immer wirkten, trieb noch einen halben Meter auf dem Eis weiter und zwang die Hunde noch ein Stück weiter nach vorne. Das Heulen und Jaulen wurde lauter und mit eingekniffenen Schwänzen begannen sie, an ihrem Geschirr zu zerren.
Verwundert blickte der Wanderer nach vorn. Immer noch waren sie etliche Hundert Yards vom Ziel entfernt, doch schien es, als hätten sie eine unsichtbare Grenze erreicht. Er wankte nach vorn, gegen den Wind und den aufgewirbelten Schnee ankämpfend, und versuchte, die Hunde zu beruhigen, doch erst, als er sie fünfzig Schritte zurückführte in die Richtung, aus der sie gekommen waren, beruhigten sie sich und er konnte es wagen, sie sich selbst zu überlassen. Mit mitgebrachten Holzpflöcken und Eisenstangen, die er so gut es ging in den gefrorenen Boden trieb, baute er einen provisorischen Pferch, an den er die Tiere band, und machte sich anschließend allein auf den Weg.
Während er seinem Ziel entgegenstapfte, achtete er darauf, seine Position zu halten und die gedachte Gerade zwischen Hundelager und Zielobjekt nicht aus den Augen zu verlieren. Je weiter er voranschritt, desto leiser wurden die Laute der Hunde, und schließlich waren sie ganz verklungen und er hörte nur noch das Heulen des Windes und das Schleifen der Eiskristalle auf dem gefrorenen Boden.
Obwohl er ging, so schnell er konnte, wurde das seltsame dunkle Objekt nicht größer, und es dauerte eine halbe Stunde, bis er seinem Ziel spürbar näher kam. Im Hintergrund erhob sich, durch das Flimmern des Schneegestöbers nur schwer erkennbar, das Gebirge, das seine Kollegen in Arkham die Berge des Wahnsinns nannten. Doch der Eindruck eines Gebirges blieb so schwach und undeutlich, dass er, wenn seine Karte nicht das Gegenteil behaupten würde, seine Existenz leugnen würde. Die Berge mussten über und über mit Eis bedeckt sein, die perfekte Tarnung in einer Umgebung, die aus nichts anderem als diesem bestand: Eis. Die Berge waren für das nackte Auge so unsichtbar wie eine in weißer Farbe gemalte Zeichnung auf weißem Untergrund.
Doch nicht die Berge, deren gezackte Reihen unheimlicher Ausläufer sich in der Ferne allmählich aufbauten, waren es, was ihn anhalten ließ und ihn in ehrfürchtiges, unheimliches Staunen versetzte. Es waren die beiden Objekte, die schwarz und drohend aus dem Eis ragten und plötzlich vor ihm auftauchten als hätten sie gewartet, bis er nah genug war, um das Fremde mit eigenen Augen zu sehen. Fremd und außerirdisch. Wächter in der bizarren tödlichen Landschaft der Antarktis. Sein Ziel. Also hatte er es doch noch geschafft.
In diesem Moment ließ das Schneegestöber ein wenig nach und gab den Blick auf die Oberfläche der Objekte frei. Schauder ergriffen den Wanderer, als er die Zeichen darauf entdeckte, Symbole, die so seltsam und fremd waren, dass es keinen Zweifel geben konnte: Sie waren nicht von dieser Welt.
Teil 1
ARKHAM
1
Carl Foster lehnte über seinem Schreibtisch und starrte auf das Manuskript, das auf der braunen Lederunterlage lag und an dem er seit fünf Monaten arbeitete, immer wieder unterbrochen von Vorlesungen und Vorträgen, Mitarbeitergesprächen und ungefähr einem halben Hundert anderen Dingen, die das Amt eines Universitätsdekans mit sich brachte. Und von unangenehmen Erlebnissen, die hinter ihm lagen und so schrecklicher Natur waren, dass er im Nachhinein gern auf seine Erfahrungen verzichtet hätte. Glücklicherweise gab es keinen Abgabetermin, denn da er noch nicht wusste, in welche Richtung sich sein Werk entwickeln würde, hatte er es auch noch keinem Fachmagazin angeboten. Er wusste nur, dass die Veröffentlichung wie eine Bombe einschlagen und gewaltige Auswirkungen nicht nur auf die Fachwelt, sondern auf das ganze Land, ja auf die gesamte Weltbevölkerung haben würde. Zu eindeutig waren die Vorzeichen. Foster wusste, dass die Miskatonic-Universität die Kapazität auf seinem Fachgebiet war und in dieser Hinsicht einen hervorragenden Ruf genoss. Man würde ihm also glauben. Doch welchen Preis würde die Welt dafür bezahlen?
Seine Augen begannen zu tränen und er spürte die aufkommende Müdigkeit. Ein Blick zur Uhr zeigte ihm, dass es bereits nach elf war, eine Tatsache, die der Vollmond mit seinem silbrigen Licht, das durch die offenen Vorhänge des kleinen Fensters fiel, nachdrücklich unterstrich. Foster zwang seinen Blick erneut auf das Manuskript, quälte sich in dem kräftezehrenden Bemühen, seine Gedanken zu sammeln und wenigstens noch einen Absatz zu schreiben, bevor seine Lider zu schwer wurden, lausige zehn Zeilen, achtzig Wörter, die den Text voranbrachten und ihn dem Ziel näher. Doch immer wieder glitten seine Gedanken ab und er ahnte, dass er in dieser Nacht keinen weiteren Satz mehr zustande bringen würde.
Er wusste, dass eine große Gefahr auf ihn, auf die Welt zukam, und es würde nicht mehr lange dauern, bis die Welt, so wie er sie kannte, aufhören würde zu existieren. Dieses Wissen – war es überhaupt Wissen? Oder war es nur ein beunruhigendes Gefühl, geboren in seinem Unterbewusstsein aus Mosaikstückchen, die er in den vergangenen Monaten zusammengesetzt hatte? Oder, schlimmer noch, Auswüchse beginnender Senilität? Doch stets, wenn er mit seinen Überlegungen an dieser Stelle angekommen war, sagte er sich, dass er möglicherweise der einzige Mensch auf der Welt war, der die Zeichen überhaupt erkennen würde, er, der Dekan der Geschichtsfakultät der Miskatonic-Universität. Wenn jemand Kompetenz in dieser Sache besaß, dann er.
Nein, das war nicht richtig, korrigierte er sich. Es gab noch jemanden, gar nicht mal weit weg von hier. Doch eine Kontaktaufnahme verbot sich. Solange er sich über die Rolle jenes anderen nicht im Klaren war, musste er davon ausgehen, dass er Teil der Gefahr war, die auf die Welt zukam. Dabei hatte alles so harmlos begonnen. Hätte er nur nie dieses Buch gekauft.
Es war nur ein schmales Bändchen, das abgegriffen und zerlesen noch immer auf dem Schreibtisch lag und ihn stets an die Gefahr erinnerte, die der Welt drohte, die Erzählung eines Seemanns aus den Zwanzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Doch die Geschichte dieses Mannes war der Auslöser für seine eigenen Studien. Als er zu recherchieren begann, hatte er noch nicht geahnt, was auf ihn zukommen würde, doch je weiter seine Recherchen vorangingen, desto deutlicher wurde das Gefühl einer subtilen Gefahr. Etwas war da, etwas, das ihn zu beobachten und zu überwachen schien. Etwas Fernes, nicht Greifbares, wie aus einer anderen Welt. Noch gab es keine sichtbaren Auswüchse in der realen Welt, aber Foster war sicher, dass es nur mehr eine Frage der Zeit war, bis das Unglück über die Welt hereinbrach, eine Katastrophe, so fremd und gewaltig, dass Dantes Inferno dagegen ein Kindergarten war.
Doch es gab eine Möglichkeit, die Apokalypse zu verhindern, und er kannte sie. Von einer plötzlichen Nervosität getrieben, ließ er den Stift fallen und sprang auf. Bis in die Kellergewölbe des alten Universitätsgemäuers brauchte er beinahe fünf Minuten und die Dunkelheit, die ihn umgab sowie das hohe Alter des Gebäudes, das aus dem späten neunzehnten Jahrhundert stammte und zwischenzeitlich nur einmal ausgebaut, aber nie renoviert worden war, zerrten an seinen Nerven und ließen in seinem Geist die schrecklichsten Dinge entstehen.
Sein Ziel lag in den äußersten Kellergewölben, am äußersten Rand der historischen Grundmauern. Sicher verwahrt hinter einer fünfzehn Zentimeter dicken Panzertür, gesichert durch ein Zahlenschloss, dessen Kombination nur er kannte, in einem Tresorraum, dessen Existenz nur dem engsten Mitarbeiterstab bekannt war, lag der größte Schatz, den die Universität besaß, das Vermächtnis eines Mannes, der zu Lebzeiten als verrückt gegolten hatte, dessen Werk jedoch der Menschheit in grauer Vorzeit das Überleben gesichert hatte. Foster war sicher, dass es das noch einmal tun würde und dass der Zeitpunkt kurz bevorstand.
Als er die Kombination eingestellt und die Tresortür geöffnet hatte, schlug ihm das Nichts entgegen. Er beruhigte seinen Atem, um sich an den geringen Luftdruck des Raumes zu gewöhnen. Der Tresor wurde technisch auf immer gleicher Temperatur und gleichem Luftdruck gehalten, notwendige Voraussetzungen, um den Gegenstand, den er beherbergte, vor dem Zerfall zu bewahren. Gleich nachdem Foster das Licht eingeschaltet hatte, fiel sein Blick auf das Objekt, das durch einen hermetisch abgeschlossenen Glaskasten in der Mitte des Raumes, in dem es sicher ruhte, zusätzlich geschützt wurde. Es war noch da. Es war alles in Ordnung. Augenblicklich kehrte Ruhe in seinen Geist ein und zufrieden löschte er das Licht und schloss den Raum wieder ab. Die Unruhe, die ihm wenige Augenblicke zuvor noch fast den Verstand geraubt hatte, kam ihm jetzt lächerlich vor. Doch andererseits, so beruhigte er sein Gewissen, hätte er ohne seinen Kontrollgang vermutlich eine schlaflose Nacht verbracht.
Foster begab sich zurück in sein Büro, langsamer und gemächlicher diesmal, ohne Hektik und ganz entspannt. Jetzt, als seine Unruhe abgeklungen war, spürte er die Müdigkeit und verwundert stellte er fest, dass alles, was er jetzt noch wollte, schlafen war, schlafen und Kräfte sammeln für den nächsten Tag, der genauso anstrengend und kräftezehrend werden würde wie die Tage zuvor. Obwohl er ein Haus in der Stadt besaß, hatte er sich im Büro ein Feldbett aufgestellt. So konnte er – was nicht selten vorkam – bis spät in die Nacht arbeiten und war doch am nächsten Morgen pünktlich wieder auf der Arbeit. Ermattet zog er den Vorhang zurück, hinter dem die Pritsche stand, zog sich aus und schlüpfte unter die dünne Decke. Eine Zeitlang zogen weitere düstere Gedanken durch seinen Kopf, doch allmählich wurden sein Geist träger und die Augen schwerer. Als seine Lider sich schließlich endgültig schlossen, war es eine halbe Stunde vor Mitternacht.
Der Schlaf dauerte genau eine halbe Stunde. Foster konnte nicht sagen, was ihn geweckt hatte, doch er war augenblicklich wach. Mit offenen Augen lauschte er in die Dunkelheit, achtete auf Geräusche, versuchte, im diffusen Licht des Mondes draußen vor dem Fenster Schatten zu erkennen. Nichts. Besorgt fragte er sich, ob er wirklich etwas gehört hatte oder ob er bereits unter Verfolgungswahn litt. Die Ereignisse der letzten Monate hatten ihn dünnhäutig gemacht und vorsichtig werden lassen, er konnte jetzt keine Möglichkeit mehr ausschließen. Doch nachdem er fünf Minuten gelauscht und nichts gehört hatte, war er bereit zu glauben, dass seine Fantasie ihm Streiche spielte. Müde schloss er die Augen und war im Nu erneut eingeschlafen.
Als er das nächste Mal aufwachte, war es kurz vor eins. Und dieses Mal war er sicher, etwas gehört zu haben. Wieder öffnete er die Augen und wieder lauschten seine Sinne in die Schwärze der Nacht. Ja, dieses Mal war es anders als eine Stunde zuvor. Foster spürte die aufkommende Angst, eine Furcht, die schon fast an Panik grenzte. Sein Körper begann zu zittern und auf seiner Haut bildete sich ein feiner Schweißfilm.
Und dann hörte er es. Ein leises Kratzen. Nein, berichtigte er sich, mehr ein Schleifen. Auf jeden Fall kein Traum, keine Fantasie. Nein, es war da. Hier und jetzt. Und es war nah.
Als Foster den dunklen Schatten vor der Pritsche auftauchen sah, war es bereits zu spät. Er spürte einen schmerzhaften Stich in seinem Hals, und im nächsten Moment begann ein höllisches Feuer seine Adern zu durchfluten. Sein Körper bäumte sich auf und begann unkontrolliert zu zucken. Foster fiel aus dem Bett, doch den Aufprall spürte er nicht, der rasende Schmerz in seinem Inneren überlagerte alle anderen Empfindungen.
In den nächsten Sekunden, die ihm allerdings vorkamen wie Stunden, gab es nichts anders als diesen Schmerz, der jede einzelne Faser seines Körpers erfasst hatte und ihn auf dem Boden herumwälzen ließ, ohne dass er das Geringste dagegen hätte unternehmen können. Er wusste nicht, wie lange der Zustand verlorener Kontrolle gedauert hatte, doch allmählich ließen die Zuckungen nach und auch der Schmerz verebbte nach und nach. Fast glaubte er, er hätte das Schlimmste überstanden. Als er sich aufrichten wollte, spürte er jedoch, dass seine Glieder ihm nicht gehorchten. Stattdessen breitete sich eine Lähmung über seinen gesamten Körper aus und schon nach wenigen Sekunden konnte er sich nicht mehr rühren. Sein Geist war jetzt wieder in der Lage, kontrolliert zu denken, doch die Gedanken, die er produzierte, trugen nicht dazu bei, sein Gemüt zu beruhigen. Der Stich fiel ihm ein. Und dann machte es Klick. Mit eiskalter Klarheit erkannte er, was geschehen war, was ihn außer Gefecht gesetzt und seinen Körper gelähmt hatte. Der Einstich – eine Injektion, ein Betäubungsmittel, um ihn wehrlos und gefügig zu machen. Wozu? Er wusste die Antwort. Und im selben Moment, in dem ihm die Erkenntnis kam, wusste er, dass es für ihn vorbei war. Es war geschehen. Das, was er immer geahnt und gefürchtet hatte, von dem er aber gehofft hatte, dass es nie eintreten würde – es war Realität geworden.
Dann ging das Licht an. Foster versuchte, seinen Kopf zu bewegen, um den Eindringling zu erkennen, doch alles, was sich noch bewegen ließ, waren die Augen, die freilich nur den Fußboden anstarren konnten. Plötzlich wurde er auf den Rücken gedreht. Er spürte hart zupackende Hände, also funktionierten seine Nerven noch; die Injektion hatte nur seine Muskeln außer Gefecht gesetzt.
In seinem Gesichtsfeld erschien eine Gestalt. Foster musste gegen die Deckenlampe blinzeln, sodass sein Sehvermögen stark eingeschränkt war. Doch was er sah, jagte ihm kalte Schauer über den Rücken. Es war ein Mann. Er trug einen schwarzen Anzug und eine schwarze Krawatte. Sein Alter ließ sich nicht bestimmen, er hätte genauso gut zwanzig wie fünfzig sein können. Auf seinen Wangen erkannte Foster tiefe Narben, die sich wie Furchen vom Jochbein bis zum Unterkiefer zogen, seltsam regelmäßig, als wären ihm vor Zeiten absichtlich schwere Verletzungen zugefügt worden. Sein Haar war extrem kurz und erinnerte Foster an militärischen Bürstenhaarschnitt, wie ihn Marines für gewöhnlich trugen. Das alles nahm Foster in sich auf und es war genug, um ihn einzuschüchtern und ihn sich bewusst werden zu lassen über die Aussichtslosigkeit seiner Lage. Das Unheimlichste aber kam erst noch.
Als der Mann zu sprechen begann, hörte Foster eine krächzende Fistelstimme, die an einen Eunuchen erinnerte. Aber es war weniger diese Stimme als vielmehr die Worte, leise, aber akzentuiert hervorgestoßen, die ihm eine Gänsehaut über den Körper trieben.
„Wo ist es?“
Foster wusste genau, worum es ging. Ein Gegenstand tauchte vor seinem geistigen Auge auf, ein Objekt, das er vor wenigen Stunden erst betrachtet und von dessen Sicherheit er sich überzeugt hatte, im Keller, in einem temperierten Tresorraum. Um nichts anderes konnte es dem Eindringling gehen. Nein! Dieser Gegenstand durfte ihm nicht in die Hände fallen, niemals, unter keinen Umständen!
Foster versuchte auszuweichen, das Unvermeidliche hinauszuzögern, doch er wusste instinktiv, dass seine Bemühungen nicht fruchten würden. Der Fremde sah nicht so aus, als würde er ohne Erfolg davongehen. Trotzdem, trotz der Gewissheit, dass ein furchtbares Schicksal auf ihn wartete, musste Foster den Versuch unternehmen. „Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.“
Er schauderte. Seine Stimme! War das wirklich seine Stimme gewesen, die da gerade gesprochen hatte? Kaum mehr als ein gehauchtes Flüstern, als besäße er keine Stimmbänder mehr. Also auch die Sprechmuskeln. Aber warum konnte er atmen, wenn alle seine Muskeln gelähmt waren? Die lebensnotwendigen Körperfunktionen funktionierten noch. Dafür musste es einen Grund geben. Doch darüber wollte Foster lieber nicht weiter nachdenken.
„Sie lügen!“ Der Eunuch zischte und sein Gesicht verzog sich zu einer hässlichen teuflischen Fratze. „Es gibt nur einen Ort auf der Welt, wo es aufbewahrt wird. Mein Herr weiß es, ich weiß es und Sie wissen es auch. Also, wo ist es?“
Er beugte sich drohend herab, sodass Foster das gefährliche Blitzen in seinen Augen sehen konnte. Nur am Rande registrierte er, dass der Fremde von seinem Herrn gesprochen hatte. Er handelte also nicht aus freien Stücken, sondern für einen Auftraggeber. Doch diese Erkenntnis war Foster beim Anblick des Gegenstandes in der Hand des anderen eher gleichgültig. Es spielte keine Rolle mehr. Er wusste, er würde sterben, so oder so.
Sein Blick fokussierte sich auf das Ding, das der andere in der Hand hielt und das er langsam in die Höhe hob und auf Foster zubewegte. Foster wusste, wie es funktionierte und er wusste, dass die Anwendung sehr, sehr schmerzhaft werden würde, qualvoll. Und tödlich. Dennoch, er durfte sein Geheimnis nicht preisgeben. Das Objekt konnte die Welt retten, aber in den falschen Händen würde es nicht retten, sondern zerstören.
Eine plötzliche Ruhe erfasste ihn. Der Tod war unausweichlich, das stand für ihn fest. Innerlich bereitete er sich auf die Schmerzen vor, die seinen Körper gleich martern würden. Er konzentrierte seine Gedanken auf eine Antwort, sammelte seine Kräfte und stieß mit krächzender Stimme hervor: „Ich wiederhole mich ungern, aber ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.“
„Gleich wirst du reden. Du wirst um Gnade winseln und mich anflehen, dich zu töten. Also, zum letzten Mal: Wo ist es?“ Die Augen des Fremden bekamen einen fanatischen Glanz, ein Flackern des Wahnsinns flammte in ihnen auf. Aus seinem Mundwinkel troff ein dünner Speichelfaden, als er weitersprach. „Ich werde es so oder so finden. Dein Leiden wird sinnlos sein, aber wenn du darauf bestehst …“
Der Eindringling zog Foster die Unterhose aus, das einzige Kleidungsstück, das er zum Schlafen anbehalten hatte. Und dann berührte das Instrument Fosters nackten Körper …
Als es vorüber war, hatte er keinen Körper mehr und der Tod war nur noch Sekunden entfernt. Seine Muskeln waren wieder bewegungsfähig, doch in trauriger Bitterkeit stellte er fest, dass ihm das nichts mehr nützen würde. Er bestand nur noch aus Schmerz, und der Tod würde eine willkommene Erlösung sein. Mühsam hob er den Kopf, um zu erkennen, was der Fremde angerichtet hatte. Dort, wo einmal sein Körper gewesen war, war nur mehr eine fleischige, rote Masse aus undefinierbarem Gewebe. Das Blut, das das gesamte Zimmer überzog, war sein eigenes, und die blutigen Schläuche, die neben dieser amorphen Masse sich über den Boden schlängelten wie tote Schlangen, waren seine Gedärme. Seine Augen erblickten den Wahnsinn, seine Nerven spürten den allumfassenden tödlichen Schmerz und sein Verstand sagte ihm, dass er die wenigen Augenblicke bis zum Eintreten des Todes in Ruhe und geistiger Sammlung verbringen sollte. Aber – es war noch etwas zu erledigen.
Während er sich unter irrsinnigen Schmerzen auf die Seite rollte, entdeckte er, dass der Eindringling verschwunden war. In einem letzten Aufflackern seines erlöschenden Geistes erkannte Foster, dass der Fremde das Objekt früher oder später in seinen Besitz bringen würde. Wenn er den Raub auch nicht mehr verhindern konnte, so musste er zumindest dafür sorgen, dass die Nachwelt Bescheid wusste.
Eine breite Blutspur hinter sich herziehend, wand er sich über den kalten Boden und erreichte nach einer Ewigkeit seinen Schreibtisch. Seine blutigen Finger krochen das Tischbein hinauf, erreichten die Kante, tasteten blind umher und fanden schließlich, was sie suchten. Kurze Zeit später lagen blutverschmierte Papierblätter und ein Stift vor ihm auf dem Boden.
Foster konzentrierte sich, versuchte, den Schmerz, den alles betäubenden Wahnsinn auszublenden, während er überlegte, was er schreiben sollte. Seine Kraft reichte nur noch für eine kurze Mitteilung. Als er sie geschrieben hatte, legte er sich erschöpft zurück und schloss die Augen, zum letzten Mal in seinem Leben. Seine Hand näherte sich seinem Mund.
Seinen richtigen Namen kannte er nicht. Sein Herr nannte ihn Ishmael. Er mochte diesen Namen, seinen schönen, geheimnisvollen Klang, die Fremdartigkeit, das Religiöse. Genauso wenig, wie er seinen Namen kannte, wusste er, wie alt er war und wo er herkam. Sein Herr hatte ihn als Säugling zu sich genommen und ihn an Sohnes Statt aufgezogen, und auch wenn er wie ein Vater zu ihm gewesen war, wagte Ishmael nicht, ihn so anzusprechen, für ihn war er nur sein Herr, der Meister. Und der Meister hatte ihm einen Auftrag erteilt.
Stolz hielt Ishmael den Gegenstand in den Händen, während er durch die nächtliche Stadt lief. Wie befohlen, hatte er ihn wasser- und blickdicht eingepackt. Er wusste, wie wertvoll er für den Meister war. Ishmael selbst hätte nichts damit anzufangen gewusst, aber da er für den Meister von so großer Bedeutung war, war er Ishmael heilig und er würde ihn mit seinem Leben verteidigen.
Ebenso wie der Professor. Nur kurz dachte Ishmael an ihn zurück, und es waren positive, anerkennende Gedanken. Trotz der wahnsinnigen Schmerzen war der Dekan bis zum Schluss standhaft geblieben. Eine ganze Stunde lang. So lange schafften es die wenigsten. Ishmael hätte die Qualen - wenn er gedurft hätte – auf Wochen ausdehnen können. Aber so viel Zeit hatte er diesmal nicht. Sein Meister wollte den Gegenstand noch in dieser Nacht. Die Zeit spielte eine große Rolle für ihn. Irgendwie hing es mit der Stellung der Sterne zusammen, aber davon verstand Ishmael nichts. Er verließ sich nur auf seinen Herrn, denn der Meister war klug, viel klüger als alle anderen.
Es war ein erhebendes Gefühl gewesen, als er mit seinen blutverschmierten Gummihandschuhen die dicke Tresortür geöffnet und das Ziel seiner Reise mit eigenen Augen erblickt hatte. Sorgfältig hatte er den Gegenstand verstaut und das Universitätsgelände verlassen, ohne einen weiteren Blick auf den Dekan zu verschwenden. Es war auch nicht nötig, Ishmael wusste mit tödlicher Sicherheit, dass er sterben würde. Und er selbst hatte keine Zeit.
Leichtfüßig glitt er durch die Straßen der dunklen Stadt, sicher, dass niemand ihn sah. Selbst wenn es Zeugen geben sollte … sein Meister hatte ihm gesagt, wie er seine Spuren zu verwischen hatte. Als er an das Ufer des träge dahinfließenden Miskatonic gelangte, legte er die wasserdichte Tasche mit dem eroberten Gegenstand sorgfältig auf den Boden, zog sich aus und warf die mit Blut besudelten Kleider – wie vom Meister aufgetragen – in den Fluss. Eine Weile sah er zu, wie der Anzug und die Wäsche im silbernen Licht des Mondes auf dem Wasser trieben und sich zusehends entfernten, dann griff er nach seiner Tasche und glitt mit geschmeidigen Bewegungen in den Fluss.
Das Wasser war kalt, doch das Adrenalin in seinem Körper ließ die Kälte von ihm abperlen wie Wasser von einem Lotusblatt. Der Fluss besaß nur eine schwache Strömung, sodass er ohne wesentliche Abdrift nach kurzer Zeit das andere Ufer erreichte. Er musste nicht lange suchen, bis er den abgestellten Wagen fand, ein zehn Jahre altes europäisches Modell, klein, unscheinbar, unauffällig. Es war alles vorbereitet.
Im Fahrzeug fand er Handtücher und trockene Kleidung. Zwei Minuten später war er trocken und angezogen. Mit ruhiger Hand startete er den Motor und fuhr los.
Zu dieser nächtlichen Stunde herrschte wenig Verkehr und im Nu hatte er Arkham hinter sich gelassen. Wie sein Auftrag es ihm befahl, fuhr er eine Stunde, in der er sechzig Meilen zurücklegte. Den Namen der Stadt, die er erreichte, wusste er nicht, er hatte das Ortsschild übersehen. Auch der Name des Motels, das er ansteuerte, spielte keine Rolle und wurde in seinem Gedächtnis nicht gespeichert. Wie befohlen, mietete er ein Zimmer, das er betrat, ohne sich großartig umzusehen. Die Tasche mit dem wertvollen Inhalt legte er sorgfältig auf das breite Bett, das Platz für zwei Personen bot, das aber in dieser Nacht einem anderen Zweck dienen würde. Dann holte er das Telefon hervor, das im Handschuhfach des Wagens gelegen hatte, und wählte die nur ihm bekannte Nummer. Am anderen Ende wurde sofort abgenommen und Ishmael vernahm die angenehme warme Stimme seines Herrn, die voller Güte und Liebe zu ihm sprach.
„Ishmael, mein Sohn, hast du es bekommen?“
Ishmael spürte die Aufgeregtheit in der Stimme seines Meisters. So viel hing ab von seiner Beute. „Ja, Meister. Es liegt hier auf meinem Bett.“
Der Meister atmete auf, Ishmael konnte es durch das Telefon hören.
„Gott sei Dank. Gut, wir haben nicht mehr viel Zeit. Der große Tag rückt näher und es müssen Vorbereitungen getroffen werden. Du wirst jetzt schlafen, Ishmael, und wenn es hell geworden ist, machst du dich auf den Weg. Du weißt, was zu tun ist.“
„Ja, Meister, ich werde tun, was du mir befohlen hast.“
Ishmael wollte das Gespräch beenden, da sprach sein Herr noch einmal zu ihm … und Ishmael wusste, dass er im Paradies war.
„Ishmael, ich bin sehr stolz auf dich.“
Mit Tränen in den Augen bereitete sich Ishmael auf die Nachtruhe vor. Es waren Tränen des Glücks. Endlich konnte er anfangen, seine Schuld zu begleichen und seinem Meister nützlich zu sein. Der Tag war nicht mehr fern, da die Welt sich verändern würde. Und er, Ishmael, würde dazu beigetragen haben.
2
Stöhnend und mit aufgekrempelten Ärmeln entstieg Alan Stewart dem alten Pontiac. Der heiße Wind spielte mit seiner Krawatte und riss sie ihm auf den Rücken, als wollte er ihn erwürgen. Dabei hatte der Wind, der Stewart an Wüstenwinde erinnerte, die die Haut und den Körper austrockneten und somit zu einer echten Lebensgefahr werden konnten, es gar nicht nötig, derart aufzutrumpfen. Das Thermometer zeigte dreißig Grad und die verdammte Klimaanlage funktionierte nicht. Sein eigenes Auto würde ihn also töten, wenn er nur lange genug darin blieb. Die kurze Fahrt von zu Hause bis hierher hatte ausgereicht, sein Hemd unter den Achseln und auf dem Rücken zu durchnässen und ihm den Schweiß auf die Stirn zu treiben. Derart mit sich selbst beschäftigt, bemerkte Stewart den Tumult erst, als er seine Jacke und die abgewetzte Aktentasche vom Rücksitz nahm.
Der Parkplatz stand voller Autos, was aber eigentlich die Regel war. Dozenten, Studenten, Verwaltungsangestellte – alle nutzten den kleinen Parkplatz, der im Laufe der Jahre viel zu klein geworden war, obwohl die Miskatonic-Universität zu den kleinsten des Landes gehörte und wahrhaftig nicht wegen Überfüllung geschlossen werden musste. An diesem Morgen jedoch war der Parkplatz nicht nur voll, er platzte geradezu aus allen Nähten. Und das lag nicht etwa an den Autos, wie Stewart langsam erkannte, sondern schlichtweg an den Fahrern, die seltsamerweise den Platz nicht verließen und stattdessen wie aufgescheuchte Hühner zwischen den Fahrzeugen hin und her wuselten.
„He, Alan!“
Stewart hob den Kopf und blinzelte gegen die Sonne. Aus Richtung Osten näherte sich eine Gestalt, die sich durch die wabernde Menge wühlte und wenige Zentimeter vor Stewart stehen blieb.
„Morgen, Freddy.“ Stewart wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn und betrachtete sein Gegenüber mit amüsiertem Gesichtsausdruck. „Was ist denn hier los? Warum sind alle Leute hier auf dem Parkplatz versammelt? Ist das ein Streik oder so?“
Freddy Miller, Dozent für englische Literatur und einer von Stewarts liebsten Kollegen, verzog das Gesicht und starrte Stewart ungläubig an. „Hast du es denn noch nicht gehört?“
Stewart grinste säuerlich. Ist wieder etwas an mir vorbeigegangen? Er wusste, dass er in den Augen der anderen der typische zerstreute Professor war, wie man ihn aus Dutzenden guter oder schlechter Hollywoodfilme kannte, bis zur Haarspitze angefüllt mit Fakten und Informationen aus seinem Fachgebiet Geschichte, aber im Alltagsleben nur bedingt tauglich. Wenn Gerüchte und Klatsch umgingen, war er immer der Letzte, der etwas erfuhr. Allerdings störte ihn das nicht, da er auf solche Dinge ohnehin keinen Wert legte.
„Also gut, Freddy, spann mich nicht auf die Folter. Offenkundig weiß wieder jeder außer mir Bescheid.“
Millers Gesichtsausdruck wurde ungewöhnlich ernst und Stewart spürte, dass etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein musste. Als Miller antwortete, war seine Stimme leise und brüchig, und sein Arm wies auf das Universitätsgebäude. „Foster ist tot. Und wie es scheint, wurde er ermordet.“
Der Einschlag einer Bombe hätte nicht gewaltiger sein können. Stewart fühlte, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Als er Millers ausgestrecktem Arm mit den Augen folgte, sah er endlich die Armada von Einsatzwagen auf dem Campus. Polizisten liefen umher und sperrten das Gebäude mit Flatterband ab, während das Blau- und Rotlicht der Fahrzeuge verzweifelt versuchte, gegen die hellen, heißen Sonnenstrahlen, die wie eine Lichtexplosion blendeten, anzukämpfen.
Unwillkürlich setzte Stewart sich auf das Hauptgebäude zu in Bewegung. Miller ergriff seinen Arm und hielt ihn zurück. „Bleib hier. Wir dürfen da nicht hin. Wir sollen uns hier für Vernehmungen bereithalten.“
Stewart schüttelte ihn mehr unbewusst als bewusst ab und ging weiter. Nur ein Gedanke beherrschte ihn und trieb ihn an. Carl! Nein, es darf nicht sein!
Im nächsten Moment wurde auch die Polizei auf ihn aufmerksam. Ein Officer näherte sich und sprach ihn an. „Sir, Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht hin. Bitte begeben Sie sich wieder auf den Parkplatz.“
Stewart ignorierte ihn und ging weiter, seine Schritte wurden schneller. Den Polizisten, der ihm nachlief, nahm er gar nicht wahr.
„Sir, ich muss Sie bitten, wieder zurückzugehen.“
Als er das Eingangsportal erreichte, befand er sich bereits in einem schnellen Laufschritt. Einige der übrigen Polizisten drehten sich zu ihm um, wandten sich jedoch wieder ihrer eigenen Arbeit zu, als sie sahen, dass sich schon jemand von ihnen um den aufdringlichen Eindringling kümmerte.
„Lassen Sie mich durch. Er war mein Freund.“ Stewart bahnte sich seinen Weg durch die Menge der Beamten und stand schließlich in der Eingangshalle des Hauptgebäudes, wo er stehen blieb und sich zu orientieren versuchte.
Aus dem Haufen der Uniformierten löste sich eine Gestalt in Zivil und kam auf Stewart und den ihn verfolgenden Polizisten zu. „Was ist hier los, Officer?“
Der Polizist keuchte und antwortete stoßweise. „Tut mir leid, Sir, ich konnte ihn nicht aufhalten. Er behauptet, ein Freund des Opfers zu sein.“
Stewart wusste später nicht mehr, wie er dazu kam, die folgenden Worte zu sagen, doch aus seinem Mitgefühl für Foster heraus, aus einem Gefühl tiefster Trauer und Pietät dem Verstorbenen gegenüber, wandte er sich mit zornigem Gesichtsausdruck, seine Stimme gerade noch unter Kontrolle haltend, dem Polizisten zu. „Carl Foster. Er hatte einen Namen, Officer.“
Der Uniformierte zuckte sichtlich zusammen und starrte den Zivilbeamten Hilfe suchend an.
„In Ordnung, Officer, ich kümmere mich um ihn. Gehen Sie wieder nach draußen.“
Stewart und der Zivilbeamte sahen dem Officer zu, wie er sich entfernte, dann wandte sich der Zivile Stewart zu. „Mein Name ist Jackson. Ich bin von der Mordkommission. Und Sie sind …?“
Stewart sah auf und nahm sein Gegenüber erst jetzt richtig wahr. Groß, schlank, autoritärer Gesichtsausdruck, doch am meisten von allem beeindruckte ihn die Kompetenz, die der Beamte ausstrahlte. Er räusperte sich beschämt. „Stewart. Alan Stewart. Entschuldigen Sie, Detective.“
„Lieutenant.“
„Wie bitte?“
„Lieutenant, nicht Detective. Aber Mr. Jackson reicht.“
Stewart schloss für einen Moment die Augen, um sich zu sammeln. Als er spürte, dass er ruhiger wurde, sah er Jackson offen ins Gesicht. „Mr. Jackson, ich muss mich entschuldigen, dass ich hier einfach so eindringe, aber Carl war mein Freund. Und mein Kollege da draußen behauptet, er sei ermordet worden.“
Jackson nickte mitfühlend. „Ich fürchte, Ihr Kollege hat Recht. Wie lange kannten Sie den Verstorbenen?“
„Carl und ich waren Freunde seit unserer Studienzeit. Als er Dekan wurde, holte er mich hierher. Ich habe ihm viel zu verdanken.“
„Der Coroner hat seinen Todeszeitpunkt auf null bis zwei Uhr heute Nacht festgelegt. Haben Sie eine Ahnung, was Mr. Foster so spät noch in der Universität machte?“
„Das ist nicht ungewöhnlich für ihn. Er arbeitet … arbeitete oft bis in die Nacht. Nicht selten hat er auch hier geschlafen. Er hat ein Bett in seinem Büro.“
„Wo waren Sie heute Nacht zwischen null und zwei Uhr, Mr. Stewart?“
Stewart fuhr zusammen. „Verdächtigen Sie mich etwa?“
Jackson zuckte die Achseln. „Reine Routinefrage. Wir werden nachher noch jeden Ihrer Kollegen vernehmen. Also?“
„Ich war zu Hause, habe geschlafen, wie wohl jeder andere auch.“
„Haben Sie ein Alibi?“
Stewart spürte förmlich, wie alle Farbe aus seinem Gesicht wich. Das kann doch nicht wahr sein. „Nein. Ich wohne allein. Wollen Sie mich jetzt verhaften?“
Jackson winkte lächelnd ab. „Ich könnte Sie höchstens festnehmen, Mr. Stewart. Verhaften geht nur mit einem Haftbefehl, und ich habe Sie ja gerade erst kennen gelernt, oder? Aber lassen wir das. Um Ihre unausgesprochene Frage zu beantworten: Nein, ich halte Sie nicht für den Mörder. Aber vielleicht können Sie mir trotzdem eine Frage beantworten. Hatte Foster Feinde?“
„Feinde?“ Stewart runzelte die Stirn und dachte nach. „Nun, Carl war Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler hat immer Feinde, aber nicht Feinde im Sinne des Wortes, sondern vielmehr Gegner, Wissenschaftler und Gelehrte eben, die andere Auffassungen und Anschauungen vertreten, so wie Politiker oppositioneller Parteien. Verstehen Sie, was ich meine?“
Jackson kratzte sich hinter dem Ohr. „Offen gestanden, nein, Mr. Stewart.“
Stewart überlegte. Wie konnte man einem Laien den Charakter wissenschaftlicher Diskurse nahebringen? „Nehmen wir ein Beispiel. Wissenschaftler Smith behauptet, die Erde sei rund. Wissenschaftler Jones dagegen ist der Überzeugung, die Erde sei eine Scheibe. Beide Männer haben Argumente für ihre eigene Theorie und gegen die des jeweiligen anderen. Wissenschaftlich gesehen stehen sie also auf verschiedenen Standpunkten und würden sich – bildlich gesprochen – bis aufs Messer bekämpfen, obwohl sie privat Freunde sein könnten. Konnte ich mich klar genug ausdrücken?“
„Ja, ich glaube, ich habe es jetzt kapiert. Halten Sie es für denkbar, dass einer seiner wissenschaftlichen Gegner Ihren Freund ermordet hat?“
Stewart wurde wieder mulmig zumute, als er Jackson seinen Blick aufmerksam auf ihn richten sah, wobei die blitzenden stahlgrauen Augen des Polizisten ihn zu durchbohren schienen. Doch als Stewart darüber nachdachte, musste er zugeben, dass Jacksons Gedanke gar nicht so abwegig war. Konnte es so gewesen sein?„Nun“, antwortete er unsicher, „ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein wissenschaftlicher Kollege so etwas tun würde. Aber ausschließen kann man das wohl nicht, oder?“
„Nein, Mr. Stewart, ausschließen können wir im Augenblick gar nichts. Wäre es Ihnen möglich, uns eine Liste der Personen zusammenzustellen, die als Fosters Gegner – im wissenschaftlichen Sinne – in Frage kommen?“
Wieder geriet Stewart ins Grübeln. Konnte es sein? Wer? „Carl hat schon lange nichts mehr publiziert. Deshalb wüsste ich im Moment wirklich nicht, wer …“
Jackson hob beschwichtigend die Hand. „Nur keine Eile, Mr. Stewart. Denken Sie zu Hause in Ruhe nach und geben Sie mir die Liste morgen oder übermorgen. Eine andere Frage: Können Sie sich ein Motiv für den Mord vorstellen?“
Ein Motiv! Stewarts Gedanken rasten. Warum war Carl ermordet worden? Besaß er etwas, was sein Mörder haben wollte? Oder wusste er etwas, das ihm zum Verhängnis wurde? Carl war Historiker und Ethnologe und besaß als solcher ein umfangreiches Fachwissen. War dort das Motiv zu suchen? So viel Stewart wusste, hatte Foster seit Jahren nichts publiziert, aber in den letzten Monaten hatte er mit Studien begonnen und angefangen, an einem Artikel zu arbeiten. Stewart kannte das Thema nicht, aber diese Arbeit als Mordmotiv anzunehmen, ging wohl zu weit. Dennoch breitete sich allmählich ein ungutes Gefühl in ihm aus. Die Miskatonic-Universität war im Besitz eines einmaligen Gegenstandes, von dem er wusste, dass es nur noch ein weiteres Exemplar gab, das sich bei einem Privatsammler befand. Carl hatte ihm vor Jahren davon erzählt und erwähnt, dass sich dieser Gegenstand in einem Tresor im Keller der Universität befinden sollte. Stewart hatte sich nie darum gekümmert und alles, was damit zusammenhing, vergessen, doch Carl hatte sich immer sehr seltsam verhalten, wenn es um diese Sache ging. War es möglich, dass …?
Stewarts Unruhe wuchs. Er musste Gewissheit haben. „Nein, tut mir leid, Mr. Jackson, ich weiß kein Motiv. Sagen Sie, kann ich ihn sehen?“
Jackson versteifte sich sichtbar und kniff misstrauisch die Augen zusammen. „Nun, es ist nicht üblich, dass wir Unbefugten den Tatort oder sogar die Leiche zeigen.“
„Bitte, Mr. Jackson, er war mein Freund.“
Jackson schien einen Moment zu überlegen, dann nickte er. „Also gut, kommen Sie mit.“
Er wandte sich um und ging voran. Auf dem Weg zu Fosters Büro kamen sie an Dutzenden Beamten vorbei, Uniformierten, Zivilbeamten, und an mit weißen Overalls bekleideten Männern und Frauen der Spurensicherung. Stewart hörte Gespräche und Gelächter. Bitter dachte er daran, dass es für die Beamten nur ein Job war, Alltag, doch er hatte einen Freund verloren.
Als sie das Büro betraten, blieb Stewart wie vom Schlag getroffen stehen. Großer Gott! War das wirklich Carl? Was hatte man ihm angetan?
Es war eindeutig ein menschlicher Körper, der vor dem großen Eichenschreibtisch lag, nackt und zusammengerollt wie ein
Fötus. Auf den ersten Blick war nicht zu erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte; dort, wo die Geschlechtsmerkmale sein sollten, waren nur Blut und zerfetztes Fleisch. Doch nicht nur der Körper, auch der Schreibtisch und der Fußboden im näheren Umkreis der Leiche waren blutverschmiert. Das Blut hatte die natürliche Hautfarbe des Körpers verdrängt und gab ihm das Aussehen einer Höllenerscheinung. Stewart fühlte sich an Dantes Inferno erinnert. Doch er erkannte noch mehr. An mehreren Stellen des Körpers – oder sollte er sagen: auf der formlosen Fleischmasse? - gab es dunkle Streifen, die durch das Blut hindurchschimmerten. Als ihm bewusst wurde, um was es sich handelte, begann er zu würgen.
„Sie haben es also gesehen“, hörte er Jackson neben sich sprechen. „Das Blut in den Wunden deutet darauf hin, dass er noch lebte, als der Mörder ihm die Fleischstreifen aus dem Körper schnitt.“
„Er wurde gefoltert.“ Stewart wunderte sich, wie kraftlos und spröde seine Stimme plötzlich klang.
„Gefoltert. Ganz recht, Mr. Stewart. Ich weiß nicht, was es war, das der Mörder von Ihrem Freund erfahren wollte, aber Foster – das kann man wohl unterstellen – muss unglaubliche Schmerzen erlitten haben. Übrigens, wo Sie schon mal hier sind, können Sie die Identität der Leiche … Entschuldigung, Ihres Freundes bestätigen?“
Mit Tränen in den Augen warf Stewart einen kurzen Blick auf das blutbesudelte, schmerzverzerrte Gesicht des Wesens, das einmal Carl Foster gewesen war. Trotz des vielen Blutes waren die Gesichtszüge noch erkennbar. Er war es. Warum? Stumm nickte er.
„Jetzt, wo Sie Foster gesehen haben und erfahren haben, wie er gestorben ist, können Sie sich vorstellen, was sein Mörder von ihm gewollt hat?“
Stewart zuckte zusammen. Was sein Mörder von ihm gewollt hat … Da war diese Idee, aber konnte er Jackson davon erzählen? Im Grunde wusste er ja selbst nicht einmal, ob sein Gedanke einer Überprüfung standhalten würde. Es war alles zu vage, so unglaublich, irreal. Nein, entschied er, er würde Jackson zunächst nichts sagen, nicht, bevor er selbst seinen Verdacht überprüft hätte.
In der Hoffnung, dass Jackson seine wahren Gedanken nicht erkannte, bemühte er sich, ein unschuldiges Gesicht zu machen und seinerseits Jackson eine Frage zu stellen. „Ist etwas gestohlen worden?“
Jackson schüttelte den Kopf. Gut, er hat mich nicht durchschaut. „Es hat zumindest nicht den Anschein. Das Gebäude ist sauber, oberflächlich deutet nichts auf Diebstahl hin, keine Verwüstungen, keine diesbezüglichen Spuren. Aber da Sie schon einmal hier sind, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich ein wenig umsehen würden. Vielleicht entdecken Sie etwas, das fehlt. Ich glaube jedoch viel eher, dass Foster ein Wissen besaß, das für seinen Mörder von Wert war. Foster wollte es nicht preisgeben, und so wurde er gefoltert. Wir müssen davon ausgehen, dass sein Mörder die gewünschte Information erhalten hat. Solcher Folter kann niemand widerstehen, den standhaften Märtyrer gibt es nur im Film.“
Stewart war nicht sicher, ob es lediglich um eine Information ging. Es gab sehr wohl einen Gegenstand, der gestohlen worden sein konnte. Wieder dachte er an den Tresorraum im Keller.
Jackson winkte einen Uniformierten herbei und mit ihm zusammen machte sich Stewart auf den Weg, um die einzelnen Räume der Universität zu inspizieren. Stunden später hatten sie die Gewissheit – zumindest dem Augenschein nach -, dass nichts gestohlen worden war. Stewart hatte den Polizisten in alle Räume, die Wertgegenstände enthielten, geführt: die Bibliothek, die Archive, das Dozentenzimmer mit dem Tagestresor. Das Ergebnis war überall dasselbe: Alles sah unberührt aus. Einen Raum gab es allerdings, den Stewart dem Beamten nicht zeigte …
Ungeduldig wartete er auf das Abrücken er Polizei, doch es wurde Abend, bis es endlich so weit war und er allein noch einmal in den Keller gehen konnte, um den Tresorraum aufzusuchen. Er musste Gewissheit haben. Unglücklicherweise hatte nur Carl die Kombination besessen, er würde also mit Gewalt zur Tat schreiten und den Tresor durch einen Schlüsseldienst öffnen lassen müssen. Doch es musste getan werden. Wenn der Gegenstand tatsächlich fehlte, wenn Carl deswegen gestorben war, befand sich die Welt in großer Gefahr.
Ishmael stand unter der Dusche und beobachtete das Wasser, das im Ausguss verschwand und in die Kanalisation floss. Ein seltenes Hochgefühl hatte ihn ergriffen, eine beinahe göttliche Euphorie, ausgelöst durch die erfolgreich zu Ende gebrachte Mission. Nach Monaten der Plackerei war es ihm – und seinem Meister – endlich gelungen, in den Besitz der Reliquie zu gelangen. Ishmael, das Werkzeug der Götter, obwohl er keine Ahnung hatte, von welchen Göttern sein Meister immer sprach. Dennoch, es war vollbracht. Sein Meister würde zu ewigem Ruhm gelangen und ein Teil des Ruhmes würde auf Ishmael abfallen. Hatte sein Herr nicht gesagt, dass es durchaus im Bereich des Möglichen lag, das ewige Leben zu erlangen? Dafür musste jedes Mittel recht sein.
Er stieg aus der Dusche, trocknete sich ab und kleidete sich an. Auf dem Bett lag noch immer seine Beute. Er hatte es nicht gewagt, sie zu entweihen, und hatte deshalb auf dem Fußboden geschlafen, doch die Steifheit seiner Knochen war nichts im Vergleich zu dem unglaublichen Glücksgefühl, den der Besitz der Reliquie bedeutete. So viele Monate.
Nachdem er seine Reisetasche gepackt und die Reliquie sorgfältig darin verstaut hatte, verließ er seine Unterkunft und ging zur Rezeption und bezahlte. In bar, wie sein Meister es ihm aufgetragen hatte. Eine Viertelstunde später befand er sich auf dem Highway Richtung New York. Sein Ziel war der John F. Kennedy International Airport. Er klopfte mit der Hand auf die Reisetasche, in der sich das Ticket befand, das der Meister ihm besorgt hatte, als wollte er sich vergewissern, dass es noch da war. Wenn alles klappte, würde Ishmael am Abend bereits in Europa sein. Wo es danach hinging, wusste er noch nicht. Aber er wusste, dass der Meister ihn sicher durch alle Fährnisse führen und – wenn die Zeit gekommen war – mit ihm über die ganze Menschheit herrschen würde. Und vielleicht – aber das wusste er eben nicht hundertprozentig – gab es das ewige Leben obendrauf.
Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen jagte Ishmael den Wagen über den Highway.
3
Das war wieder mal typisch, dachte Harriet Foster-Smith, als das Taxi vor dem Waldorf Astoria hielt. Sie musste los und es regnete. Und es war natürlich kein einfacher Regen, den man mit einem Schirm vom Körper abhalten konnte und der höchstens Schuhe und Rock benetzte. Nein, es goss in Strömen – oder, wie man hier in London sagte, es regnete Katzen und Hunde. Es war abzusehen gewesen, der Wetterbericht hatte es angedeutet, und als das Taxi von ihrem eigenen Hotel losfuhr – einem winzigen Haus mit noch winzigeren Zimmern irgendwo in den Außenbezirken der Stadt, mehr hatte die Zeitung für sie nicht übrig –, hatte sich der Himmel bereits bezogen.
Harriet zuckte die Achseln. Auftrag war Auftrag, ob mit Regen oder ohne. Sie entlohnte den Fahrer, öffnete die Tür und spannte ihren Schirm auf. Die wenigen Schritte zum Hoteleingang reichten aus, um ihre Kleider zu durchnässen: Schuhe, Strumpfhose, Rock, Jacke; der Schirm bewirkte lediglich, dass ein handtellergroßer Bereich der Bluse im Brustbereich, ihr Gesicht und ihr Haar trocken blieben.
Als sie die Lobby betrat, erwartete sie ein feuchtes Chaos. Hunderte Männer und Frauen in allen Stadien der Feuchtigkeit wuselten herum oder verschwanden in den Räumen mit den Buchstaben WC, um sich einigermaßen wieder herzurichten. Einen Augenblick lang überlegte Harriet, ob sie sich ihnen anschließen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Draußen wehte kein Wind, sodass ihre Frisur noch ordentlich lag, und die Kleider würde sie in der kurzen Zeit, die noch zur Verfügung stand, ohnehin nicht trocken bekommen.
Harriet sah sich um. Wie sie erwartet hatte, erkannte sie in der Menge einige Personen. Nach einer Minute kam sie bereits auf fünf, allesamt Kollegen von Konkurrenzblättern, die wie sie den Auftrag hatten, über den Vortrag zu berichten, den Professor Jonathan Wilmarth, der bekannte Archäologe, in wenigen Minuten halten würde. Zwei Exemplare waren darunter, denen sie am liebsten aus dem Weg gegangen wäre: hässlich, gemein, sarkastisch, widerliche Exemplare der Gattung Journalist, die Journalismus nicht als Berichterstattung, sondern als Sensationsdarstellung betrachteten. Sie betete im Stillen, diesen beiden nicht über den Weg zu laufen.
In der Mitte der großen Eingangshalle entdeckte sie eine Hinweistafel:
Versunkene Kulturen
Vortrag von Prof. J. Wilmarth
Vortragssaal 1
20.00 h
Ihre Augen wanderten durch die Halle auf der Suche nach Vortragssaal 1, als sie eine Berührung an der Schulter spürte.
„Tag, Harry. Na, auch nichts Besseres vor bei diesem Wetter?“
Harriet drehte sich um. Das Glück war nicht auf ihrer Seite. Eines von zwei Exemplaren. „Danny Margolyn. Warum treffe ich immer auf dich?“
Margolyn grinste unverschämt. Maulhelden wie ihn hasste Harriet, Weiberhelden, die jeden Rock anbaggerten und versuchten, mit ihm in die Kiste zu steigen, oberflächlich und substanzlos. Unglücklicherweise gab es Gelegenheiten zuhauf, wo sie ihm über den Weg lief.
„Warum wohl, Harry? Gib es zu, das Schicksal will es so.“
Jetzt wurde sie wütend. „Nenn mich nicht Harry. Ich heiße Harriet.“
Wenn es eines gab, das sie richtig hasste, dann war es der Name Harry. Als sie Terence Smith kennen gelernt hatte, hatte es nicht lange gedauert, bis er sie mit Harry ansprach. Terry und Harry. Lächerlich, dachte sie, aber damals hatte sie es niedlich gefunden. Unwillkürlich wanderten ihre Gedanken in die Vergangenheit. Terry war ein Gentleman und charmanter Liebhaber, der ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen hatte. Darüber hinaus war er ein Tier im Bett; bedauernd wurde ihr bewusst, dass sie nie wieder so wahnsinnig guten Sex gehabt hatte. Dennoch, das Ende war vorprogrammiert. Sie hatten viel zu früh geheiratet, Harriet war gerade volljährig geworden. Terrys Vorstellung von Ehe war traditionell und konservativ: Der Mann ging arbeiten und die Frau blieb zu Hause und versorgte Haus und Kinder. Dies jedoch war nicht Harriets Lebenseinstellung. Sie wollte nicht am Herd versauern und Kinder wollte sie schon gar nicht. Mit Müh und Not konnte sie Terry dazu überreden, dass er sie studieren ließ. Doch als sie nach dem Studium ihren Beruf als Journalistin tatsächlich ausüben wollte, strich er die Segel. Harriet konnte ihn durchaus verstehen, eine emanzipierte unabhängige Frau war eine Bedrohung des Bildes, das er sich von einer Frau machte, ein Angriff auf seine Stärke und Männlichkeit. Nach einem Jahr, das aus nichts anderem als Zank und Streit – und keinem Sex – bestand, zogen sie die logische Konsequenz. Nach der Scheidung ließ sie sich nur noch mit ihrem vollen Namen ansprechen, Harry Smith war gestorben. Harriet klang erwachsen, und heute, mit 28 Jahren, war Harriet Foster-Smith erwachsen genug, um allein durchs Leben zu gehen. Heute war sie sogar der Überzeugung, dass Terry ihre Entwicklung behindert hatte, und oft fragte sie sich, wie schnell ihre Karriere verlaufen wäre, wenn sie nicht mit Terry verheiratet gewesen wäre. Entsetzt hatte sie erkannt, dass die Scheidung ihr – zumindest beruflich – gut getan hatte. In den ersten Monaten danach hatte sie sich regelrecht in die Arbeit gestürzt. Noch heute war sie sicher, dass dieser Einsatz für ihre Zeitung dazu beigetragen hatte, dass sie da stand, wo sie war. Die Position, die sie heute innehatte, war die Bestätigung ihrer Arbeit. Als stellvertretende Redakteurin war sie hoch genug aufgestiegen, um Führungserfahrung zu sammeln, andererseits aber noch nicht so hoch, dass sie ihre eigentliche Tätigkeit vernachlässigen musste. Sie konnte immer noch das machen, was ihr am meisten Spaß bereitete: puren Journalismus. Recherchieren, schreiben, redigieren.
Harriet schrak zusammen. Margolyn klopfte ihr auf die Schulter, offenbar hatte er erkannt, dass sie mit ihren Gedanken woanders war. „Also bis später, Foster-Smith.“
Harriet wandte sich wortlos ab. Sie lehnte den Champagner ab, den eine Bedienung ihr auf einem Tablett anbot, und suchte weiter nach Saal 1. Als sie den Eingang gefunden hatte, setzte sie sich unverzüglich in Bewegung.
Saal 1 entpuppte sich als nüchterner Vortragsraum, wie sie ihn zu Hunderten schon gesehen hatte: ein Rednerpult auf einer erhöhten Bühne, Stahlrohrstühle mit Sitzen und Rückenlehnen aus Lederimitat – unbequem, aber zweckmäßig. Hinter dem Pult war eine Leinwand aufgebaut, auf die ein Beamer, der sich zwischen Redner und Publikum unter der Decke befand, gerichtet war. Der Saal war erst halb voll und so gelang es Harriet, einen Sitzplatz in den vorderen Reihen zu erlangen.
In den nächsten Minuten füllte sich der Raum allmählich, und als es 20.05 Uhr war, ging das Licht aus. Kleine Lampen an den Seitenwänden blieben erleuchtet, sodass es dem Publikum ermöglicht wurde, zwischendurch die Toilette aufzusuchen oder sich Notizen zu machen. Schließlich flammte ein Spotlight auf und die Bühne wurde in grelles Licht getaucht. Ein schlanker Mann in den Vierzigern erschien, stellte sich hinter das Rednerpult, klopfte auf das Mikrofon, um zu testen, ob es funktionierte, und begann zu sprechen.
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt und so zahlreich erschienen sind. Wie Sie wissen, ist die Archäologische Gesellschaft immer daran interessiert, interessante Vortragsredner zu gewinnen. Der Redner, der heute Abend zu Ihnen sprechen wird, ist Ihnen kein Unbekannter. Es ist uns gelungen, eine wirklich hochkarätige Kapazität auf dem Gebiet der Archäologie zu gewinnen. Er ist Doktor der Medizin, Doktor der Archäologie, wissenschaftlicher Berater der Regierung, Verfasser einiger Standardwerke der Archäologie und unzähliger Fachartikel und – ein brillanter Redner. Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Dr. Jonathan Wilmarth.“
Seine rechte Hand deutete hinter die Bühne, und unter dem tosenden Applaus des Publikums erschien der Star des Abends auf der Bühne. Harriet musterte den Mann, der festen und stolzen Schrittes auf das Pult zumarschierte, und stellte fest, dass er ihr auf Anhieb unsympathisch war. Sein freundlicher Gesichtsausdruck, das volle schwarze Haar und die stattliche Erscheinung des Mittvierzigers konnten nicht über die Arroganz hinwegtäuschen, die in seinen Mundwinkeln und seinen Augen lag. Harriet hatte im Lauf ihres Berufslebens mit Hunderten Persönlichkeiten zu tun gehabt, und obwohl sie es vermeiden wollte, Menschen in eine Schublade zu stecken und sich ihr Urteil über sie bis nach einem Gespräch aufbewahren wollte, konnte sie nicht umhin, aufgrund des ersten Eindrucks eine vorläufige Charakterisierung vorzunehmen, und die fiel bei Professor Dr. Dr. Wilmarth eindeutig negativ aus.
Als Wilmarth jedoch zu sprechen begann, sprach seine Stimme seinem arroganten Auftreten Lügen. Mit angenehmem, sympathischem Bariton begann er seine Rede.