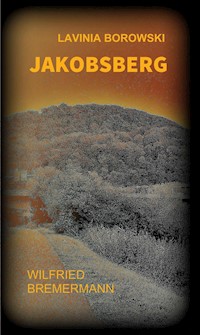
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lavinia Borowski
- Sprache: Deutsch
Was nur ist so besonders an dem Medaillon, das Lavinia im Auftrag eines verschrobenen Millionärs ersteigert hat? Erst wird es ihr gewaltsam entwendet. Kurze Zeit später wird sie überfallen und mit unsinnigen Fragen gequält, die offenbar mit dem Schmuckstück zusammenhängen. Im Zuge ihrer Ermittlungen zur Wiederbeschaffung trifft sie auf den dubiosen Gregor van der Beeck, Ehemann der Enkelin ihres Auftraggebers. Welche Rolle spielt er in dem mysteriösen und gefährlichen Spiel? Und warum hat es der berüchtigte Schatzsucher Adolf Trumpeter auf das Medaillon abgesehen? Die Spur führt weit in die Vergangenheit, zu einem Geheimnis aus den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Eine Spur, die buchstäblich mit Leichen gepflastert ist. Ganz schnell ist auch Lavinias Leben in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
WILFRIED BREMERMANN
LAVINIA BOROWSKI
JAKOBSBERG
Buch
Was nur ist so besonders an dem Medaillon, das Lavinia im Auftrag eines verschrobenen Millionärs ersteigert hat? Erst wird es ihr gewaltsam entwendet. Kurze Zeit später wird sie überfallen und mit unsinnigen Fragen gequält, die offenbar mit dem Schmuckstück zusammenhängen. Im Zuge ihrer Ermittlungen zur Wiederbeschaffung trifft sie auf den dubiosen Gregor van der Beeck, Ehemann der Enkelin ihres Auftraggebers. Welche Rolle spielt er in dem mysteriösen und gefährlichen Spiel? Und warum hat es der berüchtigte Schatzsucher Adolf Trumpeter auf das Medaillon abgesehen? Die Spur führt weit in die Vergangenheit, zu einem Geheimnis aus den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Eine Spur, die buchstäblich mit Leichen gepflastert ist. Ganz schnell ist auch Lavinias Leben in Gefahr.
Autor
Wilfried Bremermann, geboren 1963 im westfälischen Rahden, schreibt seit über 20 Jahren internationale Thriller. Sein erster regional angehauchter Krimi "Die Babylon-Falle" erschien 2014 und fand große Anerkennung beim Publikum. "Nordpunkt" war der erste Roman der Reihe um die Privatdetektivin Lavinia Borowski, die im Mühlenkreis Minden-Lübbecke ermittelt.
Wilfried Bremermann ist Mitglied im SYNDIKAT und im Bundesverband junger Autoren.
Im Internet finden Sie Wilfried Bremermann unter:
www.wilfried-bremermann.de.
Weitere Bücher von Wilfried Bremermann:
Die Hoffmann-Affäre
Der Golf-Zwischenfall
Der Armageddon-Plan
Die Babylon-Falle
Das Arkham-Manuskript
Die virginische Nymphe
Nordpunkt (Lavinias 1. Fall)
Schachtschleuse (Lavinias 2. Fall)
Wilfried Bremermann
Jakobsberg
Ein Lavinia Borowski Krimi
© 2020 Wilfried Bremermann
Umschlag, Illustration: Vorderseite Autor; Rückseite Franck Camhi, Fotolia
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-16867-1
Hardcover
978-3-347-16868-8
E-Book
978-3-347-16869-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1
Der Brief erreichte mich an einem Dienstagvormittag und ließ mir keine Zeit für Vorbereitungen. Einen Tag früher, und die Dinge wären vielleicht anders gelaufen.
Es ist eine interessante Frage, zu erörtern, ob ein Tag für Vorbereitungen die Ereignisse verhindert hätte, in die ich verwickelt wurde. Vielleicht wäre ich ausgeruhter und aufmerksamer gewesen, hätte die Auffälligkeiten und Ungereimtheiten eher bemerkt, hätte eine Abwehrstrategie entwickeln können. Hätte, hätte. Fakt ist, weil ich diese Zeit nicht zur Verfügung gehabt hatte, geschah von meiner Seite nichts dergleichen.
Am Ende waren fünf Menschen tot.
Dabei enthielt der Brief nichts, was auf die allerkleinste Gefahr hindeutete. Bianca, die hübsche Postbotin mit dem kurzen blonden Haar, klopfte gegen elf an meine Bürotür und trat ein, zwei Briefe in der Hand. „Morgen, Lavinia. Heute nur zwei Rechnungen. Dann kannst du dir heute ja vielleicht mal was zum Essen kaufen.“ Sie gluckste.
Sah ich so unterernährt aus, fragte ich mich, als ich ihr entgegenging, um die Briefe anzunehmen. Gut, der Kühlschrank war genauso leer wie mein Konto, die Mietzahlung stand noch aus und auf meinem Schreibtisch wuchs ein Berg unbezahlter Rechnungen. Es lief nicht gerade gut in letzter Zeit. Charlie und DJ, meine besten Freunde, merkten das natürlich auch, weil ich nicht mehr so viel mit ihnen unternahm. Ich spielte ihnen gegenüber die Sache herunter. Das wird schon wieder, pflegte ich zu sagen. Doch das war nur Zweckoptimismus. In Wahrheit sah meine Lage ganz schön beschissen aus. Wenn nicht bald ein Wunder geschah, würde der Staat für Klein-Vinnie sorgen.
Ich warf die Briefe achtlos auf den Tisch. Wer kümmert sich schon um Rechnungen? „Kannst mir ja morgen was mitbringen“, rief ich Bianca zu, als sie in das gelbe Elektroauto stieg, mit dem die Post neuerdings herumfuhr. Danach wandte ich mich liegengebliebenen Dingen zu, die den einen oder anderen Euro einbringen würden. Peanuts im Vergleich zur Passivseite meiner Bilanz, aber es würde für die Anzahlung der Miete reichen. Die Briefe verschwanden unter dem Rechnungsstapel.
Am frühen Nachmittag, nach einer kargen Brotzeit - bestehend aus einem Schokoriegel und einer Cola - und nach einem Spaziergang an der warmen Sommerluft, der mich zwar nicht erfrischte, mir aber Sauerstoff zuführte, legte ich schließlich die letzte Akte ab und wandte mich seufzend den Rechnungen zu. Und da lagen sie, die beiden Briefe vom Vormittag. Es waren keine Rechnungen, das sah ich auf den ersten Blick. Das erste Schreiben wanderte direkt in den Papierkorb. Schon der Druck auf dem Umschlag verriet, dass es sich um das Werbeschreiben einer Direktversicherung handelte - ein Produkt, das ich so nötig brauchte wie ein Verhungernder eine Diät. Doch der zweite Brief erregte meine Aufmerksamkeit.
Cremeweißes dickes Papier mit Riffeln, meine Büroanschrift – Lavinia Borowski, Privatdetektivin, Mindener Straße 256 A, 32479 Hille – in klaren deutlichen Buchstaben, mit Füllfederhalter geschrieben, Frauenschrift. Kein Absender.
Eine Einladung? Ich grübelte. Mir fiel keine Feier ein, die in nächster Zeit stattfand. Ein Freundschaftsbrief? So etwas hatte ich seit meiner Jugend nicht mehr erhalten. Ich tastete den Umschlag ab. Er war gepolstert, ich konnte den Inhalt nicht fühlen. Wenigstens roch ich kein Parfüm, also kein Liebesbrief.
Na denn. Brieföffner. Ratsch. Offen.
Der Umschlag war rot gefüttert. Er enthielt einen Scheck über eintausend Euro, einen unterschriebenen Blankoscheck, ein Foto mit einem Schmuckstück – ein Medaillon, wenn ich es richtig identifizierte -, einen Zeitungsausschnitt, der einen Hinweis auf eine an diesem Tag in Minden stattfindende Auktion enthielt, einen Schlüssel und ein kurzes Begleitschreiben in derselben Handschrift wie auf dem Kuvert.
An beigefügter Veranstaltung wollen Sie bitte teilnehmen und das auf dem Foto dargestellte Medaillon ersteigern, das Sie mit dem Blankoscheck, in den Sie die Summe eintragen, bezahlen. Sie haben alle Vollmachten. Der andere Scheck dient der Zahlung Ihres Honorars. Das ersteigerte Medaillon deponieren Sie anschließend in einem Schließfach des Bielefelder Hauptbahnhofs. Der Schlüssel ist diesem Schreiben beigefügt. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich anonym bleiben möchte. Für den äußersten Notfall erreichen Sie mich unter der Telefonnummer …
Es folgte eine Festnetznummer mit Mindener Vorwahl. Kein Name, keine Unterschrift. Die geheimnisvolle Schreiberin wollte wirklich anonym bleiben.
Ich schüttelte den Kopf und las den Brief noch einmal. Es war der seltsamste Auftrag, den ich je erhalten hatte.
Ich legte den Brief beiseite, stand auf und wanderte in dem winzigen Raum, der mein Büro war, auf und ab.
Ich befand mich im Zwiespalt. Sollte ich den Auftrag annehmen? Anonyme Aufträge sind heikel. Abgesehen von dem Problem, das Honorar zu verbuchen – das Finanzamt will immer exakte Angaben wegen der Kontrollmitteilungen -, stellt sich die Frage, warum der Auftraggeber nicht in Erscheinung treten will. Natürlich gibt es Gründe dafür: Sein Name soll nicht in der Öffentlichkeit auftauchen, weil er nicht in Verbindung mit einem Verbrechen oder einer anderen schlimmen Sache gebracht werden will und solche Dinge. Aber eine Auktion? Was war an der Versteigerung eines Medaillons so aufregend, dass der Käufer nicht in Erscheinung treten wollte?
Mein Magen begann eine leise Warnung auszustoßen. Hätte ich auf ihn gehört, wäre womöglich das Schlimme, das folgen sollte, verhindert worden. Doch meine Gier – zu meiner Verteidigung: meine Not – war stärker. Tausend Euro konnte ich nicht links liegen lassen. Der Scheck würde meinen Kontodisponenten glücklich machen.
Ich nahm noch einmal das Foto mit dem zu ersteigernden Medaillon in die Hand. Es schien sich um eine Kopie aus dem Ausstellungskatalog zu handeln.
Das Medaillon lag auf einem weißen Samttuch. Ich kannte mich mit Schmuck nicht aus – ich selber hatte keinen -, aber das Teil war groß und es sah schwer aus. Ich tippte auf Silber. Die Vorderseite bestand aus einer ziselierten Fläche mit einem aufgesetzten Kreuz. Mehr nicht. Schlicht und einfach. Die Rückseite war nicht abgebildet. Ich vermutete stark, dass sie noch langweiliger war als die Vorderseite.
Die Beschreibung war so kurz, wie das Medaillon einfach war: Aus dem Besitz einer Dame. Medaillon aus reinem Sterlingsilber. Hergestellt Ende des 19. Jahrhunderts von der Silbermanufaktur Tadellöser und Cie. in Berlin.
Ich fragte mich, warum jemand bereit war, für diesen Tand jede Summe zu zahlen. Schön, es war anscheinend massives Silber. Aber so hoch konnte der reine Materialpreis auch nicht sein. Ich googelte ein wenig, um herauszufinden, wie viel so ein Schmuckstück wert sein konnte, und fand allein auf der ersten Trefferseite Angebote zwischen zwanzig und eintausend Euro.
Mein Magen warnte mich immer noch, aber die Sache begann mich zu interessieren. Wie gesagt, ich war jung und brauchte das Geld. Und vielleicht würde ich auf der Auktion mehr über meinen Auftraggeber erfahren. Außerdem war ich noch nie auf einer Versteigerung gewesen.
Ich legte das Foto an die Seite und griff nach dem Zeitungsausschnitt. Die Auktion wurde ausgerichtet vom Kunsthaus Dahlgren, Königstraße 247 A, 32427 Minden. Von diesem Haus hatte ich noch nie gehört. Na ja, wie auch? Zum Gebot standen diverse Kunstgegenstände – Gemälde, Skulpturen und was man sonst unter Kunst verstand. Das Medaillon schien das einzige Schmuckstück zu sein. Ein Onlinekatalog war einsehbar. Die Auktion war am heutigen Dienstag um sechzehn Uhr.
Sechzehn Uhr? Mein Herz setzte aus. Das war in neunzig Minuten. Eineinhalb Stunden, um nach Hause zu fahren, mich umzuziehen, nach Minden zu düsen, die Galerie zu finden und mich mental vorzubereiten. Wie verhielt man sich auf einer Auktion? Wie bot man mit? Was zog man an?
Neunzig Minuten.
2
Ich schaffte es in fünfundachtzig. Aber auch nur, weil ich mich nicht schminkte und mich ohne Zögern für mein schwarzes Kleid entschied, ein praktisches Ding, das mir bis knapp über die Knie reichte und das ich sowohl zu Beerdigungen als auch zu feierlichen Anlässen trug. Und eine Auktion war meiner Ansicht nach ein ausreichend feierlicher Grund.
Die Galerie Dahlgren befand sich wenige Fahrzeuglängen hinter dem Kanal Richtung Minden. Natürlich fand ich keinen Parkplatz. Alles, was beparkt werden konnte, war zugeparkt, einschließlich der Nebenstraßen. Endlose Minuten kurvte ich herum, bis ich eine kleine Lücke sechshundert Meter entfernt am Grundbach fand. Mit meinen High Heels würde ich eine Ewigkeit bis zur Galerie brauchen, also zog ich sie aus, rannte los und schaffte es gerade auf sechzehn Uhr.
Das Kunsthaus Dahlgren war ein unscheinbarer Flachbau in einer Reihe von Wohnhäusern. Zur Straße wirkte es eher wie ein Wintergarten. Ich war schon etliche Male hier vorbeigekommen, hatte aber nie sonderlich auf das Haus geachtet. Kunst ist nicht mein Ding. Bei mir zu Hause hängen allenfalls großformatige Kalender mit Bildmotiven aus Australien oder London. Ich versuchte, von außen einen Blick durch die großformatigen Fenster auf die Ausstellungsstücke zu erhaschen, was sich angesichts der umherwuselnden Gäste aber als unmöglich erwies.
Ich trat ein. Das erste, was mich empfing, war eine Geräuschkulisse, die ich nicht erwartet hatte. Ein Geschnatter wie auf dem Schulhof. Wahnsinn. Ich hatte mir eine Auktion immer wie eine Bibliothek vorgestellt: Sprechen verboten. Aber die Besucher, deren Zahl ich auf vierzig schätzte, verhielten sich wie auf einer Party. Die Sektgläser in ihren Händen vervollständigten diesen Eindruck.
Ich war kaum zwei Schritte gegangen, als eine sympathische männliche Stimme den Weg in mein Ohr fand. „Guten Tag, die Dame. Bieten Sie mit oder schauen Sie nur?“
Meine Augen fanden den Sprecher sofort: ein attraktiver Mann mit graumeliertem Haar, Ende vierzig, Anfang fünfzig, eins fünfundachtzig groß, schwarzer Anzug, schwarze Fliege, ein Lächeln zum Dahinschmelzen. George Clooney für bürgerliche Mädchen. Er stand neben einem Tischchen am Eingang – ohne Nespresso.
„Wie bitte? Oh, Entschuldigung.“ Mir wurde heiß. Wurde ich wirklich rot? „Ich bin das erste Mal hier.“
„Kein Problem.“ Georges Lippen gingen noch weiter auseinander und entblößten zwei Reihen makelloser weißer Zähne. Bei Gelegenheit musste ich mir die Adresse seines Zahnarztes geben lassen. „Sie sind nicht die einzige.“
Gott sei Dank. Totalblamage abgewendet. George gab mir eine Nummer, die achtundvierzig, nachdem es mir gelungen war, ihm mitzuteilen, dass ich mitbieten wollte. Als er mich in eine Liste eingetragen hatte, entließ er mich mit einem verständnisvollen Lächeln ins Getümmel.
Kleidungstechnisch lag ich in der Mitte. Einige der Anwesenden trugen Anzüge und Kostüme, viele Frauen Kleider wie ich, wenn auch nicht gerade schwarz. Doch etliche waren auch leger mit Jeans und Hemd oder Bluse bekleidet. Was mich ärgerte, weil es zeigte, dass ich mich nicht hätte umziehen müssen. Ich hätte eine Stunde gespart und mich besser vorbereiten können. Doch was soll’s. Hier stand ich, schick und elegant, aufgeregt und hilflos.
Obwohl ich auf die letzte Minute gekommen war, schien es bis zum Beginn der Versteigerung noch etwas zu dauern, sodass ich Gelegenheit hatte, mich umzusehen. Ich schlängelte mich an den Leuten vorbei, grinste sie blöd an, wenn ein Anrempeln unvermeidbar war, und atmete dabei eine Million Kubikmeter Parfüm ein. Wie es wohl roch, wenn der Geschäftsinhaber mit seinen Kunstwerken allein war. Öl? Altes Leinen? Kupfer?
Die Ausstellungsgegenstände wirkten aus der Sicht eines Kunstbanausen – also meiner – nicht besonders aufregend. Aber wir waren ja auch nicht bei Christies oder Sotheby’s. Die Dinge, die nicht Teil der Auktion waren und regulär gekauft werden konnten, trugen Preisschilder mit Auszeichnungen von einigen Hundert Euro bis hin zu Beträgen im fünfstelligen Bereich. Ich dachte an die Kalender, die ich kaufte und die selten teurer waren als zwanzig Euro, und begann mich ein wenig zu schämen.
Nach einem ersten Umherstreifen kehrte ich zum Eingang zurück. Auf einem Tischchen unweit von Georges Domizil lagen die Kataloge, kleine Broschüren mit Abbildungen und Beschreibungen der zu versteigernden Gegenstände, alle in Hochglanz und Farbe. Ich nahm einen und blätterte ihn durch. Es waren Gemälde dabei, einige Bildhauerarbeiten, sogar ein Wandteppich, insgesamt zweiundfünfzig Stücke. Mein Medaillon trug die Losnummer achtzehn.
Um Punkt sechzehn Uhr fünfzehn ertönte ein Gong. Eine angenehme Frauenstimme bat die Anwesenden Platz zu nehmen. Wie die Lemminge strömten alle zum hinteren Teil der Galerie, wo einige Stuhlreihen aufgebaut waren. Vor der Stirnwand war ein Podest aufgebaut, links und rechts davon - auf mit Samttüchern ausgelegten Tischen – ruhten die zu ersteigernden Kunstgegenstände. Das Medaillon lag auf einem unscheinbaren Hocker, neben einer kleinen Kugel aus Bernstein. Bevor ich mich setzte, ging ich dort vorbei, um mir das Medaillon genauer anzusehen. Ich hatte die Hand noch nicht ausgestreckt, als dieselbe Altstimme, die das Publikum zum Setzen aufgefordert hatte, direkt neben meinem Ohr sagte: „Bitte nicht anfassen. Die Artikel werden gleich noch ausführlich vorgestellt.“
Ich drehte mich um. Hinter mir stand eine Frau mittleren Alters in einem eleganten weißen Kleid. Sie war schön und gepflegt, ihr Auftreten sicher und selbstbewusst. Offenkundig hatte ich es mit der Auktionatorin und Besitzerin der Galerie zu tun. Ohne ein weiteres Wort begab sie sich zum Podest, und ich setzte mich auf einen Stuhl in der hinteren Reihe. Erwartungsvolle Stille trat ein.
„Meine Damen und Herren, die Auktion ist eröffnet. Versteigert werden heute einige Gemälde und Skulpturen bekannter und weniger bekannter Künstler. Beginnen wir mit Los Nummer eins, einem Ölgemälde von Noel Koehn …“
Die ersten drei Lose hielt ich ganz gut durch. Danach fiel es mir schwer, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Mehrmals ertappte ich mich dabei, wie mir der Kopf auf die Brust fiel. Peinlich, aber als ich mich umsah, sah ich den ein oder anderen Leidensgenossen. Ich hatte mir Versteigerungen spannender vorgestellt. Das Los wird angeboten, die Bieter treiben den Preis in die Höhe, zum ersten, zum zweiten und zum dritten, der Hammer fällt. Zack, fertig, aus die Maus.
In Wirklichkeit geschah nichts dergleichen. Die Lose wurden vorgestellt - ruhig, sachlich, emotionslos. Die Gebote wurden abgegeben, ebenfalls völlig unspektakulär. Der Zuschlag wurde besiegelt mit den Worten Los Nr. X an den Bieter mit der Nummer Y. Einige Lose erhielten gar kein Angebot.
Nach einer Stunde, mit prickelndem Hintern und Thrombose in Lauerstellung, war ich gar und flehte das Ende herbei. Weitere zehn Minuten später, Sekundenbruchteile vor dem Absterben meiner unteren Gliedmaßen, war es endlich so weit. Die Stimme der Auktionatorin klang wie Musik in meinen Ohren.
„Nummer achtzehn. Aus dem Besitz einer Dame. Ein Medaillon aus reinem Sterlingsilber. Genaues ist nicht bekannt, seine Geschichte aber äußerst spannend. Produziert Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Berlin als Einzelanfertigung für die Gattin eines Adeligen, weitergegeben von Generation zu Generation, verloren gegangen in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, unlängst bei einer Haushaltsauflösung wiederentdeckt. Beachten Sie die Vorderseite mit der fein ziselierten Oberfläche und dem aufgesetzten Kreuz.“
Sie deutete auf die Diaprojektion an der Wand, die das Medaillon in seiner ganzen Pracht zeigte.
„Schlicht, einfach, genial. Es liegt naturgemäß keine Kaufurkunde mehr vor, aber Experten schätzen den Wert auf gegenwärtig fünfhundert Euro. Wir beginnen mit hundert. Wer bietet hundert?“
Ich kam nicht dazu, die Hand zu heben. Jemand anderes war schneller.
„Einhundert sind geboten. Wer bietet zweihundert?“
Dieses Mal war ich schneller.
„Zweihundert, meine Damen und Herren. Wer bietet dreihundert?“
Ich bekam nicht mit, dass irgendwo eine Hand gehoben wurde, aber die Worte der Auktionatorin zeugten von einem weiteren Gebot. „Dreihundert. Wer bietet vierhundert?“
Wieder schnellte meine Hand in die Luft.
Fünfhundert, sechshundert, siebenhundert … „Eintausend Euro sind geboten. Wer bietet mehr?“
Ich schluckte. Schätzwert fünfhundert, Gebot eintausend. Mein Scheck war blanko und mein Auftrag lautete, das Medaillon um jeden Preis zu ersteigern. Also steigerte ich.
Eintausend. Zweitausend … Fünftausend. Es war unglaublich.
Ein Raunen ging durch den Saal. Doch immer noch hoben sich Hände vor mir in die Höhe. Achttausend. Neuntausend. Zehntausend. Mir blieb die Luft weg. Ich hob die Hand. „Einen Augenblick, bitte. Ich brauche eine Bestätigung.“
Die Auktionatorin nickte. Ich lief nach draußen, fingerte den Auftragsbrief mit der Notfalltelefonnummer aus meiner Handtasche und rief bei meinem unbekannten Auftraggeber an.
„Ja?“ Die Stimme am anderen Ende war die eines alten Mannes, schwach, brüchig, hohl.
„Lavinia Borowski. Sie haben mich beauftragt, ein Medaillon …“
Weiter kam ich nicht. Ich wurde brüsk unterbrochen.
„Ich weiß, womit ich Sie beauftragt habe. Gibt es ein Problem? Das hoffe ich jedenfalls, weil ich Sie angewiesen hatte, nur im Notfall anzurufen.“
Warum fühlte ich mich jetzt schuldig? „Nun, äh, ich denke, es ist ein Notfall. Das Gebot liegt bei zehntausend Euro. Soll ich weiter bieten?“
Die Stimme am anderen Ende schwieg. Für genau eine Sekunde. „Bieten Sie weiter.“
„Bis wohin?“
„Bis zum Zuschlag.“
„Und wenn wir bei hunderttausend angelangen sollten?“
„Was ist Ihr Problem, Fräulein? Es ist mein Geld. Also bieten Sie.“
Ich will nicht sagen, dass er schrie. Aber die Antwort war laut genug, dass ich zusammenzuckte. Mehr kam nicht, er hatte aufgelegt.
Ich zuckte die Achseln, wackelte zurück und bot weiter.
Es waren drei Männer, alle in den Reihen vor mir, sodass ich nur ihre Hinterköpfe sah. Ein distinguierter Herr im schwarzen Anzug, der bei zwanzigtausend ausstieg. Ein junger Mann, dessen Attraktivität ich aus meiner Perspektive nur ahnen konnte; ihn raffte es bei fünfzigtausend dahin. Und dann mein Hauptkonkurrent, ein Riese mit kurzgeschorenem blonden Haar, der seine Sitznachbarn um einen Kopf überragte und sich, seit ich ihn erspäht hatte, nicht um einen Millimeter bewegt hatte, vom Heben der Hand abgesehen.
„Einhunderttausend Euro, meine Damen und Herren.“ Die Stimme der Auktionatorin zitterte vor Erregung. Das Raunen und Flüstern des Publikums war zu mittellautem Getuschel angeschwollen. „Wer bietet einhundertundzehn?“
Klein-Vinnie bot einhundertundzehn. Der Riese nicht. Er hob die Hand, bat um Pause und verschwand nach draußen. Sieh an, dachte ich, einer wie ich, ein Beauftragter, der sich rückversichern muss.
Als er zurückkam, hielt die Menge den Atem an. Blondie setzte sich nicht. Meine Haut begann zu kribbeln. Ich wurde beobachtet, das spürte ich. Ich drehte mich um.
Blondie starrte mich an. Seine eisblauen Augen funkelten wie Blitze, die mich durchbohrten. Als sein Blick in Richtung Podest ging, entspannte ich mich. Er schüttelte den Kopf und verließ das Haus. Stolz und aufrecht, keineswegs wie ein Verlierer.
„Einhundertzehn. Wer bietet mehr?“ Die Auktionatorin sah sich hoffnungsvoll in der Menge um, mit einem Gesichtsausdruck allerdings, der zeigte, dass das Ende der Fahnenstange erreicht war. „Los Nummer achtzehn. Für einhundertzehntausend Euro verkauft an die Dame mit dem schwarzen Kleid.“
Ich stand auf und lief nach draußen. Der blonde Riese interessierte mich. Ich umkreiste das Gebäude, aber Blondie war verschwunden.
Den Rest der Auktion bekam ich nur unbewusst mit. Ich hörte die schnarrende Stimme der Auktionatorin, doch die restlichen Lose zogen an meinem Auge vorbei, ohne dass ich sie wahrnahm. Ich hatte nur einen Gedanken. Wer war der blonde Hüne? Warum hatte er bei hunderttausend aufgehört? Das Medaillon war eindeutig überbezahlt, keine Frage. Doch seltsamerweise interessierte mich Blondies plötzlicher Ausstieg mehr als das Rätsel, warum mein Auftraggeber ein Vermögen für wertlosen Plunder ausgab.
Am Schluss der Veranstaltung füllte ich den unterschriebenen Scheck aus, gab meine Personalien an, zeigte meinen Ausweis, nahm das Medaillon in Empfang und verließ das Gebäude. Draußen sah ich mich noch einmal um. Von Blondie keine Spur.
3
Enttäuscht, aber nicht unzufrieden, erreichte ich den Wagen. Ein lautes Räuspern ließ mich herumwirbeln, die Hand im Stand-by-Modus an der Handtasche. Doch ich brauchte das Pfefferspray nicht. Es war nicht Blondie. Aber fremd war mir die Gestalt auch nicht, die sich angeschlichen hatte und mich dreisterweise anlächelte wie die Unschuld in Person. Der distinguierte Herr, den ich aus der Auktion nur von seiner Rückseite kannte. Von vorn sah er besser aus, nicht so alt, wie ich ihn in der Galerie geschätzt hatte. Groß, dunkelhaarig, schlank, verschmitzte braune Augen, blitzblanke Zähne, Ende dreißig. McDreamy für Arme. Der schwarze Anzug und die dunkle Krawatte vervollständigten das Bild eines Mannes, dessen Attraktivität nicht ganz an die George Clooneys aus der Galerie heranreichte, aber von der Bettkante würde ich ihn auch nicht stoßen.
„Verzeihen Sie, wenn ich Sie anspreche.“
Ich verzieh es ihm. Sein warmer Bariton ließ mich das Pfefferspray vergessen.
„Ich war auch auf der Auktion. Wir haben auf dasselbe Los geboten.“
„Das Medaillon.“
„Das Medaillon, ganz richtig. Hören Sie, es bedeutet für mich eine ganze Menge. Sie wären nicht zufällig bereit, es mir zu verkaufen?“
Ich hätte ihm mein Herz verkauft, meine Kleider, meinen Körper, alles. Aber nicht das Medaillon.
„Tut mir leid. Es gehört mir nicht. Ich arbeite im Auftrag.“
„Verstehe. Nun, dann kann ich wohl nichts machen.“ Er nickte mir zu und leitete seinen Rückzug ein. Nachdem er ein paar Schritte gegangen war, wandte er sich noch einmal um. „Hören Sie, da ist etwas, was Sie wissen sollten. Dieses Medaillon … Nun, wie soll ich sagen? Es ist nicht ungefährlich, es zu besitzen.“
„Wie meinen Sie das?“ Das Pfefferspray wanderte wieder in den Mittelpunkt meiner Gedanken.
„Sie waren auf der Auktion. Es gibt Interessenten für das Medaillon. Und einige Interessenten sind … Wie soll ich sagen? Manche würden einiges dafür tun, in seinen Besitz zu gelangen.“
In meinem Kopf wurde es eng. Zum Pfefferspray gesellte sich Blondie. „Was wollen Sie damit sagen? Muss ich um mein Leben fürchten?“
Sein Gesicht verzog sich, als hätte er in eine Zitrone gebissen. „Passen Sie einfach auf sich auf. Das gleiche gilt für Ihren Auftraggeber.“
Mit diesen Worten verschwand er endgültig. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich nicht, dass ich ihn unter dramatischen Umständen wiedersehen sollte.
Als Boxerin bin ich gewohnt, eine Menge einzustecken. Schmerzen und Verletzungen gehören dazu wie die Luft zum Atmen. Nicht jedoch die Bedrohung meines Lebens, so jämmerlich es auch sein mochte. Doch seine Worte ließen keinen Spielraum für Interpretationen. Passen Sie auf sich auf. Mir lief es kalt den Rücken hinunter.
Was hatte es mit diesem verdammten Medaillon auf sich? Warum waren mehrere Personen bereit, das Zweihundertfache seines tatsächlichen Wertes zu bezahlen? Wäre McDreamys Warnung nicht gewesen, hätte meine Neugier mich zu entsprechenden Ermittlungen verleitet. Doch jetzt wollte ich das lebensgefährliche Schmuckstück nur noch loswerden, und zwar so schnell wie möglich. Es gab nur ein Problem.
Warum musste es der Bielefelder Bahnhof sein? Hatte der Mindener keine Schließfächer? Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht einmal, ob der Mindener Bahnhof durchgehend geöffnet hatte. Der Bielefelder anscheinend schon. Also auf nach Bielefeld.
Ich beschloss, die Bahn zu nehmen. Ich wollte ja kein Sightseeing machen. Ich musste nur zum Bahnhof. Außerdem konnte ich im Zug besser nachdenken als im Auto. Über McDreamy. Über Blondie. Über meinen unbekannten Auftraggeber. Über das Medaillon und darüber, dass jemand bereit war, dafür Leib und Leben seines Besitzers zu gefährden. Meines.
Der Tatsache, dass ich den Bahnhof weit nach Feierabend erreichte, verdankte ich, dass ich mühelos einen Parkplatz fand. Die Fahrkarte war schnell gelöst, und so bestieg ich den Zug um 19.02 Uhr.
Das Abteil beherbergte außer mir eine Handvoll grölender Teenager mit Bierdosen. Kein schöner Anblick, aber genau das, was ich brauchte. Ein Schutzschild aus Personen, die mir helfen würden, falls die von McDreamy angedeutete Gefahr real werden sollte. Ich hoffte nur, dass die Meute bis Bielefeld im Zug blieb.
Der Zug war kaum angefahren, als ich das Öffnen der Abteiltür hinter mir hörte. Ich drehte mich um. Was ich sah, gefiel mir gar nicht. Es war Blondie. Er starrte mich an. Ich starrte zurück. Er kam näher, blieb neben meinem Platz stehen.
„Entschuldigung, ist hier frei?“
Sonorer Bariton, perfekt für Gutenachtgeschichten. Kam jetzt Klein-Vinnies Gutenachtgeschichte? Ich ließ meinen Blick demonstrativ durch den Waggon schweifen, um Blondie darauf aufmerksam zu machen, dass nahezu alle Plätze frei waren.
Er holte sein Grinsegesicht aus dem Koffer und nahm mir gegenüber Platz. Selbst im Sitzen überragte er mich um einen Kopf.
Ich musterte ihn wie die Maus die Schlange, die Hand an der Schließe meiner Handtasche. Blondie war der beste Kunde seiner Muckibude, Brust und Arme platzten vor Muskeln. Sein Gesichtsausdruck war emotionslos wie der eines Folterknechts, der seinem Opfer die Fingernägel ausreißt. Ich tippte auf Spezialeinheit oder Fremdenlegion. Das blonde Bürstenhaar bildete einen harten Kontrast zu seinem gebräunten Gesicht.
Am schlimmsten jedoch waren seine Augen. Stahlblaue Gewehrkugeln, die meinen Körper durchdrangen wie Hohlmantelgeschosse. Die Augen eines Killers. Augen, die kurz davor standen, mich zu töten. Die ganze Situation erinnerte mich an die Zugszene in Liebesgrüße aus Moskau.
Sein Mund öffnete sich wie das Maul eines Hais beim Angriff. Gleichzeitig schnippte er mit den Fingern. „Wir kennen uns. Sie waren doch auch auf der Auktion.“
Scheinheiliges Arschloch. Wenn er nicht unter Alzheimer litt, konnte er mich seit der Auktion kaum vergessen haben. Zu groß war die Schmach, die ich ihm bereitet hatte.
„Sie haben mir das Medaillon vor der Nase weggeschnappt. Und? Zufrieden mit Ihrem Erwerb?“
Ich sagte nichts. Meine Augen sagten alles.
„Sie wären nicht zufällig bereit, es mir zu verkaufen? Mir liegt wirklich viel daran.“
Warum hatte der Blödmann dann bei hunderttausend aufgehört?
„Bei der Versteigerung musste ich bei hundert aufhören. Aber nach jetzigem Kenntnisstand könnte ich Ihnen das Doppelte bieten.“
Mööp. Mööp. Mööp. Alarmstufe Rot. Lavinia, dachte ich, sieh zu, dass du hier wegkommst. Ich hatte das Gefühl, dass gleich etwas Schlimmes geschehen würde. Zweihunderttausend Eier für Modeplunder, der sogar mit dem Schätzwert von fünfhundert meiner Meinung nach überbewertet war. Was war hier los? Warum waren so viele Leute hinter diesem blöden Medaillon her?
Was immer es war, es interessierte mich nicht. Ich wollte das verdammte Ding nur noch so schnell wie möglich loswerden. Und natürlich auch Blondie. Das hieß, ich würde Bielefeld nicht so schnell erreichen wie geplant.
Ich entschloss mich zu einer Strategieänderung, die hoffentlich bewirken würde, dass ich Bielefeld überhaupt erreichte. Ich stand auf. „Ich muss mal aufs Klo.“
„Soll ich solange auf das Medaillon aufpassen?“
Ich würdigte diese Frage keiner Antwort und verließ ohne ein weiteres Wort den Waggon. Die Toilette war zwei Wagen weiter vorne. Als ich drin war, stellte ich fest, dass ich tatsächlich pinkeln musste. Kaum saß ich, hielt der Zug. Porta Westfalica. Scheiße. Jetzt musste ich bis Bad Oeynhausen weiterfahren.
Ich blieb auf der Toilette, bis die Ansage für Bad Oeynhausen kam. Beim Anziehen kam mir eine Idee. Ich holte das Medaillon aus der Handtasche und steckte es mir ins Höschen. Ein bisschen unbequem, aber bis Bielefeld würde es gehen. Dann machte ich mich bereit. In dem Moment, als der Zug hielt, stürzte ich aus der Kabine, rannte zur Tür, wartete, bis meinem Gefühl nach die Abfahrt bevorstand, und sprang dann auf den Bahnsteig. Es glückte. Kaum hatten meine Füße den Boden berührt, schlossen sich die Türen und der Zug setzte sich in Bewegung. Blondie hatte keine Chance. Rasch verschwand ich hinter dem alten Bahnhofsgebäude, bevor er mich aus dem Fenster sehen konnte.
Die nächste Verbindung nach Bielefeld war eine Regionalbahn um 19.37 Uhr. Ich verbrachte die Zeit am Bahnsteig. Stehend. Bei meiner Flucht aus dem Zug hatte ich die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass das Medaillon unangenehme Dinge mit der Region zwischen meinen Beinen machte.
Der Zug war pünktlich. Ich erreichte Bielefeld ohne weitere Zwischenfälle um 19.58 Uhr. Der Bahnsteig war nahezu leer. Trotzdem sah ich mich vorsichtig um. Eine überflüssige Maßnahme, Blondie war nirgends zu sehen. Wie auch? Er kannte mein Ziel ja nicht.
Ich betrat die Bahnhofshalle. Im selben Moment war es da: das Gefühl, verfolgt zu werden. Ein verdammt mieses Gefühl. Man sieht nichts. Man hört nichts. Doch Haut und Magen sagen einem, dass etwas nicht stimmt. Hektisch sah ich mich um. In der Halle wuselten etwa fünfzig Leute umher. Nicht einer hatte auch nur annähernd die Gestalt oder das Aussehen meines blonden Widersachers. Ich schalt mich eine dumme Nuss, die unter Verfolgungswahn litt. Doch je näher ich meinem Ziel, den Schließfächern, kam, desto stärker wurde das Verfolgungsgefühl.
Ich machte einen Umweg und kaufte bei Subway ein BBQ Rib Sub. Ich hatte nicht wirklich Hunger, aber das Knabbern gab mir Gelegenheit, mich in Ruhe umzusehen. Schon nach einer Minute hörte ich mit dem Umsehen auf, weil ich spürte, dass dieses Verhalten mich in den Wahnsinn treiben würde. Hinter jeder Nische sah mein alarmiertes Auge einen blonden Riesen, der nur darauf wartete zuzugreifen, wenn ich vorbeikam.
Ich begann mich zu fragen, warum ich eigentlich solche Angst vor Blondie hatte. Die Antwort war einfach. Die Größe, die Kraft, die Energie, die latente Gewalt. Die Lust zu töten. Ich hatte sie gespürt. Im Zug, als er mir gegenüber saß. Auf der Auktion, als seine kalten Mörderaugen meine trafen. Ich hatte in meinem Leben viele Killer gesehen und ihre tödliche Aura gespürt. Doch keiner kam an den blonden Riesen heran. Blondie war ein Killer. Ich wusste es. Genauso, wie ich wusste, dass er hinter mir und dem Medaillon her war.
Nachdem ich das Brötchen zu einem Drittel heruntergewürgt hatte, hielt ich inne. Auf den Rest hatte ich keine Lust mehr. Einen Moment starrte ich es an, überlegte, was ich damit machen sollte, dann warf ich es in den nächsten Mülleimer. Ich schlenderte hinüber zum Getränkestand und kaufte eine Cola, die ich in zwei Zügen austrank.
Ein neuer Zug traf ein. Neue Passagiere, aber kein blonder Hüne. Allmählich beruhigten sich meine Nerven. Dennoch wollte ich auf Nummer Sicher gehen. Außerdem musste ich dringend das Medaillon aus meinem Höschen pulen, wenn ich nicht die nächsten vierzehn Tage im Zölibat verbringen wollte. Wie im Zug, suchte ich die Toilette auf. Drei Minuten später schlich ich vorsichtig wieder nach draußen, das Medaillon in meiner Handtasche. Nichts. So sehr ich meine Augen anstrengte, Blondie war nirgends zu sehen. Ich atmete durch und marschierte los.
Die Schließfächer befanden sich in einer Nische am Ende des Bahnhofs, mit einer Mauer vom Gewusel der Halle abgegrenzt. Ein dunkler, schlecht ausgeleuchteter Platz. Ideal für einen Überfall. In diesem Augenblick war ich die einzige Anwesende. Trotzdem suchte ich jeden Zentimeter ab, kroch förmlich über den Boden, linste in jeden Spalt. Zum Schluss warf ich einen letzten Blick in die Runde, lugte hinter der Mauer hervor in die Schalterhalle. Nein, Blondie war definitiv nicht in Bielefeld.
Ich öffnete die Handtasche und holte den Schlüssel hervor, den mein Auftraggeber mir geschickt hatte. Nummer vierzehn. Zweite Reihe von oben. Ich steckte den Schlüssel hinein. Er passte. Natürlich. Langsam öffnete ich das Fach. Leer. Natürlich. Dann holte ich das Medaillon aus der Tasche, nahm es in beide Hände und betrachtete es ein letztes Mal. Groß, schwer, glänzend, hübsch. Aber nichts, was darauf hindeutete, dass das kleine Scheißerchen ein gefährliches Geheimnis barg.
Es sollte nicht mehr ins Fach kommen. Der Druck eines harten Gegenstandes, der sich in Herzhöhe in meinen Brustkorb bohrte, verhinderte dies und ließ mich gerade werden.
„Keine Bewegung.“
Der Befehl war überflüssig. Ich war bereits erstarrt. Die Stimme war nicht zu erkennen. Nicht mehr als ein heiseres Flüstern. Verstellt natürlich. Doch ich wusste auch so, wer hinter mir stand.
„Drehen Sie sich nicht um. Sie haben da etwas, was mir zusteht. Ich schlage Ihnen ein kleines Tauschgeschäft vor. Sie schenken mir das Medaillon, ich schenke Ihnen das Leben. Was halten Sie davon?“
Ich hielt das für ein gutes Geschäft. Meine Hand mit dem Medaillon wanderte in die Höhe. Eine andere Hand griff danach.
„Legen Sie die Hände auf den Rücken, die Stirn an die Fächer. Beine spreizen.“
Eine Zusatzklausel zu unserem Geschäft? Ich folgte dem Befehl ohne Widerstand. Dann spürte ich Blondies harte Hände, die meine Beine im Fünfundvierzig-Grad-Winkel nach hinten stellten. Schlaues Kerlchen. Sicherungsmaßnahmen bei Festnahmen. Ein Tritt gegen die Beine, und ich wäre ein Fall für den Gesichtschirurgen.
„Zählen Sie bis hundert.“
Ich zählte. Ich kam bis fünf. Dann machte ich einen Fehler. Als der Druck in meinem Rücken verschwand, warf ich die Arme nach vorn, drückte mich gegen die Schließfächer, stieß mich ab, wirbelte herum …
Der Scheißkerl hatte einen Elektroschocker. Meine Sinne verließen mich. Ich sah nichts, hörte nichts, schmeckte nichts, roch nichts. Aber ich spürte. Schmerzen. Noch mehr Schmerzen. Nur noch Schmerzen. Mein Körper krampfte und zitterte gleichzeitig. Mein letzter bewusster Gedanke galt James Bond. Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt.
Ein junges Paar fand mich eine Ewigkeit später.
4
Ich verbrachte eine entwürdigende Nacht im Krankenhaus.
Das Muskelzittern hatte noch am Bahnhof aufgehört, vor allem, nachdem der Notarzt mir ein Sedativ gespritzt hatte. Aber ich hatte mich eingenässt und mich über mein kleines Schwarzes erbrochen, sodass sie mir im Krankenhaus die nassen stinkenden Sachen auszogen. Mehrere Stunden verbrachte ich in der Notaufnahme, halbnackt auf einem Krankenbett, den Blicken aller ausgesetzt, die da herumwuselten: Ärzte, Schwestern, Kranke und deren Angehörige. Es zog wie Hechtsuppe. Aber irgendwann dämmerte ich weg. Und als ich aufwachte, lag ich zugedeckt in einem Stationszimmer.
Es waren die frühen Morgenstunden. Wachwechsel. Niemand kümmerte sich um mich. Geplagt vom stärksten Muskelkater meines Lebens, schlug ich die Bettdecke zurück und schwankte zum Klo. Mein Magen wollte etwas loswerden, und in meiner Blase befand sich ein ganzer Eimer Wasser. Noch müde vom Sedativ wackelte ich zurück ins Bett. Beiläufig registrierte ich, dass außer mir drei Frauen im Zimmer waren, zwei ältere jenseits der fünfzig und eine jüngere. Mehr konnte mein Hirn nicht verarbeiten, bevor ich wieder einschlief.
Das nächste Mal wurde ich wach, als mich zwei freundliche Schwestern weckten. Sie trieben mich höflich, aber bestimmt aus dem Bett, um es für den Tag aufzubereiten.
Nackt und verloren stand ich daneben, begafft von meinen Zimmergenossinnen. Da ich in diesem Moment zur Tatenlosigkeit verurteilt war, tapste ich ins Bad. Auch wenn ich weder Duschgel noch Shampoo hatte und mangels Zahnbürste meine Zähne mit Wasser und Zeigefinger reinigen musste, tat die Dusche gut. Die Muskelschmerzen aber blieben. Glücklicherweise hatte jemand an Handtücher gedacht. Leider waren es Exemplare für Hobbits. Das Tuch, das ich nahm, um meinen Unterleib zu verhüllen, musste ich mit der Hand festhalten, damit es nicht herunterfiel.
Nach dem Frühstück bekam ich ein Hemdchen. Ich verkniff mir zu fragen, warum erst jetzt. Später kam die behandelnde Ärztin, klärte mich auf, dass außer dem Sedativ bisher nichts gelaufen war. Nachdem ich ihr berichtet hatte, dass ich Opfer einer Taserattacke geworden war, wurde sie flott. Wieder musste ich mich ausziehen. Ich wurde geröntgt. Mein Körper wurde abgetastet. Jede Berührung tat weh, aber es war zu ertragen. Kein Vergleich zu den Stromstößen vom Vorabend. Die Ärzte taten wirklich alles, um mir wieder auf die Beine zu helfen. Trotzdem fragte ich mich, ob der ganze Aufwand nicht ein bisschen über das Ziel hinausschoss. Ich war schließlich nicht unter einen LKW geraten.
Gegen Mittag waren sich die Ärzte einig, dass ich keinen bleibenden Schaden erlitten hatte und gehen konnte. Das war die gute Nachricht. Die schlechte war, dass sich meine Sachen nicht wieder anfanden. Bis auf meine Schuhe und die Handtasche war alles weg. Mithilfe der grünen Damen gelangte ich in den Besitz einer zu großen Jeans und einer zu kleinen Bluse sowie gültiger Unterwäsche, sodass ich das Krankenhaus zivilisiert verlassen konnte.
Ich hätte ein Taxi nehmen können, doch der Bahnhof war nicht weit entfernt und ich brauchte frische Luft und Zeit zum Nachdenken.
In einem kleinen Café in der Nähe des Jahnplatzes nahm ich ein Mittagessen bestehend aus Schinkenbrot, eisgekühltem Bommerlunder und einem Pott Kaffee zu mir und reflektierte die Ereignisse des Vortags.
Das Medaillon war weg. Hundertzehntausend Euro im Arsch. Ich fragte mich, was meine Versicherung dazu sagen würde. Ich fragte mich auch, was mein Auftraggeber dazu sagen würde. Aber ich fragte mich nicht, wer mir das eingebrockt hatte. Ich hatte ihn nicht gesehen, weil er mir buchstäblich in den Rücken gefallen war. Außerdem hatte er seine Stimme verstellt. Dennoch hatte ich nicht den geringsten Zweifel, dass meine Nemesis zugeschlagen hatte. Blondie, der Erste. Wie zum Henker war es ihm nur gelungen, mich aufzuspüren? Ich war mir sicher, ihn in Bad Oeynhausen abgehängt zu haben. Vermutlich war auch er irgendwo ausgestiegen und hatte den Folgezug nach mir abgesucht. Was nicht schwierig war, da ich dumme Nuss am Fenster gesessen hatte. Schwerer Fehler. Das würde mir nicht noch mal passieren.





























