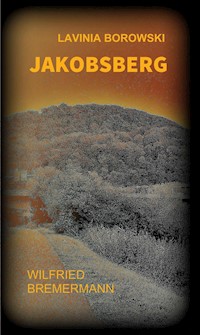2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünf unheimliche Erzählungen. Eine Hommage an H. P. Lovecraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Wilfried Bremermann
Die virginische Nymphe
Phantastische Erzählungen
© 2015 Wilfried Bremermann
Autor: Wilfried Bremermann
Umschlagfoto: captblack76 - Fotolia
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-7323-6914-0 (Paperback)
ISBN: 978-3-7323-6915-7 (Hardcover)
ISBN: 978-3-7323-6916-4 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Noras Insel
Mordmoor
Die virginische Nymphe
Die Hütte
Die Steine von Haithabu
Noras Insel
Jackson sah sie als Erster. Oder genauer gesagt, er sah das Boot als Erster. Erst als wir es an Bord hievten, sahen wir, dass eine Frau darin lag. Sie war jung und hübsch. Und sie war tot. Sie war nackt bis auf einen Seidenschlüpfer, von dem allerdings nicht mehr als ein paar dünne Fetzen ihre blasse Haut bedeckten. Was jedoch am bemerkenswertesten war, war ihr Gesichtsausdruck. Nie zuvor hatte ich ein Gesicht gesehen, das derart von Furcht und Grauen gezeichnet war wie das jener Frau. Tiefe Falten gruben sich in das schöne Antlitz. Die Mundwinkel waren verzerrt wie in tiefem Schmerz und gaben den Blick auf wunderschön gewachsene Zähne frei. Ihre Lider waren geschlossen, doch umrahmt von Falten, die ihrem Gesicht trotz ihrer Jugend den Charakter einer Frau mittleren Alters gaben. Am erstaunlichsten allerdings war ihre Körperhaltung. Im Tod hatte sie sich zusammengerollt wie ein Fötus, als habe sie sich gegen irgendwelche Unbill schützen wollen. Die See war in den letzten Tagen eher ruhig gewesen, sodass ich Furcht vor Wind und Meer bei ihr ausschloss. Was hatte diese Frau gesehen, dass die Furcht sie derart gefangen hielt? War sie an dieser Furcht gestorben, auch wenn ihr abgemagerter Körper und das Fehlen von Lebensmitteln auf Verdursten und Verhungern hinwiesen?
Mein Name ist Will Riker. Ich bin Kapitän des Forschungsschiffes DARWIN. Wir lagen zwischen Australien und Neuguinea, als Jackson, unser Biologe, seine verhängnisvolle Entdeckung machte. Wir waren mitten in einem Forschungsauftrag über die mögliche Nutzung von Plankton als Lebensmittel. Eine Rückfahrt nach Darwin oder Sydney hätte uns mindestens zwei Wochen gekostet, kam wegen der Dringlichkeit unseres Auftrags aber ohnehin nicht in Frage. Andererseits konnten wir die Leiche nicht für Wochen oder gar Monate an Bord behalten. Abgesehen von dem alten Aberglauben, dass Tote an Bord Unglück bringen, hatten wir auch gar nicht die Möglichkeit, ihren Körper so lange zu konservieren. Deshalb entschied ich, dass die Unbekannte eine Seebestattung erhalten sollte. Vorher jedoch wollten wir sie obduzieren, um ihre Todesursache zu ergründen; Verdursten war schließlich nur eine Vermutung.
Nun, um es kurz zu machen, sie war eindeutig verdurstet. Sie musste mehrere Tage in ihrer Nussschale – viel mehr war das Boot, in dem wir sie fanden, nicht – verbracht haben. Ihr Tod war also ein natürlicher. Die Frage blieb jedoch, was ihren Tod verursacht hatte. Was hatte sie in das Boot getrieben? Warum hatte sie kein Wasser und keine Lebensmittel dabei? War sie geflüchtet? Wenn ja, wovor? War sie unschuldig in eine schlimme Lage geraten? War sie vielleicht ein böses Wesen, das von anderen zum Tod auf dem Meer verurteilt worden war? Letzteres konnte ich mir nicht vorstellen, da sie selbst ja grausige Furcht empfunden hatte, wie ihr verzerrter Gesichtsausdruck bewies. Das Geheimnis beschäftigte mich und die Crew bis zum nächsten Morgen. Dann nämlich stießen wir auf die Lösung des Rätsels. Aber ich will nicht vorgreifen.
Es war wie üblich frisch und neblig, als die Sonne aufging. Schon früh hatte ich die Besatzung an Deck beordert. Der Schiffsarzt hatte die Leiche der schönen Frau in Sackleinen gewickelt. Derart präpariert wartete sie nun darauf, in der kühlen See bestattet zu werden. Ich sprach ein Gebet und ein paar Abschiedsworte, die mir passend schienen. Dann hievten wir das Paket über Bord und sahen beim Vaterunser zu, wie es langsam in den Fluten versank.
Die nächsten Stunden vergingen in Routinearbeiten, die uns vorübergehend von dem Mädchen ablenkten. Gegen elf jedoch vernahm ich den Ruf des Schiffsjungen. Schon gestern hatte ich entschieden, dass wir – quasi als Beweisstück – das Boot des Mädchens an Bord behalten wollten. Danach hatte ich keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Jetzt wurde es mir auf dramatische Weise ins Gedächtnis zurückgeholt. Hemmings, der Junge, hatte vom Ersten den Auftrag bekommen, nach dem Boot zu sehen und, falls erforderlich, Maßnahmen zu seiner Sicherung zu treffen. Und dabei stieß er auf das Buch.
Als ich am Boot eintraf, hielt er es in seiner Hand. Die halbe Besatzung stand um ihn herum, sodass ich mir meinen Weg zu ihm mühsam durch eine dichte Kette schwitzender Männerleiber bahnen musste. Schweigend hielt Hemmings mir seinen Fund entgegen. Es war ein Tagebuch. Das heißt, eigentlich war es das Logbuch eines Schiffes namens CAROL ANN. Doch nach einem Blick hinein sah ich, dass die Notizen des Kapitäns am Dienstag, den 11. November 1930 – also vor vier Wochen – plötzlich endeten und statt ihrer in kleiner ordentlicher Mädchenschrift Einträge folgten, die den Charakter von Tagebucheintragungen besaßen. Es war ohne Zweifel die Geschichte unserer Jane Doe.
Ich nahm das Buch an mich und brachte es in meine Kajüte. Der Tag war vollgestopft mit Arbeit, sodass ich erst am Abend dazu kam, es mir genauer anzusehen. Die Einträge des Kapitäns will ich überspringen, obwohl sie allein Stoff genug für ein spannendes Buch enthielten. Nur so viel: Bei der CAROL ANN handelte es sich um ein Handelsschiff, das am Morgen des 8. September in San Francisco mit dem Ziel Sydney gestartet war. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke Neuguinea-Australien – also etwa dort, wo wir uns jetzt befanden – war sie in einen heftigen Sturm geraten. Das war am 3. Oktober gewesen. Hier endeten die Aufzeichnungen des Kapitäns. Das aufgequollene Papier und die verwischten Buchstaben, die ich nur mit Mühe entziffern konnte, hatten mich schon gleich am Anfang auf den Gedanken gebracht, dass die CAROL ANN gesunken war. Offenbar hatte Jane Doe das Logbuch als Treibgut gefunden und es fortan als Möglichkeit genutzt, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Die Schrift war anfangs gleichmäßig und mit ruhiger zarter Hand geschrieben. Doch je weiter ihre Erzählung gedieh, desto ungleichmäßiger wurden die Buchstaben und Wörter, als hätte sie die Kontrolle über ihre Handbewegungen verloren. Hatten ihre Hände gezittert? Hatte ihre Furcht am Ende schon lange vor ihrer Flucht mit dem winzigen Boot eingesetzt? Die Auflösung lag in den Seiten vor mir.
Und dies ist die Geschichte des Mädchens.
Mein Name ist Nora Watts. Ich wurde geboren am 10. Februar im Jahr des Herrn 1903. Mein Vater war William Watts, ein bekannter Bankier aus New York. Meine Mutter heißt Emily. Außerdem habe ich vier Geschwister, zwei Brüder und zwei Schwestern, allesamt jünger als ich. Ich wuchs in New York auf und besuchte dort die Miller-School für höhere Töchter. Meine Kindheit und Jugend waren unbeschwert. Neben der Schule konnten wir Kinder unseren Neigungen und Interessen nachgehen, weil wir die Möglichkeit besaßen. Vater verdiente in der Bank gutes Geld, sodass wir uns Bediente leisten konnten, die uns den Haushalt führten. Zeitweise gab es sogar eine Nanny, die auf uns Kinder aufpasste.
Im Nachhinein wundere ich mich, wie schnell die schönen Jahre vergingen, auch wenn es mir damals so vorkam, als würde die Zeit stillstehen. Auch die dunklen Jahre von 1914 bis 1918, die Europa mit einem grausigen Krieg überzogen, gingen spurlos an uns vorüber. Doch dann kam der 24. Oktober 1929, der Tag, der als Schwarzer Freitag in die Börsengeschichte einging. An einem einzigen Tag verloren wir unser gesamtes Vermögen, am Tag darauf Vater seinen Posten. Und am abermals nächsten Tag war Vater tot. Wie Tausende andere, die mit der Schmach plötzlicher Armut nicht leben konnten oder wollten, hatte er seinem Leben durch eigene Hand ein Ende gesetzt und Mutter und uns fünf Kinder unserem Schicksal überlassen. Plötzlich waren wir mittellos. Zum ersten Mal in unserem Leben erfuhren wir, was Hunger ist. Da wir kein Geld mehr hatten, verkauften wir nach und nach unseren Hausrat, bis irgendwann dann auch das Haus selbst an der Reihe war. Dies war ein halbes Jahr später. Nun waren wir also auch obdachlos. Es wurde schwierig für Mutter, die Familie zusammenzuhalten. Sie fand eine Stelle als Hausmädchen, aber uns Kinder konnte sie in der kleinen Kammer, die ihr von ihrer Herrschaft zugestanden wurde, nicht unte13rbringen. So teilten wir uns auf. Zum Glück waren wir, bis auf die kleine Lucy, die erst zwölf war und bei Mutter bleiben konnte, alt genug, um uns selbst um uns zu kümmern. Wir nahmen jede Arbeit an, die wir bekamen: als Hausmädchen, als Hausmeister, als Fabrik- und Hafenarbeiter. Aber stets waren es nur Tagelöhnerjobs, und es gab viele Tage, an denen wir nichts zu arbeiten hatten und infolgedessen Hunger leiden mussten. Irgendwann begannen wir zu stehlen, weil wir keine andere Möglichkeit mehr sahen, an Geld und Essen zu kommen. Wir schliefen unter Brücken und in leer stehenden, baufälligen Häusern.
Ach, es war eine schlimme Zeit, und ich will die Erinnerungen daran nicht festhalten. Deshalb komme ich jetzt an den Punkt, der mein Leben entscheidend verändern sollte. Oder sollte ich sagen: der der Beginn meines Todes war? Denn dass mein Abenteuer mit dem Tod enden wird, daran dürfte kein Zweifel bestehen. Allein auf weiter See, weit und breit kein Land in Sicht, kein Schiff. Kein Essen, kein Wasser, dazu gnadenlose, glühend heiße Sonne. Nein, ich mache mir nichts vor. Lieber Leser, wenn du diese Zeilen liest, werde ich also wahrscheinlich tot sein. Aber ich möchte, dass die Nachwelt weiß, wie es dazu gekommen ist. Und ich hoffe, dass Nora Watts aus New York nicht völlig vergessen wird.
Irgendwann in jenen dunklen Monaten hörte ich, dass in Australien Hausmädchen gesucht wurden. Ich hatte bereits als solches gearbeitet, doch gleich mir waren Millionen anderer Mädchen und Frauen auf dieselbe Idee gekommen, sodass der Markt in den Vereinigten Staaten übersättigt und die Löhne so niedrig waren, dass man davon nicht mehr leben konnte. Ich suchte also nach einer Möglichkeit, nach Australien zu gelangen.
Ich fand sie in der CAROL ANN, einem Frachtschiff, das regelmäßig zwischen San Francisco und Sydney verkehrte. So machte ich mich also auf die lange beschwerliche Reise an die Westküste. Ich brauchte vier Wochen, weil ich mir immer wieder durch Tagelöhnerarbeit das Geld für die Bahn verdienen musste. Als Skelett kam ich schließlich am 8. Oktober in San Francisco an. Ja, als Skelett, denn durch das ständige Hungern, anders war das Geld für den Zug nicht zusammenzuhalten, war ich derart abgemagert, dass ich mehr einem Jungen als einer Frau ähnelte.
Wie es mir gelang, eine Passage für den Frachter zu erlangen, will ich lieber gar nicht erst berichten. Nur so viel: Ich musste an Bord arbeiten wie ein Sklave, von morgens bis abends putzen, wischen, Wäsche waschen, Essen zubereiten, und des Nachts… Ich fühlte mich während jener Wochen wie Defoes Moll Flanders. Auf der CAROL ANN verlor ich das letzte bisschen Würde, das ich noch besaß, und ich schwor mir, mich nie wieder so schmutzig und gebraucht zu fühlen. Ich hielt nur durch, weil ich das Ziel eines besseren Lebens vor Augen hatte. Wie konnte ich ahnen, dass alles noch schlimmer kommen sollte?
Am Morgen des 11. November, ringsum nichts als das weite, unendliche Meer, weit und breit kein Land in Sicht, gerieten wir in einen heftigen Sturm. Das Schiff begann zu schlingern. Da ich kein Seemann und infolgedessen an das Schaukeln des Schiffes nicht gewöhnt war, verbrachte ich die meiste Zeit an Deck, um meinen Magen sich entleeren zu lassen. Der Sturm wurde immer heftiger und entwickelte sich zu einem wahrhaftigen Hurrikan. Ich hörte nur noch, wie der Captain sagte: „Großer Gott, so was habe ich noch nie erlebt.“ Dann sah auch ich die gigantische Welle, die auf uns zurollte. Niemand musste mir sagen, was das zu bedeuten hatte. Wenige Sekunden später war sie heran. Die CAROL ANN, im Vergleich zu der Monsterwelle nicht mehr als eine Nussschale, hatte keine Chance und ging mit Mann und Maus unter. Verzweifelt bemühte ich mich, in der rauen See nicht unterzugehen, doch meine Kräfte waren rasch erschöpft und kamen gegen die entfesselten Urgewalten nicht an. Dann stieß mein Kopf an etwas. Bevor ich das Bewusstsein verlor, dachte ich nur, dass das mein Ende wäre.
Irgendwann kam ich wieder zu mir und wunderte mich, dass ich noch am Leben war. Als ich die Augen öffnete, sah ich einen strahlend blauen Himmel. Intensiver Sonnenschein wärmte meine Haut. Ich hörte das Plätschern des Wassers und fühlte eine schaukelnde Bewegung. Als ich mich aufrichtete, sah ich, dass ich in einem Boot lag. Ich erkannte, dass es das kleine Boot war, das die Männer der CAROL ANN immer genutzt hatten, wenn sie Erkundungen an Land eingezogen hatten. Es war klein, doch es hatte mich gerettet. Wie jedoch war ich an Bord gekommen?
Und dann sah ich, dass ich nicht allein war. Zu meinen Füßen lag ein Mann - der Kapitän der CAROL ANN. Ich brauchte nicht lange um zu erkennen, dass er tot war. Sein Körper war blutüberströmt. In der Hand hielt er etwas, das ich als das Logbuch der CAROL ANN erkannte. Sofort erinnerte ich mich an den Frachter und die vergangenen Ereignisse. Ich blickte mich um, doch weit und breit war nichts weiter als das unendliche Meer. Keine Spur von dem Schiff und seiner Besatzung.
Ich wandte mich wieder der Leiche des Kapitäns zu. Wie hatten wir beide es geschafft, an Bord dieses Bootes zu kommen? Ich konnte es mir nur so erklären, dass der Captain mich gerettet hatte und bei dem Versuch selbst schwer verletzt worden war. Offenbar war es ihm mit letzter Kraft gelungen, meinen Körper an Bord des Bootes, das durch glückliche Umstände den Untergang des Frachters überstanden hatte, zu hieven und anschließend selbst hineinzuklettern. Doch offenkundig waren seine Verletzungen so schwer, dass er letztendlich daran verstarb.
Ich wusste nicht, wie viele Stunden seit dem Untergang der CAROL ANN vergangen waren. Ich wusste nur, dass ich lebte und vermutlich die einzige Überlebende war. Und dass ich nichts weiter besaß als die Fetzen, die ich auf dem Leibe trug. Mutlos musste ich erkennen, dass die einzige Überlebende wohl nicht lange überleben würde. Denn zwar war es dem Kapitän gelungen, mich zu retten, doch unglückseligerweise gab es in dem kleinen Boot weder Wasser noch Nahrung. Und weit und breit kein Land in Sicht. Es war also nur eine Frage der Zeit, wann auch ich das Schicksal des Kapitäns und des Restes der Besatzung teilen würde.
Es dauerte auch nicht lange, bis mein Todeskampf begann. Die Sonne brannte vom Himmel herab, heiß und unerbittlich. Zuerst verbrannte sie meine Haut, dann trocknete sie mich aus. Welche Ironie des Schicksals: Ich war umgeben von Wasser und konnte es nicht trinken. Am Abend erinnerte mich ein lautes Knurren in meinem Bauch daran, dass ich auch etwas zu essen brauchte. Als die Nacht hereinbrach, wurde es kühler, und ich begann zu fieren. Trotzdem legte ich mich nieder und war irgendwann eingeschlafen.
Der nächste Tag verging genauso wie der vorhergehende. Sonne, Wasser. Sonne, Wasser… Hilflos meinem Schicksal ausgeliefert, begann ich zu weinen und zu beten. Meine Rettung musste doch einen Sinn haben. Ich konnte doch in dem Hurrikan nicht mit dem Leben davongekommen sein, nur um jetzt qualvoll zu verhungern und zu verdursten. Irgendwann überwand ich meine Trägheit und begann zu rudern. Eine Sisyphusarbeit, denn so sehr ich mich auch anstrengte, das Boot schien sich nicht von der Stelle zu rühren.
Als mein Blick zufällig wieder auf die Leiche des Kapitäns fiel, bemerkte ich, dass sein Körper bereits Spuren von Verwesung aufwies. Natürlich, wir waren in den Tropen, und dort verwesten Körper wesentlich schneller als in den gemäßigten Breiten der amerikanischen Ostküste. Was sollte ich tun? Die Vorstellung, mit einer vergehenden Leiche an einen Ort gefesselt zu sein, erzeugte Ekel in mir. Und so tat ich, was ich tun musste. Ich sprach ein schnelles Vaterunser, dankte ihm noch einmal für meine Rettung und warf den Captain dann über Bord. Im Nu versank der Körper im Wasser. Fortan war ich ganz allein. Das einzige, was mir geblieben war, war das Bordbuch der CAROL ANN.
Der Tag dümpelte dahin. Die nächste Nacht kam. Dann ein weiterer Tag, eine weitere Nacht. Am vierten Tag im Boot war ich am Ende meiner Kräfte war und bereitete mich auf meinen Tod vor. Da geschah das Wunder. Zuerst hielt ich es für eine Fata Morgana, eine Illusion, die mein sterbender Geist mir halluzinierte. Doch die Erscheinung blieb. Fern am Horizont war der vage Umriss einer Erhebung aufgetaucht. Eine Insel? Mein Herz pochte, und ich begann neue Hoffnung zu schöpfen. Die Stunden vergingen, doch die Erscheinung blieb. Nicht nur das, sie wurde größer, je näher ich kam. Sollte Gott doch ein Einsehen mit mir haben? Es war eine Insel, eindeutig. Ich jubelte, meine Rettung war nahe. Das Boot trieb direkt auf die Insel zu. Ich begann, hektischer zu paddeln, um die Geschwindigkeit des Bootes zu erhöhen. Ich paddelte wie wild, und tatsächlich kam die Insel näher. Meine Rettung. Mein Leben konnte weitergehen. Wie konnte ich ahnen, dass mir das Schlimmste noch bevorstand?
Ich erreichte die Küste des Landes, von dem ich nicht wusste, ob es Festland oder eine Insel war, am Abend. Mit der letzten Kraft, die mir geblieben war, zog ich das Boot an den Strand, der, dem Empfinden meiner Füße nach und so viel ich im Mondlicht sehen konnte, aus Sand bestand. Als das erledigt war, sprang ich wieder hinein. Sicherlich ein seltsames Verhalten, aber ich war todmüde, und da ich das Land, in das es mich verschlagen hatte, noch nicht kannte, schien es mir ratsam, die Nacht an dem Ort zu verbringen, den ich kannte und der mir sicher schien. So legte ich mich also im Boot nieder und war augenblicklich eingeschlafen.
In der Nacht wachte ich auf. Etwas hatte mich geweckt. Ich war mir nicht sicher, aber ich meinte, über das Brausen der Brandung hinweg einen Schrei gehört zu haben. Doch als ich mich darauf konzentrierte, war nichts mehr da. Ich zuckte die Achseln und legte mich wieder hin. Meine Gedanken waren wohl mit mir durchgegangen. Vor Durst und Hunger war ich kurz vor dem Delirium und richtig wach war ich auch nicht. Wahrscheinlich hatte ich nur geträumt und in meinem angeschlagenen Zustand Wahn und Wirklichkeit durcheinandergebracht. So war ich auch schnell wieder eingeschlafen.
Der nächste Tag brachte die endgültige Rettung. Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen blauen Himmel, doch jetzt machte mir das nichts mehr aus. Ich war ja gerettet. So glaubte ich wenigstens. Gleich hinter dem Strand, nicht mehr als fünfzig Yards vom Wasser entfernt, begann ein Wald aus mir unbekannten Bäumen. Es waren Palmen dabei, aber das waren auch die einzigen Bäume, die ich erkannte, die anderen hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber es waren auch nicht ihre Namen, die mich interessierten, sondern der Schatten, den sie spendeten. Und die Tatsache, dass sie da waren. Denn wo es Bäume gab, musste es auch Wasser geben. Ich musste nicht lange suchen. Keine hundert Schritt entfernt fand ich eine Quelle mit sauberem klarem Wasser, das aus einer Felsspalte sickerte und sich in einem Bach sammelte. Ich sprang in den Bach und schöpfte das Wasser mit beiden Händen. Es war kalt, aber es war süß. Das beste Trinkwasser, das ich je genossen hatte. Ich schlürfte ein Dutzend Handvoll Wasser, bis ich das Gefühl hatte, meinen Durst gestillt zu haben. Glücklich und zufrieden legte ich mich mit dem Rücken in den Bach, ließ das kalte Wasser über meinen Körper fließen, lachte und freute mich, dass ich lebte. Ja, es war wirklich eine Freude. Es war mehr. Ich war quasi von den Toten auferstanden. Das erste Mal seit Monaten spürte ich wieder die reine Lebensfreude in mir.
Derart beschwingt stand ich nach etlichen Minuten, die meinen Körper auf angenehme Temperaturen abgekühlt hatten, auf und ging weiter, denn zwar war mein Durst gestillt, aber immer noch wartete mein Magen darauf, gefüllt zu werden. Doch auch dieses Problem löste ich rasch. Ich fand Bananenbäume und jede Menge weiterer Früchte, die an verschiedensten Bäumen wuchsen und recht schmackhaft waren. Ich probierte sie alle, vorsichtig erst, für den Fall, dass es sich um Giftfrüchte handelte, doch erwiesen sich alle als genießbar und wohlschmeckend. Zwar bekam ich furchtbare Bauchschmerzen, doch diese waren nicht das Ergebnis der Früchte, sondern darauf zurückzuführen, dass ich unvorsichtig war. Nach den Tagen des Hungers hätte ich meinen Magen durch kleine Mengen langsam darauf vorbereiten müssen, dass er wieder zu tun bekam. Nun, die Schmerzen waren nicht schön, zumal Blähungen dazu kamen, aber damit konnte ich leben.
Den Rest des Tages verbrachte ich damit, das Land, das mich gerettet hatte, zu erkunden. Ich lief den Strand entlang, hinauf und hinunter, meilenweit, ohne an ein Ende zu gelangen. Und ohne auf Menschen zu stoßen. Dies fand ich bedenklich, ließ es mich doch befürchten, weit und breit der einzige Mensch auf diesem Stückchen Erde zu sein. Nun ja, die Hoffnung blieb, dass ich irgendwann doch noch auf Menschen stieß, denn der Strand dehnte sich schier unendlich in beide Richtungen, und vielleicht würde ich, wenn ich nur weit genug ging, auf Spuren von Zivilisation stoßen. Doch dafür musste ich besser ausgerüstet sein, denn ohne einen kleinen Vorrat an Wasser und Nahrung würde ich keine solche Expedition unternehmen. Dennoch nahm ich mir vor, an einem der nächsten Tage eine solche Reise anzutreten, sollte es mir nicht gelingen, im Landesinneren auf Menschen zu treffen. Denn das war mein nächstes Vorhaben: den Urwald zu durchstreifen, um in das Binnenland zu gelangen.
Ich zögerte nicht lange und setzte meinen Plan in die Tat um. Sorgfältig merkte ich mir die Stelle, wo ich an Land gespült worden war, weil dort das Boot lag und weil in der Nähe die Wasserstelle war, die mir das Überleben sicherte.
Leider war meine Armbanduhr im Salzwasser des Meeres kaputtgegangen, sodass ich nicht nachvollziehen konnte, wieviel Zeit beim Durchstreifen des Waldes verging, doch dass es Stunden waren, dessen war ich sicher. Der Wald war wie der Strand: unendlich. Ich marschierte und marschierte und kam nicht an sein Ende. Ich sah exotische Bäume, von deren Früchten ich hin und wieder naschte. Ich traf auf Insekten, die meine Haut zerstachen. Ich hörte Vögel, die fremdartige Laute von sich gaben. Doch ich sah nicht ein einziges größeres Tier. War das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?