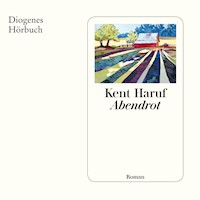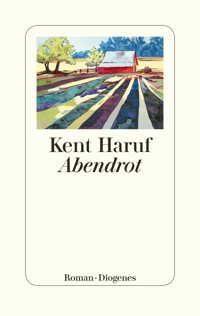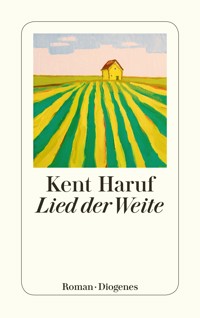11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Holt Roman
- Sprache: Deutsch
Die achtzigjährige Edith Goodnough wurde verhaftet. Ihr Nachbar Sandy weiß um Ediths Lebenstragödien und die kleinen Lichtblicke, die vielleicht unweigerlich zu diesem Januar 1977 führten: die entbehrungsreiche Kindheit, der Tod der Mutter, der durch einen Unfall abhängige, stets wütende Vater. Wahrhaftig und einfühlsam entführt Kent Haruf abermals in ein Leben, in dem es an dem meisten fehlt, in dem es Herz und Beharrlichkeit braucht, um die Geschenke darin zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kent Haruf
Das Band, das uns hält
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von pociao und Roberto de Hollanda
Diogenes
1
Edith Goodnough ist nicht mehr auf dem Land. Sie liegt jetzt im Krankenhaus der Stadt, in diesem weißen Bett, mit einer Nadel im Handrücken und einem Mann, der auf dem Gang vor ihrem Zimmer Wache hält. Diese Woche wird sie achtzig. Eine schöne, anständige Frau mit weißem Haar, die im ganzen Leben nie mehr als zweiundfünfzig Kilo gewogen hat und seit diesem Silvesterabend noch viel weniger. Trotzdem gehen der Sheriff und die Anwälte davon aus, dass sie sich so weit erholen wird, dass man sie in einen Rollstuhl setzen und dann durch die Stadt zum Gerichtsgebäude fahren kann, um ihr den Prozess zu machen. Sollte es überhaupt dazu kommen, ist nicht klar, ob sie so weit gehen würden, ihr Handschellen anzulegen. Bud Sealey, der Sheriff, hat sich als Mistkerl entpuppt, schon klar, trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass er einer Frau wie Edith Goodnough das antut.
Andererseits glaube ich auch nicht, dass Bud Sealey jemals vorhatte, ein Mistkerl zu werden. Erst vor neun Tagen saß er auf einem Barhocker am Tresen des Holt Café. Es war Freitagnachmittag, gegen halb drei, in der täglichen Flaute, wenn aller Papierkram erledigt ist und er nichts mehr zu tun hat, außer abzuwarten, dass die Kids aus der Highschool kommen und anfangen, die Main Street auf und ab zu rasen oder raus auf den Highway 34 zu fahren, um Wendemanöver auf dem Asphalt zu üben. Bud hatte also Zeit. Er ruhte sich ein bisschen aus. Sein Stück Butterscotch Pie hatte er bereits verputzt, und Betty hatte den Teller weggeräumt. Als er jetzt darauf wartete, dass seine zweite Tasse schwarzer Kaffee abkühlte, saß er mit dem Rücken zum Tresen auf seinem Hocker, sodass er die Männer an den Tischen vor sich hatte. Sie waren in ihren Stadtklamotten und Schirmmützen hereingekommen. Zwei oder drei hatten ihm wie immer auf den Rücken geklopft und sich auf die anderen Hocker oder an die nächsten Tische gesetzt, damit sie den Gesprächen folgen konnten und auf dem Laufenden blieben.
An diesem Nachmittag redete fast nur Bud. Er erzählte ihnen eine Geschichte. Ich glaube, ein Großteil der Männer hatte diese Geschichte mindestens schon zweimal gehört, aber vermutlich dachte keiner daran, ihn davon abzuhalten, sie noch einmal zum Besten zu geben, denn das Einzige, was sie im Übermaß hatten, war Zeit. Damit meine ich, dass sich zwei oder drei aus dem Berufsleben, mit dem sie nicht einmal hatten anfangen können, bereits zurückgezogen hatten.
Wie auch immer, die Geschichte, die Bud ihnen an diesem Nachmittag erzählte, handelte von einem Kerl, der auf der National Western Stock Show mit einem Stück rosa Strick herumlief, den er sich umgebunden hatte, als wäre er eins der landwirtschaftlichen Ausstellungsstücke in den Hallen des Pavillons. Er stellte sich sozusagen selbst zur Schau. Das heißt, bis die Polizei ihn festnahm und wegen unsittlichen Verhaltens und Erregung öffentlichen Ärgernisses ins Gefängnis steckte. Man erteilte ihm eine Verwarnung. Ein paar Wochen später, als er vor dem Richter steht – einem alten Mann mit Nickelbrille und kaum noch Haar auf dem Kopf –, sagt der zu ihm: »Ich werde dir nur eine einzige Frage stellen, mein Junge, und ich erwarte eine Antwort darauf. Bist du verrückt?« Und der Kerl mit dem rosa Strick sagt: »Nein, Sir, ich glaube nicht.« Darauf der Richter: »So so, bist du dann vielleicht nur halb verrückt?« Und der Kerl sagt …
Doch dieses Mal kam Bud nicht dazu zu erzählen, was der Kerl antwortet, weil just in diesem Augenblick jemand im Holt Café erschien, den weder Bud noch irgendeiner der anderen Männer kannte. Er fragte, wer von ihnen der Sheriff sei. Und einer der Jungs zeigte auf Bud.
Wie sich herausstellte, war dieser Neue ein Zeitungsreporter aus Denver. Er war gerade erst angekommen. Auf dem Polizeirevier hatte man ihm gesagt, er würde den Sheriff wahrscheinlich im Holt Café finden, und so war es auch. Deshalb ist das für mich der Zeitpunkt, kurz nach halb drei an einem Freitagnachmittag im April, an dem Bud Sealey ernsthaft zum Mistkerl wurde. Denn kurz darauf gingen Bud und dieser Mann aus Denver nach draußen zu Buds Streifenwagen. Anschließend fuhren sie die Main Street hinauf, und ich glaube nicht, dass sie sehr weit gekommen waren, bis Bud ihm die Geschichte von dem fünfundzwanzig Kilo schweren Sack mit Körnerfutter erzählte, den jemand in den Hühnerstall geschleift und in erreichbarer Nähe der sechs oder sieben Hühner, wo er vor Regen oder Schnee geschützt war, aufgeschlitzt hatte.
Doch das reichte nicht. Er war noch nicht zufrieden. Der Mann aus Denver wollte mehr als nur Hühnerfutter. Also bog Bud in eine der Wohnstraßen ein, fuhr unter den blühenden Ulmen am Straßenrand einen Häuserblock oder zwei weiter, und dann in der Birch Street oder Cedar Street packte er den angebundenen Hund noch obendrauf. Erzählte, wie man den milchäugigen alten Köter, der noch nie angebunden worden war, bis auf jenen Dezembernachmittag vor dreieinhalb Monaten, gefunden hatte, ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Futter und Wasser, das für mehrere Tage reichen würde.
Doch auch das genügte nicht. Das Hühnerfutter und ein alter Köter hatten den Appetit des Manns aus Denver nur noch mehr angeregt. Außerdem fing er jetzt vermutlich an, Bud zu bedrängen, hartnäckig immer mehr zu fordern. Andererseits kam Bud da aber auch der Gedanke, es könnte für ihn etwas dabei herausspringen. Vielleicht bildete er sich ein, es würde seine zwanzigjährige Investition in die örtlichen Bezirkswahlen absichern, wenn sein Name auf der Titelseite einer Zeitung aus Denver erschiene, als wäre es so etwas wie der endgültige Abschluss einer Versicherung mit uns, die dafür sorgte, dass wir am ersten Dienstag im November das Kreuz neben seinen Namen machten. Denn wenn sein Name in den großen Zeitungen der Stadt an prominenter Stelle oder sogar auf der Titelseite erschiene, wären wir stolz auf ihn, stolz darauf, dass einer von uns so etwas schaffte, und dann müsste er nie wieder Geschichten im Holt Café erzählen, um unsere Stimmen einzusammeln. Er müsste nur noch seinen Namen zur richtigen Zeit auf die entsprechende Wahlliste setzen lassen und dafür sorgen, dass er korrekt buchstabiert wurde, und dann – verdammt noch mal – einfach weiter die Arztrechnungen seiner Frau bezahlen und die Studiengebühren an die staatliche Universität von Boulder überweisen, wo sein Sohn, wie es aussah, es nie zu was bringen, geschweige denn einen Abschluss machen würde.
Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob Bud wirklich so dachte. Was ich angedeutet habe, beruht allein auf dem, was ich von ihm weiß, nach diesen fünfzig Jahren, die ich ihn kenne und mich ungefähr einmal die Woche mit ihm unterhalte. Alles, was ich sagen kann, ist, dass sein Streifenwagen etwas später an diesem Nachmittag draußen auf dem Land war und dass er und der Mann aus Denver noch immer darin saßen, sich noch immer unterhielten, einander beschnüffelten wie zwei Rüden, die sich über die neu entdeckten Wonnen mit einer läufigen Hündin austauschen. Nur ging es hier nicht um Paarung, nicht um Liebe oder das Wetter, nicht mal um den Preis von fetten Mastschweinen auf dem Schweinemarkt in Brush. Es war mehr als das. Ich glaube, es war viel mehr als das, denn genau dann und dort, zwischen Maisstoppeln auf der einen und grünem Weizen auf der anderen Seite der Straße, wurde Bud zum Verräter und lieferte ihm Edith Goodnough aus.
Er erzählte ihm, wie Edith im Dezember hier gesessen hatte, still in ihrem Schaukelstuhl, wartend, während ihr Bruder Lyman schräg gegenüber im Bett lag, mit dem Gesicht zur Wand, und laut schnarchte. Das hätte Bud ihm nicht erzählen müssen. Es gab schon genug, auch ohne das. Nur gut, dass der Mistkerl nichts von Lymans Reiseprospekten und dem Kürbiskuchen wusste, denn dann hätte er ihm als Zugabe auch noch davon erzählt. Ganz sicher.
Ich selbst erzählte ihm, als er mich am folgenden Nachmittag aufsuchte, gar nichts.
Das ist jetzt acht Tage her. Samstag. Als Erstes höre ich die Reifen auf dem Kiesweg, danach die Wagentür. Es ist noch zu früh für die Rückkehr von Mavis und Rena Pickett aus der Stadt, deshalb schaue ich aus dem schmalen Treibgang auf, wo ich die Rinder verarzte, und als ich das Nummernschild aus Denver sehe, denke ich, dass es einer dieser staatlichen Landwirtschaftsvertreter sein muss, der mir eine neue Sorte Dünger andrehen will. Selbst als ich den Schlips und die gelbe Hose sehe, denke ich das noch; mittlerweile ziehen sich einige der Jungen an, als wollte man sie jeden Augenblick zu einem Pingpongmatch auffordern. Wie auch immer, da ist er, steigt aus seinem Wagen und kommt auf mich zu. Er erreicht die Koppel, findet das Gatter und fummelt am Riegel herum. Sieht aus, als käme er nicht dahinter, wie man es öffnet, denn jetzt versucht er drüberzuklettern. Nicht besonders gut für die Scharniere. Trotzdem zieht er sich hoch, und als das Gatter unter ihm hin und her schwankt, schwingt er beide Beine auf die andere Seite und lässt sich in die Koppel neben mich fallen.
»Ich bin auf der Suche nach Sanders Roscoe«, sagt er.
Ich wende mich wieder der Kuh zu. Verpasse ihr die Injektion, sie brüllt auf, dann öffne ich den Treibgang, und sie trottet los, galoppiert dann mit gesenktem Kopf davon und spritzt dabei frischen Kuhmist auf. Ein Spritzer, so groß wie eine halbe Dollarmünze, landet auf seinem Hemd neben dem Schlips.
»Sie haben ihn gefunden«, sage ich.
Er sieht nicht viel älter aus als ein Kind, aber bislang habe ich nicht viel von seinem Gesicht gesehen. Im Augenblick hat er den Kopf gesenkt und begutachtet sein Hemd. Und während ich ihn noch mustere, zieht er einen Eversharp-Stift aus der Hemdtasche und reibt mit der Spitze an dem Mistspritzer herum. Als er ihn ganz gut wegbekommen hat und es aussieht, als hätte er sich bloß mit ein bisschen Bratensauce bekleckert, steckt er den Stift wieder in die Brusttasche und streckt mir die Hand entgegen. Sie fühlt sich an wie das Klopapier, von dem es in der Fernsehwerbung heißt, man solle es nicht zu sehr drücken. Weich.
»Mr. Roscoe«, sagt er. »Ich bin Dick Harrington. Von der Post.«
»Ach ja?«, sage ich. »Ich hoffe, Sie wollen mir nichts andrehen.«
»Nein«, sagt er. »Von der Denver Post. Das ist eine Zeitung. Vielleicht kennen Sie sie.«
»Sicher kenne ich sie«, sage ich. »Wir legen sie gewöhnlich vor die Hintertür, wo wir uns die Stiefel abtreten, damit wir keinen Kuhmist in die Küche tragen.« Dann werfe ich den Kopf zurück und lache. »So kann man sich die Fußmatten schenken«, sage ich.
Er findet das eigentlich nicht lustig. Er sieht mich an, als würde er denken: Wie kann man nur so blöd sein? Kerle wie er glauben, sie fahren 150 Meilen von Denver Richtung Osten, und da, wo sie ankommen, haben die Leute von nichts eine Ahnung. Sie meinen, sie müssten uns arme Hinterwäldler aufklären. Als wüssten wir nicht, was die Denver Post ist. Natürlich wissen wir das. Bloß geht uns das am Arsch vorbei.
Doch jetzt ist er wieder mit seinen Händen beschäftigt. Scheint so, als hätten diese Hände ständig etwas zu tun, als gönnte er ihnen keine Pause. Er greift in die Gesäßtasche nach seiner Brieftasche, öffnet sie und fischt eine kleine weiße Karte heraus. Ich sehe sie mir an. Oben ist das Logo seiner Zeitung, und darunter steht sein Name – hier allerdings Richard – und eine Telefonnummer, damit man ihn im Büro anrufen kann, wenn man ihn dort erreichen will. Ich gebe sie ihm zurück.
»Können Sie behalten«, sagt er.
»Nein«, sage ich. »Hier geht sie nur verloren.«
»Ach so«, sagt er. »Na dann …«
Doch dann scheint es, als wüsste er nicht, wie es weitergehen soll. Er blickt über die Koppel auf die drei oder vier Kühe, die ich bereits behandelt habe und die sich jetzt gegenseitig rückwärts gegen den Zaun drängen, ihn mit verdrehten Augen, in denen fast nur das Weiße zu sehen ist, fixieren und aussehen, als würden sie für einen Vierteldollar entweder den Zaun hinter sich platt walzen oder, wenn das nicht klappt, ihn quer über die Koppel zum Gatter jagen, das er nicht öffnen konnte, um auf diese Weise auszubüxen. Etwa zwei Minuten starren sich die Kühe und er an, über zehn Meter Koppelraum und frischen Kuhmist zwischen ihnen hinweg, bis die Kuh, die ich noch nicht verarztet habe, plötzlich losbrüllt. Als hätte jemand heftig an seinem Ärmel gezerrt, dreht er sich hastig zu ihr um. Sie steckt noch immer im Treibgang, man kann sie zwischen den Gitterstangen sehen. Auch ihre Augen zeigen jetzt jede Menge Weiß, denn sie wird allmählich nervös, weil man sie sich selbst überlassen hat, doch zumindest ist da dieses Gitter, das sie voneinander trennt. So, wie sie in dem schmalen Gang gefangen ist, kann sie auch nicht genügend Anlauf nehmen, um drüberzusetzen. Was sie aber garantiert nicht tun will. Allerdings glaube ich nicht, dass er das weiß.
»Mr. Roscoe«, sagt er. »Können wir uns nicht woanders unterhalten?«
»Oh«, sage ich und zeige auf die Kühe. »Achten Sie einfach nicht auf sie. Sie haben noch nicht so viele gelbe Hosen im Leben gesehen. Geben Sie ihnen noch ein bisschen Zeit – vielleicht gewöhnen sie sich daran.«
Er wirft den Kühen einen skeptischen Blick zu. Zugegeben, sie haben sich nicht viel verändert. Sie sehen noch immer so aus, als wollten sie am liebsten wegrennen, davonfliegen oder sonstwie ausreißen. Sie starren ihn noch immer an, mit verdrehten Augen, und drücken sich mit den Hintern, so fest sie können, gegen den Zaun.
»Nun«, sagt er und wendet sich wieder zu mir um. »Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn das möglich ist. Darf ich?«
»Kommt drauf an«, sage ich.
»Worauf?«, fragt er.
»Auf die Fragen.«
Also stellt er seine Fragen, und was er fragt, zeigt mir, dass er nicht mal so etwas wie ein Landwirtschaftsvertreter ist, nicht ansatzweise vergleichbar. Außerdem wird klar, dass – gelbe Hosen hin, gelbe Hosen her – jetzt Schluss mit lustig ist. Denn seine erste Frage lautet: »Sie sind doch bestimmt ein guter Nachbar, Mr. Roscoe, oder?«
»Ich kann einer sein«, sage ich, denn jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Was als Nächstes kommen wird.
»Ich meine, Sie kennen alle Nachbarn hier in der Gegend.«
»Vielleicht. Ein paar von ihnen.«
»Edith und Lyman Goodnow, zum Beispiel?«, fragt er. »Die Leute haben mir gesagt, Sie kennen sie besser als jeder andere hier. Sie hätten einiges für sie getan. Stimmt das?«
Da haben wir es. Er hat nicht lange gebraucht. »Haben all die Leute, mit denen Sie über die beiden gesprochen haben, wie Sie sagen, Ihnen nicht wenigstens gesagt, wie sie richtig heißen – während sie Ihnen den Rest erzählt haben?«
»Sie meinen, sie heißen nicht Good-now?«
»Nein.«
»Wie dann?«
»Good-no.«
»Okay«, sagt er. »Wie Sie meinen.«
Dann greift er wieder in die Gesäßtasche, zieht einen kleinen Spiralblock raus und macht sich mit dem Eversharp-Stift, den er zuvor benutzt hat, um den Kuhmist von seinem Hemd zu schnipsen, ein paar Notizen. Als er fertig ist, sagt er: »Sie wohnten früher ein Stück weiter die Straße runter, stimmts?«
»Das Grundstück gehört immer noch ihnen«, sage ich. »Bisher hat niemand es ihnen abgekauft.«
»Ja«, sagt er, »und ich weiß auch schon, dass es ein Stück weiter die Straße runter ist.«
So spricht er jetzt also, als wäre er inzwischen wieder etwas selbstsicherer, weil er mit dem Spiralblock und dem Stift in der Hand vergessen hat, dass er auf einem Haufen Kuhmist in einer Koppel steht, wo zehn Meter von ihm entfernt ein paar frisch verarztete Kühe noch immer auf seiner Seite des Zauns stehen und ihn am liebsten zertrampeln würden, statt ihn noch länger anstarren zu müssen.
Doch er fährt fort. »Ich habe gehört, dass Sie in der besagten Dezembernacht als Erster dort waren. Dass die anderen, als sie ankamen, Sie dort vorfanden, dass Sie bereits auf sie gewartet haben und sie nicht ins Haus lassen wollten. Sie haben versucht, sie daran zu hindern, das Haus zu betreten. Warum eigentlich?«
»Sagen Sie es mir. Sie wissen doch schon alles.«
»Hören Sie, Mr. Roscoe«, sagt er. »Ich versuche nur, das herauszufinden, was mein Herausgeber von mir erwartet. Und das heißt nicht, dass es mir besser gefällt als Ihnen. Aber ich kann mir vorstellen, wie Sie sich gefühlt haben müssen …«
»Sie haben keine Ahnung!«, erkläre ich ihm.
»Na schön«, sagt er. »Schön, vergessen Sie das. Aber eine Frage gestatten Sie mir noch. Nur eine einzige Frage: Sie stimmen mir doch zu, dass es Absicht war, oder? Sie glauben nicht, dass es ein Unfall war.«
Ich antworte nicht. Da steht er, in seiner gelben Pingponghose, keine Armlänge von mir entfernt, und für das, was er aus mir herauszukriegen versucht, müsste ich ihm eine reinhauen. Aber das mache ich nicht. Ich sehe ihn nur an.
Und dann sagt er: »Darüber sind wir beide uns doch einig, oder? Ich will nur wissen, wie Sie darüber denken.«
Jetzt habe ich genug von ihm. Mehr als genug. »Sie wollen wissen, was ich denke?«
»Ja.«
»Ich denke, dass Sie das Ganze einen Scheißdreck angeht. Ich denke, Sie fahren jetzt besser nach Denver zurück.«
»Mr. Roscoe«, sagt er und spricht meinen Namen jetzt aus, als sagte er Scheiße. »Ich habe bereits mit dem Sheriff gesprochen, Bud Sealey. Und der hat gesagt …«
»Nein«, sage ich. »Nein, Sie gehen jetzt besser.« Und mache einen Schritt auf ihn zu. Er wirkt überrascht, als hätte er gerade eine falsche Tür geöffnet und sei auf etwas gestoßen, womit er nicht gerechnet hat. Er weicht ein paar Schritte zurück.
»Es wird sowieso alles rauskommen«, sagt er. »Ich werde es von irgendwem anders erfahren.«
»Nicht von mir. So viel steht fest.«
Ich mache noch einen Schritt auf ihn zu und schaue ihn an, höchstens dreißig Zentimeter sind unsere Gesichter voneinander entfernt. Der Schnurrbart unter seiner Nase ist dünn, und auf den Wangen hat er Pockennarben. Er könnte einen Haarschnitt gebrauchen. Aber er weicht – so viel will ich ihm zugestehen – keinen Schritt mehr zurück, obwohl er so ein Jungspund ist, deshalb habe ich genug von dem Spielchen. Ich gehe um ihn herum zum Gatter, schiebe einfach den Riegel zurück und halte das Tor für ihn auf.
Er kommt auf mich zu, und gerade als er an mir vorbeigehen will, nehme ich ihm den kleinen Spiralblock aus der Hand und reiße die oberste Seite raus, die, auf der er sich etwas notiert hat, als er mit mir sprach. Dann gebe ich ihm den Block zurück. Sein Gesicht sieht aus, als hätte ihm jemand eine Ohrfeige verpasst.
»Was machen Sie da?«, fragt er. »Das dürfen Sie nicht.«
»Hör zu, mein Junge«, sage ich. »Beweg deinen Arsch von meinem Grundstück. Und lass dich hier nie wieder blicken. Verstanden? Ich will dich hier nicht noch mal sehen.«
Er will noch etwas sagen, sein Mund unter dem Schnurrbart öffnet sich, schließt sich dann wieder. Dann dreht er sich um und geht von mir weg auf seinen Wagen zu. Er steigt ein und fixiert mich noch eine volle Minute lang durch das Fenster. Am Ende dreht er den Zündschlüssel, der Wagen setzt sich in Bewegung und wirbelt den Kies hinter sich hoch, als er wegfährt. Ich sehe ihm nach, wie er über den Schotterweg auf die Landstraße und weiter Richtung Stadt fährt. Als ich ihn aus den Augen verliere, werfe ich einen Blick auf das Gekrakel auf dem Stück Papier, das ich aus seinem Block gerissen habe. Sanders Roscoe – um die fünfzig – korpulent – stur – Goodnoughs Nachbar Good-no. Ich zerreiße es und lasse es fallen. Mein Stiefelabsatz zermalmt es in der Kuhscheiße, bis es weg ist, verschwunden, in braunes Nichts verwandelt. Was für ein gottverdammter Schnösel.
Aber es nützte nichts. Er kam trotzdem dahinter. Es stand in allen Zeitungen. Wahrscheinlich hatte er nochmals mit Bud Sealey und ein paar anderen in der Stadt gesprochen. Sie packten es auf die Titelseite. Deshalb reden sie jetzt von einem Gerichtsverfahren. Sein verdammter Zeitungsbericht hat das ganze Gerede erst ausgelöst.
Einiges stimmte sogar. Manches von dem, was sie auf die Titelseite zwischen die beiden Fotos von Edith und Lyman klatschten, entsprach der Wahrheit. Vermutlich kann sogar ein Zeitungsreporter aus Denver in das Gerichtsgebäude von Holt County gehen und sich ein Datum aus dem Eintrag im Grundbuchamt abschreiben und, wenn er das hat, zum Friedhof fahren und lesen, was auf den drei Grabsteinen eingraviert ist, die dort nebeneinander im braunen Gras stehen, ganz hinten, am Ende des Friedhofs, wo zwischen dem letzten Grabstein und dem Maisfeld von Otis Murray gerade noch Platz genug für ein weiteres Grab ist. Denn ja, okay, das alles hat er korrekt hingekriegt. Und anschließend hat seine Zeitung es schlauerweise auf die Titelseite platziert.
Sie druckten Ediths Foto oben links und Lymans genau gegenüber oben rechts ab, sodass beide in die Mitte blickten. Damit wirkte es nicht nur so, als würden sie sich gegenseitig anschauen, sondern auch das, was zwischen ihnen stand. Und das, was zwischen ihnen stand, wie eine Art Todesanzeige oder vielleicht ein Eintrag auf der Innenseite der Familienbibel, war Folgendes:
ROY GOODNOUGH, GEBOREN 1870 IN CEDAR COUNTY, IOWA
ADA TWAMLEY, GEBOREN 1872 IN JOHNSON COUNTY, IOWA
R. GOODNOUGH & A. TWAMLEY, VERHEIRATET 1895
GOODNOUGHS FAMILIENSITZ, HOLT COUNTY,
COLORADO 1896
EDITH GOODNOUGH, GEBOREN 1897
LYMAN GOODNOUGH, GEBOREN 1899
ADA TWAMLEY GOODNOUGH, GESTORBEN 1914
ROY GOODNOUGH, GESTORBEN 1952
Und darunter schließlich nur noch ein weiteres Datum, dieses letzte Datum, das den Ausschlag gab für die Story auf der Titelseite:
FREITAG, 31. DEZEMBER 1976
Insofern entsprach dieser Teil von dem, was der Reporter aus Denver herausfand, und dieser Teil von dem, was seine Zeitung abdruckte, der Wahrheit. Doch das war nicht alles. Das war nicht mal besonders viel. Der Artikel ging nicht auf das Wie ein. Erwähnte nicht mal das Warum. Und obwohl er wiedergab, was Bud Sealey dem Reporter über das halbe Dutzend Hühner erzählt haben musste, den alten Köter und Lyman, der in seinem Bett schlief, während Edith still im Schaukelstuhl saß, war es nicht mal vollständig. Erstens, weil es Roys Stümpfe ausließ. Und zweitens, weil es kein Wort über Lymans Warten verlor oder über seine Pontiacs, die Postkarten und Zwanzig-Dollar-Scheine. Außerdem erfuhr man nichts darüber, wie Edith selbst gewartet hatte, zuerst darauf, dass der eine starb, später darauf, dass der andere zurückkam, was sie alles mit ihm machte, als er zurückkam, und wie sie es schließlich geschafft hatte, die vielen Jahre seiner Reiseberichte zu ertragen. Auch mein Dad wurde nie erwähnt.
Doch ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass dieser Reporter aus Denver darüber hätte schreiben können, selbst wenn er gewollt hätte, denn zunächst einmal hatte ihm niemand davon erzählt, sodass er darüber hätte berichten können. Ich erzählte ihm nichts. Und ich wäre der Einzige gewesen, der es gekonnt hätte. Da hatte Bud Sealey recht. Aber ich habe es nicht getan. Bei Gott, das hätte ich nicht fertiggebracht.
Doch hören Sie. Wenn derjenige nicht vorhätte, es in einer Zeitung abzudrucken oder zwischen zwei Fotos auf die Titelseite zu setzen, die so platziert waren, dass die Leute auf den Fotos auf das starren mussten, was zwischen ihnen stand, als wäre es etwas, für das sie sich schämen müssten – wenn sich jemand an einem Sonntagnachmittag ganz friedlich mir gegenüber an diesen Tisch setzen und seinen Kaffee trinken würde, während ich rede, und wenn er mich nicht allzu sehr drängte – nun ja, dann könnte ich es erzählen. Ich würde es so erzählen, dass es vollständig wäre, und ich würde es so erzählen, dass es richtig wäre.
Denn:
2
Das meiste von dem, was ich Ihnen erzählen werde, weiß ich. Den Rest vermute ich.
Ich weiß zum Beispiel, dass ihre Reise in Iowa begann, so wie es in den Zeitungen stand.
Andererseits vermute ich, dass er die Flugblätter gesehen haben muss, in denen die Rede davon war. Vielleicht sah er Artikel in den Zeitungen von Iowa und auch staatliche Broschüren. Alle berichteten darüber und behaupteten, es seien noch jede Menge Morgen Land hier draußen zu haben und wenn man sich dahinterklemmte und dranblieb, könnte man es in Eigentum verwandeln.
Er war fünfundzwanzig. Er hatte spät geheiratet. Ada noch später – für eine Frau, meine ich, denn es ist zweiundachtzig Jahre her, und damals war sie bereits dreiundzwanzig. Doch über Dinge wie Alter und Zeit hätte er sich sicher anders den Kopf zerbrochen als sie, denn die Bilder, die ich von ihr gesehen habe, zeigen eine kleine, schmale Frau mit Augen, die viel zu groß für ihren Kopf erschienen – sie war eine von den Frauen mit blauen Adern an den Schläfen. Eine solche Frau – angespannt, nervös, viel zu zart besaitet für das, was von ihr erwartet wurde – hätte nie jemanden wie ihn heiraten dürfen, und es hatte seinen Preis. Er war ein harter Brocken. Er hatte sehnige Arme und Beine, einen Adamsapfel, so groß wie eine Hickorynuss, der auf und ab tanzte, wenn er kaute oder etwas sagte, und ich glaube, dass er sich kaum daran gewöhnt hatte, eine Frau in seinem Bett zu haben, da dachte er bereits: Jetzt bin ich schon ein halbes Jahr verheiratet und wohne immer noch zu Hause. Ich schaufle noch immer Mais für die Schweine eines anderen Mannes, löffle die Suppe am Esstisch eines anderen. Herrgott noch mal!
Er war der Inbegriff eines übellaunigen, eigenbrötlerischen Mannes, das weiß ich aus eigener Erfahrung, vielleicht sogar eher störrisch als introvertiert. Er hasste nichts mehr, als von irgendetwas oder irgendjemandem abhängig zu sein. Deshalb vermute ich, dass es etwas wie diese Flugblätter gegeben und er sie gesehen haben muss.
Ich sehe ihn vor mir, wie er in diesen nasskalten Iowa-Nächten im ersten Winter ihrer Ehe neben einer Kerosinlampe steht, seine Brüder und Schwestern in den angrenzenden Zimmern schlafen und seine Eltern in ihrem Schlafzimmer am Ende des Flurs schnarchen. Ich stelle mir vor, wie er die Flugblätter und Anzeigen und Broschüren liest, bis er sie auswendig kann, während Ada im selben Zimmer in ihrem Bett liegt, schmal und gerade unter einigen dicken, selbst gemachten Steppdecken, das Haar ausgekämmt und geflochten, und versucht, für ihn wach zu bleiben, denn bestimmt hat sie geglaubt, dass man das als frisch verheiratete Ehefrau tun oder es wenigstens versuchen sollte. Und trotzdem – denn ich weiß, dass er so war – hat er wahrscheinlich Nacht um Nacht so weitergemacht. Weiter neben der verfluchten, stinkenden Lampe gestanden, gelesen, geplant und gezittert, in seiner langen Unterhose mit ausgeleiertem Hinterteil, mit vor Kälte kribbelnden roten Füßen und sehnigen Armen und Beinen, auf denen sich Gänsehaut gebildet und sich die Haare wie Schweineborsten aufgestellt hatten, wenn er endlich die Lampe ausblies und neben Ada ins Bett kroch – noch nicht, um zu schlafen, versteht sich, oder auch nur, um Adas Flanellnachthemd anzuheben und seine schwieligen Hände über ihre schmalen Hüften und kleinen Brüste zu reiben, sondern nur, um sie wieder aufzuwecken, sie zu wecken, damit er ihr einmal mehr erzählen konnte, was er sich, Herrgottsakra, ausgedacht hatte.
Nun, er hatte sich alles ausgerechnet – das tat er immer –, aber ich glaube nicht, dass diese Geschichte von kalten Füßen, Gänsehaut und mitten in der Nacht geweckt werden noch sehr lange hätte weitergehen können, denn nicht einmal Ada hätte sich das gefallen lassen. Sie wäre nach Johnson County zu ihrer Mutter zurückgekehrt und hätte sich auf das berufen, was man in jenen Tagen als Unvereinbarkeit der Charaktere bezeichnete, und dann hätte Roy vor Wut geschäumt, Betrug ins Feld geführt und von ehelichen Pflichten gefaselt. Und vielleicht wäre es das Beste für beide gewesen; zumindest wäre es das Beste für Ada gewesen, denn dann hätte sie Iowa niemals verlassen müssen. Aber wie gesagt, diese Gänsehautphase kann nicht sehr lange gedauert haben, jedenfalls nicht so lange, dass Ada ihn verlassen hätte, denn ich weiß, dass die beiden im nächsten Frühjahr, im Frühjahr 1896, Iowa in einem vollgepackten Pferdewagen verließen und zu den High Plains von Colorado aufbrachen.
Sie fuhren durch das westliche Iowa und setzten mit der Fähre über den Missouri River, um anschließend ganz Nebraska zu durchqueren. Mehr als zwanzig Meilen am Tag können sie nicht geschafft haben, und sie reisten wahrscheinlich allein, denn seit dreißig Jahren hatte es keine echten Wagentrecks mehr gegeben. Vielleicht in der Mitte der zweiten Woche hatte Ada aufgehört, aus dem hinteren Teil des Pferdewagens zu schauen. Wie auch immer, sie kamen hierher, und als sie den Nordosten von Colorado erreichten, was fanden sie da vor? Zufällig ist das eines der Dinge, die ich weiß. Ich weiß, was sie vorfanden, aber nicht, was sie zu finden hofften. Das hängt davon ab, welche Art von Lügen diese Flugblätter und Broschüren ihnen aufgetischt hatten. Doch falls sie gehofft haben sollten, so etwas wie Cedar County, Iowa, zu finden, eine Art Fortsetzung des Landes, das sie drei oder vier Wochen zuvor verlassen hatten, dann hätten sie nie einen Sack mit Saatgut, einen Pflug oder eine Nähmaschine mit Fußpedal in den Pferdewagen packen dürfen. Sie hätten da bleiben sollen, wo sie waren, denn hier war alles anders. Es gab keine tiefschwarze Muttererde mit vierzig Zoll Regen im Jahr, gut entwässerten Böden und reichlich Hartholz in der Nähe – Bur-Eichen und schwarze Walnussbäume –, das man zum Bauen und als Brennstoff verwenden konnte. Dieses Land bestand aus Sand, es war trocken und zum größten Teil flach, mit nur wenigen niedrigen Sandhügeln, die sich in Richtung Nordosten zum Nebraska Panhandle erstreckten. Bäume gab es so gut wie gar nicht.
Selbst heute wachsen hier nur wenige Bäume, obgleich die Menschen in Städten wie Holt an ausgewachsene Bäume gewöhnt sind, die frühe Bewohner vor sechzig und siebzig Jahren in Hinterhöfen und an den Straßen gepflanzt haben – Ulmen und Nadelbäume, Pappeln und Eschen, gelegentlich auch ein verkümmerter Ahorn, den jemand mit mehr Hoffnung in den Boden gesteckt hatte, als es die tatsächliche Erfahrung in dieser Gegend erlaubt hätte. Natürlich haben wir hier auf dem Land jetzt auch welche rings um unsere Häuser, sodass man erkennen kann, wo jemand wohnt oder gewohnt hat, doch wir denken dabei eher an Windschutz. Die 1930er-Jahre lehrten uns, den Windschutz zu schätzen, und die Regierung will ihn zusätzlich fördern.
In jedem Frühjahr versucht nun das Amt für Bodenschutz uns Rotzedern, Blautannen, Gelbkiefern, Ölweiden, Kirschmandeln, Pappeln, Flieder, Ebereschen, Pflaumenbäume und Geißblatt zu verkaufen – dünne Setzlinge, ein Bündel von dreißig für neun Dollar oder fünfzig für fünfzehn Dollar. Für weitere zwanzig Cent pro Baum schickt uns die Regierung jemanden, der sie für uns einpflanzt. Letztes Frühjahr waren es ein alter Mann auf einem Traktor, der eine Furche pflügte, und eine junge Frau, die auf einer Baumpflanzmaschine hinter dem Traktor saß, mit einem Bündel von Setzlingen in einer Kiste neben sich, die Füße auf der Ablage, damit sie ihr nicht im Weg waren und sie die Setzlinge zwischen ihren Oberschenkeln in die gepflügte Furche stecken konnte, fast so, als würde sie ein Kind zur Welt bringen. Diese spezielle junge Frau liebte es, so viel von ihrem Körper wie möglich der Sonne auszusetzen, und die Leute vom Bodenschutz überlegen immer noch, wie viel sie uns dafür abknöpfen sollen, dass wir sie dabei beobachteten.
Aber ich wollte erzählen, wie es 1896 in diesem Land aussah, als Roy und Ada in einem Pferdewagen aus Iowa ankamen, um sich ein Stück Land zu sichern. Ich sagte, es habe kaum Bäume hier gegeben, und das ist die Wahrheit. Damals wuchsen die einzigen Bäume in diesem Land an den Ufern der Flüsse und Nebenflüsse, und davon gab es jeweils nur zwei, im Norden den South Fork Platte River und etwa hundertfünfzig Meilen südlich den Arkansas River, und dazwischen noch zwei Nebenflüsse, den Republican und den Arikaree.
Was sie vorfanden, als sie hierherkamen – und ich glaube nicht, dass Ada diesen Schock jemals überwunden hat –, war flaches, baumloses und trockenes Land, das früher Stammesgebiet gewesen war.
Es war eine gewaltige, sandige Gegend, mit einem Horizont, der sich damals für jemanden, der nicht wusste, wie man dieses Land ansehen sollte, und bevor Henry Ford und die asphaltierten Highways es ein wenig schrumpfen ließen, unendlich weit in alle Himmelsrichtungen zu erstrecken schien. Darüber ein Himmel, der sich im Sommer nicht darum scherte, ob die Säcke mit Maissamen, die Roy in den Sand säen wollte, jemals Früchte tragen würden, und dem es im Winter, selbst wenn er so blau war, wie er laut Bilderbüchern sein sollte, und so hoch und hell, wie man es sich nur wünschen konnte, egal war, ob das Holzhaus, das Roy bauen wollte, verhindern würde, dass Schnee auf Adas Nähmaschine fiel. Es gab nichts und niemanden auf der Welt, den es interessierte, ob Roys Maispflanzen mehr sein würden als verschrumpelte Triebe, und zwischen Kanada und Mexiko nichts, was hoch oder breit genug gewesen wäre, um Schneestürme daran zu hindern, über das Land zu fegen.
Nein, Ada kam nie über den Schock dieses Landes hinweg. Es gab zu viel davon, und nichts sah aus wie in Iowa.
Ada hätte Iowa niemals verlassen, wenn dieses Land noch den Indigenen gehört hätte. Sie war nicht der Typ von Frau, die Risiken einging. Irgendwie hätte sie Roys Siedlerpläne vereitelt und entweder einen Weg gefunden, Roys kalte Füße zu ertragen, oder wäre, wie schon gesagt, zu ihrer Mutter zurückgekehrt. Egal was, jedenfalls wäre sie in Iowa geblieben, das mittlerweile ein zivilisiertes Land war. Sie hätte sich dort zu Hause gefühlt und wäre weiter zu den Treffen der Kirchengemeinde gegangen oder hätte kleine Ausflüge in die Stadt unternommen, um Stickgarn für Zierdeckchen zu kaufen oder irgendwelchen Plunder für das Haus, und wenn es tatsächlich so gekommen und sie in Iowa geblieben wäre, hätte dieser dunkle, verlorene Blick, den man auf den Fotos von ihr sieht, niemals Einzug in ihre Augen gehalten. Aber die Cheyenne waren verschwunden. Sie hatte diesen Vorwand nicht benutzen können und auch sonst keinen guten Grund gefunden, nicht mitzukommen. Sie musste ihrem Mann folgen, solange das, was er vorhatte, auch nur ansatzweise vernünftig schien, und obendrein füllte sich das Land bereits seit Beginn des letzten Jahrzehnts im neunzehnten Jahrhundert mit Siedlern. Allmählich wurde Siedlungsland knapp. Und so kam Ada mit.
Roy wäre vermutlich auf jeden Fall gekommen, selbst wenn die Cheyenne noch hier gewesen wären. Er war wie ein Foxterrier, der in ein Gebiet eindrang, das einem anderen gehörte, und, kaum angekommen, das Hinterbein hob und sein Revier markierte, ohne einen Gedanken an bereits bestehende Ansprüche oder Konsequenzen zu verschwenden. Doch Roy bekam keine Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen. Als er hier ankam, war Colorado bereits seit zwanzig Jahren ein Bundesstaat. Die Indigenen waren schon mindestens genauso lange verschwunden. Und das kleine Stück Land, auf das er Anspruch anmeldete, wurde ihm im örtlichen Gemeindeamt überschrieben.
Nun gut, im späten Frühjahr 1896 kamen die Goodnoughs in ihrem Wagen hier an, und obwohl sie enttäuscht waren, weil sie nicht das vorfanden, was sie sich erhofft hatten, nachdem sie die Flugblätter und staatlichen Broschüren gelesen hatten, blieben sie. Sie kehrten nicht zurück. Sie koppelten den Pferdewagen ab, und dann brachte Roy Ada wahrscheinlich in der heruntergekommenen Pension der Stadt unter, wo sie sich die Zeit damit vertreiben konnte, den Staub aus den Haaren zu waschen, einen weiteren langen Klagebrief nach Hause zu schreiben und zu warten, während er auf einem der Arbeitsgäule loszog, um sich das Land anzusehen. Ich glaube nicht, dass er sehr lange brauchte. Er hatte es viel zu eilig, er war viel zu stur, er wollte seine Samen endlich in die Erde bringen, und vielleicht spürte er auch, dass Ada irgendwie aus ihrer Träumerei und Benommenheit aufwachen, sich aufrichten, umsehen und dann Reißaus nehmen könnte, notfalls zu Fuß, das kleine Kinn und die großen Augen gen Osten gerichtet, wenn er sich nicht beeilte. Deshalb sah er sich hastig in der Gegend um, stieß auf weite Flächen voller Bartgras, Büffelgras, Liebesgras, Präriegras und Sandgras, das seinem Brabanter bis zum Bauch reichte, und fand die Stellen, die noch übrig geblieben waren, nachdem frühere Siedler ihre Claims abgesteckt hatten und mit Roden und Räumen fertig waren.
Sieben Meilen südlich der Stadt fand er das, was er glaubte, sich vorgestellt zu haben. Nur eine Meile westlich von der Ecke des Viertelabschnitts, den Roy für sich beanspruchen wollte, gab es bereits ein Haus, ein oder zwei Schuppen und ein paar Ställe, aber dort wohnten nur ein sechsjähriger Junge und eine schweigsame Frau mit dunklen Augen. Und ich nehme an, dass Roy sich diesen Ort ausguckte, weil er davon ausging, dass der Junge und die Halb-Cheyenne, die dort wohnten, eine halbe Meile von dem entfernt, was damals nicht mal eine Wagenspur war, nicht lange durchhalten würden, besser gesagt, nicht durchhalten konnten. Er glaubte, irgendwann, und zwar schon ziemlich bald, könnte er sich diese andere Parzelle, die bereits bewohnt war, unter den Nagel reißen, da weit und breit kein Mann zu sehen war. Der Mann, der eigentlich dort hätte sein müssen, war drei Jahre zuvor verschwunden. An einem Sonntagmorgen war er in die Stadt gegangen – zu den drei Läden, der Pension, dem Saloon, dem Friedhof und den fünfzehn oder zwanzig Holzhäusern, aus denen Holt damals bestand – und nie wieder zurückgekehrt. Auch geschrieben hatte er nicht, weil der sechsjährige Junge noch nicht lesen konnte und die Pfeife rauchende Frau, die er zurückgelassen hatte, es nie würde lernen können. Einen Brief zu schreiben und sich zu erklären, wäre nur Verschwendung von Tinte, Papier und einer Zwei-Cent-Briefmarke gewesen.
Sie verstehen – weil es dieses spezielle Stück Grasland war, das Roy sich ausgeguckt und vor aller Welt als seins erkoren hatte, eine halbe Meile östlich von dem anderen Haus, weiß ich, was ich über ihn weiß, und auch über Ada und Edith und Lyman, denn natürlich war der sechsjährige Junge, der im Haus lebte, John Roscoe, und John Roscoe hielt durch.
Nun, die Goodnoughs ebenfalls. Und die Dinge verliefen – zumindest am Anfang – genau so, wie man es erwartet hätte. Roy erhob Anspruch auf das Land, spannte seine Pferde vor einen Pflug, pflanzte die Iowa-Samen aus seinem Sack, so gut er konnte, in den harten Boden, kaufte ein oder zwei Kühe, die auf der nahe gelegenen Weide grasten, und machte sich schließlich daran, Ada ein Holzhaus zu bauen. Bis es so weit war, hatte sie unter einer Plane gewohnt, die an der Seite des Pferdewagens festgezurrt war und die jedes Mal, wenn Roy meinte, er müsse irgendetwas transportieren, losgemacht werden musste, sodass sie wie eine arabische Nomadin lebte, allerdings ohne deren Beständigkeit oder jegliche Erfahrung damit. Sie musste über einem offenen Feuer kochen und versuchen, in einer Ecke des gepflügten Ackers, die Roy ihr als Garten überlassen hatte, Bohnen, Erbsen und vielleicht ein paar Zinnien zu pflanzen. Es war nicht leicht. Um ihren kleinen Garten zu bewässern und auch, um etwas zu trinken zu haben, allerdings nie genug, um ein Bad zu nehmen, musste Ada mit zwei an einem Joch befestigten Eimern über den schmalen Schultern eine halbe Meile weit laufen und Wasser von dem anderen Haus holen, wo der Junge und die Frau lebten. Sie besaßen eine Windmühle, die das Wasser aus der Erde pumpte.
Offensichtlich interessierte sich diese andere Frau für sie. Vielleicht war es aber auch nur so etwas wie Mitleid – so wie man Mitleid mit einem Hund empfindet, der draußen auf dem Land ausgesetzt wird, nicht einen Straßenköter, der ohnehin überlebt hätte, sondern einen Zwergpudel oder Pekinesen, die in einen Salon gehörten – denn ich weiß genau, dass die Frau mindestens einmal zu Ada ging, als diese neben ihren beiden Kübeln an der Windmühle und bei der Pferdetränke hockte und sich die Handgelenke und das Gesicht mit Wasser bespritzte.
»Willst du nicht baden?«
Ada sah sie an. Sie verzog den Mund zu etwas, das ein Lächeln sein sollte, blickte dann hastig nach Osten, wo sie sehen konnte, wie ihr Mann auf dem Feld hinter seinen Gäulen her trottete, und drehte sich wieder um.
»Wenn es dir nichts ausmacht.«
»Komm mit ins Haus.«
Deshalb weiß ich, dass Ada in diesem Sommer mindestens noch ein weiteres Mal badete, außer in der Pension in der Stadt. Als sie sich wieder angezogen hatte, sagte sie: »Aber erzähl es ihm nicht. Er würde nicht wollen, dass ich in einem fremden Haus bade.«
Nun, das erfuhr Roy nie über seine Frau. Und vermutlich gab es noch vieles andere, das er nicht erfuhr oder verstand, aber er baute ihr ein Haus. Den ersten Teil hatte er im Herbst fertig. Später baute er noch weitere Zimmer an, eine neue Küche und eine Terrasse nach hinten raus und auch das, was sich später als Esszimmer entpuppte, doch der erste rechteckige, zweistöckige Teil des Hauses wurde Ende jenes Sommers errichtet. Und er war ein guter, einfacher Zimmermann, das muss man ihm lassen.
Das Holz kaufte er in der Stadt, in Holt, und transportierte es mit seinem Pferdewagen aufs Land, um es dann eigenhändig zusammenzunageln. Ada half ihm, die Holzwände aufzurichten, und hielt sie fest, während er sie zusammenfügte, aber das meiste andere musste er allein machen, denn er hatte sich einen Ort zum Leben ausgesucht, in dessen Nähe es keinen anderen ausgewachsenen Mann gab, und selbst dann hätte er nicht um Hilfe gebeten. Sie kauften noch ein paar Möbel, ergänzend zu Adas Nähmaschine, und zogen ein, kurz bevor es Zeit für die Maisernte war.
Im ersten Jahr fiel sie nicht besonders gut aus. Es gab nicht viel zu ernten. Zu viel Salbei und Palmlilien und zu viele Graswurzeln machten Probleme, mit denen sie sich herumschlagen mussten, und trotz seiner Eile war der Mais zu spät ausgesät worden. Als das bisschen Regen fiel, das wir hier im Frühjahr kriegen, hatten die Samen noch in den Säcken gelegen. So kam sein Mais nicht gut zurecht, und ich glaube, das galt auch für Ada. Zur Erntezeit ging es ihr schon ganz schön schlecht, denn irgendwann im August dieses Sommers hatte Roy endlich genug Saft, Kraft und auch Zeit gefunden, um sie zu schwängern, sodass Ada im folgenden Frühjahr, in der Nacht zum einundzwanzigsten April, nachdem sie es Gott weiß wie geschafft hatte, durch den ersten langen High-Plains-Winter zu kommen, ein Mädchen zur Welt brachte, das sie Edith taufte.
Natürlich wollte Roy auch damit allein fertigwerden. Er würde die Laken auskochen, den Kopf des Babys in die richtige Position drehen, ihm einen Klaps geben, damit es zu atmen begann, und Ada anschließend mit Nadel und Faden zunähen, ohne Hilfe von außen. Keine Ahnung, vielleicht hatte er darüber ebenfalls irgendwelche Flugblätter und offizielle Broschüren gelesen, aber auch diesmal verliefen die Dinge anders, als er erwartet hatte. Denn irgendwann in dieser Nacht, nachdem Ada schon zwei oder drei Tage lang Wehen gehabt hatte, das schweißnasse, dünne braune Haar an ihrem Gesicht klebte und ihre weißen Schenkel stocksteif waren, fing Roy einen seiner Gäule ein und galoppierte die halbe dunkle Meile zu dem anderen Haus, um die Halb-Cheyenne aufzuwecken. Als ihr Gesicht an einem der oberen offenen Fenster erschien, rief er zu ihr hoch: »Verdammt noch mal, ich könnte es machen, aber sie will dich. Sie will, dass du zu ihr rüberkommst.«
Er saß da unten auf seinem ungesattelten nervösen Brabanter und brüllte hinauf in die Dunkelheit, zu dem dunklen Gesicht, das er kaum sehen konnte.
»Ich könnte es selbst, aber jetzt sagt sie, dass sie dich dabeihaben will. Trotzdem schaffe ich das auch, verdammt. Du wirst schon sehen.«
Die Frau oben am Fenster betrachtete den Mann, der auf seinem Pferd in ihrem Vorgarten saß.
»Hörst du mich nicht?«, schrie er. »Verstehst du nicht, was ich verflucht noch mal sage? Sie will dich dabeihaben.«
Doch die Frau war verschwunden und hatte ihn in die Dunkelheit brüllend stehen lassen, wo nicht mal mehr ein stummes Gesicht war, das ihn schreien und wüten hören konnte. Die Frau war gegangen, um ihren Jungen zu wecken, der nun sieben war, und das schon seit dem vierundzwanzigsten Februar. Sie wies ihn an, ihr Pferd zu satteln, sie wolle zu den Goodnoughs reiten, um nach dem Rechten zu sehen, und sei am Morgen wieder da. Und ich denke, dass Roy begriff, dass er lang genug in die Nacht geschrien hatte, als er den Jungen aus der Hintertür kommen und auf die Koppel zugehen sah, und so galoppierte er wieder nach Hause.
Die Frau kam wenige Minuten nach ihm an. Ich kann nicht genau sagen, was sie tat oder wie sie es tat, aber ich bin mir sicher, dass sie Roy aus dem Zimmer scheuchte, wo er alles andere als eine Hilfe war, und ich glaube, dass sie dann Ada genügend wiederbelebte, um es noch einmal zu versuchen. Vielleicht kochte sie einen Tee oder etwas anderes Heißes mit Kräutern drin, vielleicht war es auch nur ihre Stimme und die Hand, jedenfalls holte sie das Baby auf die Welt, und dann ruhte Ada sich aus. Und danach muss sie ein paar Dinge so weit klar gemacht haben, dass selbst Roy sie verstand, denn zwei Jahre später im Juni, als Ada wieder so weit war, wartete er nicht erst, bis seine Frau zwei oder drei Tage Wehen gehabt hatte und völlig erschöpft war, bevor er meinte, es sei wieder an der Zeit, in die Dunkelheit zu brüllen. Nein, er kam mitten am Tag, klopfte an die Vordertür und fragte, ob die Frau kommen könnte. Daher verlief Lymans Geburt einfacher, glatter, ohne das galoppierende Pferd und das Gebrüll. Das war 1899.
Tja, jetzt hatte Roy also ein Mädchen und einen Jungen, und ich glaube nicht, dass er jemals viel von Edith erwartet hat (mehr, als dass sie ständig schuftete, meine ich) oder jemals daran dachte, sich etwas für sie zu erhoffen – das hätte er nicht getan, sie war ein Mädchen, eine Kartoffelschälerin, eine Eiersammlerin. Aber von Lyman mag er etwas mehr erwartet haben, also war er wahrscheinlich nicht begeistert, als er sah, was aus ihm wurde. Nicht, dass Lyman nicht hart genug arbeitete – das tat er auf seine nachlässige, mechanische, spröde Art –, und er verließ die Farm auch nicht besonders oft, bis es fast schon zu spät für ihn war, sie überhaupt jemals zu verlassen. Nur mochte er das alles hier nicht, er legte sich nie wirklich ins Zeug. Lyman hatte zu viel von einem Schoßhund, um seinem Vater zu gefallen.