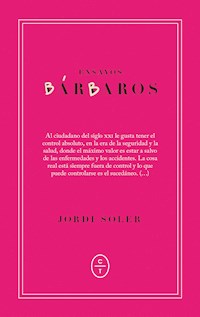15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Wozu der Mensch fähig ist – ein Stück Literatur, das unter die Haut geht
Oriol, Franco-Gegner und republikanischer Kämpfer, ist bei der Flucht über die Pyrenäen im Schneesturm umgekommen. So weiß es die Familienüberlieferung. Fast siebzig Jahre später jedoch kommt sein Großneffe mit Hilfe eines Ziegenhirten und einer Waldfrau einer unglaublichen Geschichte auf die Spur. Sie erzählt davon, was aus einem Menschen werden kann, der alles verloren hat. Jodi Solers Roman über die menschlichen Abgründe in einer archaisch anmutenden Welt ist ein erzählerisches Meisterstück.
Was machen Menschen, die alles verloren haben, Heimat, Familie, Überzeugungen? Im Lauf des Jahres 1939 stoßen in den Pyrenäen aus entgegengesetzten Richtungen kommend zahllose Menschen aufeinander, denen eben dies widerfahren ist. Während von der spanischen Seite aus Bürgerkriegsflüchtlinge versuchen, sich nach Frankreich zu retten, fliehen aus der Gegenrichtung immer häufiger Menschen vor den Nazis. Viele von ihnen verlieren elend ihr Leben. Auch Oriol. In seiner Familie wird er seither wie ein Heiliger verehrt. Bis einem Großneffen ein Gerücht zugetragen wird. Nach abenteuerlichen Recherchen steht er schließlich vor dem Mann, der angeblich seit siebzig Jahren tot ist. Und der damals in aussichtsloser Lage alle Prägungen der Zivilisation abgestreift hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Denn auf dem Berg war niemand, nur die letzten Sterne, und die Luft war ein endloser Albtraum.
Gonzalo Rojas
Who was waiting there who was hunting me.
Leonard Cohen
Teil I
1
So viel ist bekannt: Als die erste Bombe explodierte, raste ihr Widerhall wie ein wildes Tier unter seiner Pritsche hindurch, um gleich darauf, in ein sich ebenso rasch selbst verzehrendes Licht umgewandelt, an den Wänden emporzuflammen und in einem letzten Aufblitzen an der Decke zusammenzuschießen. Angesichts dieser und der vier folgenden Explosionen sagte sich Oriol, dass wohl kaum Hoffnung für ihn bestand, sich noch einmal von der Pritsche erheben zu können. Eine Viertelstunde später hatte Oriol seine schwarzen Gedanken in gewisser Hinsicht weitergesponnen: Wenn er sich in der Aufregung nicht täuschte, gingen die Bomben über dem Hafen nieder, während er sich am Rand der Ortschaft befand, ein ziemliches Stück entfernt, in einem Schuppen, der als Behelfslazarett diente, und dass der Feind das Lazarett verschonte, konnte durchaus sein. Schon seit mehreren Wochen steckten ihm Granatsplitter in einer Pobacke, und die Wunde, die ein Arzt noch auf dem Schlachtfeld behelfsmäßig versorgte, hatte sich entzündet und drohte, bald in akuten Wundbrand umzuschlagen. In jedem Fall hatte sie ein nicht nachlassendes heftiges Fieber hervorgerufen, das Letzte also, was man inmitten eines Bombardements brauchen konnte. Schlimmer ging es eigentlich nicht mehr, schließlich war der Krieg verloren, und Oriol wollte sich bloß noch nach Frankreich absetzen, um sich vor den rachedurstigen Franquisten in Sicherheit zu bringen, die sie aus der Luft mit Bomben bewarfen und ihnen zu Lande unerbittlich auf den Fersen waren. Am einfachsten wäre es vielleicht gewesen, Oriol hätte sich an seinen ursprünglichen Gedanken geklammert, hätte eingesehen, dass kaum Aussicht darauf bestand zu überleben, hätte sich in sein Schicksal gefügt und aufgehört, sich Sorgen um eine Zukunft zu machen, die nur noch kurz und jämmerlich sein konnte. Wahrscheinlich endete diese Zukunft ohnehin mit der Explosion der nächsten Bombe, jedenfalls war es müßig, sich in einer Lage wie der seinen irgendwelchen Träumereien hinzugeben. Bekannt ist auch, dass Oriol, als feststand, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war, seine Frau in Barcelona zurückgelassen hatte und zusammen mit seinem Bruder von Pontius zu Pilatus gelaufen war, um irgendwo eine Möglichkeit aufzutun, aus Spanien zu fliehen, bis er, als sich seine Wunde immer mehr entzündete, in dem Schuppen Zuflucht nahm, wo er in Gesellschaft von fünfundneunzig republikanischen Soldaten auf Heilung hoffte. Die Männer lagen wie er auf Pritschen oder unmittelbar auf dem Boden, manche eines oder gleich mehrerer Körperteile beraubt – einer Hand, eines Arms, eines Beins, eines Auges –, ein schrecklich zugerichtetes Bataillon schwerstkranker, wenn nicht im Sterben liegender Soldaten. Diesen Soldaten stand so gut wie keine Medizin zur Verfügung, und sie durften bei niemandem auch nur auf das geringste Mitleid hoffen. Bei ihnen befand sich ein Arzt, der tat, was er konnte. Nach dem ersten Bombenangriff und all den immer wieder ebenso rasch an den Wänden emporflammenden wie sich selbst verzehrenden Lichtblitzen versprach er den verzweifelten Soldaten, dass bald ein Bus kommen und sie alle in ein französisches Krankenhaus bringen würde, wo sie vor jeglicher Verfolgung geschützt wären und sich mit Hilfe einer ganzen Schar von Ärzten, die genau wüsste, was im Fall jedes Einzelnen von ihnen zu tun war, erholen könnten. So lange schilderte der Arzt ihnen ihre in makelloses Weiß gekleideten, lächelnden Helfer, dass die Insassen des stinkenden Behelfslazaretts sie irgendwann tatsächlich vor sich zu sehen glaubten. Doch der Arzt, der all das versprach, war gar kein Arzt, sondern ein Krankenpfleger aus einer Klinik in Figueras, dem man, bevor man die Rechnung aufmacht, wie vielen Verletzten ein richtiger Arzt mit der entsprechenden Erfahrung das Leben hätte retten können, zugutehalten sollte, dass er diesen Männern vor allem helfen und zur Seite stehen wollte. Andernfalls hätten ihnen nicht einmal seine rudimentären medizinischen Kenntnisse zur Verfügung gestanden, wie sie auch um die Hoffnung auf das Eintreffen des Busses gebracht worden wären, an die sie sich, zumindest in den Pausen zwischen den Bombardements, klammern konnten, um sich eine Zukunft ohne dröhnende Explosionen und grell aufleuchtende Blitze auszumalen. Wie gesagt, einfacher wäre es vielleicht gewesen, Oriol hätte sich an seinen ursprünglichen Gedanken geklammert, schließlich wäre es nur normal gewesen, auf dieser Pritsche zu sterben, die immer wieder unter der Druckwelle der Bomben erzitterte, die auf Port de la Selva niedergingen, viel einfacher jedenfalls, als weiter in Richtung Frankreich zu fliehen. Denn da war nicht nur seine Verwundung, die allein schon ausreichte, um ihm das Leben unerträglich zu machen, sondern es war auch Anfang Februar 1939, was bedeutete, dass außerhalb des Schuppens, unter dem freien Himmel, von dem unaufhörlich die Bomben der Franquisten fielen, eine Kälte herrschte, mit der er es keinesfalls aufnehmen wollte. Doch Oriol erfand mehrere Ausreden, die es ihm untersagten, seinen Gefühlen zu folgen und sich einfach aufzugeben und in sein Schicksal zu fügen: Da war seine Frau in Barcelona, die wollte, dass er weiterlebte, und sein Bruder Arcadi, der ihn in dem Schuppen zurückgelassen hatte, weil er sich nicht mehr um ihn kümmern konnte. Er hatte Arcadi aber versprechen müssen, dass er sich anstrengen und den Bus besteigen werde, der am nächsten Tag kommen und ihn über die Grenze bringen werde, wo Arcadi ihn erwartete. Die Aussicht auf das Eintreffen des Autobusses muss, wie ich einige Zeilen zuvor bereits angedeutet habe, den Verletzten Mut gemacht haben, zumindest denen, die sich noch in irgendeiner Weise verständlich machen konnten oder wenigstens mitbekamen, was vor sich ging. Andere dagegen hatten schon seit Tagen die Augen nicht mehr aufgemacht, weil sie sich ganz darauf konzentrieren mussten, den Kampf gegen ihre Verwundung zu bestehen und nicht der Fäulnis anheimzufallen, die sich anschickte, sie bei lebendigem Leib aufzufressen. Allerdings ist »Mut machen« vielleicht doch nicht ganz der richtige Ausdruck, wenn von einem Schuppen voller Sterbender die Rede ist, in dem sich lautes Stöhnen mit dem durchdringenden Gestank vergammelter Salbenverbände und den Pestschwaden fauligen Fleisches und offener Wunden mischt. Bestenfalls war dieser Bus also das Teil, das eine Konstruktion vor dem endgültigen Einsturz bewahrt. Bei Anbruch des folgenden Tages herrschte im Innern des Schuppens tödliche Stille, und das Licht der ersten Sonnenstrahlen, die durch die Ritzen zwischen den Brettern drangen, war trüb, weil die Bomben draußen tonnenweise Erde aufgewirbelt hatten, genau genommen handelte es sich weniger um Licht als um eine Art Querschnitt, Bodenprobe, Muster der ringsum zerstörten Landschaft – gewissermaßen um die Essenz dessen, was am Ende übrig bleibt: Staub. Beim Anblick der ersten trägen Strahlen beendete der Arzt seine Nachtwache und machte sich davon, und je weiter sich das Licht im Lauf des Vormittags in dem Schuppen ausbreitete, desto mehr erhärtete sich der Verdacht der verletzten Soldaten, dass kein anderer Arzt kommen und ihn ablösen werde; und dass – sosehr sie sich auch gegen den Gedanken sträubten – ebenso wenig der angekündigte Bus eintreffen werde, schien irgendwann ebenfalls nicht mehr undenkbar. Gegen Mittag stemmte ein Mann mit einem dick verbundenen Kopf in einer Uniform, die noch abgerissener wirkte als die der meisten seiner Schicksalsgenossen, mithilfe seiner Krücke die Tür des Arztzimmers auf – im Schuppen schrie jemand so verzweifelt, dass der Mann, und möglicherweise nicht nur er, davon fast verrückt geworden wäre. Andererseits hatten sich sämtliche Insassen des Schuppens zu diesem Zeitpunkt und angesichts der niederschmetternden Gewissheit, dass man sie im Stich gelassen hatte, ohnehin längst der völligen Mutlosigkeit und Willenslähmung hingegeben; das Nichterscheinen des Busses hatte, wie vorauszusehen, den endgültigen Zusammenbruch herbeigeführt und ausnahmslos alle mit so maßloser Verzweiflung erfüllt, dass die Klage eines Einzelnen darüber bloß noch wie lästiges Gemurmel erschien. Trotzdem beschaffte sich der Mann, der sich anders als die anderen noch nicht komplett aufgegeben hatte, im Arztzimmer eine mit Morphium gefüllte Spritze, die er dem verzweifelt Schreienden verabreichte, um anschließend zurück ins Arztzimmer zu humpeln und dort so lange an dem Radio herumzufummeln, bis er in Erfahrung gebracht hatte, dass der Krieg tatsächlich verloren war und kein Arzt den voraus- beziehungsweise fortgegangenen ablösen würde. Es würde auch weder einen Bus geben, um über die Grenze nach Frankreich zu fliehen, noch eine Schar in makelloses Weiß gekleideter Helfer, die sie dort bereits erwartete. Bekannt ist, dass der Mann mit dem dicken Verband und der Krücke Rodrigo hieß und ein wackliges Bänkchen bestieg, um seinen Schicksalsgefährten, die ihn teilnahmslos aus dem Jenseits betrachteten, zu berichten, was er gerade im Radio erfahren habe, und anschließend einen Vorschlag zu unterbreiten, einen Fluchtplan, der so verzweifelt wie aussichtslos war. Wenigstens aber sollte er dafür sorgen, dass die Franquisten, die kurz davorstanden, Port de la Selva zu erreichen, sie nicht zu fassen bekamen. Sein genialer Plan bestand schlicht und ergreifend darin, auf den Rot-Kreuz-Laster zu klettern, der vor dem Schuppen stand. Auf die dazugehörigen Schlüssel war der Mann bei der Suche nach den Morphiumampullen gestoßen; jetzt brachte er den Bund zum Erklingen, indem er ihn seinem wenig überzeugten Publikum von der Höhe des Bänkchens aus entgegenhielt und triumphierend hin und her schwenkte. Bekannt ist, dass sich ihm an die zwanzig Mann anschlossen, unter ihnen Oriol. Die Übrigen, soweit sie überhaupt noch am Leben und in der Lage waren, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, zogen es vor, auf die Ankunft der feindlichen Soldaten zu warten. Das tragische Häuflein verteilte sich, einer spontan gebildeten Rangordnung folgend, über den Lastwagen; die am schwersten Verletzten, oder die Rücksichtslosesten, auf Sitzen und Bänken, der Rest, je nach Stärke ihrer Schmerzen und ihrer Transportfähigkeit, stehend oder auf dem Boden kauernd. Oriol nahm mit der unverletzten Pobacke am Rand einer Sitzbank Platz, darauf bedacht, dass die unaufhörlich nässende Wunde nicht mit dem Bein seines Nebenmanns in Berührung kam; zum einen wäre es ihm peinlich gewesen, dort Flecken zu hinterlassen, vor allem aber durchfuhr ihn schon beim leisesten Druck ein unerträglicher Schmerz. Dass er im Lastwagen einen solch bevorzugten Platz hatte einnehmen können, hatte nichts mit der erwähnten Rangordnung zu tun, es war vielmehr einzig und allein dem Zufall geschuldet. Dort, wo er jetzt war, hatte er sich niedergelassen und nicht mehr von der Stelle gerührt, auch wenn er nicht als sehr schwer verletzt, allerdings auch keineswegs als dreist und rücksichtslos eingestuft werden konnte. Schließlich war Oriol, wie ein großer Teil derjenigen, die auf diesem Lastwagen nach Frankreich fliehen wollten, eher zufällig Soldat geworden; er hatte seine Pianistenlaufbahn unterbrochen, um in den Krieg zu ziehen, er war ein normaler, durchschnittlicher Mensch, weder besonders mutig noch feige, eigentlich auch kein Abenteurer, dafür aber als halbwegs kräftig zu bezeichnen, doch wie viel Schmerzen und Unglück er aushalten konnte, hatte er erst im Lauf des Krieges herausgefunden. Wie so viele der Soldaten, die sich freiwillig den republikanischen Truppen angeschlossen hatten, taugte Oriol also eigentlich nicht fürs Kriegshandwerk, er war Musiker, Sohn eines Journalisten, der sich ebenfalls den kämpfenden Republikanern angeschlossen hatte, und der Bruder von Arcadi, der ihn, in der Hoffnung, eines Tages nach Spanien zurückkehren und sein Jurastudium beenden zu können, auf der anderen Seite der Grenze erwartete. Rodrigo ließ sich am Steuer des Lastwagens nieder und versuchte, schwerverletzt, wie er war, aufs Geratewohl die französische Grenze zu erreichen. Obwohl das Ziel nicht weit entfernt lag, war es nahezu unmöglich, auf den Landstraßen vorwärtszukommen, alles war überfüllt mit Personenkraftwagen, Lastwagen, Bussen, Pferdewagen oder Ochsenkarren und Leuten zu Fuß, die sich einen Großteil ihres Hausrats aufgeladen hatten, um zusammen mit ihren Kindern und Tieren aus Spanien zu fliehen. Rodrigo stammte aus Besalú und kannte sich in diesem Teil der Pyrenäen sehr gut aus, weswegen er den Versuch unternahm, auf Seitenstraßen auszuweichen, was die Flucht in eine Irrfahrt verwandelte, bei der sie, kaum dass sie höher gelegenes Gebiet erreichten, auf Schnee stießen. Für die Mitreisenden wurde die Fahrt zum Albtraum; bei jedem Schlagloch, jedem neuen grob gepflasterten Feldweg, den der Laster in Angriff nahm, wurden sie heftig durch-und gegeneinander geworfen, erst recht, wenn es rücksichtslos querfeldein ging, was mehrfach vorkam. So ging es, bis der Laster bei einem weiteren solchen halsbrecherischen Abstecher, irgendwo an einem Bergabhang zwischen Beget und Rocabruna, in einen Graben rutschte, der unter dem Schnee nicht zu sehen gewesen war. Mühsam kletterten die Männer aus dem Fahrzeug, das mit der Schnauze in dem Graben steckte, während das Gehäuse selbst Schlagseite hatte. Der Fahrzeugboden hatte sich so in eine Rutschbahn verwandelt, was nicht nur manchen der Verletzten in eine äußerst unbequeme Lage brachte, drei oder vier von ihnen waren vielmehr bereits Richtung Führerhaus geschlittert. Zuletzt schafften sie es aber doch, sich gegenseitig hinauszuhelfen, wo sich sogleich die Frage stellte, was mit denen geschehen solle, die nicht mehr gehen konnten. Manche dachten auch weniger menschenfreundlich und machten sich unverzüglich bergaufwärts davon, Richtung französische Grenze oder wenigstens zu einem Punkt, der möglichst weit weg von den sterbenden Kameraden war, von denen sie nichts mehr wissen wollten – der Krieg war verloren, niemand würde jetzt noch verfolgt, geschweige denn ausgezeichnet, also blieb ab sofort alles dem Gewissen jedes Einzelnen überlassen. Oriol gehörte zu denen, die es geschafft hatten, selbstständig vom Laster zu klettern, und für ihn war es eine Frage des
Anstands, denjenigen beizustehen, die dazu nicht in der Lage waren, auch wenn er bei jedem Schritt bis zu den Knien im Schnee versank und sich sehr wohl bewusst war, dass jede Sekunde, die er für die Rettung seiner Kameraden verwendete, seine Aussichten minderte, lebend bis nach Frankreich zu gelangen. Die Kälte, die von seinen Füßen aufstieg, und die dicken Schneeflocken, die von oben auf ihn herabfielen und erbarmungslos seine Kleidung durchnässten, ließen das Fieber nochmals heftig ansteigen, bis er so sehr mit den Zähnen klapperte und vom Schüttelfrost gepackt wurde, dass er kaum noch etwas zu den Hilfsbemühungen der anderen beitragen konnte, als ob es nicht schon gereicht hätte, dass jemand wie er, der selbst dringend Unterstützung benötigt hätte, anderen Beistand leistete. Dazu kam der Schock, den es ihm versetzt hatte, als er, kaum war er vom Lastwagen gestiegen und zum ersten Mal im Schnee versunken, an seinem verletzten Bein keinerlei Kälte verspürte, gar nichts, genauer gesagt, was nur bedeuten konnte, dass dieser Teil seines Körpers bereits abgestorben war und er ihn dennoch über den Berg würde mitschleppen müssen. Ich weiß nicht, ob Oriol das damals tatsächlich in dieser Weise für sich formuliert hat, mir erscheint sein abgestorbenes Bein jedenfalls durchaus als tragfähige Metapher dessen, was sich in diesem Augenblick abspielte: Wenn man so will, schleifte Oriol an diesem bitterkalten Wintertag des Jahres 1939 den Leichnam Spaniens hinter sich her. Rodrigo, der keineswegs zu den am wenigsten schwer Verletzten gehörte, dafür aber immer noch der Zuversichtlichste von allen war, kletterte in den Lastwagen zurück und schlang denjenigen, die sich nicht mehr selbst von der Stelle bewegen konnten, ein Seil um die Hüften. Sie mussten schleunigst hinausgeschafft werden, denn auf dem Metallboden des Lastwagens war es eiskalt, noch kälter als draußen, und wenigstens diese Hilfe konnte man ihnen zuteil werden lassen, sosehr sie die Betroffenen auch zu gellenden Schmerzensschreien veranlasste. Schließlich konnte man sie nur aus dem Wagen befördern, indem man sie, notgedrungen ziemlich gewaltsam, über den Boden schleifte, was bei mehr als einem weitere Brüche und neue Wunden herbeigeführt haben dürfte. Auch Rodrigos verletztes Bein dürfte beim Kontakt mit dem Lastwagenboden zusätzlich gelitten haben, jedenfalls bin ich durchaus der Meinung, dass es eindeutig als Heldentat zu bezeichnen ist, wenn sich jemand in seinem Zustand um die Bergung von Verletzten kümmert. Zwei Soldaten blieben allerdings im Innern des Lastwagens. Der eine hatte die Hilfe zurückgewiesen, weil er sich schlichtweg zu schwach für eine solche Bergungsaktion fühlte, weshalb er es vorzog, sich in eine Decke hüllen zu lassen, um abzuwarten, bis sich das Wetter besserte oder jemand vorbeikam, der über weniger rudimentäres Hilfswerkzeug verfügte. Vielleicht – wahrscheinlich – war er ohnehin halb bewusstlos und wollte bloß noch in Ruhe gelassen werden. Wie auch immer, er blieb jedenfalls, wo er war, genau wie sein Nebenmann – der allerdings war tot; wahrscheinlich war er schon während der Fahrt gestorben, was in dem Moment bloß niemand bemerkt hatte. Erst Rodrigo fiel es auf, als er ihn um die Hüften packen wollte; der Mann war steif wie ein Brett, und seine Gesichtszüge verrieten, dass das Leben schon vor einer ganzen Weile aus seinem Körper entwichen war. Trotzdem dürfte Rodrigo, in aller gebotenen Eile, erwogen haben, ihn in jedem Fall hinauszuschaffen und zu beerdigen, dann jedoch zu der Einsicht gelangt sein, dass sie so schnell wie möglich aufbrechen und die Ersteigung des Berges in Angriff nehmen mussten, schließlich verschlechterte sich das Wetter von Minute zu Minute, und es zogen sich immer dunklere Wolken zusammen. Oriol beteiligte sich bis zuletzt an den Bergungsarbeiten, auch wenn er bloß mehr oder weniger symbolisch mit am Seil zog. Danach schloss er sich den anderen an, die in einer Reihe hinter Rodrigo herliefen, der zu diesem Zeitpunkt zwar immer noch der Zuversichtlichste von allen war, sich aber längst nicht mehr so gut im Gelände zurechtfand wie zuvor, abgesehen davon, dass sein eindeutig als heldenhaft zu bezeichnendes Verhalten in der Tat zur Verschlimmerung seiner Beinverletzung geführt hatte. Bei jedem Schritt versank Rodrigos Krücke tief im Schnee, was das Tempo nicht gerade beschleunigte, und als sich der von ihm geführte Trupp gerade daranmachen wollte, die Ersteigung eines steilen Hangs in Angriff zu nehmen, verdichteten sich die dicken Flocken zu einem heftigen Schneetreiben, das sie zeitweilig den Boden unter den eigenen Füßen nicht mehr erkennen ließ. Bekannt ist, dass Oriol einem Mann mit Namen Manolo zur Seite stand, und das aus demselben Grund, der ihn zuvor veranlasst hatte, wenn auch eher symbolisch, mit am Bergungsseil zu ziehen: Es schien ihm eine Frage des Anstands.
Andererseits fragte er sich allmählich, ob ebendieser Manolo, statt sich durch seine, Oriols, Hilfe zu retten, ihn nicht ebensogut mit den Abhang hinunterreißen konnte. Mein Eindruck ist – obwohl ich damit wahrscheinlich jemand anderem meine eigenen Gedanken unterschiebe –, dass Oriol, während er so dem Schnee und dem Fieber trotzte und sich den immer steileren Hang hinaufkämpfte, sich irgendwann gefragt haben muss, ob der Anstand nicht vielmehr von ihm verlangte, dass er sich selbst rettete, ja, ob er sich nicht am Ende seiner Frau und seinem Bruder gegenüber unanständig benahm, wenn er sein Schicksal so mit dem eines gewissen Manolo verknüpfte, den er gar nicht kannte. Ihn bis auf den Grund der nächsten Schlucht zu begleiten, wäre ihm jedenfalls übertrieben vorgekommen. Aber was auch immer Oriol in diesem Zusammenhang wirklich gedacht und mit welch ausgeprägter Überzeugung er Manolo letztlich beigestanden haben mag – wenn man seinen Großmut bedenkt, die gewaltige Anstrengung, die es bedeutete, verletzt, wie er war, den Versuch zu unternehmen, einen anderen zu retten, spielt all das keine Rolle. Dafür entspricht es in seiner Großartigkeit dem Verhalten Rodrigos – beide hätten, so gesehen, weniger ihre Mitmenschen als vielmehr die Ehre des Menschengeschlechts überhaupt gerettet. Andererseits bestand durchaus eine enge Beziehung zwischen Oriol und dem Unbekannten an seiner Seite, gehörten sie doch beide derselben tragischen Bruderschaft an und hatten gemeinsam denselben Feind bekämpft und zuletzt den Krieg gegen ihn verloren. Oriol konnte nur mit großer Mühe mit Rodrigo mithalten, schließlich kam er kaum voran, da Manolo immer stärker aus dem Tritt geriet und sich immer mehr bei ihm abstützte, so dass es ihm, Oriol, immer schwerer fiel, nach jedem Schritt die Stiefel aus dem Schnee zu ziehen. Trotzdem schleifte er Manolo immer noch neben sich her, hatte allerdings irgendwann das Gefühl, er schleife den ganzen Berg mit. Trotz dieser gewaltigen Anstrengung und des Hundewetters konnte Oriol sich nicht die kleinste Verschnaufpause erlauben, durfte er Rodrigo doch um keinen Preis aus den Augen verlieren, wozu bei diesem Schneesturm schon ein einziger Meter Abstand gereicht hätte. Wie lange sie auf diese Weise den Berg hinaufgestiegen sind, weiß ich nicht, allzu weit können sie aber nicht gekommen sein, bekannt ist nämlich, dass sich Rodrigos Zustand schon bald merklich verschlechterte, der Schmerz in seinem Bein war unerträglich geworden, und das ständige Zerren an der im Schnee versinkenden Krücke hatte seine Kräfte aufgezehrt. Jedenfalls blieb er irgendwann schlagartig stehen und drehte sich um, und Oriol befiel Panik angesichts seines leeren Blicks, war darin von einem Weg, geschweige denn einem Plan zu ihrer Rettung doch nicht mehr das Geringste zu erkennen. Stattdessen wurde Rodrigos vereistes Gesicht im Rhythmus der Sturmböen immer wieder von einem losen Teil seines Verbandes bedeckt, wodurch im Gegenzug seine Kopfverletzung freigelegt wurde, die an einen hart gefrorenen Axthieb erinnerte. Oriol drehte sich seinerseits, Rodrigos Blickrichtung folgend, unwillkürlich um und stellte zu seinem noch größeren Entsetzen fest, dass niemand hinter ihm zu sehen war.
Alles, was von ihrem Häuflein Verwundeter übrig war, waren also Manolo, der den Versuch, sich von allein aufrecht zu halten, längst aufgegeben hatte, der völlig erledigte Rodrigo und er, Oriol selbst, der sich unversehens in den stärksten Mann am Platz verwandelt hatte, der Einzige, der noch imstande schien, den versprengten Rest der Nachhut des republikanischen Heeres voranzutreiben. Rodrigo machte mit dem tiefen Schnitt am Kopf und dem im Wind flatternden blutigen Verbandsfetzen einen so üblen Eindruck, dass Oriol sich sagte, wenn überhaupt, könne er bestenfalls noch Manolo zurate ziehen, um zu überlegen, wie es weitergehen solle. Als er daraufhin jedoch den Versuch unternahm, Manolo aufzurichten und ein Stück von ihm abzurücken, um ihn ansprechen zu können, musste er feststellen, dass sein Leidensgenosse tot war, was bedeutete, dass er ihn offenbar schon seit wer weiß wie langer Zeit so neben sich hergeschleift hatte. Unter dem immer noch völlig leeren Blick Rodrigos ließ Oriol Manolos Körper zu Boden gleiten, bettete ihn in den Schnee und fing an, ihm die Kleidung zurechtzuziehen, ihm Uniformjacke und Hemd zu richten, und mithilfe einer Handvoll Schnee brachte er einen hässlichen Blutfleck auf Manolos Gesicht zum Verschwinden. Bei all dem ging er mit großer Sorgfalt vor, als wollte er so den toten Körper bestmöglich für die Bestattung vorbereiten und das sie umgebende Chaos und die maßlose Wut des Berges beschwören. Als Manolos Leichnam schließlich einen geradezu ansehnlichen Eindruck machte, überlegte Oriol, ob er ihn an Ort und Stelle im Schnee begraben solle, doch schon im nächsten Augenblick war ihm klar, dass es vollkommen genügte, ihn einfach liegen zu lassen, der Sturm würde den Rest binnen weniger Minuten von selbst erledigen. Da riss ihn Rodrigos Stimme aus seinen Gedanken. Um den tosenden Wind zu übertönen, schrie dieser, so laut er konnte: »Den Ausweis!«, und noch etwas, was Oriol nicht verstand – vermutlich, dass sie die persönlichen Angaben des Toten brauchten, um seine Familie benachrichtigen zu können, woraufhin Oriol Manolos Taschen durchwühlte, bis er tatsächlich auf dessen Ausweis stieß. Zugegebenermaßen drückte sich in all dem ein bemerkenswerter Optimismus aus, wenn man bedenkt, was die beiden Männer, die ihrerseits dem Tod näher als dem Leben waren, in diesem Augenblick erwartete. Oriol steckte den Ausweis in seinen Tornister und ging zu Rodrigo, um diesem seine Pläne darzulegen, doch der schnitt ihm das Wort ab, kaum dass er zu reden begonnen hatte, und sagte seinerseits, er, Oriol, solle sofort aufbrechen und weiter den Berg hinaufgehen, er selbst werde später nachkommen; sobald Oriol oben sei, brauche er bloß noch auf der anderen Seite hinabzusteigen, dann sei er in Frankreich; sie seien außerdem schon ziemlich weit oben, die Pyrenäen seien hier nämlich nicht so hoch wie an anderen Stellen. Anschließend übergab er Oriol auch seinen Ausweis – »falls ich dich nicht einhole«. Daraufhin marschierte Oriol unverzüglich los, etwas anderes blieb ihm auch gar nicht übrig, denn verletzt, wie er war, musste er unbedingt die Zeit bis zum Anbruch der Dunkelheit nutzen, der Aufstieg würde ohnehin schwierig genug. Außerdem, nehme ich an, hatte ihn etwas in Rodrigos Augen, die ihn zwar nicht mehr völlig leer, deshalb aber noch lange nicht sehr lebendig anblickten, erkennen lassen, dass Rodrigo der Anstrengung überdrüssig war und sich lieber an Ort und Stelle seinem Schicksal ergab, ob es nun unerwartet ein glückliches Ende fand oder die Gestalt des Feindes oder einer Lawine annahm. Hier, wo alles den ungezügelten Kräften der Natur unterworfen war, hatte sich Oriols Hoffnungslosigkeit, der er sich auf der Lazarettpritsche noch widerstandslos ausgeliefert hatte, in unbändigen Überlebenswillen gewandelt, während Rodrigo den umgekehrten Weg genommen hatte: Dessen heldenhafter Vorsatz, sie alle über den Berg zu führen und zu retten, war auf halber Höhe zum Erliegen gekommen, woraufhin er folgsam zur Erde zurückgekehrt war und nun zuließ, dass ihn derselbe Schnee bedeckte, der eineinhalb Meter von ihm entfernt auch Manolo unter sich begrub. So, ergeben im Schnee sitzend, präsentierte Rodrigo sich jedenfalls Oriol, als dieser sich ihm ein letztes Mal näherte, weil Rodrigo ihm – laut schreiend: »Die brauche ich nicht mehr« – die Krücke entgegenhielt. Woraufhin Oriol umso bedrückter davongegangen sein muss, schließlich hätte sein Gefährte ihm kaum deutlicher zu verstehen geben können, dass er für sich keine Rettung mehr erhoffte. Was mich wiederum auf den verwirrenden Gedanken bringt, wie stark die Art unserer Beziehungen zu anderen Menschen oft von den Umständen abhängt, so dass ein für uns namen- und gesichtsloser Mensch innerhalb der wenigen Stunden, die wir mit ihm verbringen, wichtiger für unsere Biographie werden kann als andere, die uns fast das ganze Leben hindurch begleiten. Das behaupte ich hier so, weil es eine unbestreitbare Tatsache im Leben Oriols gibt: Jahrelang war uns nur deshalb bekannt, wie Oriols letzte Stunden verlaufen waren, weil in einem Brief Rodrigos davon berichtet wurde, was mehr als hinreichend beweist, wie wichtig Oriol für Rodrigo gewesen ist. Aber damit versuche ich schon wieder, zu viele verschiedene Dinge unter einen Hut zu bringen. Oriol sah, bald von Gewissensbissen gequält, bald von dem festen Entschluss gedrängt, so schnell wie möglich zu verschwinden, auf seinen Gefährten hinab, der sich aufgegeben hatte und ihm die Krücke hinhielt, die Oriol schließlich, vermutlich nicht, ohne sich zu bedanken, entgegennahm, um sich sodann umzudrehen und den ersten Schritt zu tun, mit dem er sich von Rodrigo entfernte, anschließend die Krücke in den Schnee zu bohren und daraufhin sein abgestorbenes Bein nachzuziehen. Als Oriol zum letzten Mal versuchte, den Gipfel des Berges in den Blick zu nehmen, war es später Nachmittag und das Sonnenlicht so schwach, dass es ihm kaum noch gelang, das dichte Schneetreiben zu durchdringen. Oriol muss sich einerseits von einer großen Last befreit, andererseits aber auch furchtbar einsam und verlassen gefühlt haben. Wie sehr er sich bewusst war, welche Rolle ihm zugefallen war, ob er sich tatsächlich darüber im Klaren war, dass er der letzte Mann vom letzten Trupp der Nachhut, der letzte Atemzug der spanischen Republik war, das letzte Überbleibsel einer Sache, die missraten war und nicht mehr existierte, weiß ich nicht. Wie viele Stunden Oriol gegen den Sturm ankämpfte, ist nicht bekannt, ebenso wenig, wie er zuvor überhaupt den ersten Teil des Anstiegs hatte bewältigen können, mit Manolo als bleischwerer Last an seiner Seite, einem abgestorbenen Bein und, zu diesem Zeitpunkt, weder einem Stock noch einer Krücke. Und über alles Weitere gibt es erst recht keine Gewissheit. Dennoch ist es uns gelungen, im Lauf mehrerer Jahrzehnte das Ende der Geschichte zu rekonstruieren, ein Ende wenigstens, das wir so oft wiederholten, dass es meiner Familie, mit Ausnahme meines Großvaters Arcadi, dabei half, irgendwann hinzunehmen, dass Oriol 1939 bei dem Versuch, nach Frankreich zu fliehen, gestorben war. Irgendwann war es damals jedenfalls so weit: Das letzte Sonnenlicht war von Schnee und Sturm verschluckt worden, und die Dunkelheit, Müdigkeit und die von der Wunde verursachten Schmerzen hatten Oriol gezwungen, haltzumachen und sich einen Unterschlupf zu suchen, in diesem Fall eine Höhle, wo er sich zusammenkauerte und, für immer, einschlief. Womit wir unserem Großonkel Oriol zugegebenermaßen ein recht gnädiges Ende zugestanden, hätte er doch ebenso gut in eine Schlucht stürzen oder von einem Wolf oder Bären gefressen werden können. In jedem Fall brauchte die Familie, wie schon gesagt, unbedingt ein Ende, um Oriol der anderen Welt übergeben zu können, und wenn es sanft ausfiel, umso besser. Mein Großvater Arcadi dagegen hatte seit ihrem Abschied im Februar 1939 in dem verdreckten Schuppen in Port de la Selva niemals den Gedanken aufgegeben, sein Bruder könne noch am Leben sein und wohne in Frankreich oder gar, eine Vorstellung, an der er mit an Wahnsinn grenzender Sturheit festhielt, in irgendeinem Land Südamerikas. Während der sechzehn Monate, die Arcadi im Internierungslager Argelès-sur-Mer hatte zubringen müssen, einem Stacheldrahtverhau, wo die französische Regierung die Anhänger der spanischen Republik einsperrte, die vor der Verfolgung durch die Franquisten hatten fliehen können, klammerte er sich unaufhörlich an die Vorstellung, im nächstbesten Augenblick werde Oriol erscheinen, hinkend und auf einen Stock gestützt, aber gerettet und, wie versprochen, durch die Behandlung in einem französischen Krankenhaus halbwegs wiederhergestellt. Im Lauf dieser sechzehn Monate blieb Arcadi mindestens einmal täglich fast das Herz stehen, sobald durch die Lautsprecheranlage Neuigkeiten angekündigt wurden; und wenn einer der Aufseher sich seiner Barracke näherte, war er jedes Mal aufs Neue überzeugt, der Mann sei erschienen, um zu fragen, ob einer von ihnen einen Bruder mit Namen Oriol habe. Als Arcadi das Lager endlich verlassen durfte, ging er ins Exil nach Mexiko, nach Veracruz, eine Rückkehr nach Spanien war ja ausgeschlossen. Und dort, am völlig zugewucherten Ende der Welt, befand er es für gut und richtig, La Portuguesa zu gründen, eine Kaffeeplantage, wo wir, dem Spanischen Bürgerkrieg sei Dank, einer nach dem anderen als seine Nachkommen das Licht der Welt erblickten, eine lange Reihe Heimatloser, die niemals richtig Wurzeln schlugen, weder Spanier noch Mexikaner, weder Veracruzaner noch Katalanen, und einer von ihnen bin ich. Bis ans Ende seines Lebens wartete Arcadi auf La