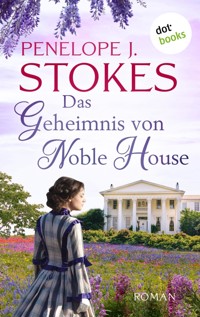Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Geheimnis eines ganzen Lebens: Die bewegende Familiensaga »Das bernsteinfarbene Foto« von Penelope J. Stokes jetzt als eBook bei dotbooks. »Finde dich selbst. Finde deine Wahrheit. Rechne nur nicht damit, dass alles so ist, wie du es erwartest.« Mit diesen geheimnisvollen Worten erhält Diedre McAlister an ihrem 25. Geburtstag von ihrer sterbenden Mutter ein Schmuckkästchen. Darin ein altes, bernsteinfarbenes Familienfoto, auf dem zwei Kinder zu sehen sind: Diedre und ihre Schwester Sissy, die so jung und tragisch ums Leben kam. Doch das Foto wurde erst Jahre später aufgenommen – ist es etwa der Beweis für eine erschütternden Lüge, die das Leben ihrer Familie bis heute beherrscht? Auf der Suche nach Antworten reist Diedre zu der alten Villa ihrer Großmutter – stets der Hoffnung entgegen, mehr über ihre Schwester zu erfahren, zu der sie noch immer eine tiefe Verbindung spürt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Familiengeheimnisroman »Das bernsteinfarbene Foto« von Bestseller-Autorin Penelope J. Stokes. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Finde dich selbst. Finde deine Wahrheit. Rechne nur nicht damit, dass alles so ist, wie du es erwartest.« Mit diesen geheimnisvollen Worten erhält Diedre McAlister an ihrem 25. Geburtstag von ihrer sterbenden Mutter ein Schmuckkästchen. Darin ein altes, bernsteinfarbenes Familienfoto, auf dem zwei Kinder zu sehen sind: Diedre und ihre Schwester Sissy, die so jung und tragisch ums Leben kam. Doch das Foto wurde erst Jahre später aufgenommen – ist es etwa der Beweis für eine erschütternden Lüge, die das Leben ihrer Familie bis heute beherrscht? Auf der Suche nach Antworten reist Diedre zu der alten Villa ihrer Großmutter – stets der Hoffnung entgegen, mehr über ihre Schwester zu erfahren, zu der sie noch immer eine tiefe Verbindung spürt …
Über die Autorin:
Penelope J. Stokes unterrichtete zwölf Jahre lang an einem College Literatur und kreatives Schreiben, bevor sie 1985 ihre Lehrtätigkeit beendete, um sich vollends dem Schreiben zu widmen. Für ihre Romane wurde sie vielfach ausgezeichnet und eroberte die Herzen ihrer Leser mit dem Bestseller »Eine Flaschenpost voller Träume« im Sturm. Ihr Roman »Die Töchter von Asheville Hall« ist eine Hommage an ihre Heimat inmitten der wunderschönen Blue Ridge Mountains in North Carolina.
Penelope Stokes veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romane:»Einen Flaschenpost voller Träume«»Das Geheimnis von Noble House«»Die Töchter von Asheville Hall«»Die Frauen, die wir waren«»Das Lied unseres Sommers«
Mehr über die Autorin erfahren Sie auf ihrer englischsprachigen Website: lifebeyondbooks.wordpress.com/
***
eBook-Neuausgabe August 2020
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2001 unter dem Originaltitel »Amber Photograph« im Verlag Thomas Nelson, Nashville, Tennessee.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2001 by Penelope Stokes
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 Gerth Medien GmbH, Asslar
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with Penelope J. Stokes
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Andrii Medvediuk / KUCO / Nagel Photography / DMS Foto / Kowit Lanchu sowie © pixabay
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (tw)
ISBN 978-3-96655-364-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das bernsteinfarbene Foto« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Penelope Stokes
Das bernsteinfarbene Foto
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Weyandt
dotbooks.
Prolog
»Lass mich fliegen, Sissy!«
Wild wirbelten sie herum, die beiden, Hand in Hand. »Dreh mich schneller! Schneller!« Das ältere Mädchen, beinahe erwachsen, warf den Kopf in den Nacken und lachte in kindlichem Übermut, während die Füße des jüngeren Kindes vom Boden abhoben und durch die Luft flogen.
»Wir fliegen, Sissy! Wir fliegen!«
Und sie flogen tatsächlich, bis es schien, als würde jede Bewegung aufhören, und nur die Welt um sie herum drehte sich weiter.
Schließlich ließen sie sich erschöpft und atemlos zu Boden sinken, lagen still auf dem weichen Sommergras und beobachteten, wie sich der Himmel über ihnen drehte. Die große blaue Kuppel, durch die Zweige und Äste des Baumes über ihnen in Spalten aufgeteilt, lief langsam aus wie das große Glücksrad auf der Kirmes. Langsamer, immer langsamer, bis das Universum zum Stillstand kam und sich aufrichtete ...
Keuchend fuhr sie aus dem Schlaf hoch. Sie erinnerte sich mühelos an jedes Detail des Traumes. Sie kannte ihn bereits auswendig, hatte ihn in den vergangenen zwanzig Jahren tausendmal geträumt. Sogar bei Tag verfolgten diese Bilder sie wie ein falsch platziertes Foto in bernsteinfarben und ockergelb, das sie drängte, die Seite eines unsichtbaren Fotoalbums umzublättern und sich an alles zu erinnern.
Aber sie konnte sich nicht erinnern.
Und es machte alles keinen Sinn. Diese Vision war kein Albtraum, vielmehr ein Bild von zwei fröhlichen Mädchen, vielleicht sogar ein Segen. Trotzdem, irgendetwas nagte an ihr, zerrte an ihrer Seele. Immer wachte sie in Tränen aufgelöst auf, war sich einer namenlosen Leere bewusst, eines schwarzen Loches, eines riesigen gähnenden Abgrunds, der sie zu verschlingen drohte.
Sie konnte nicht davon loskommen. Trotz des Schmerzes umklammerte sie den Traum mit der Entschlossenheit eines Kindes, zog ihn an sich, wie sie ihr Kissen Trost suchend an sich drückte und weinte, bis der Traum selbst feucht und kalt an ihrer Wange kratzte.
Er war alles, was von ihrer Schwester noch übrig war.
Teil 1Der Traum
Träume kommen wie der Glaubetief aus unserem Innern und von weit her.Wir klammern uns an sie, nicht fester,als wir die Dämmerung umklammernoder uns selbst im Wind verankern.Träume entgleiten uns wie der Glaube,und doch bleibt das Geschenk,wenn auch dort verborgen,wo nur das Herz es finden kann.
Der Eindringling
Heartspring, North CarolinaApril 1995
Cecilia McAlister hielt die Luft an. Ein stechender Schmerz ging durch sie hindurch. Sie versuchte sich auf dem Samtsofa aufzusetzen. Als der Schmerz nachließ, strich sie die Decke glatt und ließ sich schwer atmend wieder in die Kissen sinken. Im Augenblick war die kleinste Bewegung für sie eine enorme Anstrengung; vom Bett zum Sofa zu gehen, konnte ihre Energie für einen halben Tag aufbrauchen.
Trotzdem war sie entschlossen, nicht aufzugeben. Das Krankenhausbett, dieses bösartige Ungeheuer aus Metall mit seinen elektronischen Funktionen, war acht Monate zuvor in ihr Zimmer gebracht und in der Ecke aufgestellt worden. Es war ihr Sarg. Wenn sie dort liegen blieb, würde sie sterben, dessen war sie sich sicher. So lange sie aufstehen und sich auf das Sofa legen konnte, so lange Vesta sie frisierte und ein wenig Make-up auflegte, so lange sie ein hübsches Bettjäckchen trug und ein Buch auf ihrem Schoß lag, würde sie den Eindringling noch eine Weile länger abwehren können. Es war eine nutzlose Täuschung, aber wenigstens für den Augenblick konnte sie vielleicht dem Tod vormachen, er würde sie nicht kampflos bekommen.
Sie atmete nun etwas leichter. Cecilia sah sich in dem früheren Musikzimmer des großen Hauses um. Wie viel Echo klang in diesem Raum mit seinem Flügel und den großen Fenstern zum Garten hin noch nach. Erinnerungen an Gesang und Gelächter und an Stimmen, die ihren Namen riefen. Als sie so dasaß, den Rücken an die Kissen gelehnt, konnte sie beinahe glauben, dass alles noch so war wie früher. Sie konnte die Blumen im Garten hinter der Veranda blühen sehen und beobachten, wie sich Gewitterwolken über den Bergspitzen zusammenzogen. Von Anfang an war dieser Raum ihre Zuflucht gewesen, ihr Allerheiligstes, der einzige Platz auf der Welt, wo sie sich lebendig fühlte und ganz und ...
Sie konnte das Wort kaum denken: normal. Seit Jahren schon war nichts mehr normal. Und nun, da sie vor der unausweichlichen Rückeroberung ihrer Seele stand, war Cecilia gezwungen, über das nachzudenken, was hätte sein können, wenn sie nur schon vor Jahren die Kraft gehabt hätte, zu ihrem Mann Nein zu sagen. Nein zu seinen hochtrabenden Träumen, seinem Ehrgeiz. Nein zu seiner Vorstellung, wie ihr Leben zu verlaufen habe. Nein zu – na ja, zu einer ganzen Reihe von Dingen.
Aber niemand, nicht einmal seine Frau, sagte Nein zu Duncan McAlister. Als er vor dreißig Jahren dieses Haus gebaut hatte, hatte er behauptet, es für sie zu tun, als liebevoller Ehemann, der der geliebten Frau ein prächtiges Heim schaffen wollte.
Aber schon damals hatte sie die Wahrheit gekannt, so wie sie sie heute kannte. Dieses Haus war nie für sie gebaut worden. Es war Duncan McAlisters überdimensionales Anschlagbrett, auf dem er für alle Menschen in seiner Vergangenheit, die ihn einen Niemand genannt hatten, einen Taugenichts, Sohn eines Alkoholikers und gewalttätigen Vaters, in großen Buchstaben geschrieben hatte: »Ich habe es euch doch gesagt.«
Nun, er hatte es tatsächlich geschafft. Er war reich. Er war jemand. Ein Immobilienmogul. Bürgermeister einer der ersten zehn Kleinstädte Amerikas. Eine Ikone. Ein Idol. Man sprach sogar davon, ihm auf dem Marktplatz ein Denkmal zu errichten.
Mein Mann hat sich bewiesen, überlegte Cecilia. Aber was war aus dem Mann geworden, den sie geheiratet hatte, dem sanften, verletzlichen, mitfühlenden Jungen, der sie in ihren Erinnerungen verfolgte? Hatte er tatsächlich existiert oder war er nur ein Produkt ihrer Phantasie gewesen, ein Wunschdenken?
Sie schob die Frage beiseite. Ihr blieb nicht mehr genügend Zeit oder genügend Energie, um alle Fragen des Lebens zu beantworten. Man konnte nicht an jedem losen Faden ziehen, sonst würde sich alles auflösen.
Der Tod hatte die Angewohnheit, das Leben in den Mittelpunkt zu rücken, nebensächliche Sorgen herauszudestillieren und einen mit der reinen und unverschleierten Wahrheit zurückzulassen. Eine Wahrheit, die ausgesprochen werden musste – jetzt, schnell, solange noch Zeit war.
Eine Zeile von Keats ging ihr durch den von Tabletten vernebelten Sinn: Die Wahrheit ist Schönheit; Schönheit, Wahrheit ...
Cecilia schüttelte den Kopf. Solche Gedichte klangen hochtrabend und edel, aber bis man nicht alles andere beiseite geschoben hatte und mit nichts anderem als keuchenden Atemzügen in einer Welt von Schmerz zurückgeblieben war, konnte man sich nicht einmal vorstellen, wie ungeheuer hässlich die Realität sein konnte.
Die Wahrheit machte vielleicht frei, aber zuerst würde sie einen durch die Hölle führen.
Die Träumerin
Ein schmaler Streifen Sonnenlicht bohrte sich durch den Schlitz zwischen den geschlossenen Vorhängen und fiel auf Diedre McAlisters linkes Auge. Stöhnend legte sie einen Arm über ihr Gesicht, aber es half nicht. Der Sonnenstrahl ging durch sie hindurch, bis sie das Gewirr der Blutgefäße sehen konnte, die sich am dünnen Fleisch ihrer Augenlider abzeichneten.
Sie drehte sich zur Wand und zog die Decke höher. Es hatte keinen Zweck. Der Schlaf bot ihr vielleicht ein paar gesegnete Stunden der Erholung, ein willkommenes Vergessen, aber jeder Morgen brachte den Schmerz erneut mit sich. Pflicht. Sorge. Verantwortung. Eine Mutter, die langsam an dem zornigen Wüten des Tumors in ihrem Körper zu Grunde ging. Allgegenwärtige Erinnerungsstücke an die Tatsache, dass Diedre mit jedem gequälten Atemzug mehr den Menschen verlor, den sie auf der Welt am meisten liebte.
Das war zu viel für eine Vierundzwanzigjährige.
Und dann fiel es ihr ein. Heute war ihr Geburtstag. Sie war jetzt fünfundzwanzig. Fünfundzwanzig und ging auf die siebzig zu, falls die Müdigkeit ihres Körpers ein Anzeichen dafür war.
Sie hörte die Türangeln quietschen, als ihre Schlafzimmertür geöffnet wurde, das Kratzen von Krallen auf dem Parkettboden. Ein Satz, ein Schlag und dann ein fröhliches Grunzen. Diedre roch den Hundeatem und spürte eine warme Zunge an ihrer Wange und ihrem Ohr.
Sie stöhnte erneut, öffnete die Augen und rappelte sich hoch. »Ist ja schon gut, Sugarbear; nicht so stürmisch, mein Mädchen. Ich stehe ja auf.«
Der Hund spielte mit dem Laken, bohrte sein Maul in Diedres Hand. Sie spürte, wie eine Welle der Zuneigung von ihr Besitz ergriff. Der kleine Hund, eine Mischung aus einem Cockerspaniel und einem Lhasa, war eine typische Blondine – nicht die hellste Glühbirne im Leuchter, aber sehr liebevoll und loyal. Und trotz Missbrauch und Vernachlässigung durch die vorherigen Besitzer war das Tier mit einer Veranlagung gesegnet, die jeden anderen Hund wie einen Brummbären erscheinen ließ. Sie lebte jetzt schon zehn Jahre bei ihnen und egal wie Diedres emotionale Verfassung auch war, sie konnte immer darauf zählen, dass Sugarbear sie zum Lächeln bringen würde. Sie war ein Antidepressivum auf Pfoten.
Die Schlafzimmertür wurde noch etwas weiter geöffnet und ein faltiges braunes Gesicht tauchte im Türrahmen auf. »Bist du wach, Liebes?«
»Jetzt schon.« Diedre stopfte sich ein Kissen in den Rücken, schob Sugarbear etwas zur Seite und winkte Vesta Shelby herein. Vesta war schon seit Jahren bei den McAlisters und Diedre betete sie regelrecht an. Für ein kleines Mädchen, das als Einzelkind aufgewachsen war, stellte Vesta eine ewige, scheinbar unerschöpfliche Quelle bedingungsloser Liebe und unkritischer Akzeptanz dar.
Die gebückt gehende alte Frau schlurfte mit einem Tablett ins Zimmer, auf dem sich Rühreier mit Schinken und Diedres Lieblingsgericht, »Arme Ritter« mit Zucker und Zimt türmten.
»Was ist das?«
»Dein Geburtstagsfrühstück natürlich.« Vesta stellte das Tablett auf Diedres Schoß und ließ sich auf dem Stuhl neben ihrem Bett nieder. »Du denkst doch wohl nicht, die alte Vesta würde deinen Geburtstag vergessen.«
»Um ehrlich zu sein, ich wünschte, die Leute würden ihn tatsächlich vergessen. Irgendwie ist mir nicht nach Feiern zu Mute.«
»Das meinst du doch nicht ernst, Liebes. Dass deine Mutter krank ist, bedeutet doch nicht, dass du aufhörst zu leben.«
»Wie geht es Mama heute Morgen?«
»Immer gleich, denke ich. Iss jetzt dein Frühstück, bevor es kalt wird.«
»Vielleicht sollte ich ...« Diedre warf die Decke zurück und wollte aufstehen.
»Du kannst sie nicht gesund machen, indem du dich sorgst«, sagte Vesta mit fester Stimme. »Ich habe ihr vor einer Stunde ihre Arznei gebracht. Sie wird noch eine Weile schlafen. Und jetzt iss.«
Diedre hielt inne, dann schob sie die Hälfte der Eier auf den Teller mit dem gebackenen Weißbrot und teilte ihr Frühstück so auf, dass zwei davon satt werden konnten. »Du wirst mir doch helfen, das alles hier aufzuessen, nicht?«
Vesta zog sich den Stuhl näher an das Bett heran und nahm den Teller, den Diedre ihr hinhielt. »Ich kann kaum glauben, dass mein Baby schon fünfundzwanzig Jahre alt ist.«
»Ich bin schon einige Zeit kein Baby mehr, Vesta.«
Die alte Frau lächelte und zwinkerte ihr zu. »Du wirst immer mein Baby bleiben. Das solltest du doch mittlerweile wissen.« Sie hob den Zeigefinger und drohte dem Hund. »Runter vom Bett, Sugarbear«, befahl sie mit strenger Stimme. »Du darfst das nicht fressen.«
Doch Sugarbear rückte nur noch näher an Diedre heran, verhielt sich ganz still und sah sie mit treuem Hundeblick an. »Nur ein kleines Stück«, sagte Diedre und zerteilte ein Stück gebratenen Speck. Der Hund wackelte erwartungsvoll mit dem Schwanz.
»Das ist nicht gut für sie.«
»Es ist auch für mich nicht gut, wenn man es genau nimmt. Aber ich werde es trotzdem essen.«
Vesta lachte und Sugarbear, die merkte, dass sie diese Runde des andauernden Streites um das Betteln gewonnen hatte, verschlang den Speck, bevor Vesta protestieren konnte.
Nach der Mahlzeit stellte Diedre das Tablett beiseite und ließ Sugarbear die Überreste von den Tellern ablecken.
»Du weißt, dass dein Vater das überhaupt nicht mag.«
Diedre zuckte die Achseln. »Was Daddy nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Außerdem spart es dir Zeit. So brauchst du nicht erst alles abzuspülen, bevor es in die Spülmaschine kommt.« Sie nahm einen Schluck Kaffee, lehnte sich zurück und seufzte. Sugarbear machte es sich dicht an sie gedrückt auf ihrer Bettdecke gemütlich. Abwesend streichelte Diedre den Kopf des Hundes. »Du musst noch mal richtig gebürstet werden, Mädchen«, murmelte sie. »Sieh dir nur deinen Bart an, der in alle Richtungen absteht.«
»Morgen früh hat sie einen Termin beim Hundefrisör. Dann bekommt sie ein Bad und ihr Fell wird gestutzt«, erwiderte Vesta. »Und wenn du mich fragst, du könntest auch mal einen neuen Haarschnitt vertragen.«
»Ich hatte keine Zeit.«
»Du meinst, du hast dir die Zeit nicht genommen.« Vesta strich Diedre mit zitternder Hand eine Locke hinters Ohr. »Du hast dieses Haus schon wer weiß wie lange nicht mehr verlassen. Miss Celia hat bestimmt nichts dagegen, wenn du dir mal etwas Zeit für dich nimmst.«
So wie Sugarbear sich gegen ihre streichelnde Hand drückte, drückte sich auch Diedre gegen die liebevolle Berührung an ihrem Hals. Einen Augenblick lang, nur einen Herzschlag, war sie wieder das kleine Mädchen, das sich daran erinnerte, wie es war, sicher und getröstet zu sein, frei von allen Ängsten des Lebens als Erwachsener. Dann setzte sie sich auf und fuhr sich mit der Hand durch ihr zerzaustes Haar. »Gefällt dir meine Frisur etwa nicht?«
Vesta lachte leise und zog an einer Locke. »Ich denke, ein Besuch beim Frisör könnte tatsächlich nicht schaden.« Ihr Lächeln verschwand und ihre dunklen Augen wurden traurig. »Ich werde mich um deine Mama kümmern, Liebes. Du brauchst nicht vierundzwanzig Stunden am Tag verfügbar zu sein. Warum fährst du nicht nach Asheville, kaufst dir ein Geburtstagsgeschenk und verabredest dich vielleicht mit deiner kleinen Freundin Carlene zum Mittagessen?«
Bei Vestas Beschreibung Carlenes als »ihrer kleinen Freundin« musste Diedre unwillkürlich lächeln. Nichts an Carlene Donovan konnte als »klein« beschrieben werden. Carlene war sehr groß und liebte auffallende Farben wie rot, lila und pink. Ihre extrovertierte Art stand im krassen Gegensatz zu Diedres Zurückhaltung. Seit der Schulzeit war Diedre mit ihr befreundet und sie waren auch während des Studiums in Kontakt geblieben. In den vergangenen fünf Jahren hatte Carlene es als ihre persönliche Lebensaufgabe betrachtet, Diedre das Träumen zu lehren. Sie hatte es fast geschafft.
Carlenes neuster Traum, und damit auch Diedres, war die Eröffnung eines Geschäfts in Biltmore Village. Eine Galerie mit dem Namen Mountain Arts, in dem die Werke von Malern und Bildhauern aus der Umgebung ausgestellt werden sollten. Nun, da Diedre und Carlene ihre Ausbildung abgeschlossen hatten, konnten sie beginnen, ihr Geschäft aufzubauen. Der Plan war eine gleichberechtigte Partnerschaft – Carlene würde das Geschäft führen und sich um den Einkauf kümmern, während Diedre, die den größten Teil des Geldes zur Verfügung gestellt hatte, als freie Fotografin tätig sein und ihre Fotos ausstellen und verkaufen würde. Ihr Geschäft würde ein großer Erfolg sein, davon war Diedre überzeugt, und nicht zuletzt auf Grund von Carlenes bestechender Persönlichkeit.
Sie hatten bereits ein Kaufangebot für ein Haus in der Nähe der Holy Trinity Cathedral abgegeben und während ihres letzten Semesters hatte Diedre begonnen, im Internet nach einem passenden Wohnhaus für sich zu suchen. Doch als Mamas Krebs wieder ausgebrochen war, hatte Diedre den Traum erst einmal auf Eis gelegt und war nach Heartspring zurückgekommen. Die Beinarbeit in Asheville blieb derweil Carlene überlassen.
Kurze Zeit schwelgte Diedre in der Vorstellung, einen Tag in Asheville zu verbringen. Es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen und sie sehnte sich verzweifelt danach, dem Ganzen hier zu entfliehen, mit Carlene auf der Terrasse des La Paz, ihres mexikanischen Lieblingsrestaurants, zu sitzen, die Sonne zu genießen und das Treiben in Biltmore Village zu beobachten. Aber sie konnte nicht. Angesichts des Zustands ihrer Mutter kam das überhaupt nicht infrage.
»Ruf Carlene doch an und verabrede dich mit ihr«, drängte Vesta.
»Du weißt, ich hasse Einkaufsbummel«, widersprach Diedre. Das stimmte, aber nur teilweise. Wie konnte sie Vesta sagen, was sie sich selbst kaum eingestehen konnte? Mama war noch immer krank. Diedres Leben in der Schwebe. Die Last der Verantwortung kreiste über ihr wie ein Geier, der auf seine Beute wartet. Ein Einkaufsbummel, ein neuer Haarschnitt oder ein Mittagessen mit Carlene würden daran auch nichts ändern.
Es war richtig gewesen, nach Hause zu kommen, davon war Diedre überzeugt. Aber nach vier Jahren Studium am College und zwei Jahren an der Universität fiel es ihr schwer, wieder unter dem Dach ihrer Eltern zu wohnen. Sie fühlte sich seltsam hin- und hergerissen, spürte eine Trägheit der Seele, die sie weder überwinden noch kontrollieren konnte. Sie war nicht mehr das, für das sie sich bisher gehalten hatte – eine unabhängige Frau von fünfundzwanzig Jahren, mit zwei Studienabschlüssen, auf die eine wundervolle Zukunft wartete. Vielmehr hatte sie aus reiner Willenskraft die Rolle sowohl der Mutter als auch des Kindes übernommen. Ihre Mutter war abhängig von ihr und wieder drohte der überzogene Beschützerinstinkt ihres Vaters sie zu erdrücken.
Sie war gefangen – eingeschlossen in einem goldenen Käfig, aber trotzdem gefangen. Und obwohl Diedre diese Pflicht aus Liebe übernommen hatte, fühlte sie sich gefangen in einem Krieg, der kein Ende zu nehmen schien.
Sie wechselte das Thema. »Ist Daddy zu Hause?«
»Der Herr Bürgermeister? Er hat heute Morgen das Haus gegen halb acht verlassen. Sagte etwas von einem Frühstück mit einer Reihe von Immobilieninvestoren.« Vesta runzelte die Stirn. »Er sollte eigentlich hier bei seiner Frau sein, wo er hingehört.«
Ihre Augen weiteten sich plötzlich, als hätte dieser Ausbruch sie schockiert. Diedre jedoch war nicht erstaunt. Dies war vielleicht das erste Mal, dass Vesta ein unbedachtes Wort über ihren Arbeitgeber äußerte, denn Vesta behielt ihre Gedanken meistens für sich. Aber an ihrer Einstellung Duncan McAlister gegenüber konnte es keinen Zweifel geben.
»Lass ihm Zeit, Vesta«, erwiderte Diedre leise. »Er leidet auch; er kann es nur nicht zeigen. Es ist schwer für ihn, sie so zu sehen.«
Trotzdem musste Diedre zugeben, dass sie manchmal dasselbe über ihren Vater dachte. Er war liebevoll und besorgt, sogar bis zu dem Punkt, dass er sie erstickte. Jahrelang hatte sie versucht, ihm klarzumachen, dass sie erwachsen war und selbst für sich sorgen könnte. Aber gelegentlich entdeckte sie einen Hauch von Zurückhaltung bei ihm. Etwas Verborgenes, als würde er irgendeine unsichtbare Wunde pflegen, die ihn unfähig machte, sich ganz zu geben. In letzter Zeit hatte er ein eigenartiges Verhalten ihrer Mutter gegenüber an den Tag gelegt. Vermutlich konnte er nicht mit ansehen, wie sie von Tag zu Tag mehr verfiel, und darum zog er sich zurück, verdrängte seinen Schmerz durch Arbeit.
»Du siehst müde aus, Liebes«, bemerkte Vesta in ihre Gedankengänge hinein.
»Ich habe nicht viel geschlafen.«
»Hast du dir um deine Mutter Sorgen gemacht?«
»Ja.« Diedre hielt inne. »Und um den Traum.«
»Seit du nach Hause gekommen bist, hast du den Traum sehr oft gehabt.«
Diedre nickte. Es war vermutlich logisch, dass die Rückkehr in ihr Elternhaus den »Wirbelnden Traum«, wie sie ihn immer genannt hatte, wieder belebte. In der Vision war sie jung, vielleicht drei oder vier Jahre alt. Das andere Mädchen, da war sie sich ziemlich sicher, war die ältere Schwester, die sie nie kennen gelernt hatte.
Jahrelang hatte der Traum sie verfolgt, aber niemand wollte darüber reden. Mama fing an zu weinen, und Daddy wurde trübsinnig und schweigsam. Endlich hatte sie es aufgegeben, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, außer mit Vesta.
»Erzähle mir von Sissy.«
Vesta schüttelte den Kopf. »Es ist nicht gut, die Toten wieder lebendig werden zu lassen.« Ihr Tonfall war freundlich, mitfühlend, wenn auch die Worte hart klangen.
»Aber ich muss es wissen, Vesta. Sie war doch meine Schwester.«
Vesta nahm das Frühstückstablett und stand auf. »Warum machst du dich nicht fertig und besuchst deine Mama? Sie wird jetzt wach sein.«
An der Tür hielt sie inne und wandte sich Diedre noch einmal zu. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Du musst das loslassen, Kind«, riet sie. »Das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Manchmal ist ein Traum einfach nur ein Traum.«
Das Foto
Diedre blieb vor dem Musikzimmer stehen und lauschte an der Tür. Falls Mama schlief, würde sie später wiederkommen. Aber sie hörte nicht den oberflächlichen, rasselnden Atem, der in dem Maß schlimmer geworden war, in dem die Lungenfunktion ihrer Mutter abgenommen hatte. Alles war still.
Sie stieß die Tür einen Spalt auf und spähte hinein. Mama lag mit geschlossenen Augen und einem aufgeschlagenen Buch auf dem Sofa. Diedre spürte einen Stich in der Brust, als würde ihr Herzschlag beinahe aussetzen. Jedes Mal wenn sie diesen Raum betrat, hielt sie die Luft an und hoffte, dass ihre Mutter nicht einfach sterben würde, ohne dass sie sich von ihr verabschieden könnte.
Ein so langwieriger Sterbeprozess wirkte sich unterschiedlich auf die einzelnen Personen aus. Ihr Vater befand sich in der Phase der Leugnung, ging seinem Beruf weiterhin nach, als hätte sich seine Frau, mit der er mehr als vierzig Jahre verheiratet war, nur ins Musikzimmer zurückgezogen, um in aller Ruhe ein spannendes Buch zu lesen oder über eine neue Tapete nachzudenken. Vesta, die immer da war, immer treu und liebevoll, verweigerte standhaft jedes Gespräch darüber, was passieren würde, wenn »Miss Celia« schließlich sterben würde. Und Diedre fühlte sich zwischen den beiden Seiten hin- und hergerissen. Sie sehnte sich danach zu entfliehen, wünschte, sie könnte in der Leugnung Zuflucht finden, aber in beidem war sie nicht erfolgreich.
Sechs Monate zuvor, bevor die Schmerzmedikation verstärkt worden war, hatten Diedre und ihre Mutter über das Sterben gesprochen. »Lass nicht zu, dass sie mich an irgendwelche Maschinen anschließen«, hatte Mama sie versprechen lassen. »Keine Operation mehr, keine Chemotherapie. Ich habe genug. Sorge nur dafür, dass die Schmerzen erträglich bleiben, und dann lass mich gehen.«
Der Krebs war zum ersten Mal drei Jahre zuvor in der rechten Brust aufgetreten, aber Mama hatte sich strikt geweigert, Diedre zu gestatten, während ihres letzten Semesters das College zu verlassen. Nach einer beidseitigen Brustamputation hatten die Ärzte gehofft, den Krebs besiegt zu haben. Mama war noch keine sechzig gewesen und hatte gute Chancen gehabt. Doch dann tauchten die Metastasen auf, in der Lunge, der Leber, der Bauchspeicheldrüse. Es war, als würde man den Schimmel in einer Duschkabine bekämpfen, sagte Mama immer, man schrubbt und schrubbt, aber wenn man einen Tag später nachsieht, ist er wieder da. In einer anderen Ecke, aber die gleiche Sauerei.
Und so hatte Diedre ihre Träume erst einmal beiseite gestellt und war nach Heartspring zurückgekehrt. Mama hielt nun schon neun Monate durch, aber allmählich ging es ihr immer schlechter. Diedre sah es in ihren Augen, hörte es an ihrem mühsamen Atem, spürte es an der Berührung ihrer zitternden Finger. Sie nahm sogar den Geruch von Desinfektionsmitteln und Verfall in dem sonst so schönen Raum wahr.
Wohlmeinende Freunde behaupteten, Diedre könne sich glücklich schätzen, oder gesegnet, je nach ihrer religiösen Überzeugung und Philosophie. Hatte sie doch jetzt die Gelegenheit, Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen und all jene unausgesprochenen Gefühle in Worte zu fassen. Wer hatte schon das Vorrecht, sich angemessen verabschieden zu können.
Aber trotz der Monate des Trauerns über den bevorstehenden Verlust wusste Diedre, dass sie auf diesen Augenblick nicht richtig vorbereitet war. Sie würde nie darauf vorbereitet sein. Wie konnte man sich darauf vorbereiten, einen Menschen, den man liebte, gehen zu lassen?
»Mama? Bist du wach?« Als Diedre die Tür noch ein wenig weiter aufschob, zwängte sich Sugarbear an ihr vorbei und schoss zu dem Sofa, auf dem ihre Mutter lag. »Böser Hund!«, zischte Diedre. »Sitz!«
»Lass sie nur, Liebes.«
Mama öffnete nicht die Augen, aber eine Hand glitt langsam nach unten, um den Kopf des Tieres zu streicheln. Der Hund schien die Situation beinahe zu erfassen, denn er legte sich an den Rand des Sofas und achtete darauf, dass er seine Herrin nicht einengte. Er leckte die Hand, die ihn streichelte.
»Miss Barett wird dich jetzt empfangen«, meinte Mama trocken. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
Diedre lächelte. Seit Mama ins Musikzimmer verlegt worden war, hatte sie sich immer mit Elizabeth Barett Browning verglichen, der eleganten, aber verkrüppelten Frau, die, auf ein Samtsofa gebettet, zusammen mit ihrem Spaniel Flush in angemessener viktorianischer Würde ihre Besucher empfing.
»Wie geht es dir heute Morgen?« Diedre zog sich einen Stuhl an das Sofa heran und nahm die Hand ihrer Mutter.
»Wie der Tod, noch nicht ganz aufgewärmt.« Mama öffnete die Augen. »Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz.«
Tränen brannten Diedre in den Augen. »Lass uns nicht von meinem Geburtstag sprechen.«
Mama runzelte die Stirn. »Warum nicht? Du wirst doch nur einmal fünfundzwanzig. Das ist ein großer Tag. Ich habe ein Geschenk für dich, das letzte, das ich dir je werde geben können.« Sie deutete auf das Fenster. Ein bunt eingepacktes Päckchen lag auf dem Flügel.
»Mama, wie ...?«
»Vesta hat mir geholfen. Wie immer.« Diedres Mutter richtete sich mühsam auf. Sie wurde von einem Hustenanfall geschüttelt, sodass sie eine Zeit lang nicht weitersprechen konnte. »Mein letztes Geschenk und mein schönstes.«
Diedre ging zum Flügel und nahm das Päckchen, dann kam sie zu ihrem Stuhl zurück. »Soll ich es jetzt aufmachen oder bis heute Abend warten, wenn Daddy nach Hause kommt?«
Ein Schatten legte sich auf das Gesicht der Kranken. »Das Jetzt ist alles«, beharrte sie. Und unter Aufbietung aller Kräfte winkte sie ab. »Mach es auf.«
Vorsichtig entfernte Diedre das Papier und öffnete das Päckchen. Darin lag in einem Nest von blassblauem Papier eine alte Zigarrenschachtel. Nichts weiter. Nun war es wohl passiert. In den letzten Zügen ihrer Krankheit hatte ihre Mutter den Verstand verloren. »Es ist ... schön, Mama«, stammelte sie.
Ein Leuchten ging über Cecilia McAlisters Gesicht. »Nicht die Schachtel, Diedre.« Sie verdrehte die Augen. »Was in der Schachtel ist. Das ist dein Geschenk. Das ist, was du immer wolltest, was ich dir nie habe geben können ... bis jetzt.«
Diedre wollte den Deckel aufmachen, doch ihre Mutter streckte die Hand aus und hielt sie auf.
»Liebes, ich muss dir etwas erklären ...«
Diedre starrte auf die Hand, die sich auf die ihre gelegt hatte. Eine Klaue. Ein Skelett umhüllt von Haut. Nicht die Hand ihrer Mutter. Sie zog scharf die Luft ein.
»Ja, Mama? Was ist?«
»Ich hätte es dir schon vor langer Zeit erzählen sollen. Die Dinge ... sind nicht, wie sie zu sein scheinen.«
Mehr als die Worte war es der Tonfall ihrer Mutter, der Diedre einen Schock versetzte, als hätte jemand Eiswasser in ihre Venen geleitet.
»Was meinst du, Mama?« Gegen ihren Willen versuchte sie ihrer Mutter ihre Hand zu entziehen.
»Mach ...« Mit zitternden Fingern deutete ihre Mutter auf die Schachtel. »Mach sie einfach auf.«
Diedre gehorchte. In der Schachtel lag ein altes Foto, vom Alter vergilbt und an den Ecken ausgefranst – das Foto eines kleinen Kindes. Ein bernsteinfarbenes Foto.
Das Mädchen, vielleicht vier oder fünf Jahre alt, saß auf dem Schoß eines Mannes. Er saß bequem in einem alten, gepolsterten Sessel. Hinter ihm konnte Diedre ein Wohnzimmer erkennen: Einen kümmerlichen Weihnachtsbaum und einen Kamin aus Karton, an dessen aufgemaltem Sims drei Strümpfe hingen. Das Mädchen hatte lockige Haare und schwarze, abgestoßene Schnürschuhe. Aber es war das Gesicht, das Diedre eine Gänsehaut verursachte – ein kleines rundes Gesicht mit großen braunen Augen, weißen, gleichmäßigen Zähnen und einem Grübchen in der linken Wange.
Diedres Gesicht.
»Es ist schlimm, ein Elternteil zu verlieren, Diedre«, sagte Mama gerade. »Aber noch schlimmer ist es, ein Kind zu verlieren ...«
Diedre konzentrierte sich erneut auf das Foto. Es hätte ihr Gesicht sein können, aber das war es nicht. Die Kleider stimmten nicht. Das Zimmer kam ihr ganz unbekannt vor. Der Mann jedoch wirkte vertraut. Er lächelte strahlend, hatte die Arme in einer Haltung reiner Freude um das Kind gelegt.
Und dann traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag.
»Das ist Sissy«, keuchte sie. »Meine Schwester! Mit Daddy!«
»Tot«, japste ihre Mutter. Ihr Atem klang jetzt noch gequälter. »Für immer tot.« Alarmiert beugte sich Diedre vor. »Mama, ist alles in Ordnung?«
»Alles wird gut ... jetzt.« Unter Aufbietung all ihrer Kräfte streckte sie ihre Hand nach dem Foto aus. »Finde dich«, flüsterte sie. »Finde deine Wahrheit.« Sie ließ sich in die Kissen zurücksinken. »Nur erwarte nicht, dass alles so ist, wie du dachtest, dass es sein müsste.«
Die Trauerfeier
Diedre saß auf dem Sofa im Musikzimmer und spielte zerstreut mit der cremefarbenen Decke, die ihre Mama vor mehr als zwanzig Jahren für sie gemacht hatte. In den vergangenen Monaten hatte Mama sie immer bei sich gehabt, als könnte ihre Wärme die Kälte des Todes vertreiben.
Aber es hatte nicht funktioniert. Cecilia McAlister war hier in diesem Raum in den Armen ihrer Tochter gestorben und Diedre hatte nichts tun können, als sie in den Armen zu halten und zuzusehen, wie das Licht aus ihren Augen wich.
»Ich liebe dich, Mama«, flüsterte sie in den leeren Raum hinein, so wie sie diese Worte ihrer Mutter in jenen letzten Minuten zugeflüstert hatte. Diedre hatte mit diesem Augenblick gerechnet, ihn gefürchtet, doch als er schließlich da war, blieb sie betäubt und ungläubig zurück.
Was Diedre sich wünschte, war mit Geld nicht zu kaufen, konnte reines Wunschdenken nicht zurückbringen, hatte sogar Gott ihr versagt. Zeit. Zeit, um noch einmal zu sagen: »Ich liebe dich.« Zeit, um das Lächeln ihrer Mutter noch einmal zu sehen und ihr Lachen zu hören. Zeit, um die tausend Fragen zu stellen, die ihr auf der Seele brannten.
Aber sie hatte keine Zeit mehr. Keine Zeit für Erklärungen. Keine Zeit für Trauer. Der Krankenwagen war gerade mit dem leblosen Körper ihrer Mutter davongefahren und nun wappnete sich Diedre innerlich für die bevorstehende Hektik. Entscheidungen waren zu treffen, die Beerdigung musste vorbereitet werden. Mama mochte vielleicht in Frieden ruhen, aber auf alle anderen im Haus wartete viel Arbeit.
Müde. Sie war so schrecklich müde.
***
Heartspring war eine kleine Stadt, aber selbst der größte Raum im Dower and Gray Beerdigungsinstitut war nicht annähernd groß genug, um die Hunderte von Menschen aufzunehmen, die kommen würden, um ihr Beileid zu bekunden. Nach intensiver Diskussion mit Mr. Dower beschlossen Diedre und ihr Vater widerstrebend, die Trauerfeier in ihrem Haus abzuhalten.
Das bedeutete Bewirtung – Party Service. Sie brauchten zusätzliche Hilfskräfte, mussten Mamas Krankenhausbett aus dem Musikzimmer entfernen und sich auf eine Invasion von Gästen vorbereiten.
Die großen Räume des Hauses boten vielleicht mehr Platz als im Beerdigungsinstitut vorhanden war, aber der Effekt war trotzdem derselbe, als würde man mehrere Sumo-Ringer in einen VW Käfer stecken. Anscheinend hatten alle 3.159 Einwohner von Heartspring beschlossen ihre Anteilnahme zu bekunden, alle auf einmal. Diedre hatte Mühe, sich von einer Seite des Zimmers zur anderen zu schieben. Die Zimmer waren voll gestopft mit Trauernden – zumindest nannten sie sich traditionsgemäß so. Eine ganze Reihe von ihnen war offensichtlich aus anderen Gründen gekommen und nicht, um die verstorbene Cecilia McAlister zu betrauern.
Zuerst war ihr das nicht so sehr aufgefallen. Sie hatte ihre Tochterpflichten zu erledigen, Hände zu schütteln, sich umarmen zu lassen und immer wieder der Versuch, die Tränen zu unterdrücken, wenn alle, die durch die Tür kamen, ihr sagten, was für eine wundervolle Frau ihre Mutter gewesen sei.
Das stimmte natürlich. Aber jedes freundliche Wort über Mama wurde zu einem Messerstich in Diedres verwundetes Herz und schon wurde sie von ihren Gefühlen überwältigt. Wenn sie sich jetzt mit hineinziehen ließ, würde sie innerhalb kürzester Zeit in Tränen aufgelöst sein. Sie zog sich besser ein wenig zurück, distanzierte sich. Das eigentliche Trauern würde zweifellos später kommen. Im Augenblick musste sie diesen Tag so gut wie möglich überstehen.
Aber sich von dem Schmerz zu distanzieren, hatte Nebenwirkungen. Ihre Gedanken begannen zu wandern und andere Sorgen bedrängten sie. Sie war es nicht gewöhnt, Schuhe mit hohen Absätzen zu tragen. Ihre Füße taten weh. Ihr Rücken schmerzte. Sie brauchte eine Pause, wollte so gern für eine Weile dem ganzen Trubel entkommen. Wo steckte nur Daddy?
Sie suchte den Raum ab und fand ihn schließlich, umgeben von Männern in dunklen Anzügen, von denen jeder um die Ehre buhlte, dem Bürgermeister in dieser Stunde der Trauer zur Seite zu stehen. Es sah eher aus wie eine Cocktailparty oder eine Wahlveranstaltung, nicht wie eine Beerdigungsfeier. Die Frauen schienen alle dasselbe kleine Schwarze zu tragen und eine Perlenkette um den Hals. Einige der Gäste bemühten sich um Duncan McAlisters Aufmerksamkeit. Einige standen in kleinen Gruppen zusammen und tratschten. Andere stellten sich für Fotos in Pose, als die wenigen Reporter der Lokalzeitung herumschlenderten und Fotos schossen.
Diedre presste die Hände an die Schläfen und schloss kurz die Augen. Als sie sie wieder öffnete, starrte sie in die eifrigen, wässerigen Augen von Oliver Ferrell.
Er umklammerte ihre Finger in einem feuchten, ernsten Handschlag. »Miss McAlister«, sagte er atemlos, »es tut mir so schrecklich, schrecklich Leid. Ein solcher Verlust, ein so schrecklicher Verlust, schrecklicher Verlust. Ihre liebe Mutter war eine so reizende, reizende Frau, eine fabelhafte, fabelhafte Zierde der Karriere Ihres Vaters.«
Diedre bemühte sich, ein Grinsen zu unterdrücken, das an ihren Mundwinkeln zerrte. Sie kannte Ferrell nicht besonders gut, aber sie hatte oft gehört, wie Mama und Daddy über ihn gesprochen hatten. Er gehörte schon jahrelang dem Stadtrat an und sorgte dafür, dass jedes Programm, das Duncan McAlister vorschlug, auch durchgesetzt wurde. Ihr Vater hatte sie häufig mit Geschichten über Ferrell erheitert und seine Angewohnheit nachgemacht, jedes Adverb und Adjektiv mindestens einmal zu wiederholen, manchmal auch zweimal oder dreimal. Wenn ihr Vater seine Olli-Ferrell-Parodie dann beendet hatte, hatten Diedre und ihre Mutter über dem Tisch gehangen und so stark gelacht, dass sie sich die Tränen aus den Augen hatten wischen müssen.
Die Erinnerung kam hoch und Diedre musste mühsam ein Lachen unterdrücken. Aber es war zu spät. Es überfiel sie, bevor sie es zurückhalten konnte – diese Art von unkontrollierbarer Hysterie, die einen dazu bringt, einen Gottesdienst zu stören oder Milch in die Nase zu bekommen. Sie entriss Olli ihre Hand und drückte ihr Gesicht in ihr Taschentuch. Mit bebenden Schultern stand sie da, unfähig, den Lachanfall zu unterdrücken.
Glücklicherweise hielt Olli ihren Ausbruch für eine Gefühlsaufwallung. Er tätschelte ihr unbeholfen den Arm und versuchte, sie zu trösten. »Du meine Güte, meine Güte, meine Güte«, murmelte er. »Nur ruhig, Miss McAlister. Wir alle werden Ihre wundervolle, wundervolle Mutter sehr, sehr vermissen. Ihr Tod, ihr zu früher Tod, ihr schrecklich früher Tod hinterlässt eine Lücke, eine solche Lücke in unserer kleinen Stadt.«
Er hielt inne, wartete offensichtlich auf eine Antwort, doch Diedre lachte so heftig, dass kein Geräusch herausdrang, nur eine Reihe hoher, atemloser kleiner Quiekser.
»Wir alle teilen Ihren Schmerz, Ihren tiefen, tiefen Schmerz«, setzte Olli erneut an.
»D-danke«, brachte Diedre schließlich mühsam heraus. Ihr Gesicht hatte sie noch immer in ihrem Taschentuch verborgen.
»Entschuldigung«, unterbrach sie eine tiefe Stimme. »Ich denke, Miss McAlister braucht jetzt eine kurze Ruhepause.«
Mit fester Hand wurde Diedre von der Menge fortgeführt in die Bibliothek auf der anderen Seite der Halle. Als die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, blickte Diedre auf und in das Gesicht von Jackson Underwood. Er grinste sie an.
»Onkel Jack!«, seufzte sie erleichtert. »Danke, dass du mich gerettet hast.« Sie legte eine Hand an die Brust und schnappte nach Luft.
Er verschränkte die Arme. »Olli Ferrell ist wirklich ein Original, nicht?«
»Ich konnte mich nicht beherrschen, Onkel Jack. Er stand plötzlich vor mir und wiederholte immer seine Adjektive und ich ...« Sie brach erneut in Gelächter aus und sank in einen Ledersessel.
»Warum setzen wir uns nicht einfach ein paar Minuten her, bis du dich wieder beruhigt hast?«
Diedre seufzte. »Das ist eine ausgezeichnete Idee. Könnte ich etwas zu trinken bekommen, was meinst du?«
»Im Esszimmer stehen Punsch und Kaffee. Was möchtest du?«
»Etwas Kaltes, bitte. Am liebsten hätte ich eine Diät-Cola, wenn du eine finden kannst, aber Punsch ist auch in Ordnung.«
»Ich bin gleich wieder da.«
Er öffnete die Tür und der Lärm der Leute überfiel sie wie eine Welle, nicht zu unterscheidende Stimmen, die aus dieser Entfernung wie das Schnattern von Gänsen auf einer Wiese klangen. Als die Tür sich wieder schloss, hüllte die Stille sie ein wie heilendes Wasser. Guter alter Onkel Jack. Immer verlässlich. Immer in der Nähe, wenn man ihn brauchte.
Jackson Underwood war nicht ihr richtiger Onkel, aber er war schon vor Diedres Geburt ein Freund der Familie gewesen. Als Daddys Anwalt, Geschäftspartner, engster Vertrauter und manchmal auch Wahlkampfmanager fehlte Jack bei keiner Familienfeier der McAlisters, seit fünfundzwanzig Jahren nahm er an jedem Wahlbankett, jeder Wahlveranstaltung und jeder Beerdigung teil. Er hatte drei Ex-Frauen, aber keine Kinder und war Diedres inoffizieller »Junggesellenonkel« geworden. Das war schon so lange her, dass er tatsächlich zur Verwandtschaft gehören könnte. Und er behandelte sie immer, als sei sie für ihn der wichtigste Mensch auf der Welt.
In Heartspring erzählte man sich, Jackson Underwood sei ein Schürzenjäger. Diedre wusste nicht so genau, ob das stimmte, aber angesichts seiner schlanken Figur, seines schnellen Verstandes und seiner Ausstrahlung wäre sie nicht überrascht, wenn die Frauen ihm nachliefen. Er hatte eine ganz besondere Art, einen mühelosen Charme, der bewirkte, dass die Menschen sich in seiner Gegenwart sofort wohl fühlten. Vielleicht war es sein strahlendes Lächeln. Er lachte gern und obwohl er in Daddys Alter sein musste, sah er zehn Jahre jünger aus.
Ja, dachte sie, zweifellos hielten die Frauen ihn für eine gute Partie. Aber seit seiner letzten Scheidung, die mittlerweile fünfzehn Jahre zurücklag, hatte niemand ihn erobern können.
Die Tür zur Bibliothek öffnete sich und Onkel Jack kam mit zwei Kristallgläsern und einem Teller mit kleinen Sandwiches und Kuchen zurück. »Ich dachte, du hast vielleicht Hunger.« Er setzte sich auf den Stuhl ihr gegenüber und reichte ihr den Teller.
Diedre winkte ab. »Ich könnte jetzt nichts runterbringen. Aber danke für den Punsch.« Sie trank einen Schluck von der rosa Flüssigkeit, einer Mischung aus Limonade und Grapefruitsaft, der leicht nach den süßen Törtchen schmeckte, die sie als Kind so geliebt hatte.
Sie sah Jack an und versuchte, ihn objektiv einzuschätzen, so als würde sie ihn nicht bereits ihr Leben lang kennen. Er war sehr gut aussehend, fand sie erstaunt. Das war ihr früher gar nicht aufgefallen ...
»Stimmt was nicht?« Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Du starrst mich an.«
»Nein, ich ...« Diedre zuckte die Achseln. »Tut mir Leid.«
»Ich weiß, das ist alles sehr schwierig.« Er grinste sie an und blinzelte ihr zu. »So sehr, sehr schrecklich, schrecklich schwierig.«
Jacks Parodie von Olli Ferrell war nicht so gut wie die ihres Vaters, aber Diedre musste trotzdem lachen.
Er nahm ihre Hand und drückte sie. »Also, jetzt mal ehrlich, wie geht es dir, Kindchen?«
»Es geht, denke ich.« Sie seufzte tief auf. »Der Adrenalinstoß hat mich angetrieben, aber mein Vorrat ist aufgebracht. Ich bin erschöpft.«
»Morgen ist die Beerdigung. Dann wird alles wieder normal werden.«
Zurück zum Normalen. Die Worte hallten in ihrem Kopf wider wie eine fremde Sprache, flüchtige Geräusche, die sie eigentlich verstehen sollte. Doch sie konnte ihren Verstand nicht dazu bringen, sie zu erfassen. So lange war schon nichts mehr normal, zuerst die Krankheit ihrer Mutter, dann ihre Heimkehr, um sie zu pflegen. Diedre konnte sich schon gar nicht mehr daran erinnern, was Normalität war. Und jetzt, ohne Mama, konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass das Leben jemals wieder normal sein würde.
Ein leises Klopfen an der Tür ertönte. Sie öffnete sich, und eine langbeinige, attraktive Blondine im unausweichlichen schwarzen Kleid mit Perlenkette, aber mit deutlich mehr Make-up als die anderen Damen, erschien im Türrahmen. »Da bist du.« Sie ging auf Jack zu und warf einen flüchtigen Blick auf Diedre. »Bist du beschäftigt, Jack?«
»Sehe ich beschäftigt aus?«
Die Blondine zog eine ihrer sorgfältig gezupften Augenbrauen in die Höhe. »Es sieht so aus, als hättest du dich an ein Mädchen herangemacht, das nur halb so alt ist wie du. Also wirklich, Jack!«
Er stellte sein Punschglas auf den Tisch und machte einen Schritt auf die Frau zu. »Das ist Diedre McAlister«, sagte er sehr langsam und deutlich, als würde er mit einem sehr dummen Kind sprechen. »Bürgermeister McAlisters Tochter.«
Ein verwirrter Ausdruck trat auf das Gesicht der Frau. »Oh, tut mir Leid.«
Onkel Jack verdrehte die Augen. »Diedre, das ist Pamela Langley, meine neue Sekretärin.«
»Rechtsassistentin«, korrigierte Pamela mit einem leeren Lächeln. Sie ergriff Diedres ausgestreckte Hand mit ihren manikürten Fingerspitzen. »Es ist mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Nette Party.« Sie wandte sich wieder Jack zu und blickte ihn mit halb niedergeschlagenen Augen an. »Sollten wir nicht langsam gehen?«
Jack runzelte die Stirn und warf einen Blick in Diedres Richtung. »Nicht jetzt, Pamela ...«
Diedre winkte ab. »Keine Sorge, Onkel Jack. Geh nur. Ich bin sicher, du hast noch zu arbeiten. Das ist schon okay.«
»Kommst du klar?«, fragte er.
»Natürlich. Ich muss jetzt sowieso zu unseren Gästen zurückkehren.«
Diedre erhob sich, um sie hinauszubegleiten, doch bevor sie den Raum verlassen hatten, stand eine große, vertraute Gestalt im Türrahmen.
»Carlene!« Diedre streckte ihrer besten Freundin die Hand hin. »Komm herein!«
Carlene Donovan zwängte sich an Pamela Langley und Jack vorbei und zog Diedre in ihre Arme. »Tut mir Leid, dass ich erst jetzt komme. Es ging leider nicht früher.«
Diedre klammerte sich eine Weile an sie, dann trat sie zurück und sah sie an. Sie trug eine fließende Tunika, dazu eine pfauenblaue Hose und kleine Pfauenfedern hingen an ihren Ohrläppchen. Mit ihrem runden Gesicht, dem kurzen Haarschnitt und dem bunten Seidenoutfit stellte sie einen auffallenden und angenehmen Gegensatz zu der schwarz gekleideten Pamela dar.
»Ich freue mich so, dich zu sehen!«, sagte Diedre und ergriff Carlenes Hände. »Du warst nicht da, als ich angerufen habe; ich war nicht sicher, ob die Nachricht dich erreicht.«
»Ich habe sie bekommen und bin, so schnell ich konnte, gekommen.«
Die Assistentin ließ den Blick ihrer kalten Augen über Carlenes Gestalt gleiten, wobei sie sich nicht die Mühe machte, ihre offensichtliche Missbilligung zu verbergen. Wenn sie ihre Meinung laut ausgesprochen hätte, hätte sie nicht klarer sein können: Eine Frau von solcher Größe und Fülle, die auch noch den Mut hatte, auffällige Farben zu tragen und sich selbstbewusst zu geben, hatte in der Welt der schlanken Miss Langley keinen Platz. »Können wir jetzt gehen?«, jammerte sie in Jacks Richtung, ohne ihren taxierenden Blick von Carlene zu nehmen.
Er räusperte sich. »Du kannst ohne mich gehen.«
Das Gesicht der Frau verzog sich, als hätte sie gerade einen abscheulichen Geruch in die Nase bekommen. »Wenn du meinst.« Sie zog seine Krawatte gerade und steckte eine kleine Serviette in seine Brusttasche. »Ich werde nicht ins Büro zurückkehren. Hier ist meine neue Handynummer. Ruf mich später an.«
Jack schob sie zur Tür hinaus und wandte sich an Diedre. »Tut mir Leid.« Er zuckte die Achseln, dann streckte er Carlene die Hand hin. »Ich glaube nicht, dass wir uns schon kennen. Ich bin Jack Underwood.«
»Das ist Carlene Donovan, meine beste Freundin aus Asheville«, stellte Diedre vor. »Carlene, das ist mein Onkel Jack.«
»Dein Onkel?«
»Nur dem Namen nach, leider«, erwiderte Jack galant. »Ich bin der Rechtsanwalt von Diedres Vater und ein alter Freund der Familie. Sie bleiben ein paar Tage hier, Miss Donovan?«
Carlene nickte. »Zumindest bis zur Beerdigung.«
»Dann freue ich mich darauf, Sie wieder zu sehen.« Er beugte sich vor und gab Diedre einen Kuss auf die Stirn. »Tschüss, Liebes. Ich muss noch kurz mit deinem Vater sprechen, dann bin ich weg. Wir sehen uns morgen.«
Diedre sah ihm nach. Als sie sich umdrehte, lag Carlene in dem Ledersessel und schüttelte sich vor Lachen.
»Was ist denn so lustig?«
»Dein gut aussehender Onkel Jack und sein magersüchtiges Model. Was für ein Paar.«
»Sie sind kein Paar, Carlene. Sie ist seine Sekretärin.«
»Genau. Und ich bin Cindy Crawford.«
»Du denkst, sie sind zusammen? Das glaube ich nicht.«
»Glaub, was du willst.« Carlene lachte leise. »Aber sie sind ein Paar – irgendwie. Und nach dem, was ich gerade mitbekommen habe, verdienen sie einander.«
»Es ist nicht nett, so etwas über meinen Onkel Jack zu sagen. Er ist ein sehr mitfühlender und großzügiger Mensch.«
»Wenn ich mehr mit ihm zu tun hätte, würde ich mich in Acht nehmen«, beharrte Carlene. »Leicht mit den Augen, hart im Herzen.«
Daddys Mädchen
Diedre lag in der Dunkelheit und lauschte. Im Haus war es still. Die letzten Trauergäste waren nach Hause gegangen. Kühlschrank und Kühltruhe waren randvoll gefüllt mit so viel Essen, dass sie mühelos im kommenden Monat eine kleine Armee würden ernähren können. Carlene war nach Asheville zurückgekehrt. Vesta hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen und Daddy hielt sich zweifellos in seinem Arbeitszimmer auf.
Die Ereignisse der vergangenen Tage gingen ihr durch den Sinn. Alles war viel zu schnell gegangen und bei dem ganzen Chaos, dem Krankenwagen, dem Trauerempfang, dem Trauergottesdienst und der Beerdigung, den ständigen Erinnerungen an die Abwesenheit ihrer Mutter, hatte Diedre beinahe ihr Geburtstagsgeschenk vergessen.
Sie setzte sich im Bett auf und knipste das Licht an. Die Zigarrenschachtel lag in der Schublade ihres Nachttischs. Sie nahm sie heraus und öffnete den Deckel. Nur ein Blick auf das vergilbte Foto ihrer schon lang verstorbenen Schwester und die Bilder ihres Traumes standen ihr wieder vor Augen. Ein Gefühl des Verlustes und der Einsamkeit überwältigte sie. Sie war fünfundzwanzig und doch fühlte sie sich wie ein Waisenkind, ein kleines Kind, das verlassen und verängstigt in einer bedrohlichen und unsicheren Welt zurückgeblieben ist.
Ihre Augen brannten vor unvergossenen Tränen, verspotteten sie und quälten sie mit dem Versprechen von Befreiung. Aber wenn sie versuchte zu weinen, wollten keine Tränen kommen. Sie vermisste ihre Mama. Sie wollte ihren Daddy. Sie sehnte sich nach der Schwester, die sie nie richtig kennen gelernt hatte.
Aber Mama war tot und Daddy hatte sich in seine Trauer geflüchtet, die sie nicht teilen konnte. Sie drückte das Foto an die Brust, aber es brachte ihr keinen Trost.
Ihr ganzes Leben lang hatte sich Diedre danach gesehnt, ihrem Vater nahe zu sein. Im Herzen war sie Daddys Mädchen, zumindest wollte sie es sein. Und sie konnte nicht leugnen, dass er sie liebte. Er hatte sich immer um sie gekümmert, sie beschützt. Aber irgendetwas fehlte, irgendetwas, das sie nicht richtig in Worte fassen konnte.
Sie ließ die Finger über das vergilbte Foto gleiten. Kein Wunder, dass sie den Mann auf dem Foto nicht sofort erkannt hatte. Er lächelte. Lachte. Vielleicht kitzelte er das kleine Mädchen auf seinem Schoß sogar. Aber das war nicht nur irgendein kleines Mädchen. Das war Sissy. Ihre große Schwester. Und das Foto war das perfekte Porträt von Vater und Tochter.
Das war, was sie ihr ganzes Leben lang vermisst hatte, ohne es je in Worte fassen zu können. Der Übermut. Die Freude. Die Freiheit, ohne Vorbehalte zu lieben und geliebt zu werden. Diesen Ausdruck hatte Diedre auf dem Gesicht ihres Vaters nie wahrgenommen. Sie hatte immer nur eine kurze Sekunde des Zögerns, eine Spur der Zurückhaltung gespürt.
Endlich stiegen Diedre die längst überfälligen Tränen in die Augen. Sie weinte lange – manchmal schluchzte sie wie ein Kind, manchmal weinte sie still vor sich hin. Sugarbear sprang auf das Bett und legte sich leise wimmernd neben sie.
Die Dinge sind nicht, wie sie erscheinen.
Mamas Worte fielen ihr wieder ein, hallten in ihr nach; und während Diedre das Foto betrachtete, fragte sie sich, was Mama wohl gemeint hatte. War es möglich, dass Daddy früher offen und liebevoll, ein wirklicher Vater gewesen war? Hatte der Verlust seiner Erstgeborenen ihn verschlossen gemacht, sodass er seine jüngere Tochter nicht vorbehaltlos lieben konnte? War eine solche rückhaltlose Liebe ein zu großes Risiko für ihn?
Da der Tod ihrer Mutter gerade eine frische Wunde in ihr Herz gerissen hatte, konnte Diedre eine solche Zurückhaltung beinahe verstehen. Die Liebe machte einen verletzlich. Und obwohl die Zeit, wie man ihr gesagt hatte, den Schmerz lindern würde, würde sie niemals die Narben vollständig entfernen können. Sie blieben für immer – eine Erinnerung an das, eine Warnung vor dem, was passieren konnte, wenn man sein Herz verschenkte.
Mama war tot. Sissy war tot. Aber Daddy lebte noch. Er war alles, was ihr geblieben war. Vielleicht gab es ja tief in seinem Innern einen Funken, und wenn auch nur ein Glimmen, des Vaters, der sie auf dem alten Foto anlächelte. Eine weiche Seite, die sich vielleicht jetzt zeigen konnte, wo sie nur noch einander hatten. Vielleicht konnten sie einen Weg finden, eine Familie zu sein.
Diedre konnte ihre Mutter oder ihre Schwester nicht mehr zurückbringen. Aber sie musste die Gelegenheit ergreifen, die sich ihr vielleicht bot, ihren Vater zurückzubringen.
Was hatte sie schon zu verlieren?
Morgen, dachte sie, als sie die Zigarrenschachtel beiseite stellte und sich hinlegte. Ich werde morgen mit ihm sprechen.
Sugarbears Entdeckung
Diedre erwachte von einem schnüffelnden Geräusch und einer Bewegung auf dem Bett. Die Leuchtziffern des Weckers zeigten 6 Uhr 55. Draußen vor dem Fenster wurde es langsam hell.
»Leg dich hin, du Ungeheuer«, murmelte sie. Mit der Hand strich sie über Sugarbears Kopf. »Es ist noch zu früh. Schlaf weiter.«
Das Schnüffeln hörte nicht auf.
Sie setzte sich auf und betrachtete im Halbdunkel den Hund, der mit den Pfoten und der Nase nach etwas stieß. Diedre knipste die Nachttischlampe an. »Sugarbear, Nein!«
Die Zigarrenschachtel stand neben ihr auf dem Bett. Anscheinend war sie eingeschlafen, ohne sie auf den Nachttisch zu stellen. Der Hund hatte jetzt seine Schnauze in der Schachtel und schob sie zum Ende der Matratze. In dem Augenblick, bevor sie herunterfiel, fing Diedre sie auf.
»Was ist denn nur los mit dir?«, schimpfte sie. »Sieh nur, was du getan hast – überall auf dem Bild meiner Schwester sind die schleimigen Abdrücke deiner Nase.« Sie wischte das Foto an der Decke ab, hielt es ins Licht und betrachtete es erneut. Ihre Schwester sah ihr auf ihren Kleinkindfotos erstaunlich ähnlich. Ihr Vater wirkte so liebevoll und aufmerksam, dass Diedre einen Stich der Eifersucht empfand.
Sie musste aufhören, sich so zu quälen. Leg es einfach wieder in die Schachtel und schlaf weiter, dachte sie. Dann fiel ihr Blick auf etwas, das sie vorher nicht bemerkt hatte. »Was ist denn das?«
Sugarbear legte sein Pelzgesicht auf die Schachtel und sah sie an. Unter dem Bild lag ein rechteckiges Kartonstück. Es hatte fast dieselbe Größe und Farbe wie die Schachtel. Sugarbears Untersuchung hatte es in eine Ecke geschoben. Jetzt hob Diedre es hoch und stellte fest, dass es einen hübschen falschen Boden in der Schachtel darstellte. Darunter wiederum lag ein gefaltetes Stück Papier und eine Reihe von Umschlägen.
Mit zitternden Fingern faltete sie das Blatt auseinander. Oben stand in verschnörkelten Buchstaben:
Geburtsurkundedes Staates North Carolina
Diedre überflog das Dokument.
Name des Kindes: Diedre Chaney McAlisterGeschlecht: weiblichGeburtsdatum: 3. April 1970
Das war ihre Geburtsurkunde. Aber warum als Kopie und warum sollte Mama sie in dieser Schachtel verstecken?
Das Original lag in Diedres Schreibtisch, zusammen mit ihrem Pass, den sie noch nie hatte benutzen können, einer Kopie der Lebensversicherungspolice, die Daddy auf sie abgeschlossen hatte, als sie sechs Monate alt war, und den Telefonnummern von Daddys Versicherungsagenten und Börsenmaklern.
Dann sah sie genauer hin.
Name der Mutter: Cecilia A. McAlisterName des Vaters: unbekannt
Die Schrift verschwamm ihr vor den Augen. Diedre blinzelte. Unbekannt?
Mamas Worte hallten in ihr nach: Die Dinge sind nicht, wie sie zu sein scheinen ...
Diedre wusste, sie sollte jetzt eigentlich langsam diese Situation logisch durchdenken. Es musste eine vernünftige Erklärung dafür geben. Aber die Bremse in ihrem Gehirn schien defekt zu sein; ihre Gedanken sprangen weiter und achteten nicht auf die Warnleuchte.
Wie ein schnell vorgespulter Film standen ihr die Bilder vor Augen: Daddys zögernde Versuche, ihr seine Zuneigung zu zeigen. Seine Zurückhaltung ihr gegenüber im Vergleich zu der Liebe und Freude, die das Foto von ihm und Sissy ausstrahlte. Er hatte für Diedre gesorgt, sie mit materiellen Geschenken überschüttet, ihr Disziplin beigebracht und sie mit seinem übergroßen Beschützerinstinkt beinahe erstickt. Aber er konnte Diedre nicht die Art von Liebe und Wärme geben, die ihre Schwester bekommen hatte, weil ...
Weil er nicht ihr Vater war.
Sie schnappte nach Luft, als würde sie ertrinken. War es möglich, dass Daddy nicht ihr Daddy war? Dass Mama ihn betrogen hatte und Diedre das Ergebnis dieser Untreue war?
Kein Wunder, dass sie sich wie ein Waisenkind fühlte. Wenn sie nicht war, wer sie zu sein glaubte, nicht Diedre McAlister, Tochter von Duncan und Cecilia McAlister, wer war sie denn dann?
Und warum hatten ihre Eltern es vor ihr geheim gehalten?
Diedre legte die Geburtsurkunde beiseite und griff vorsichtig in die Zigarrenschachtel, als würde sie eine Mausefalle oder etwas Lebendiges enthalten, das beißen könnte. Sie nahm die Umschläge heraus und betrachtete sie – Briefe, adressiert nicht an »Mr. und Mrs. Duncan McAlister« oder »Mrs. Duncan McAlister«, sondern an »Cecilia McAlister« – ganz allein an ihre Mutter, als wäre sie eine allein stehende Frau.
Waren diese Briefe von ihrem richtigen Vater, einem Mann, den ihre Mutter geliebt hatte? Auf den Umschlägen stand keine Adresse, nur der Name. Und sie waren ganz seltsam gefaltet, als hätten sie in einem zweiten Umschlag gesteckt. Ihre Gedanken überschlugen sich, suchten nach Erklärungen. Vielleicht ein Vermittler. Jemand, der das dunkle Geheimnis ihrer Mutter bewahrt hatte. Vielleicht sogar Vesta.
Diedres Hand zitterte, als sie die Briefe anstarrte. Die Vernunft kämpfte mit ihren Gefühlen um die Vorherrschaft. Sie wollte es wissen. Sie wollte es gar nicht wissen. Aber sie musste es wissen. Sie strich die Decke um ihre Beine gerade und steckte sich ein Kissen in den Rücken. Mama hatte ihr diese Dokumente aus einem bestimmten Grund gegeben.
War dies die Wahrheit, die Diedre finden sollte? Hatte Mama nach Vergebung gesucht, nach einem Weg, ihre Sünden zu büßen, bevor sie ihrem Schöpfer gegenübertrat? Diedre konnte sich Mama nicht mit einem anderen Mann vorstellen. Diese Vorstellung allein verursachte ihr Übelkeit und einen Schweißausbruch. Zitternd schob sie den Gedanken beiseite.
Endlich nahm sie allen Mut zusammen, öffnete den ersten Brief und begann zu lesen. Aber wenn sie gedacht hatte, sie hätte für diesen Morgen bereits genug Schläge eingesteckt, so hatte sie sich geirrt. Gleich der erste Satz zeigte ihr, dass noch eine ganze Reihe von Landminen auf sie warteten.
November 1974Liebe Mama,
ich schicke dir diesen Brief durch Vesta, damit du ihn auch bestimmt bekommst. Verzeih mir, aber ich traue es Daddy zu, dass er ihn verbrennt oder für seine eigenen Zwecke behält.
Es tut mir Leid, dass ich einen solchen Aufstand verursacht habe, als ich noch einmal nach Hause gekommen bin. Ich wollte niemanden verletzen, am wenigsten dich. Zumindest konnte ich die kleine Diedre sehen und allein dafür hat es sich gelohnt, diesen Preis zu zahlen. Sie ist ein süßes Kind. Vermutlich kann sie all das noch nicht verstehen, nicht?
Ich bin sicher, dass du bestimmt traurig bist, vielleicht auch Schuldgefühle hast. Aber du musst das loslassen, wie mein Arzt immer sagt, und lernen, dir selbst zu vergeben. Bitte versuche es – um meinetwillen und um deinetwillen.
Als sie fertig gelesen hatte, zitterte Diedre am ganzen Körper. Der Brief war nicht unterschrieben, aber er war bestimmt von ihrer Schwester, der Schwester, nach der sie sich gesehnt und von der sie all die Jahre geträumt hatte. Und offensichtlich wusste sie alles über die Umstände der Geburt ihrer kleinen Schwester! Das schien unmöglich. Und doch stand es da schwarz auf weiß.
Mama hatte Recht. Das war nicht die Wahrheit, die sie erwartet hatte. Und es war fast zu viel für sie. Diedres Vater war nicht ihr Vater. Ihre Mutter war ihm untreu geworden und hatte als Folge dieser Affäre ein Kind geboren. Ihre Schwester hatte alles darüber gewusst und ihre Mutter nicht verurteilt, wie dem Brief zu entnehmen war.
Was sonst noch?
Sie schloss die Augen und schickte ein stummes Gebet um Kraft zum Himmel, dann nahm sie allen Mut zusammen und öffnete den zweiten Brief.
April 1979Liebe Mama,
dies wird vermutlich mein letzter Brief aus Raleigh. Mein Arzt scheint mit meinen Fortschritten sehr zufrieden zu sein und hat die Empfehlung ausgesprochen, mich in den nächsten Wochen zu entlassen. Fünf Jahre Krankenhaus sind eine lange Zeit und die Welt draußen wird für mich vermutlich sehr fremd sein. Ich hoffe, ich bin darauf vorbereitet.
Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn ich nach meiner Entlassung nach Hause komme. Eine Freundin hat mir eine Wohnung und eine Arbeitsstelle angeboten, einen Ort, wo man mich in Ruhe lassen wird. Ich werde meinen Namen ändern und noch einmal neu anfangen, in der Hoffnung, dass dieses Mal alles anders sein wird. Gott weiß, dass ich mich geändert habe.
Mach dir um mich keine Gedanken und gib D einen dicken Kuss von mir. Ich wünschte, ich könnte bei ihr sein – vielleicht eines Tages. Ich versuche, in Verbindung zu bleiben.
Wie betäubt lehnte sich Diedre zurück. Ihr Blick hielt einzelne Sätze aus dem Brief fest: Mein Arzt ... im Krankenhaus ... in ein paar Wochen entlassen. Daddy hatte ihr vorgemacht, Sissy sei tot; sogar Mama hatte schließlich gesagt, sie sei für immer fort. Aber da stand es, so deutlich wie nur irgendetwas – ihre Schwester war in einem Krankenhaus gewesen. Fünf Jahre lang.
War sie nach ihrer Entlassung vielleicht gestorben? War das der Grund, warum Diedres Eltern nur so widerwillig über sie sprechen wollten, Diedre keine Einzelheiten über das Leben und den Tod ihrer Schwester erzählt hatten? Doch der Brief vermittelte nicht den Eindruck, als sei sie krank gewesen. Sie schien vollkommen gesund zu sein und alles unter Kontrolle zu haben. Man hatte den Eindruck, dass sie sich von ihrer Vergangenheit abgewendet hatte und entschlossen war, die Zukunft besser zu gestalten. Und sie hatte die kleine Schwester geliebt, die sie kaum kannte. Gib D einen dicken Kuss von mir. Ich wünschte, ich könnte bei ihr sein – vielleicht eines Tages ...