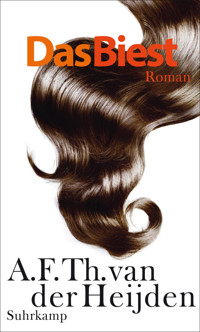
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Knallgelb ist das Staubtuch, das Tante Tiny stets mit sich führt, um es bei Bedarf blitzschnell und ungeniert zu zücken – gern auch, wenn sie bei anderen zu Gast ist. Tientje Putz nennt man sie in der Familie, vorsichtshalber jedoch nur hinter ihrem Rücken. Denn so weich ihr Staubtuch ist, so scharf und verletzend kann ihre Zunge sein, mit der sie über Leichen geht. Ihr Neffe Albert Egberts – den wir aus van der Heijdens schon fast sagenhaftem Zyklus Die zahnlose Zeit kennen – verfolgt das Treiben seiner jungen, attraktiven Tante aus nächster Nähe, befremdet und gleichzeitig fasziniert. Es dauert Jahre, bis er entdeckt, was sie ein Leben lang antreibt, was in stillschweigender familiärer Übereinkunft geheim gehalten wird.
Das Biest ist ein grandioses Frauenporträt, von Adri van der Heijden, dem »Saft- und Kraftgenie« (Tagesspiegel) der zeitgenössischen niederländischen Literatur, gezeichnet bis in die feinsten Verästelungen, liebevoll, beklemmend und absolut komisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Knallgelb ist das Staubtuch, das Tante Tiny stets mit sich führt, um es bei Bedarf blitzschnell und ungeniert zu zücken – gern auch, wenn sie bei anderen zu Gast ist. Tientje Putz nennt man sie in der Familie, vorsichtshalber jedoch nur hinter ihrem Rücken. Denn so weich ihr Staubtuch ist, so scharf und verletzend kann ihre Zunge sein, mit der sie über Leichen geht. Ihr Neffe Albert Egberts – den wir aus van der Heijdens schon fast sagenhaftem Zyklus Die zahnlose Zeit kennen – verfolgt das Treiben seiner jungen, attraktiven Tante aus nächster Nähe, befremdet und gleichzeitig fasziniert. Es dauert Jahre, bis er entdeckt, was sie ein Leben lang antreibt, was in stillschweigender familiärer Übereinkunft geheim gehalten wird.
Das Biest ist ein grandioses Frauenporträt, von Adri van der Heijden, dem »Saft- und Kraftgenie« (Tagesspiegel) der zeitgenössischen niederländischen Literatur, gezeichnet bis in die feinsten Verästelungen, liebevoll, beklemmend und absolut komisch.
A.F.Th. van der Heijden, geboren 1951 in Eindhoven, lebt in Amsterdam. Für sein Werk, darunter die Romanzyklen Die zahnlose Zeit und Homo duplex, erhielt er zahlreiche Preise. Tonio, der bewegende Requiemroman für seinen verstorbenen Sohn, wurde 2012 mit dem Libris-Literaturpreis ausgezeichnet.
A.F.Th. van der Heijden
Das Biest
Roman
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Suhrkamp
Die Originalausgabe: De helleveeg, erschien 2013 bei De Bezige Bij, Amsterdam.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016
Erste Auflage 2016
© der deutschen Übersetzung Suhrkamp Verlag Berlin 2016.
© 2013 A.F.Th. van der Heijden
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: subbotina/123rf
Umschlag: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-74767-4
www.suhrkamp.de
Inhalt
Tientje Putz
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Ich habe es satt, ich habe es satt, hier immer für alles herhalten zu müssen, der Fußabtreter, die stinkende Nonne zu sein, weder Kind noch Kegel zu haben und nicht einmal einen Gott. Ich habe ihn so satt, diesen Kochherd, der mir als Altar gegeben wurde. Satt, satt, satt, Sklavin und Hexe und stinkende Magd zu sein.
Frei nach Jean Genet, Die Zofen
Tientje Putz
Wann immer Tante Tiny ein Wohnzimmer betrat, selbst bei wildfremden Leuten, zog sie sofort ein knallgelbes Staubtuch aus ihrer Jackentasche, um damit unauffällig links und rechts über die Armlehnen zu wischen. Das ging so schnell, auch das Einstecken des Lappens, dass jeder Augenzeuge sich zu Recht fragen konnte, ob er es denn wirklich gesehen hatte – hätte nicht diese grellgelbe Flamme, die für einen Moment aus ihrer Hand gezüngelt war, auf jedermanns Netzhaut nachgeglüht.
Diese Angewohnheit trug ihr den Spitznamen Tientje Putz ein, den keiner in ihrer Hörweite laut auszusprechen wagte, denn so weich ihr Staubtuch, ihr Mopp und ihre Buntwäsche auch waren, so scharf konnte ihre Zunge ausholen.
Seit ihrer Heirat mit Koos Kassenaar kleidete Tante Tiny sich wie eine Dame, doch das hinderte sie nicht daran, unter ihrem Pelzmantel, über dem Kleid oder dem Deuxpièces eine kurze Dienstmädchenschürze zu tragen: Man konnte nie wissen, ob man nach dem Betreten einer fremden Wohnung nicht sofort in Aktion treten musste. Um die Reinlichkeit der meisten Hausfrauen war es bekanntlich miserabel bestellt. Das viel bespöttelte Staubtuch konnte einem folglich auch unversehens unter einem offenen Mantel hervor entgegenflattern. Es war immer ein neues oder so gut wie neues, nie öfter als zweimal »von Hand« gewaschen, damit es nicht einlief und das fast leuchtende Gelb (mit rotem Garn gesäumt) nicht verblasste. Sie bezog die Tücher im Dutzend von dem Buckligen, der in Breda allwöchentlich von Haus zu Haus ging, mit einem Karren voller Körbe und Bürsten und Wäscheklammern sowie all dem, was sonst noch von den Unglücklichen in De Koepel von Hand gefertigt wurde.
Ach, Tientje Putz, mit ihren Mucken und Marotten.
Sie hatte die Angewohnheit, sich von hinten anzuschleichen, gerade wenn man einen Liebesbrief an seine Herzallerliebste schrieb. Dann las sie über die Schulter mit, um danach die pikantesten Passagen mit ihrer ätzenden Stimme so laut herauszuschreien, dass man es bis in die Küche der Nachbarn verstand.
Tientje Putz, die teure Porträtfotos vor den Augen desjenigen zerriss, der sie aufgenommen und entwickelt hatte, weil sie sich darauf unvorteilhaft vorkam, obwohl sie (auch auf den vernichteten Porträts) eine hübsche, fotogene Frau war. Sie riss und riss, bis die Schnipsel nicht mehr kleiner werden konnten, wobei sie sich vor Anstrengung fest auf die Zunge biss und gleichzeitig eine Art tierisches Heulen ausstieß.
Oder: Sie bekam Mundgeschwüre von den in jedem Haus verteilten Gratisproben einer Testzahnpasta aus durchsichtigem türkisfarbenem Gelee, hielt es aber für eine Verschwendung, die erst zur Hälfte aufgebrauchte Tube wegzuwerfen. Dann eben schwärendes Zahnfleisch, ein lepröser Gaumen und eine mit weißen Quaddeln belegte Zunge. Zur selben Zeit, während sie sich wegen ihres schmerzenden Mundes in Modegeschäften kaum verständlich machen konnte, kaufte sie ganze Armvoll teurer Kleider, die sie als »funkelnagelneue Ableger« meiner Mutter, ihrer ältesten Schwester, vermachte – ohne sich damit groß aufzuspielen, was sie auch noch hervorhob: »Also, ich will mich ja nicht aufspielen …« (Sie hatten mehr oder weniger dieselbe Kleidergröße.)
Oh, Tientje Putz, die so virtuos lügen konnte: dass sie schwanger sei oder unfruchtbar oder vorübergehend infertil, je nachdem, was die Situation verlangte.
Als Onkel Hasje in Neuguinea diente, erzählte sie mir spannende Geschichten über die Papuas. Es war Ostern. Ich durfte morgens zu ihr ins Bett, sofern ich mein großes Schokoladenei mitbrachte. Bei jedem Cliffhanger in ihrer Geschichte forderte sie als nicht rückzahlbaren Vorschuss ein Stück davon, sonst könnte ich mir die Fortsetzung abschminken. Am Ende der Osterferien war nichts mehr von dem Schokoladenei übrig, und ich wusste immer noch nicht, wie es mit Onkel Hasje enden würde, während die giftigen Pfeile aus den Blasrohren regungslos in der Luft hingen. Das alles und noch viel mehr war Tientje Putz.
Später, nach ihrer Heirat, kam sie jeden Samstag aus Breda nach Eindhoven, um ihre mittlerweile betagten Eltern zu drangsalieren, und nachdem sie diese ins Grab getriezt hatte, war meine Mutter an der Reihe. Erst wenige Jahre vor Tientjes Tod habe ich entdeckt, wodurch sie diesen so durch und durch vergifteten, miesen Charakter entwickelt hatte und was sie ein Leben lang umtrieb.
Kapitel I
1
Das Problem bei Tante Tiny war, dass sie keinen Verehrer an sich binden konnte. An ihrem Äußeren lag es nicht. Sie war ein schönes Mädchen, die Hübscheste von fünf Geschwistern, obwohl ihre älteste Schwester, meine Mutter, ebenfalls als Schönheit galt (bis sie noch vor ihrem Dreißigsten aus Sorge und Krankheit zu welken begann).
Es heißt, ich hätte Tiny mit vier Jahren, als sie sechzehn war, »entdeckt« und sei immer häufiger wie eine kleine Ente hinter ihr hergewatschelt. Zunächst bestand sie vor allem aus einer Duftwolke: Make-up, Shampoo und noch etwas Besonderes, das nur zu ihr gehörte. Dann füllte sich diese immaterielle Erscheinung allmählich mit einem Wust dunkelbrauner welliger Haare, einer schmalen Taille über wiegenden (um nicht zu sagen: hin- und herschaukelnden) Hüften sowie Beinen, über die die schnurgeraden Nähte ihrer Nylonstrümpfe liefen, angefangen bei den Absätzen und dann schwindelerregend in die Höhe bis unter den Saum eines engen Rocks.
Nur ihre Stimme … die klang nicht immer angenehm. Manchmal, wenn sie mir schmeichelte oder eine ulkige Geschichte erzählte, dann schon … dann war es, als käme der Wohlgeruch, den ich so liebte, aus ihrem Mund, als dufteten ihre Komplimente nach Veilchen. Weit häufiger benutzte sie diese Stimme jedoch, um an allem und jedem herumzumäkeln: an ihren Eltern, ihren Geschwistern, den Kollegen, im Grunde der ganzen Welt samt allem Drum und Dran. Nichts und niemand taugte etwas.
Tante Tiny und ich waren im selben Haus geboren: Lynxstraat 83, im Tivoli-Viertel, das sich an den Eindhovener Stadtteil Stratum schmiegte, verwaltungsmäßig aber zum acht Kilometer entfernten Geldrop gehörte. Nach meiner Geburt wohnten meine Eltern mit mir und später auch meiner kleinen Schwester noch ein paar Jahre bei meinem Opa und meiner Oma zur Untermiete, doch um die Zeit, als ich Interesse an meiner jungen Tante zu zeigen begann, war unsere Familie bereits umgezogen – ins richtige Geldrop. Ich sehnte mich nach meinem Geburtshaus zurück, in dem ich, von meinem Vater gebracht und wieder abgeholt, oft die Wochenenden verbrachte und, nachdem ich in die Schule gekommen war, auch Teile der Ferien.
Meine Großeltern stammten aus Den Bosch. Sie waren in den dreißiger Jahren in das kleine Arbeiterparadies Tivoli gezogen. Offiziell, weil mein Opa Arbeit bei Philips bekommen konnte, als Glasbläser, doch nach den gefauchten Auskünften von Tiny steckte mehr dahinter.
»Was machst du, Albert, wenn dir der Boden zu heiß wird unter den Füßen? Genau, so ist es … dann stellst du dich ein Stück weiter weg. So wurde deinem Opa und deiner Oma in Den Bosch der Boden unter den Füßen zu heiß. Meistens bekommt man Blasen vom Laufen, sie aber liefen vor den Blasen davon. Verstehst du?«
Ich wusste als Fünf-, Sechsjähriger nicht so genau, was ich mir darunter vorzustellen hatte. Eine Art Feuertanz vielleicht, von dem ich in einem Buch Bilder gesehen hatte.
2
Seitdem es nicht mehr nötig ist, mich als reicher oder adliger auszugeben, als ich meiner Herkunft nach bin, erzähle ich immer ehrlich, dass meine Eltern sich als Fabrikkinder in der Schuhfabrik Lata in Best kennengelernt haben. Mit der Geschichte, wie sie über den Bottichen mit warmer Schuhwichse high wurden und sich nach einem halben Liter Milch draußen im Gras wieder ausnüchtern durften, kann ich bei niemandem mehr landen. Sie ist zu bekannt. Obwohl es noch immer Ungläubige gibt, die denken, ich hätte mir das Detail mit den Schuhwichsdosen, die gefroren und nicht mehr zu gebrauchen von der Ostfront nach Best zurückgeschickt wurden, ausgedacht oder zumindest übertrieben. Ich belasse es einfach dabei.
Von ihrem sechzehnten Lebensjahr an, Mitte der fünfziger Jahre, arbeitete Tante Tiny ebenfalls bei Lata. Sie klebte Sohlen unter die Schuhe – mit einem Leim, der einen im Übrigen auch ganz schön high machen konnte, wie ich später von ihr erfuhr. Ohne dass es zum Ausgleich einen halben Liter entgiftende Milch gab. Sie hatte ihren Wochenlohn komplett zu Hause abzugeben, wofür sie dann wiederum einen festen Betrag erhielt, ein karg bemessenes Kleidergeld inbegriffen. Meine Mutter entdeckte eines Tages in ihrem Elternhaus, dass eine Schublade der Anrichte bis obenhin mit Tinys Lohntüten gefüllt war – noch zugeklebt, denn man musste immer auf schlechte Zeiten gefasst sein. Ihr finanzieller Beitrag bedeutete nicht, dass sie sich nach der Arbeit auf die faule Haut hätte legen können: Der Haushalt war auch noch zu erledigen.
Im Nachhinein ist mir klar, dass Tiny in jenen Jahren bereits vollauf damit beschäftigt war, die formvollendete Karikatur eines sich sklavisch im Haushalt abrackernden Wesens vorzuführen, und zwar damit »den Alten« ein Licht aufging – oder um zu zeigen, dass es ihnen vielmehr an Licht mangelte, das ihnen hätte aufgehen können. So schleppte sie immer öfter Taschen voller Schuhe von Lata mit nach Hause, um ihnen mit Hilfe des Schraubstocks ihres Vaters eine Sohle unterzukleben. Wenn ich wieder mal zu Besuch in der Lynxstraat war, durfte ich »senkeln«: in die fertigen Schuhe Schnürbänder einziehen. Möglicherweise bekam ich fünf oder zehn Cent dafür, aber dieses Senkeln wurde doch in erster Linie als Überstundenarbeit für Tiny abgerechnet und diente der Erweiterung ihrer Garderobe. Sie hatte schon damals regelmäßig »nichts anzuziehen«, und von Zeit zu Zeit musste sie doch auch mal tanzen gehen, sonst käme sie nie zu einer guten Partie, um dem elterlichen Horrorhaus zu entfliehen.
Den Streitereien zwischen Tiny und meinen Großeltern entnahm ich etwas über die Hausregeln, die für sie etwas strenger zu sein schienen als für die anderen Kinder. Normal war: nach dem einundzwanzigsten Geburtstag auf eigenen Füßen stehen, es sei denn, man heiratete mit achtzehn (oder etwas später), dann durfte man gleich aus dem Haus. Für Tiny galt: Heirat nicht vor dem zwanzigsten Geburtstag, also frühestens als Zwanzigjährige und fest unter der Haube aus dem Haus.
Tiny wurde siebzehn. Noch eine ganze Ewigkeit, bevor sie das Haus in der beklemmenden Lynxstraat mit seinen dunklen, feuchten Räumen verlassen konnte, in das wegen der zu kleinen Fenster kaum Sonne fiel. Am schlimmsten waren Vater und Mutter selbst. Ich liebte meinen Opa und meine Oma natürlich, weniger selbstverständlich war hingegen die Liebe der siebzehnjährigen Schönheit, die flügge werden wollte, zu ihren Eltern. Wenn sie gegen das strengere Regime protestierte, das nur für sie galt, erinnerten (auch in meiner Anwesenheit) meine Großeltern sie an »etwas«, das in der Vergangenheit passiert war – möglicherweise irgendein Fehltritt Tinys aus der Zeit, als ich noch im Laufstall stand.
»Darüber müssen wir doch wohl nicht schon wieder sprechen, oder?«, sagte Oma dann.
»Wie – wieder sprechen«, fauchte Tiny. »Wir haben nie anständig darüber geredet, Mensch.«
»Wie wolltest du denn anständig über was Unanständiges reden?«, schaltete sich Opa ein. »Ein andermal. Jetzt sind Kinder dabei.«
Abgesehen von der doofen Mehrzahl fühlte ich mich schuldig, weil meine Anwesenheit offenbar ein Hindernis dafür war, dass Tante Tiny etwas sehr Wichtiges mit ihren Eltern ausdiskutieren konnte. Als ich einmal nicht im Zimmer war, aber trotzdem (auf dem Flur) hören konnte, was gesprochen wurde, ertönte aus Opas Mund: »Was du angestellt hast, Tientje, ist so entsetzlich … ich finde noch immer keine Worte dafür.«
»Das ist euer Problem«, schrie Tiny, »dass ihr keine Worte dafür habt. Mit euch kann man nicht reden. Eines Tages schreie ich es laut heraus. Ich habe nämlich Worte dafür.«
»Dann würdest du aber niemand finden, der zu dir hält.«
Wenn ihre Eltern ihr nicht erlaubten, auszugehen: »Dir ist alles zuzutrauen, Menschenskind. Hat sich ja gezeigt. Du bleibst schön zu Hause, hörst du.«
Und wenn ich bei Tante Tiny in der Küche war: »Du erzählst dem Kind doch wohl nichts Falsches, oder? Pass bloß auf! Du bringst es fertig, den Kleinen für den Rest seines Lebens zu verderben.«
Ich hörte das so oft, dass ich immer neugieriger wurde und es mir gar nicht so schlimm vorkam, für den Rest meines Lebens versaut zu sein. Ein verdorbenes Kind, aber immerhin mit einem phantastischen Geheimnis, mit dem es seinerseits das Leben anderer vermasseln könnte, falls es Lust dazu hatte.
Was Tiny mir verriet (nicht in der Küche, sondern als ich eines Morgens zu ihr ins Bett kroch), war, dass sie entgegen den Anweisungen ihrer Eltern möglichst schnell nach ihrem achtzehnten Geburtstag heiraten wollte, und zwar um jeden Preis.
»Vom Gesetz her können sie mir dann nix mehr anhaben.«
Es musste nur noch ein passender Verehrer gefunden werden, der es nicht für nötig hielt, allzu lange mit der Hochzeit zu warten. Da genau aber lag der Haken, entnahm ich einem Gespräch zwischen Tiny und einer Freundin von ihr, Gerda Dorgelo.
»Sie lassen dich jedes Mal wieder fallen wie eine heiße Kartoffel«, sagte Gerda.
»Von wegen, ich lasse sie fallen wie eine heiße Kartoffel«, sagte Tiny.
»Das genau ist das Problem«, sagte Gerda. »Du servierst sie ab. Reihenweise. Und zwar bevor es richtig schön wird. Du denkst, die kommen bestimmt zurück, aber Pustekuchen. Sie haben Angst vor dir.«
»Angst, warum?«
»Du schlägst sie.«
»Aus Spaß. Wenn sie das noch nicht mal verkraften.«
»Viel zu hart. Schon nicht mehr schön, Tineke. Du müsstest mal dein Gesicht sehen, wenn du zupackst. Fester geht es nicht mehr. Diese hinterhältige Zungenspitze zwischen den Zähnen …!«
»Na gut, Gerda, wenn du meinst … ich werde keinen Typen mehr malträtieren. Ehrenwort. Aber ein kleiner Klaps dann und wann, das gehört doch einfach dazu, oder? Das machst du doch auch beim Schiele-Wil?«
»Am schlimmsten ist, als was du sie behandelst. Wie den letzten Dreck. Du müsstest dich mal hören, Tientje. Durch und durch gemein. Wie du sie beleidigst, wie locker dir das über die Lippen geht. Für so jemanden bist du hinterher auch nur noch ein Haufen Scheiße, verlass dich drauf.«
3
Obwohl sie sich lieber die Zunge abgebissen hätte, als Gerda recht zu geben, merkte ich an Kleinigkeiten, dass Tiny sich zu bessern versuchte. Davon hing viel ab.
»Ich will keine alte Jungfer werden«, war der für mich rätselhafte Satz, den sie, an niemanden speziell gerichtet, wiederholt aussprach. Wenn sie dann merkte, dass ich der einzige Zuhörer war, sagte sie: »So ist es doch, Albertje. Ich will nicht alt und sauer werden in diesem Haus, bei diesen zwei alten, sauren Leuten. Jetzt bist du hier ja zu Besuch, und ich habe ein bisschen Gesellschaft, aber ab nächster Woche gehst du wieder zur Schule.«
Es war still geworden in der Lynxstraat 83. Meine Mutter, die Älteste, hatten sie dank der allgemeinen Wohnungsnot, die ganze Familien in lebenslange Feindschaft stürzte, noch lange im Haus zu halten verstanden. Mit inzwischen zwei Kindern ertrugen meine Eltern das Leben in diesem knapp drei mal vier Meter großen Zimmer nicht länger, unter der Terrorherrschaft des herrischen van der Serckt und seiner leicht gekränkten Frau. Regelrechte Kriege wurden in dem Arbeiterhäuschen, das zeitweise zehn Personen Platz bieten musste, ausgetragen – psychologische, mit Schweigen und Fauchen als Waffen, wenngleich mein Vater auch schon mal mit seiner nicht abgelieferten Dienstwaffe in der Wohnstube seiner Schwiegereltern gestanden hatte.
Mein Vater und meine Mutter begnügten sich mit einer Bruchbude in Geldrop, nur um der vergifteten Geselligkeit des Zusammenwohnens zu entfliehen. Nicht viel später wanderte die mittlere Schwester mit ihrem Mann nach Australien aus, um ein neues Leben in Melbourne zu beginnen.
»Unsere Sjaan hat’s richtig gemacht«, sagte Tiny zu mir. »Gleich ans andere Ende der Welt. Dort werden unsere sauren Alten sie nicht so schnell finden. Und sie hat eine gute Ausrede, warum sie sie nicht besuchen kann. Ein Flugzeug können sie und dieser ihr angetraute Habenichts sich nicht leisten. Und bei der Schifffahrtsgesellschaft stehen sie auf der schwarzen Liste.«
Ich wollte wissen, was das war, eine schwarze Liste.
»Auf der Hinreise haben sie sich so ungefähr ihre ganze Aussteuer auf dem Schiff zusammengeklaut. Handtücher, Betttücher, Tafelsilber. Da ist noch eine gewaltige Rechnung offen.«
Mir wurde klar, dass Tante Sjaan viel daran gelegen sein musste, sich in eine rote Wüste auf der anderen Seite des Globus abzusetzen. Auch der älteste Sohn, mein Onkel Freek, allgemein nur Der Freek genannt, hatte sich der elterlichen Gewalt entzogen und auf die Weltmeere begeben. Ab und an schickte er eine Karte von den Antillen oder aus Paramaribo. Wenn Der Freek auf Urlaub kam, füllte sich das kleine Haus mit seiner lauten Stimme, die immer einem heulenden Lachen nahe war, allerdings ohne jede Fröhlichkeit.
Jetzt waren nur noch die beiden jüngsten Kinder im elterlichen Haus: Tiny und ihr jüngerer Bruder Hasje.
Für mich war Hasje eher ein älterer Bruder als der jüngste Onkel. Als meine Großmutter zu Beginn des Krieges ungeplant noch ein Kind zur Welt bringen musste, hatte sie genug von der Mutterschaft: »Einer alten Frau wie mir noch ein Kind machen, und das im Krieg …«
Sie war siebenunddreißig. Sie legte sich ins Bett. Krank. Ihr Mann schaltete die Fürsorge ein. Er hatte eine gesunde Tochter, die ihre Zeit auf der Haushaltsschule vertrödelte, wo man sie zu Hause so dringend brauchte. So wurde der kleine Hasje, während seine Mama sich jahrelang von der unerwünschten Mutterschaft erholte, von seiner ältesten Schwester großgezogen, von der Flasche über das Töpfchen bis zu den ersten Schritten und all dem, was im Leben eines Kindes weiter folgte. Sie haben ihm zweifellos gesagt, wie sich die Sache verhielt, aber gefühlsmäßig (wie er später bekannte) betrachtete er Hanny als seine Mutter. Er war gerade zehn geworden, als ich in dem Haus, in dem er von meiner Mutter erzogen wurde, zur Welt kam. Ich meinerseits wusste nach einiger Zeit nichts anderes, als dass ich in der Gestalt Hasjes einen älteren Bruder hatte. Es sorgte für viel Gelächter in der Familie, wie ich mich auch als jüngerer Bruder verhielt, der hingerissen zum zehn Jahre älteren Draufgänger aufsah – doch mir selbst verging das Lachen, als mir viel später klar wurde, dass ich das Erstgeburtsrecht gegenüber dem fragwürdigen Propheten meiner frühesten Kindheit verwirkt hatte. Das Gefühl, mich vor einem älteren Bruder, der in moralischer Hinsicht meine Leitfigur gewesen war, verantworten zu müssen, hat mich nie verlassen, bis auf den heutigen Tag nicht.
Hasje begann mit vierzehn eine Lehre bei einem Eindhovener Malereibetrieb. Zwei Jahre später erhielt sein Chef einen Großauftrag: die Renovierung des farblosen kleinen Bahnhofs von Geldrop, weil dieser auf der Route lag, auf der Königin Juliana mit ihrem Gast Haile Selassi vom DAF-Werk in Eindhoven ins Geldroper Rathaus gelangen wollte, wo ein Empfang stattfinden sollte. Hier bekam Hasje die Gelegenheit, der Welt zu zeigen, was in ihm steckte. Trotz seines Alters, sechzehn, lieferte er fachmännische Arbeit ab. Der Meister war sehr zufrieden. So standen sie beide stolz, in sauberen weißen Kitteln, gemeinsam mit den Anwohnern hinter den Absperrgittern und warteten darauf, dass die Limousine mit unserer Königin und dem Kaiser von Äthiopien in bewunderndem Schritttempo vorbeigleiten würde. Es galt als nicht ausgeschlossen, dass die fürstlichen Herrschaften aussteigen würden, um zu fragen, wer dem Hauptbahnhof von Geldrop diesen schönen Mattglanz verpasst hatte.
Was immer an jenem Nachmittag geschah, es kam kein Haile Selassi. Später erfuhren die Maler, dass der Besuch bei DAF ausgeufert war, worauf beschlossen wurde, auf dem Eindhovenseweg schleunigst direkt zum Rathaus zu brausen. Ich war dabei, als Hasje in der Lynxstraat von dem Fiasko berichtete, und nahm mir das Drama sehr zu Herzen. Doch was mich noch mehr erschreckte, war der Hohn Tinys über das Debakel ihres jüngeren Bruders. Plötzlich verwandelte sie sich mit ihrer verwaschenen Schürze in ein Schulmädchen, das durch Niederschreien des anderen als Siegerin aus einem Retourkutschenstreit hervorgeht.
»Hasje hat sich schon den Palast in Abbis Abeba anstreichen sehen … mit Goldfarbe … ha ha!«
Durch diese Demütigung muss etwas in Hasje zerbrochen sein. Ein Jahr zuvor hatte er mit ganz anderen Pinseln als den bei seiner Arbeit verwendeten anhand einer Ansichtskarte den Sämann von Vincent van Gogh kopiert. Die wogenden blauen Linien seines Pinsels auf der weißen Leinwand … der berauschende Geruch des Terpentins … die strahlend gelbe Sonne, die von der Staffelei sein schummriges kleines Zimmer zu erhellen schien … das war’s. In aller Heimlichkeit begann er Vorbereitungen zu treffen, um mit seiner Palette in die weite Welt hinauszuziehen und alle Eindrücke von unterwegs mit seinem Genie zu konfrontieren. Seinen Job bei dem Malermeister müsste er nicht eigens kündigen: Eines Tages wäre er einfach verschwunden.
4
Wie Hasje sich eines Nachts mit seinen Malsachen aus der Lynxstraat davonschlich, um in Amsterdam ein neues Leben als Künstler anzufangen, und wie er auf dem Boschdijk eine Mitfahrgelegenheit in einem Streifenwagen erhielt, der ihn schnurstracks nach Hause zurückbrachte – diese Geschichte ist schon viel zu häufig erzählt worden. Weniger bekannt ist die Folge von Hasjes Abenteuer für seine Schwester Tientje. Sie musste am frühen Morgen Kaffee für die beiden jungen Polizisten kochen, die den Ausreißer ablieferten. Der eine, Karel Henneman, konnte seinen Blick nicht von ihr losreißen. Seitdem kam er mindestens zweimal die Woche vorbei, angeblich im Auftrag seiner Dienststelle, um sich nach Hasjes Wohl zu erkundigen. Die Eltern befanden, er sei eine gute Partie für Tientje, und förderten den Kontakt, solange dieser sich innerhalb des Hauses in der Lynxstraat 83 abspielte.
Mehrere Monate lang sah ich Polizeiwachtmeister Henneman regelmäßig in meinem Geburtshaus, mal in Uniform, mal im Sonntagsanzug. Er und Tientje saßen sich dann unbehaglich am Esstisch gegenüber, die kleinen Finger ineinander verhakt und den Blick niedergeschlagen, meist schweigend. Ab und an spähte Oma durch einen Spalt der Küchentür, ob es voranging. Hasje hielt sich in seinem Atelier versteckt und betete wahrscheinlich, dieser auf Künstler angesetzte Kopfgeldjäger möge sich nicht mit seiner Schwester verloben. Ich erlebte noch die Zeit, in der die Lider sich hoben und schmachtende Blicke gewechselt wurden, während Tientje an der Wollstickerei des Tischtuchs herumzupfte.
Von einem bestimmten Tag an ließ sich der Wachtmeister nicht mehr blicken. »Es ist aus«, war alles, was Tientje dazu, auch ihren Eltern gegenüber, preisgab. Opa und Oma waren wütend. So eine ideale Partie. Künftiger Polizeipräsident, wer weiß.
Kapitel II
1
Tante Tiny hatte sich erneut einen geangelt, und diesmal war sie fest entschlossen, ihn nicht mehr loszulassen. Peter hieß er. Gerda hatte eifrig gekuppelt.
»Und du wirst ihn nicht schlagen. Verstanden? Und auch nicht kneifen. Sonst sorge ich höchstpersönlich dafür, dass aus der Sache nichts wird. Benimm dich jetzt endlich mal. Der Junge ist nicht mit Gold aufzuwiegen.«
»So schwer ist er nicht. Er ist klapperdürr.«
»Siehst du, da geht’s schon wieder los. Ich wette, der ist schon nach fünf Minuten auf und davon.«
»Ich werde ganz lieb zu ihm sein.«
Es klappte. Beim ersten Mal war ich nicht dabei, aber bei späteren Verabredungen, wenn sie mich als Alibi auf einen Spaziergang mitnahm, gab Tiny sich Peter gegenüber sehr fügsam. Er arbeitete in einem Eindhovener Hotel. Zu vereinbarten Zeitpunkten warteten wir auf einem kleinen Innenhof, wo die Mülltonnen standen, bis Peter in seiner Portiersuniform oben an einer Art Dienstbotentreppe erschien. Sie redeten dann kurz miteinander, wobei sie sämtliche Finger ineinanderflochten, unaufhörlich, ohne den Blick vom anderen zu lösen. Mir schenkten sie keine Beachtung. Ich stand im Gestank von Fischabfällen und fauligem Feldsalat rum.
»Ich mag ihn wirklich«, vertraute sie mir während eines dieser Spaziergänge an. »Ihn würde ich gern heiraten. Aber wie kriege ich ihn bloß an dieser sauertöpfischen Sippschaft in der Lynxstraat vorbei?«
2
Eines Tages während der Weihnachtsferien (ich war bei meinen Großeltern zu Besuch) war es so weit: Tiny würde Peer Portier, wie sie ihn nannte, ihren Eltern vorstellen. Er hatte abends Dienst, also trug er seine Uniform – mit Ausnahme der Mütze, die er in der Hand hielt und halbwegs hinter seinem Oberschenkel versteckte. Ich saß im kleinen Vorderzimmer und gab vor, zu lesen, behielt aber über den Rand des viel zu schwierigen Buchs hinweg den Esstisch, an den sie sich alle vier gesetzt hatten, genau im Blick.
»Portier«, sagte mein Großvater, »dann bist du bestimmt auf ein Trinkgeld hier und da angewiesen.«
»Zusätzlich zu meinem festen Gehalt«, sagte Peter. »Zugegeben, das ist nicht allzu hoch. Aber die Trinkgelder, da kommt ganz schön was zusammen. Ich verdiene gut, auch wenn ich es selber sage.«
»Es bleibt aber ein unsicherer Beruf«, sagte Opa.
Und Peter wieder: »Man hat gute Aufstiegschancen. Ich möchte es bis zum Geschäftsführer bringen.«
»Dann stehst du auch nicht so im Zug«, sagte Oma und machte ein kluges Gesicht.
»Unter dem Baldachin am Eingang hängt ein Strahler«, sagte Peter.
»Und mit euch beiden …« (Opa warf einen flüchtigen Blick auf seine Tochter), »wie ernst ist es?«
»Wir haben vor, uns zu verloben«, sagte Peter feierlich.
Tante Tiny senkte den Blick.
»Ist das nicht ein bisschen früh?«, fragte Oma. »Ihr kennt euch doch kaum.«
»Ich habe nichts gegen eine Verlobung«, sagte Opa. »Du musst aber wissen, dass wir sie nicht vor ihrem zwanzigsten Lebensjahr heiraten lassen.«
»Sie ist achtzehn«, sagte Peter. Er blickte nach Zustimmung heischend zu Tiny, doch die löste den Blick nicht von der Tischdecke. »Ich dachte …«
»Absprache ist Absprache«, sagte Opa. »Wir haben abgesprochen, dass Tientje frühestens mit zwanzig aus dem Haus geht. Und zwar verheiratet. Sonst mit einundzwanzig.«
»Dann erzähl ihm auch, warum«, sagte Tiny. »Sonst kapiert er’s nicht.«
»Das bleibt unter uns«, sagte Oma. »Wir müssen die schmutzige Wäsche doch, flixnochmal, nicht in der Öffentlichkeit waschen.«
»Dann sag ich’s ihm«, stieß Tiny, plötzlich heftig, hervor. »Ich bin nicht auf den Mund gefallen.«
»Du sagst ihm gar nichts«, entgegnete Oma. »Hier haben immer noch wir das Sagen. Es sind unsere Angelegenheiten, und da brauchen wir keine Fremden bei.«
»Wenn es irgendwas gibt, was ich wissen sollte«, sagte der Portier. Seine Mütze lag umgedreht auf dem Tisch, darin seine beigefarbenen Handschuhe. »Es handelt sich immerhin um eine Verlobung. So was macht man ja nicht zum Spaß.«
»Ein Vorschlag zur Güte«, sagte Opa zu Peter. »Ihr verlobt euch, wann ihr wollt. Nächste Woche, nächsten Monat, ist mir egal. Ich bezahle das Fest. Und dann reden wir über nichts mehr. Nicht über eine Hochzeit, bevor sie zwanzig ist. Und auch nicht über das andere, womit Tientje da ankam.«
3
Nicht lange nach diesem Gespräch verlobten Tiny und Peter sich, mit Kupferringen (die Tiny hinter seinem Rücken als »Gardinenringe« bezeichnete), aber ohne Feier, denn Tiny wollte nicht, dass ihre Eltern ihre Freunde einluden, darunter die Familie van Dartel aus dem Puttense Dreef.
»Ich bezahl«, hatte Opa gesagt. »Dann lad ich auch ein, wen ich will.«
»Keinen Nico van Dartel«, sagte Tiny. »Ich kann mich auch ohne Rosinenbranntwein von De Sparren verloben. Davon krieg ich doch nur Sodbrennen.«
Jeder, der mich kennt, hat sich schon mal die Geschichte anhören müssen, wie Nico van Dartel »die Geigen mittendurch gesägt hat«. Bei uns daheim gab es keinen Fernseher. Wenn ich bei meinen Großeltern zu Besuch war, sah und hörte ich mir zu gern auf einem der deutschen Sender Orchestervorführungen an. Ich hatte keine Ahnung von der Musik, aber sie machte mich irgendwie ruhig und sogar ein bisschen glücklich. Eines Abends kam Opas Freund Nico van Dartel, ein Schuster, mit seiner Familie, um sich die Revue De Jantjes anzuschauen, von der schon seit Wochen aufgeregt geredet wurde. Die van Dartels setzten sich zusammen mit meinen Großeltern an den Tisch, und Tiny sollte Kaffee für alle kochen. Ich gab zu verstehen, dass ich das Konzert auf Deutschland 1 oder 2 zu Ende sehen wollte. Daraufhin begann Mijnheer van Dartel, das Orchester lächerlich zu machen.
»Nichts als sägen, sägen und noch mal sägen«, sagte er. »Die sägen die Geigen noch mittendurch.«
Mein Großvater schaltete zu De Jantjes um. Ich flüchtete in die Küche, zu Tante Tiny, die auf den brodelnden Kaffee in dem gläsernen Behälter starrte.
»Am liebsten würde ich ihm Rattengift in den Kaffee tun«, sagte Tiny leise. Sie meinte den Kaffee von Nico van Dartel. »Niemand würde was merken. Ja, dass er tot umfällt. Aber nicht, dass es vom Kaffee kam. Von Rattengift fallen einem die Haare aus. Tja, und Nico hat schon ’ne Glatze.«
»Hast du denn Rattengift, Tante Tiny?« Ich hatte keine Angst, war nur neugierig. Sie öffnete eine Dose mit grünlichem Zeug, das stark nach Suppe roch. Ich dachte eher an Bouillonwürfel mit Gemüseextrakt als an ein tödliches Mittel.
»Schmeckt man das denn nicht im Kaffee?«, wollte ich wissen.
»Wenn es erst mal reingerührt ist, dann denkt man vielleicht: Was schmeckt der Kaffee komisch«, sagte Tiny. »Aber das sagt man schließlich nicht laut, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Dann sagt man: ›Mmh, leckerer Kaffee‹, und rutscht einfach unter den Tisch. Mausetot.«
Allein schon aus Sensationslust und weniger der mittendurch gesägten Geigen wegen wünschte ich, Tiny würde etwas von diesen Suppenwürfeln in Nicos Kaffee bröckeln.
»Wenn ich genau wüsste«, sagte Tiny, »dass er es trinkt, dann hätte ich da überhaupt kein Problem mit. Aber angenommen, die Tasse mit dem Gift landet direkt vor seiner Frau. Die hat ja sowieso schon so ein Scheißleben mit dem Dreckskerl.«
Ich riet ihr, Tassen in verschiedenen Farben zu nehmen und dann zum Beispiel die rote vor Nico hinzustellen.
»Superpraktisch«, sagte ich. »Wie bei den Steinen von Mensch ärgere dich nicht. Ich spiele immer mit Grün.«
»Du musst aber verstehen, Albertje«, sagte Tiny, »dass einem, der im Begriff ist, einen anderen zu vergiften, schon mal die Nerven durchgehen können. Angenommen, ich habe im letzten Moment vergessen, welche Farbe jetzt für den Glatzkopf war …«
Tiny erzählte nicht, warum sie den Mann so verabscheute. Ich fragte nicht nach. Sie konnte so viele Leute nicht ausstehen, warum also nicht auch Nico van Dartel. Sie drückte den Deckel wieder auf die Dose mit Rattengift. So wurde ich Zeuge, wie der Schuster dem sicheren Tod entrann. Als Tiny mit dem Tablett in die Stube ging, um jedem Kaffee zu servieren, folgte ich ihr. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, wie Nico van Dartel genüsslich seinen Kaffee trank, ohne unter den Tisch zu rutschen, obwohl das genauso gut hätte geschehen können.
Kapitel III
1
Wenn ich sonntagmorgens zu Tante Tientje ins Bett schlüpfte, trug sie nicht den Puder- und Rougeduft vom Vorabend an sich, doch der leicht animalische Geruch, den ich jetzt roch, war mir ebenso lieb. Die Geschichten, die sie mir erzählte, hatten in Verbindung mit ihrem Körpergeruch die gleiche Wirkung auf mich wie die Aktzeichnungen und anatomischen Studien in Onkel Hasjes Atelier, bei deren Anblick mir meine Hose auch irgendwie zu eng wurde.
Wenn ich ihre Geschichten aus der Erinnerung rekonstruiere, waren sie ganz schön schweinisch. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich drei Viertel nicht verstand, waren sie noch immer obszön.
»Mir wird selber warm«, sagte sie manchmal und wedelte dann demonstrativ mit der Decke. Die abwechselnd schwüle und kühle Luft, die so in Bewegung gesetzt wurde, wogte über mich hinweg und stiftete noch mehr Verwirrung in meinem Blut.
Einmal verweigerte sie mir den Zutritt in ihr Bett.
»Lass das«, sagte sie, als ich die Decke aufschlug, um mich neben sie zu legen. »Nicht!« Sie schob mich von sich. »Du stinkst.«
Ich trat einen Schritt zurück und begann an mir zu riechen, fast in Tränen, weil sie es so brutal gesagt hatte. »Ich riech nichts. Ehrlich nicht.«
»Ich stinke«, sagte sie.
»Find ich nicht«, sagte ich.
»Doch«, sagte Tiny, »das ist der monatliche Scheiß.«
Sie erklärte mir, was »die Tage haben« genau bedeutete. Endlich füllten sich die Worte, die ich ständig um mich herum hörte, in der Schule und im Heim der Pfadfinder, mit Inhalt. Ich musste zugeben: Sie roch heute anders, aber stinken – nein.
Nachdem sie mir alles haargenau erklärt hatte, sagte sie auf einmal: »Ich weiß nicht mal, ob ich meine Tage überhaupt noch kriegen kann. Früher schon. Fing an mit zwölf. Nach meinem vierzehnten Lebensjahr hörte es auf. Das heißt … es kommt schon noch was, aber sehr unregelmäßig. Kein Verlass drauf. Ich weiß nicht, ob das noch die Tage sind oder einfach krankhafter Blutverlust, weil irgendwas bei mir nicht in Ordnung ist …«
»Gehst du denn mal zum Arzt, Tante Tiny?«
»Ich trau mich nicht. Blöd, nicht? Ich habe Angst, die entdecken dann was. Das erlebt man bei so vielen Leuten. Sie haben alle vage Beschwerden, aber sonst nix … und dann lassen sie sich auf den Kopf stellen, eine Untersuchung nach der anderen, und plötzlich liegen sie im Krankenhaus und sind sterbenskrank. Ohne mich!«
»Was sagt Oma?«
»Glaubst du wirklich, ich kann mit der darüber reden? Dann kannst du genauso gut gegen die Tür da reden. Wobei, ’ne Tür antwortet manchmal noch was Vernünftiges … wenn’s zieht.«
2
»Andere Frauen haben die Periode nach der Uhr«, sagte Tante Tiny, »aber ich … Ich bin nicht fürs Leben geschaffen.«
Über Letzteres musste sie selbst lachen. Es klang nicht fröhlich. So wie ein heulender Hund sich manchmal an seinem Jaulen verschluckt, so klang ihr Lachen.
3
Dass Peter ihre »große Liebe« war, wie Tientje sagte, bedeutete noch nicht, dass sie ihn nicht ab und an bis ins Mark zu beleidigen versuchte. Was Schläge und Kneifen anging, hielt sie sich zurück, aber anderen mit Worten zuzusetzen, das konnte sie nun mal nicht lassen. Die Schlange durfte ihr Gift nicht immer hinunterschlucken, sonst würde sie sich möglicherweise selbst vergiften.
Peter ließ sich viel von ihr gefallen, doch das steigerte Tinys Lust zu quälen nur noch. So hatte der Portier nicht einfach ein Grübchen am Kinn, sondern einen richtigen Spalt, der ihm das Rasieren erschwerte.
»Sieh dir das an, diesen Hühnerpopo … da kann jeden Moment ein Ei rausfluppen. Einfach so, irgendwem mittenmang ins Gesicht, dass es nur so runtertropft. Wusstest du, Albert, dass Peer sich nicht normal rasieren kann? Er muss mit so ’nem altmodischen Rasiermesser in diese Furche, um sie mit Schaum auszukratzen. Da bleiben immer ein paar von diesen Borsten zurück.«
»Na komm, Tineke«, sagte Peter dann. »Jetzt wissen wir’s.«
»Bei Philips«, fuhr sie fort, »sind sie dabei, einen speziellen Philishave für ihn zu entwickeln. Noch liegt er auf dem Zeichentisch, aber wenn sie’s hinkriegen, dann kann er sich endlich sein Popokinn ausrasieren. Verstehst du jetzt, Albert, warum er bestimmte Dinge bei mir nicht darf? Es reibt. Er hält mich wohl für ’ne Muskatnuss. Meine Haut wird feuerrot davon. Da hilft auch keine Nivea.«
»Tientje, hör jetzt auf. Du kannst mich ruhig lächerlich machen, aber nicht, wenn ein Kind dabei ist.«
Ich war regelmäßig Zeuge, wenn ein Bruch zwischen den beiden gekittet werden musste. Dann hatte Peer Portier Schluss gemacht, weil sie ihn demütigte, oder sie, weil er die Stirn besaß, ihr Kontra zu geben. Ich saß auf meinem vertrauten Platz im kleinen Vorderzimmer und konnte durch die halb geschlossene Schiebetür hindurch auf den Esstisch im Wohnzimmer blicken, an den Tiny und ihr Verehrer von Oma unsanft verfrachtet worden waren.
»Du hier, du da. Und es wird nicht aufgestanden, flixnochmal, bevor ihr das nicht ausdiskutiert habt.«
Oma verzog sich dann ausnahmsweise in die Küche, um Kaffee zu kochen, aber dazu kam es nie: An die Spüle gelehnt, lauschte sie, ohne sich zu rühren, den Verwicklungen im Wohnzimmer, nur von ihrer Schwerhörigkeit behindert, weshalb sie gelegentlich eine Nuance nicht mitbekam – was dann wieder Anlass zu endlosen Missverständnissen sein konnte.
Peter saß an der Stirnseite des Tisches, auf einem nah herangerückten Stuhl, die Arme ordentlich vor sich abgelegt wie ein Schüler, der gerade einen Anschiss vom Lehrer erhalten hat. Tiny saß seitlich am Tisch, so dass ihre Beine freies Spiel hatten. Mal um Mal schlug sie sie übereinander. Rechts herum, links herum. Ihre Nylons sirrten. Da, am oben liegenden Bein, hing der hochhackige Schuh (Lata, mit Personalrabatt) locker an ihren Zehen, wodurch man sehen konnte, dass sie unter dem Strumpf einen Füßling trug: den halben Fußteil, von einem alten Nylonstrumpf abgeschnitten und über die Zehen geschoben, damit die Nägel keine Laufmaschen in den neuen Strumpf reißen konnten.
Tante Tientje schaute nicht zu Peter, sondern auf den wippenden Schuh, der jetzt nur noch am großen Zeh hing. Sie bemühte sich um eine bekümmerte Miene, doch ihr erbostes Gesicht spielte nicht mit. Es sah aus wie ein Experiment: Welches Mindestmaß an Halt benötigte der Pumps von ihrer Zehenspitze, um nicht herabzufallen?
Plötzlich stellte Tiny ihren Fuß hart auf den Boden. Sie stampfte ihn in den Schuh und trat mit der Spitze gegen Peters Schenkel. Mit einem kurzen Wimpernschlag versuchte sie, ihn wütend anzusehen, aber es entging mir nicht, dass auch ein Hauch von Versöhnung in ihrem Blick lag. Meist war dies der Moment, in dem Peer Portier um des lieben Friedens willen nachzugeben begann.
Heute lief es anders. Er faltete die Hände, legte sie mit der Zeigefingerseite ganz exakt in die Kerbe seines Popokinns und räusperte sich. Er sagte: »Ich habe mit Henneman gesprochen.«
»Kenn ich einen Henneman?«, fauchte Tiny, die wahrscheinlich einen reuigen Kniefall vonseiten Peters erwartet hatte. »Muss ich denn jeden kennen?«
»Stell dich nicht dumm«, sagte Peter. »Du kennst ihn nur zu gut. Karel Henneman. Der Polizist, der in den Augen deiner Alten so eine gute Partie für dich war.«
»Ich habe ihm den Laufpass gegeben wegen dir«, fauchte Tiny. »Entgegen dem Wunsch meiner Alten. Damit du das weißt.«
Meine Tante nahm das Geschaukel mit ihrem Bein, das Gewippe mit ihrem Schuh, auf den sie böse blickte, wieder auf.
»Aber wie, darum geht es mir«, sagte Peter so leise, dass Omas schwerhörige Ohren es mit Sicherheit nicht auffingen.
»Einfach Schluss gemacht«, sagte Tiny. »Da fackel ich nie lange.«
»Er wollte dich heiraten«, sagte Peter. »Gemeinsam eine Familie gründen. Du hast ihm gesagt, dass du« (er senkte seine Stimme noch weiter und warf einen Blick in Richtung Vorderzimmer) »unfruchtbar bist.«
Einige Zeit war es still. Sehr ungewöhnlich, denn meist schoss Tiny sofort eine Antwort zurück, um ihrem Gegenüber den Mund zu stopfen. Ihre Miene nahm auf einmal etwas Weiches und Flehendes an. Sie schüttelte betrübt den Kopf. »Peter«, sagte sie fast flüsternd, »kapierst du denn immer noch nicht, was ich für dich übrighabe? Mein Vater und meine Mutter hätten so gern gesehen, dass ich ihn heirate … den Karel … und er wusste das. Dann lernte ich dich kennen. Henneman hatte spitzgekriegt, dass meine Alten hinter ihm standen und dich nicht als Schwiegersohn wollten. Da gab’s nur noch eins, womit ich ihn loswerden konnte. Sagen, dass ich keine Kinder bekommen kann. Ich habe ihn angelogen. Eine kleine Notlüge. Dir zuliebe. Damit wir zusammenbleiben konnten. Du und ich.«
»Du bist also nicht unfruchtbar?«
»Nein, du Dusseltier.« Tiny zog seine verschränkten Hände zu sich heran und umschloss sie mit den ihren. »Ich habe gelogen. Um ihn loszuwerden. Um den Weg für dich frei zu machen. Bitte glaub mir. Ich will dich heiraten. Und Kinder kriegen.«
»Dieser Polizist war sich seiner Sache aber ziemlich sicher«, sagte Peter, dem diesmal offenbar nicht danach war, die Versöhnung wie sonst zu beschleunigen und mit Küssen zu besiegeln. »Er schien überzeugt davon, dass es nicht nur eine Ausflucht war.«
»Wenn er so gutgläubig sein will«, lachte Tiny, »umso besser, oder? Stell dir vor, er hätte mich zum Arzt geschleift. Ich darf gar nicht dran denken.«
»Alles schön und gut«, sagte Peter, »aber verstehst du, dass ich auf so eine Information hin einen Schreck bekam? Ehrlich gesagt, ich hab ihm geglaubt. Eigentlich bin ich heute Abend hergekommen, um die Verlobung zu lösen.«





























