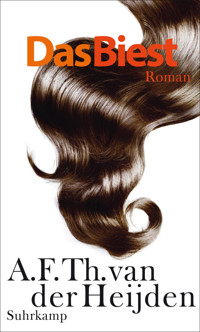25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Worüber man nicht reden kann, darüber muß man einen Roman schreiben, so lautet die Lebens- und Überlebensmaxime A. F. Th. van der Heijdens. Es ist die einzige Art und Weise, wie er dem Schicksal seines 22jährigen Sohnes begegnen kann. Tonio van der Heijden starb am 23. Mai des Jahres 2010 in Amsterdam: Ein Auto überfuhr ihn am frühen Morgen auf dem Weg nach Hause. In einem zweiteiligen Roman findet und erfindet der Ich-Erzähler Adri die ersten sechs Lebensjahre seines Sohnes, und zwar von der Geburt im Juni 1988 bis zum Schuleintritt. Dieser Romanteil gehorcht dem Motto: den Sohn festhalten, ihn schützen vor allen Gefahren. Der zweite Teil konstruiert, in Form eines Kriminalromans, die für sich betrachtet völlig unlogischen Todesumstände von Tonio. Entstanden ist auf diese Weise ein berührender und bewegender Roman über das Unglück schlechthin, über die Unbegreifbarkeit des Unvorstellbaren – zugleich ein Buch über die unabweisbaren Fragen nach der eigenen Schuld, ein Buch der Trauer. Wenn es angesichts der Unfaßbarkeit des Todes eine Form der Trauer gibt, die den Lebenden Zukunft eröffnet und Zuversicht ermöglicht – so muß sie die Gestalt dieses Herz und Kopf in Bann schlagendes Requiems besitzen. Dieses Buch dementiert die weitverbreitete Meinung, angesichts des Todes sei alles sinnlos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
A. F. Th. van der Heijden
Tonio
Ein Requiemroman
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Suhrkamp
Titel der Originalausgabe: Tonio. Een requiemroman.
Zuerst erschienen 2011 bei Bezige Bij, Amsterdam.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© Adri van der Heijden 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-76210-3
www.suhrkamp.de
Give sorrow words: the grief that does not speak
Whispers the o‘er-fraught heart, and bids it break.
Shakespeare, Macbeth (IV, 3)
Farewell, thou child of my right hand, and joy;
My sin was too much hope of thee, loved boy,
Seven years thou wert lent to me, and I thee pay,
Exacted by thy fate, on the just day.
O, could I lose all father, now. For why
Will man lament the state he should envy?
To have so soon ‘scaped world‘s, and flesh‘s rage,
And, if no other misery, yet age!
Rest in soft peace, and, asked, say here doth lie
Ben Jonson his best piece of poetry.
For whose sake, henceforth, all his vows be such,
As what he loves may never like too much.
Ben Jonson, On my First Son
Prolog
Kein zweiter Name
1
»Tooooooo-niii-iooooo …!«
Nie habe ich seinen Namen häufiger gerufen als in den knapp vier Monaten seit dem Schwarzen Pfingstsonntag. Wenn ich hinzufüge »mit der ganzen Kraft meiner Stimme«, so meine ich meine innere Stimme, die unendlich lauter klingt und weiter trägt als das, was meine Stimmbänder im Zusammenwirken mit der vibrierenden Luft hervorzubringen imstande sind. Äußerlich ist mir nichts anzusehen.
Vergleiche das mit Weinen. Ich schäme mich manchmal Mirjam gegenüber, die sich, anders als ich, der Naturgewalt eines plötzlichen Heulkrampfs hinzugeben vermag.
»Auch wenn du keine Tränen siehst, Minchen, ich weine trotzdem mit dir«, habe ich ihr einmal erklärt (mit erstickter Stimme, immerhin). »Bei mir äußert sich dieser furchtbare Kummer wie eine innere Blutung. Er sickert oder strömt irgendwo in mir.«
2
Zu Beginn von Nabokovs Roman Lolita kostet der Erzähler Silbe um Silbe den Namen seiner Geliebten: »Die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei Drei gegen die Zähne. Lo. Li. Ta.«
Der Name meines Sohnes beginnt mit einem solchen Antippen der Zungenspitze an die Rückseite der Schneidezähne (T …), wonach sich die Lippen öffnen, um den Vokal o in seiner ganzen Vollheit der Luft preiszugeben. Der restliche Atem bringt mit Hilfe der höher gelegenen Nasenhöhle einen leicht quietschenden Nasallaut hervor (niii …) – kaum mehr als eine kurze Unterbrechung im langgedehnten ooo, das nun aus dem nach wie vor geöffneten Mund ungehindert weiterhallt.
»Tooooooo-niii-iooooo …!«
Der ideale Rufname, dachten wir – auch im Wortsinn, wenn wir ihn später, ein draußen spielender Junge inzwischen, zum Essen hereinrufen wollten. Das zweite o ließe sich mühelos, anschwellend, bis zum Ende der Straße dehnen, notfalls bis zum Jacob Obrechtplein, wo er eines Tages mit seinen Freunden bei der Synagoge herumhängen würde.
Als Mirjam schwanger war, kam es uns nicht in den Sinn, mit Hilfe einer Ultraschallaufnahme das Geschlecht des Kindes feststellen zu lassen. Auch ohne Bestätigung durch die Medizintechnik waren wir beide überzeugt, es würde ein Mädchen – warum, weiß ich nicht mehr. Wir wollten es Esmée nennen, nach der Oper, die Theo Loevendie gerade komponierte und über deren Fortschritte er uns regelmäßig im Café Welling auf dem laufenden hielt.
Ein paar Wochen vor dem errechneten Stichtag kam Mirjam ins Badezimmer, wo ich verkatert in der Wanne lag. Sie stieß die Tür, die einen Spaltbreit offenstand, mit ihrem Spitzbauch ganz auf, und der schien durch die Art und Weise, wie sie beide Hände ins Kreuz stemmte, nur noch weiter vorzustehen.
»Und wenn es nun ein Junge wird?«
Mein Kopf schmerzte schon zu heftig, als daß ich ihn mir darüber noch hätte zerbrechen wollen. Seit Monaten lagen überall in der Wohnung Blätter mit Notizen für ein Referat, das Mirjam im Rahmen eines Niederländischseminars schrieb: eine vergleichende Untersuchung von Thomas Manns Novelle Tonio Kröger und dem Roman Geur der droefenis von Alfred Kossmann. Ich brauchte eines dieser Blätter nur von fern zu betrachten, schon sprang mir der Name Tonio Kröger ins Auge. Die ganze Wohnung bis hin zur Küche war übersät mit verschiedenen Ausgaben von Tonio Kröger, deutschen und niederländischen. Mirjam las mir Passagen aus ihrer Arbeit vor. Am Telefon hörte ich sie mit dem Dozenten, mit Kommilitonen darüber diskutieren. Immer wieder dieser vollmundige Name: »… wie es in Tonio Kröger heißt …«
»Ein Junge«, wiederholte ich, während ich einen schaumigen Arm nach Mirjam ausstreckte. »Der kann dann nur Tonio heißen.«
Ich bekam einen Klaps auf die Hand, daß die Flocken stoben. »Okay.« Mirjam watschelte wieder aus dem Badezimmer. Offenbar bedurfte es keiner weiteren Diskussion. Wir hielten nach wie vor an Esmée fest, aber jetzt hatten wir wenigstens einen Jungennamen in Reserve, für den undenkbaren Fall, daß.
3
Ein paar Tage nach der Badezimmerszene wurde, rund drei Wochen zu früh, unser Sohn geboren. Als ich vor dem Brutkasten stand, las ich von dem graurosa Pflaster auf seiner schmalen Brust wieder und wieder flüsternd seinen Namen ab, der mir immer besser zu gefallen begann.
To. Ni. Io.
Es hatte etwas von einer rollenden, brechenden, weiterrollenden Woge. Ni. Ein Name mit einer überwundenen Verneinung.
Na schön, es war ein Wagnis gewesen, aber wie sich herausstellte, paßte Tonio perfekt zu ihm. Als die Augen des kleinen blinden Mannes sich richtig öffneten, sahen sie einen genauso rund und konzentriert an wie die o‘s, die fettgedruckt auf der Geburtsanzeige standen.
Mein Kosename für ihn wurde wie von selbst Totò. Er lachte dann sabberiger, als wenn er seinen richtigen Namen hörte, deswegen würde er mich später also wohl nicht ermorden. Nachdem einige Jahre später der Mafiaboß Totò Riina auf Sizilien verhaftet worden war, sagte ein Besucher, der mich den Kleinen so ansprechen hörte: »Wie kannst du nur deinen Sohn nach einem Mafioso nennen.«
»Bis gestern hatte ich noch nichts von diesem Riina gewußt. Ich habe immer an Antonio de Curtis gedacht. Den neapolitanischen Komiker. Künstlername Totò. Er hat in Uccellacci e uccellini von Pasolini mitgespielt. Ein phantastischer Clown.«
Wenn Tonio in späteren Jahren irgendeinen Blödsinn angestellt hatte, nannte ich ihn Totò le Héros, nach dem Film von Jaco van Dormael. Dann lachte er noch lauter, allerdings auch etwas nervös, denn er wußte aufgrund meiner Erklärung, daß er als »Held« bezeichnet wurde, und das konnte alles mögliche bedeuten.
Mirjam hatte in der Anfangszeit ihren eigenen, eher an van den Vondels Werk erinnernden Kosenamen für ihn: Tonijntje. Wenn sie den aussprach, legte sie so viel Liebe in ihre Stimme, daß er wirklich nichts mehr zu befürchten hatte, und das wiederum ließ er uns selbstgefällig spüren.
»Na gut, noch fünf Minuten, Tonijn, aber dann mußt du wirklich kommen.«
»Ich bin traurig.«
»Wegen Runnertje bestimmt …« (Runner war sein Russischer Zwerghamster, den er vor Monaten tot in der Holzwolle gefunden hatte. Von Zeit zu Zeit, wenn es sich ergab, trauerte Tonio um ihn. So hatte er zusammen mit seinem Gitarrenlehrer ein kurzes Requiem für Runner komponiert.)
»Ich find es so schlimm, daß er tot ist.«
»Traurig, aber du mußt nicht weinen.«
»Ich spüre Tränen, die du nicht siehst.«
4
Bei all meiner Angst vor seiner Verletzbarkeit ist mir nie aufgefallen, daß die beweglichen o‘s, die mir so lebendig aus Tonios Namen zulachten, typographisch dieselben sind wie die, die mich aus der starren Kongruenz des Wortes »dood«, Tod, anstarren.
Als Mirjam und ich ihn das letzte Mal sahen, ragten zwei Drainageröhrchen aus seiner Stirn, ein kurzes und ein etwas längeres, wie Hörner. Sie waren dort einige Stunden zuvor angebracht worden, um die überschüssige Flüssigkeit aus seinem anschwellenden Gehirn abzuleiten. Bei allem, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging, war in meinem eigenen Gehirn offenbar noch Platz für eine Szene aus dem Film Camille Claudel, den ich vor Jahren zusammen mit Mirjam gesehen hatte. Ich wollte sie daran erinnern, aber nein, nicht dort, nicht in dem Moment, unmöglich.
Der Bildhauer Rodin mustert eingehend eine kleine Nashornskulptur. »Es heißt Totò«, sagt eine der Claudel-Schwestern. »Wenn man es von vorn anschaut, hat man seinen Namen.«
Zwei verschiedene Hörner, zwei gleiche Augen. Obwohl das eine Lid ein wenig hochkroch, konnte man getrost sagen, daß Tonio die Augen geschlossen hielt, so daß das Bild nur zum Teil stimmte.
5
Mit »Antonio« durfte man ihm nicht kommen, aber ansonsten mochte er seinen Namen, inklusive aller Ruf-, Schmeichel- und Kosevarianten. Nur wenn er wieder einmal, bei einer Anmeldung in der Schule oder anderswo, nach seinen übrigen Vornamen gefragt worden war, kam er wütend nach Hause. Ein aufgebrachter Tonio kreuzte die Arme vor der Brust, in einer Art unvollständiger Verschränkung, bei der die gekrümmten Handgelenke wie zornige Buckel hochstanden.
»Warum hab ich nur einen Vornamen?«
»Ach, mein Junge, der Name Tonio ist schon so schön, so perfekt … warum sollte man ihn durch einen zweiten verschandeln?«
»Adri, jeder hat zwei Vornamen. Manche Kinder in der Schule haben sogar drei. Ich nur einen. Du hast auch drei.«
»O ja, und dabei kann ich noch von Glück sagen, daß sie keinen vierten drangehängt haben. Maria war damals sehr in Mode. Besonders für Jungs.«
Eines Tages, als er schon etwas größer war, habe ich ihm die Sache mit dem einen Vornamen erklärt. »Es ist meine Schuld, Tonio. Es liegt an mir, daß du nicht mehr Vornamen hast.«
Eine Selbstbezichtigung seines Vaters, davon wollte Tonio kein Wort verpassen. Er war sofort Feuer und Flamme und strahlte vor Vorfreude. »Dann will ich das jetzt endlich mal hören.«
»Gott, was tu ich mir da wieder an. Nun gut. Mama und Tante Hinde, wie heißen sie hinten? Und jetzt nicht wieder so albern sein und Arsch sagen. Das kennen wir langsam.«
»Rotenstreich natürlich.«
»Was ist der Nachname von Opa Natan?«
»Rotenstreich natürlich.«
»Und du, Sohn von Mirjam Rotenstreich und Enkel von Natan Rotenstreich, wie lautet dein Nachname?«
Lachend: »Van der Heijden natürlich. Wie du.«
Tonio warf sein Kuscheltuch triumphierend nach oben, er wollte immer die Decke erreichen, was aber selten gelang. Es war sein liebstes Sabbeltuch, weiß mit roten Noppen, aus einer alten Baumwollbluse von Mirjam geschnitten. Dem Schnuller hatte er schon vor einiger Zeit abgeschworen, und auch für so ein Schmusetuch war er inzwischen zu alt, aber ganz ohne ging es noch nicht. Das Tuch fiel herunter und landete auf seinem Kopf. »Ups.«
»Wie viele Söhne hat Opa Natan?«
Tonio tat so, als zählte er sie an seinen Fingern nach, und sagte dann: »Keinen. Nur zwei Töchter. Mama und Tante Hinde. Das sind Schwestern.«
»Opa Natan ist in den Achtzigern. Er besitzt nicht das ewige Leben. Und Mirjam und Hinde … wir hoffen natürlich, daß die Schwestern Rotenstreich noch ganz lange unter uns weilen. Aber irgendwann ist Schluß. Dann ist der Name Rotenstreich ausgestorben.«
»Ja, wenn nämlich Tante Hinde und Onkel Frans Kinder kriegen, heißen die auch van der Heijden. Ihr seid zwei Brüder, verheiratet mit zwei Schwestern. Stimmt doch, Adri?«
»Deshalb gibt‘s auch doppelt soviel Krach in der Familie«, sagte ich. »Aber das ist ein anderes Problem.«
»Hat Opa Natan keine Brüder?«
Tonio ließ sein genopptes Tuch ganz schnell kreisen, in einer Schleuderbewegung. Er schaute mit zusammengekniffenen Augen dem imaginären Geschoß nach, das er wegkatapultierte. Treffer. Er ballte die Faust. »Yesss …!«
»Brüder, nein. Er hatte mehrere Schwestern. Die sind im Zweiten Weltkrieg von den Nazis ermordet worden. Genau wie seine Eltern und der gesamte Rest der Familie. Jetzt tragen nur noch drei Menschen auf der Welt den Namen Rotenstreich.«
»Weißt du, Adri … in der Schule ist ein Junge, der heißt wie seine Mutter. Er hat keinen Vater. Wenn Tante Hinde jetzt …«
»Oh? Das wird Onkel Frans bestimmt gefallen.«
»Ups. War wohl nix.«
Tonio legte sich das Tuch über Kopf und Gesicht.
»Ich habe gerade auch einen Fehler gemacht«, sagte ich. »Etwas verschwiegen. Vor Jahren hat Opa Natan nämlich in alten Registern und so Nachforschungen über seinen Familiennamen angestellt. Er hat nur tote Rotenstreichs gefunden. Bis auf einen. Einen Professor Rotenstreich in Jerusalem. Opa Natan hat mit ihm telefoniert. Der Mann behauptete steif und fest, sie könnten nicht miteinander verwandt sein. Er wollte auch keinen weiteren Kontakt. Also wieder eine tote Spur.«
Einen Moment lang war es still. Tonio hatte sein Tuch zurückgeschoben, so daß er aussah wie ein kleiner Pharao. »Adri«, schmeichelte er jetzt, »du wolltest mir doch erzählen, warum ich keine zwei Vornamen habe.«
»Du hast auch kein Fitzelchen Geduld! Ohne diesen Umweg über den Namen Rotenstreich würdest du überhaupt nichts kapieren. Ich steuere behutsam auf das Ziel zu.«
»Oh, ‘tschuldigung.« Er ließ sich laut lachend zurückfallen und warf gleichzeitig das zu einem Ball zusammengeknautschte Kuscheltuch in die Höhe. Das Ding berührte lautlos die Zimmerdecke und kam dumpf wieder auf. »Yesss …!«
»Hör zu, Totò, ich erzähl dir jetzt, was für ein Trottel dein Vater ist. Das hörst du bestimmt gern.«
»Ja! Ja!«
»Von dem Moment an, als Mirjam schwanger wurde, haben wir gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, wie man diesen bedrohten Namen … Rotenstreich … mit dem unseres künftigen Kindes verbinden könnte.«
»Hä?«
»Heutzutage, bei all den exotischen Stammbäumen, wundert sich niemand mehr über einen merkwürdigen, langen Vornamen. Schon gar nicht, wenn es der zweite oder dritte ist. Als du geboren wurdest … ich weiß nicht, ob man damals schon Phantasienamen auf dem Einwohnermeldeamt angeben durfte. Wenn du was nicht verstehst, dann sag‘s ehrlich.«
»Ich weiß nicht, was ein Einmelder …«
»Wo wir alle registriert sind. Alle Einwohner von Amsterdam. Wo ich dich am Tag nach deiner Geburt angemeldet habe …«
»So ähnlich wie bei einem Hotel.«
»Einchecken, ja. Wir wollten es einfach mal probieren. Ein Verleger hatte uns geraten, die Sache in einem Brief an die Königin anzusprechen. Majestät, haben Sie Erbarmen, es geht um einen seltenen Namen, et cetera, et cetera … Also, dazu hatten wir keine Lust. Ich wollte einfach aufs Einwohnermeldeamt gehen und sagen: ›Liebe Leute, hört her. Der neue Weltbürger heißt van der Heijden, Rufname Tonio, zweiter Vorname Rotenstreich. Vollständiger Name: Tonio Rotenstreich van der Heijden. Ohne Bindestrich.‹ Hauptsache, es stand erst mal auf dem Papier. Wenn es ein Mädchen geworden wäre, hätte es bis zur Hochzeit oder bis zum Tod den Nachnamen Rotenstreich van der Heijden führen können. Ein Junge hätte sogar noch seinen Kindern den Nachnamen Rotenstreich van der Heijden mitgeben können.«
»Ohne Bindestrich. Ulkig.«
»Falls sie darauf reinfallen würden. Am 16. Juni 1988, dem Tag nach deiner Geburt, ging ich zum Einwohnermeldeamt an der Herengracht. Mama und du, ihr wart noch im Krankenhaus …«
»Im Slotervaart«, sagte Tonio, ein wenig abwesend. »Ich mußte im Brutkasten bleiben.«
»Ja, wir hatten uns mal wieder was Minderwertiges andrehen lassen. Aber wir beschlossen, dich trotzdem zu behalten, also, am nächsten Tag … ich zur Herengracht. Siehst du mich da gehen, den stolzen jungen Vater?«
»Jungen Vater?« Wieder flog das Noppentuch in die Luft. Diesmal landete der Lumpen, sich im Fall ausbreitend, auf meinem Kopf. »Ups. War wohl nix.«
»Frischgebackener Vater dann eben. Wie du willst, du Wortklauber. Ich war morgens noch bei Mama auf der Entbindungsstation gewesen. Sie hatte mir bestimmt zwanzigmal auf die Seele gebunden, ich sollte versuchen, irgendwie … egal, wie … den Namen Rotenstreich auf den Geburtsschein zu kriegen.«
»Ohne Bindestrich.«
»Ich ging die Leidsestraat runter und über die Herengracht und sagte mir immer wieder vor: ›Tonio Rotenstreich van der Heijden.‹ Ich fand, es klang immer schöner. Von wegen zwei Vornamen – ein doppelter Familienname. Es hatte etwas Adliges. Ich, Vater eines Sohnes? Eines blaublütigen Prinzen, oho. Da, der Eingang zum Einwohnermeldeamt. Ich die Stufen hoch. Jetzt konnte nichts mehr schiefgehen. Ich würde es so achtlos wie möglich von mir geben, als hätte ich noch anderes im Kopf. ›Ich möchte die Geburt eines Sohnes anzeigen. Tonio Rotenstreich van der Heijden. Gestern, ja, fünfzehnter Juni. Zehn Uhr sechzehn.‹ Wenn dieser Typ vom Einwohnermeldeamt fragen würde: ›Pardon, ist das ein Name, Rotenstreich?‹, dann würde ich antworten: ›Ja, in der Ukraine, wo mein Schwiegervater herkommt, war das vor dem Krieg ein häufiger Vorname.‹ Kam nur drauf an, den richtigen beiläufigen Ton anzuschlagen.«
Tonio lachte. »Ich glaub, ich weiß schon, wie es ausgegangen ist.« Er zog das Tuch hinter seinem Nacken hervor und drückte den kühlen Stoff an seine glühenden Ohren, die von Schläfrigkeit zeugten.
»Nicht so voreilig, mein Freund. Es lief alles anders, als ich mir vorgestellt hatte, ja. Hinter der Tür, wo ich hinmußte, war eine Art Vorraum, einen Quadratmeter groß, mit einem Plastikstuhl. Kein Mensch konnte sich da auch nur umdrehen. Sonst war da noch ein kurzer Tresen mit einem Computer drauf und …«
»Gab‘s damals schon Computer?«
»Ja, irre, was? Computer, schon vor deiner Geburt. Antike Dinger mit Tretantrieb.«
»Und wieso weißt du dann immer noch nicht, wie …«
»Irgendwann darfst du es mir beibringen. Hinter dem Computer auf dem Einwohnermeldeamt saß eine junge Frau, die mich freundlich begrüßte. Wahrheitsgemäß sagte ich: ›Ich bin gestern Vater eines Sohnes geworden, und jetzt …‹ Es war die Zeit, als Beamte noch dazu angehalten wurden, den Bürger so zu behandeln, daß er sich wohl fühlte, also rief sie: ›Oh, wie schö-h-ön! Wie soll er denn heißen?‹ Ich dachte, der offizielle Teil der Anmeldung kommt noch, also habe ich, wieder wahrheitsgemäß, geantwortet … na, was glaubst, was ich geantwortet habe?«
Tonio senkte seine Stimme und sagte verträumt: »Tonio.«
»Und die junge Frau wieder, beinahe singend: ›Was für ein schöner Na-h-ame!‹ Es hätte mir auffallen müssen, daß ihre Fingernägel über die Tasten flitzten, aber ich war nun mal ein nervöser, junger … ähm … frischgebackener Vater und habe nicht aufgepaßt. Sie warf einen flüchtigen Blick in den Paß, den ich ihr hingelegt hatte, und tippte noch ein bißchen rum. Der Drucker spuckte ein Blatt Papier aus, auf den sie den Stempel der Gemeinde knallte. Sie faltete es zusammen, schob es in eine Plastikhülle, sah mich strahlend an und sagte: ›Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau und natürlich dem Baby Tonio ein glückliches Wochenbett.‹ Leicht schwindlig von der schnellen Erledigung stand ich kurz danach draußen an der Gracht. Irgendwas stimmte nicht …«
»Adri, ich hab doch gesagt, ich weiß, wie es ausging.«
»Ja, lach du nur. Es betraf in erster Linie dich.«
»Wie konntest du nur …«
»Genau, so was passiert einem als frischgebackenem Vater. Verstand futsch. Ich machte das Mäppchen auf. Van der Heijden, Tonio, geboren am 15. Juni 1988, gemeldet am 16. Juni 1988. Stimmte alles. Die dumme Kuh. Hätte sie bloß nach einem zweiten Vornamen gefragt, dann hätte ich‘s hingekriegt.«
»Warum bist du nicht zurückgegangen? Du hättest doch sagen können: Da muß noch was dazwischen. Rotenstreich. Ohne Bindestrich. Oder, Adri?«
Seine Stimme klang nun weich und kindlich. Jetzt fand er die Geschichte nicht mehr lustig. Seine Hände hatte er in das zusammengerollte Tuch geschoben wie in einen Muff.
»Ich hab mich nicht getraut. Wenn sie diesen sogenannten zweiten Vornamen nachträglich hörten … ich hatte Angst, dann würden sie erst recht argwöhnisch.«
»Pech.«
»Ich mußte erst mal gründlich darüber nachdenken, wie ich weiter vorgehen sollte. Vielleicht doch ein Brief an die Königin.«
»Mama fand es bestimmt nicht so gut.«
»Ich zurück ins Krankenhaus. Auf der Entbindungsstation gab sie dir gerade die Brust. Sie sah mich an mit … du kennst das doch … diesen großen braunen, erwartungsvollen Augen, die so aussehen, als wüßten sie, was passiert. Daß ihr seltener Familienname wieder für mindestens eine Generation gerettet ist.«
Tonio schüttelte langsam den Kopf und schüttelte ihn noch einmal. Wenn ich einen Funken Schadenfreude bei ihm spürte, dann galt sie mir, nicht seiner Mutter.
»Ich hab Mama erzählt, was schiefgelaufen war. Glückliches Wochenbett? Alles andere als ein glückliches Wochenbett.«
»Adri, ich kapier nicht, daß du so blöd sein kannst.«
6
Es wird Zeit, daß ich ihm nachträglich seinen zweiten Namen beschaffe.
Erstes Buch
Schwarzer Pfingstsonntag
KAPITEL I
Hundert Tage
1
Die Türklingel, zweimal: erst kurz und zögernd, dann lang und nachdrücklich.
Das gellende Geräusch jagte den Norwegischen Waldkatzen jedesmal wieder einen fürchterlichen Schreck ein und ließ sie nach allen Richtungen davonstieben, um sich zu retten – ein Grund für Mirjam, an Wochentagen morgens, wenn der Postbote mit einem Päckchen klingeln konnte, die elektrische Klingel oft abzustellen. Die Katzen gingen vor. Heute, am Sonntag, war die Möglichkeit, daß jemand klingelte, so gut wie Null, zumal am frühen Morgen, also hatte sie den Kontakt nicht unterbrochen.
Das erste Klingeln hörte sich an, als habe ein Finger keinen Halt auf dem Knopf gefunden. Für die Katzen noch immer laut genug, die unterste Treppe hinaufzuflitzen. Sogar dort, wo ich mich befand, im Bett im zweiten Stock, konnte ich ihre kräftigen Pfoten auf den Stufen trappeln hören. Wahrscheinlich machten sie in der Treppenbiegung kurz halt, um nach dem zweiten, wesentlich lauteren Klingeln noch schneller nach oben zu rennen. Ihre Krallen kratzten über das Parkett im Flur der ersten Etage, worauf sie mit langen Sätzen die nächste Treppe in Angriff nahmen. Das Trommeln der Pfoten verstummte gleichzeitig mit dem Nachhall der Klingel, so daß Tygo und Tasja irgendwo auf halber Höhe der zweiten Treppe stehen mußten, die Ohren gespitzt, den buschigen Pelz gesträubt, gefaßt auf weitere Gewalt.
2
Pfingstsonntag, 23. Mai 2010. Die Turmuhr der Obrechtkerk hatte kurz zuvor neun geschlagen. Das störende Glockengeläute, das die Gemeindemitglieder zum Gottesdienst rief, würde erst etwas später kommen, um Viertel vor elf. Klassische Sonntagmorgenruhe in Amsterdam Oud-Zuid.
Ich lag auf dem Rücken im Bett. Das Kopfende der Matratze hatte ich mit der Fernbedienung in Leseposition gehoben. Die Vorhänge waren zur Seite geschoben, so daß ich von meinen Kissen aus sehen konnte, welch schöner Frühlingstag uns bevorstand. (Eine Zeitung hatte einen »frühsommerlichen Tag« vorhergesagt.) Die Sonne war noch hinter den hohen Häusern verborgen, doch deren Dachgesimse hoben sich messerscharf gegen einen schon jetzt tiefblauen Himmel ab. Wie sich aus der Struktur des herabströmenden Regens manchmal ableiten ließ, daß er den ganzen Tag lang fallen würde, so verriet der Himmel heute, daß er bis zum Abend wolkenlos sein würde.
Weil die Luft, die durch die halb geöffnete Balkontür ins Schlafzimmer drang, noch kühl war und Gänsehaut auf meinen nackten Schultern erzeugte, hatte ich gerade ein gelbbraun kariertes Holzfällerhemd übergezogen.
Ich las nicht wirklich. Das Buch, in dem ich eine bestimmte Passage hatte suchen wollen, lag, auf meinen Zeigefinger gespießt, auf der Decke. Darin geblättert hatte ich eigentlich nur, um mir das große Wohlbehagen noch bewußter zu machen, das mir an diesem Morgen zuteil wurde. Das reglose Liegen im Bett, der Absatz, der aufgespürt werden sollte, das Zählen der Glockenschläge … das alles diente einem überaus angenehmen Aufschub.
Auf dem langen Sortiertisch in meinem Arbeitszimmer, eine Etage höher, lag für die kommenden hundert Tage ein neuer Arbeitsplan bereit, der am Pfingstmontag in Kraft treten sollte. Danach galt der heutige Tag als Tag Null, der morgige als Tag Eins und der einunddreißigste August als Tag Hundert. Der erste September: Abgabetag.
Jedesmal diese Arbeitseinheiten von hundert Tagen … so ging es schon seit zwanzig Jahren. Aberglaube? Allüren? Zwanghaftes Festhalten an dezimalen Antriebsformen? Von allem etwas, denke ich, und dazu noch so einiges.
Ich hatte durch Zufall entdeckt, daß ein Plan von hundert aufeinanderfolgenden Arbeitstagen (eine großzügig bemessene Zeitspanne und dennoch übersichtlich) wie maßgeschneidert für mich war. Ende ‘89 war ich mit Frau und Kind für ein paar Jahre in die Veluwe gezogen. Ich machte mir weis, für mein neues Buch, das in Amsterdam spielte, sei es gut, für eine Weile auf Abstand zu der Romankulisse zu gehen. Tatsächlich, aber das gab ich nicht zu, hatte ich meine kleine Familie mit dem eineinhalbjährigen Tonio auf dem Land in Sicherheit bringen wollen. Wenn der Kleine alt genug für die Grundschule wäre, würden wir wohl wieder in die Stadt zurückkehren.
Bereits nach wenigen Monaten, im Frühjahr ‘90, gerieten wir in Konflikt mit dem Vermieter, dessen Haus durch eine Glasgalerie mit unserem verbunden war. Die Situation eskalierte zu der Art von psychologischer (und gelegentlich auch physischer) Kriegsführung, derentwillen ich wirklich nicht aus Amsterdam hätte wegziehen müssen. Um mein Buch zu Ende schreiben zu können, das im Herbst ‘90 erscheinen sollte, war ich gezwungen, mich anderweitig nach einem Unterschlupf umzusehen.
Ich entschied mich für De Pauwhof, eine alte Künstler- und Wissenschaftlerkolonie in Wassenaar, wo ich am 23. Juni mit der Endfassung von Der Anwalt der Hähne begann. Am ersten Oktober saß ich mit dem vollständigen Typoskript des verfluchten Buches im Taxi nach Loenen in der Veluwe, wo ich Frau und Kind abholen wollte, um sie nach Amsterdam zurückzubringen. Auf der Rückbank rechnete ich aus, wie lange ich in Wassenaar an der Fertigstellung des Romans gearbeitet hatte. Nulla dies sine linea – dafür hatten Panik und Schuldgefühl schon gesorgt. Ich kam exakt auf hundert Tage, inklusive der Wochenenden. Ein zwingendes Ritual war geboren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!