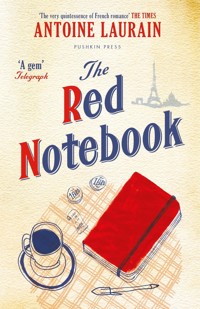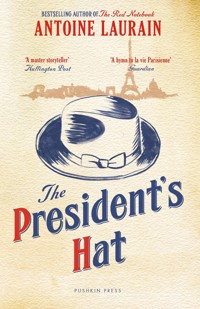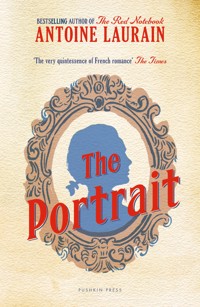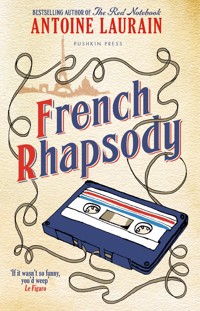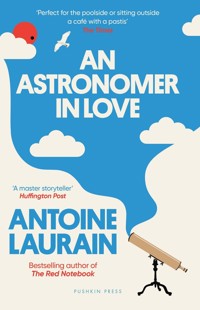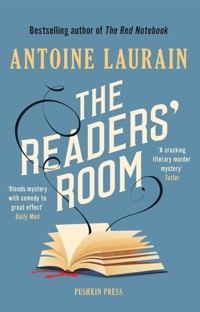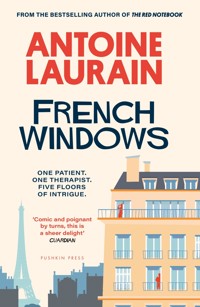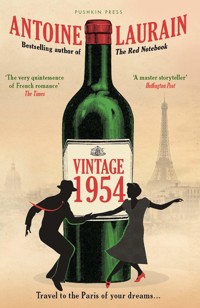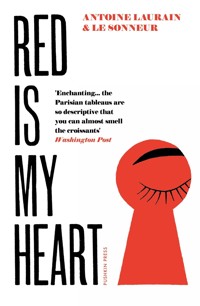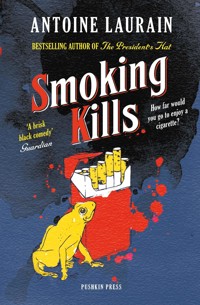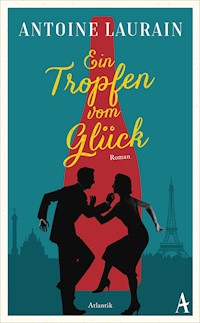Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maître Pierre-François Chaumont, ein brillanter Pariser Anwalt, ist leidenschaftlicher Kunstsammler und lässt sich keine Auktion entgehen. Von einem alten Ölgemälde kann er eines Tages den Blick nicht mehr abwenden: Der dargestellte Mann mit gepuderter Perücke ähnelt ihm wie sein Spiegelbild! Das Porträt soll seine Sammlung krönen und er ersteigert es, aber schon bald wandelt sich das Glücksgefühl in Paranoia, denn Pierre-François fürchtet, verrückt geworden zu sein: Niemand seiner Familie oder Freunde sieht die frappierende Ähnlichkeit. Mithilfe des Wappens findet er jedoch die Familie des Porträtierten - ein altes Adelsgeschlecht, das seit Jahrhunderten auf Schloss Mandragore in der Bourgogne lebt. Heimlich reist Pierre-François dorthin und erlebt eine weitere Überraschung: Jeder scheint ihn zu kennen! Man hält ihn für den seit Jahrzehnten verschollenen Grafen, und Pierre-François belässt es dabei - er kann der Versuchung nicht widerstehen, einfach eine neue Identität anzunehmen und ein neues Leben anzufangen … Antoine Laurain erzählt in seinem Debüt von der Suche nach Identität, sich selbst und dem Glück, und von der Faszination für schöne und alte Dinge, die ihre eigenen Geschichten haben.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antoine Laurain
Das Bild aus meinem Traum
Roman
Aus dem Französischen von Sina de Malafosse
Atlantik
Sic * luceat * lux
IEiner, der Dinge liebte
Am Rande eines Feldes gelegen, fensterlos, ohne funktionierendes Licht. Die etwa Hundert Quadratmeter große Lagerhalle ist aus Blech, im Sommer erwärmen sich die Metallplatten in der Sonne, und die Temperaturen sind kaum noch auszuhalten. Um im Innern für Licht zu sorgen, könnte man eine Lampe an eine der Steckdosen anschließen, aber ich bevorzuge Kerzen.
Ich zünde die zwanzig, die ich in willkürlicher Anordnung aufgestellt habe, eine nach der anderen an. Anschließend rauche ich eine Zigarette und schenke mir ein Glas Whisky ein, das ist mein Ritual. Hinter einem Fass mit Industrieöl habe ich einen exzellenten, noch jungen Bowmore versteckt. Wie alle guten Whiskysorten schmeckt er nach Leder und Torf und ist, anders als diese widerlichen bernsteinfarbenen Cognacs, klar wie Hühnerbrühe. Ich serviere ihn mir in einem Silberbecher im Louis-quinze-Stil, der mich immer, wenn ich vorbeikomme, auf einer alten Holzbank erwartet.
Die großen Blechplatten sind nie gestrichen worden und haben geduldig Rost angesetzt, bis sie diesen besonderen Farbton angenommen haben, den Künstler als »gebranntes Siena« bezeichnen. Ein so kräftiges Braun, dass es fast rot wirkt.
Ich komme ein- bis zweimal im Monat hierher und bleibe zwei Stunden, um meine Sammlung zu bewundern, wie ich es einst in meinem Arbeitszimmer getan habe. Tabakdosen aus Gold oder Schildpatt, schmiedeeiserne Schlüssel mit Griffen in Form von Delphinen oder Chimären, durchsichtige kugelförmige Briefbeschwerer, die für immer ihre vielfarbigen Einsprengsel umschließen, fluoreszierende Salzflakons, geformt aus diesem gelben, Uranglas genannten Kristall, Madonnen mit Elfenbeinschnitzereien aus Dieppe, Haute-Époque-Becher aus Vermeil, und so vieles mehr. Sie sind auf einer ehemaligen Werkbank angeordnet, wo ich auch ein Regal mit mehreren Fächern aufgebaut habe. In jedes von ihnen habe ich ebenfalls kleine Dinge gestellt, es sind vierundzwanzig. Es erinnert mich ein wenig an die Adventskalender, die ich als Kind hatte. Hinter jedem Türchen gab es ein kleines Fach mit einer Überraschung aus Plastik. Tag für Tag, Überraschung um Überraschung rückte Weihnachten, der große Geschenkeabend, näher.
Alle Geschenke, die ich mir im Laufe meines Sammlerlebens gemacht habe, sind hier vereint. Hier in meinem Kuriositätenkabinett, vor den Blicken anderer verborgen, so wie es solch ein geheimer Ort voller fabelhafter Dinge, die eifersüchtig von ihrem einzigen Herrn bewacht werden, zu sein hat. Mit seiner Lage am Feldrand ist es das merkwürdigste aller Kuriositätenkabinette. Mitten im Burgund, da, wo nicht einmal Handys klingeln.
Die sommerliche Hitze drückt schwer, und die Strohballen, die seit Jahrzehnten bis unters Dach der Halle gestapelt stehen, sind so trocken, dass sie von einem Augenblick auf den anderen plötzlich Feuer fangen können. Oben rechts steht, auf Säcken mit verdorbenem Dünger, mein Porträt, darauf ein Wappen. Heute ahne ich, was wirklich mit diesem Bild geschehen ist.
Ich setze mich nun auf einen kleinen Rattanstuhl, trinke den ersten Schluck Whisky und stelle dann mit lauter Stimme meine übliche Frage, bei der ich jedes Mal lächeln muss: »Pierre-François Chaumont, bist du da? Ein Schlag, ja, zwei Schläge, nein.« Dann stelle ich meinen Silberbecher schwungvoll auf die Bank, das aufschlagende Metall gibt die Antwort.
Alles begann vor etwas mehr als einem Jahr. Weit weg vom Burgund, in Paris.
Es waren die letzten Frühlingstage, und seit ein paar Wochen wagte ich eine schüchterne Ausweitung in Richtung Wohnzimmer. Meine wundervollen Sammlungen waren Jahr um Jahr von meiner Frau in einen einzigen Raum der Wohnung verbannt worden. Im sogenannten »Arbeitszimmer« lagerte ich alle meine Schätze. Ich hatte – die feindlichen Linien überschreitend – erneut ein paar Saint-Louis-Briefbeschwerer auf dem Couchtisch arrangiert. Erst kurz zuvor hatte ein dramatischer Zwischenfall den Sturz einer Kristallglaskugel aus Baccarat verursacht, die an der Kante eines Mörsers aus Bronze zerbrochen war. Die zweitausend Euro für die Kugel hatten sich in nichts aufgelöst. Der finanzielle Aspekt hatte Charlotte dazu bewogen, einen Sicherheitsbereich für die anderen Kugeln zu genehmigen. Wir hatten uns auf den Couchtisch geeinigt.
Am darauffolgenden Tag hatte ich meine zwei weinroten Vasen von Gallé geholt, »Nachtfalter« genannt, und sie unter dem missbilligenden Blick meiner Frau auf beide Seiten des Kamins gestellt.
»Wenn sie kaputt gehen, kostet uns das hunderttausend Mäuse«, hatte ich verkündet, damit jede ungewollte Bemerkung abgewehrt und mich in die Zeiten des Francs zurückversetzt, damit der bereits übertriebene Betrag sie noch mehr beeindruckte.
Das finanzielle Argument hatte gefruchtet, und ich hatte mich gefragt, ob ich nicht den Wert weiterer Gegenstände anheben sollte, um sie erneut ins Wohnzimmer stellen zu dürfen.
Es war einige Zeit her, dass ich zuletzt bei Drouot war, um meine Hand zum Gebot zu heben. Auktionen hinterlassen ein Gefühl der Trunkenheit, wie es kein alkoholisches Getränk vermag, und, im Gegensatz zum Kasino, hat man, wenn man verliert, trotzdem den Eindruck, ein wenig gewonnen zu haben: Das Geld, das man für das Objekt vorgesehen hatte, das einem gerade entgangen ist, geht wie von Zauberhand wieder auf dem Konto ein, da man es ja unbewusst schon ausgegeben hatte. Man hat also den Eindruck, reicher aus dem Auktionshaus hinauszugehen, als man hineingegangen ist. Was das betraf, spielte ich manchmal mit dem Gedanken, mir den Zutritt zum Auktionshaus Drouot verbieten zu lassen, wie manche Spieler es von Kasinos fordern. Ich stellte mir einen Mann mit einem guten Personengedächtnis vor, groß und stark, gekleidet wie die Portiere vor Luxushotels. Er würde alle Neugierigen vorbeigehen lassen, um dann den Arm nach mir auszustrecken.
»Maître Chaumont«, würde er in höflichem, aber bestimmtem Ton sagen.
»Sorry, I think it’s a mistake, my name is Smith, Mister Smith …«, würde ich hinter meiner schwarzen Brille und meinem großen Schal antworten.
»Das bringt nichts, Maître Chaumont, wir haben Sie erkannt. Gehen Sie.«
Einige Stunden später würde ich mit blond gefärbten Haaren wiedergekommen. Kaum hätte ich mich genähert, würde der Mann die Augen schließend mit dem Kopf schütteln. Nie wieder würde ich einen Fuß über die Tür des Auktionssaals setzen.
Seit einigen Wochen beschäftigte ich mich in der Kanzlei ausschließlich mit dem Durit BN-657. Als bedeutendes Element in der Formel-1-Motorenentwicklung trug dieser kleine Schlauch seinem Erfinder zufolge den zukünftigen Schumacher, Häkkinen oder Alonso in sich. Zwei Rennställe stritten sich um die Urheberschaft des Durits, wobei ihn jeder seiner Entwicklungsabteilung zuschrieb, und die Kanzlei Chaumont-Chevrier wurde zu Hilfe gerufen. Finanziell stand nicht wenig auf dem Spiel, und Chevrier hatte eine recht gewöhnliche Sache, in der es um das Plagiat eines Firmenlogos ging, vorläufig auf Eis gelegt, um mich beim Durit zu unterstützen.
An einem Mittag gönnte ich mir, während er sich die Akte anschaute, eine Pause, wie ich sie liebte, und flanierte durch die Ausstellungsräume von Drouot. Die Kanzlei befand sich fünfzig Meter vom Auktionshaus entfernt, was bei der Entscheidung für die Räumlichkeiten ausschlaggebend gewesen war. Nachdem ich schnell ein belegtes Brötchen verschlungen und eine Limonade getrunken hatte, trat ich in die Halle. Flüchtig beobachtete ich eine asiatische Auktion. Sie umfasste nur einen erotischen Druck, auf dem man eine Frau bei einer intimen Begegnung mit einem gigantischen Tintenfisch erkennen konnte. Da ich mich wenig für Zoophilie und Kephalopoden begeisterte, ging ich bald meiner Wege.
Der erste Stock quoll über vor Porzellanfiguren und Kommoden aus Rosenholz. Es gab auch eine Waffenauktion, die Neugierige und Fachleute für Schwarzpulver und Feuersteine anzog. Ich ging weiter ins Untergeschoss. Die Auktionen hier stehen stets weniger hoch im Kurs als die im ersten Stock, aber man hat mir von gewissen Leuten erzählt, die davon leben, im Untergeschoss etwas zu kaufen, um es wenige Monate später im ersten Stock wieder zu verkaufen.
Ich schlenderte durch einen Raum, in dem eine Philatelie-Auktion ausgestellt war. Mein Blick verlor sich in den bunten Federn tropischer Vögel, in den Seen Italiens und den Profilen der Heilsbringer verschiedener Länder. Da ich keine besondere Vorliebe für Briefmarken hatte, zog es mich in den benachbarten Raum weiter, wo die Taxidermie im Mittelpunkt stand. Vom Kolibri bis zum Zebra war geradezu die gesamte Fauna vertreten. Ein Ameisenbär zog meine Aufmerksamkeit auf sich, doch der Einzug dieses großen Insektenliebhabers in unsere Wohnung hätte mit Sicherheit für weitere Missstimmung in meiner Ehe gesorgt. Und doch hätte ich alle ausgestopften Tiere kaufen und in den Zimmern verteilen können, die Konsequenzen wären weniger erschütternd gewesen als das, was folgen sollte.
Mit resigniertem Schritt und müden Augen trat ich in Saal 8. Schränke, Buffets, Konsolen und Spiegel stapelten sich bis zur Decke. Es roch nach Rumpelkammer, nach Dachbodenmobiliar ohne Stil und Wert. Ich ging weiter, schritt günstige Ziergegenstände und einige alte Schinken ab, die an den Wänden hingen, als ich es sah.
Sechzig mal vierzig Zentimeter. Ein Pastellbild aus dem 18. Jahrhundert im Originalrahmen. Ein Mann mit gepuderter Perücke und blauem Anzug. Oben rechts ein unentzifferbares Wappen. In diesem Augenblick war es jedoch nicht das Wappen, das meine Aufmerksamkeit erregte, sondern das Gesicht. Ich war wie versteinert, konnte meinen Blick nicht mehr abwenden: Dieses Gesicht, das war meins.
Dieses Porträt von mir, das zweieinhalb Jahrhunderte zuvor angefertigt worden war und nun in meinem sechsundvierzigsten Lebensjahr auftauchte, war der Wendepunkt eines vor langer Zeit begonnenen Anhäufens von Dingen. Jahr um Jahr, Gegenstand um Gegenstand, Rechnung um Rechnung, bis zu diesem späten Vormittag im Saal 8 des Auktionshauses Drouot. Ich muss ganz an den Anfang meines Lebens als Sammler zurückkehren, zum ersten Kauf. Ich war neun Jahre alt und als guter Anwalt, der etwas auf sich hält, würde ich diesen Moment meines Daseins als den »Radiergummi-Fall« bezeichnen.
Arthur, der alte Basset artésien der Familie, verstarb im Schlaf an einem Herzinfarkt. Zwei Wochen später kaufte meine Mutter einen identischen Hund, der sich zu jener Zeit nur durch seine geringe Größe von seinem Vorgänger unterschied. Ich empfand diese Wiederholung als geschmacklos, als echten Affront gegen die Erinnerung an den ersten Hund. Als Variation zu dem Basset artésien hatte ich den Kauf eines schwarzen Dobermanns angeregt, ich ging sogar so weit, einen Namen vorzuschlagen: »Sorbonne«, als Hommage an den Hund, der als Begleiter von Jean Rochefort in Angélique auftrat, ein Film, den ich mit Begeisterung in den Osterferien gesehen hatte. Diese Anregung fand keinerlei Zuspruch, und meine Eltern trieben es mit ihrem chronischen Mangel an Vorstellungskraft so weit, dass sie dem neuen Hund denselben Namen gaben wie seinem Vorgänger.
Einige Zeit später schleppte mich meine Mutter zu einem dieser Einkaufsnachmittage mit, die sie so mochte. Ihr bevorzugter Zufluchtsort war der Old-English-Laden auf den Grands Boulevards, ein luxuriöses und altmodisches Markengeschäft, in dem sie mir beharrlich graue Flanellhosen und marineblaue Blazer kaufte. Daher stammt sicherlich meine Abscheu vor Mausgrau und dunklem Blau. Für alles Gold der Welt könnte man mich heute nicht dazu zwingen, eine Jacke in diesem Blau zu tragen, und ich ginge lieber in Unterhosen ins Büro als in einer grauen Hose. Zu jener Zeit träumte ich nur von Jeans, aber der Denimstoff stand in meiner Privatschule noch auf der Verbotsliste. Nachdem sie mich gequält und mit diesen Luxusfetzen eingekleidet hatte, die ein gutes halbes Jahrhundert hinter der Zeit zurück waren, führte meine Mutter ihre Einkäufe in den großen Warenhäusern fort. Sie probierte zahlreiche Kostüme an, die sie nie überzeugten. Wir gingen runter in die Schreibwarenabteilung, das Schuljahr hatte begonnen und der Inhalt meines Mäppchens musste erneuert werden. Meine Mutter kaufte mir ein gelbes Radiergummi, das nach Banane roch und auf dem der Kopf eines Dobermanns gedruckt war, der die Zunge rausstreckte. Ohne Zweifel würden einige von Freuds Nachahmern darin einen aufschlussreichen Akt sehen: Meine Mutter kaufte mir ein Radiergummi mit dem Bildnis des Hundes, den ich gefordert hatte, damit ich jede Spur dieses ungestillten Wunsches aus meinem Gedächtnis radierte. Ich selbst sah darin nur ein sehr hübsches, parfümiertes Radiergummi. Ein schöner Gegenstand, den ich keineswegs vorhatte zu benutzen. Am darauffolgenden Tag, als ich aus dem Unterricht kam, machte ich mich auf die Suche nach einem zweiten parfümierten Radiergummi mit dem Kopf eines Hundes. In einer kleinen Papeterie auf dem Schulweg fand ich ein grünes mit dem Kopf eines Huskys. Es roch nach Apfel.
Am selben Abend schrieb ich in mein Tagebuch: »Eine Sammlung beginnt mit zweien, wenn man auf der Suche nach dem dritten ist.«
Um diesen Satz würde mein Leben zukünftig kreisen.
Onkel Edgar beschämt mich«, sagte meine Mutter gewöhnlich mit einem Seufzer, und meinte damit den Bruder ihres Vaters. Mein Vater fügte seinerseits einen gewollt unverständlichen Satz hinzu, dessen einziges halbwegs erkennbares Wort so etwas wie »schwül« war. Ich brauchte etliche Jahre, um zu verstehen, warum dieses Adjektiv der Wetterkunde dem so sonnigen Onkel Edgar zugewiesen wurde, den ich leider nur ein- oder zweimal im Jahr sah.
»Du, mein Kleiner, du bist sehr viel klüger als deine Eltern«, hatte Onkel Edgar eines Tages in vertraulichem Ton zu mir gesagt.
Ich war mit ihm im Wohnzimmer geblieben, während meine Mutter hinausgegangen war, um etwas zum Knabbern für den Aperitif zu holen. Ich erinnere mich, wie ich Onkel Edgar, der schon fast fünfundsiebzig war, in die wasserblauen Augen geschaut hatte. Mein Blick war über seine perfekt rasierte Wange und den merkwürdig schildpattfarbenen Teint gewandert, der sein ganzes Gesicht überzog. Mein Vater hatte diesen Teint nicht. Mit meiner Kinderhand hatte ich mich dem alten Gesicht genähert und die Wange des Onkels berührt. Auf meine Fingerspitzen hatte sich ein feiner hautfarbener Puder gelegt, der ähnlich glänzte wie der, den das Hausmädchen Céline vor dem Spiegel in der Küche auftrug.
Auch meine Mutter benutzte wohl Make-up, aber ich habe sie sich nie schminken sehen. Sie schloss sich im Badezimmer ein, um dieses Ritual zu vollziehen, das die Männer und kleinen Jungen, die sie alle geblieben waren, faszinierte. Nur Céline erlaubte mir zuzuschauen, wenn sie Puder und Lidschatten auflegte.
Meine Augen hatten wieder die des Onkels gesucht, und wie unter denen von Céline war eine feine blaue Linie zu sehen gewesen, die die Farbe der Iris hervorhob. Mein Onkel hatte mich zärtlich betrachtet, ein verschwörerisches und trauriges Lächeln war auf seinem Gesicht erschienen.
»Wenn du groß bist, wirst du es verstehen«, hatte er gemurmelt.
Meine Mutter war mit einem Teller trockener Plätzchen zurückgekommen, ich hatte die Finger geschlossen und sie möglichst unauffällig am Handballen gerieben, um das Geheimnis des Onkels zu tilgen, der sich schminkte wie eine Frau.
Onkel Edgar hatte die Angewohnheit, aus seinen Taschen Dinge hervorzuholen, eines erstaunlicher als das andere, und sie auf wunderbare Weise zu beschreiben. Seine zärtliche, gezierte Stimme habe ich Jahre später wiederentdeckt, als ich zufällig eine Wiederholung französischer Schwarz-Weiß-Filme im Kabelfernsehen sah. Ein Nebendarsteller war meinem Onkel in Gestalt, Stimme und Art zum Verwechseln ähnlich: der Schauspieler Jean Tissier. Unter den besorgten Blicken meiner Eltern hielt Onkel Edgar mir die Gegenstände hin und forderte mich auf, sie zu betrachten, und zwar »mit Intelligenz und Logik, mein Junge«. Zündholzhalter, kleine Necessaires, Taschenspiegel, Fächer, Puderdosen, Süßigkeitenschatullen, Tabakdosen, jedes dieser Dinge hielt ein unerwartetes Geheimnis bereit – eine verborgene Mechanik, einen doppelten Boden, andere versteckte Funktionen, die mich als kleinen Jungen bezauberten. Ich hatte wiederholt den Wunsch geäußert, Onkel Edgars Sammlungen anzuschauen, doch dies stieß systematisch auf ein kategorisches elterliches Nein.
Edgar-der-Schwüle kam mit Artikeln über Ballettaufführungen über die Runden, seine Ode an »den grazilen Spann schöner Jünglinge beim Spitzentanz« hat ihn bekannt gemacht. Edgar-der-Sammler plünderte seit über fünfzig Jahren Flohmärkte und Kunstauktionen. Er gehörte zum armen Teil der Familie und leerte sein Bankkonto für Antiquitäten und diverse Gigolos. Mit fortschreitendem Alter schmolzen seine Ersparnisse dahin.
Bei meiner letzten Begegnung mit Onkel Edgar hatte er aufmerksam meine Radiergummisammlung betrachtet, die inzwischen fünfundneunzig Exemplare und zahlreiche Varianten zählte, darunter nunmehr Autos, Menschen und Pflanzen. Mein liebstes Radiergummi war mit einer riesigen Bohne verziert und roch nach etwas schwer Definierbarem, was ich mit den Jahren jedoch süßen Fenchel taufte. In seinem schwarzen umhangartigen Mantel, ohne den er niemals ausging, und mit seiner Größe von einem Meter neunzig hatte er sehr ernst auf mich herabgesehen.
»Wenn du ein echter Sammler werden willst, musst du eines verstehen: Die Dinge, die echten Dinge«, hatte er mit gehobenem Zeigefinger betont, »bewahren die Erinnerung derjenigen, die sie besessen haben.«
Ich hatte ihn, ein wenig nach hinten gebeugt und leicht eingeschüchtert durch diese feierliche Erklärung, angesehen.
»Verstehst du?«, hatte er nachgehakt.
Ich hatte genickt.
»Was hast du verstanden?«, hatte Onkel Edgar gelacht, während er sich hinkniete, um mit mir auf einer Höhe zu sein.
»Wenn sie alt sind …«, hatte ich gemurmelt.
»Sprich weiter, mein Junge … Wenn sie alt sind …«
»… bewahren sie Seelen«, hatte ich schnell gesagt, ohne den Blick von den blauen Augen meines Onkels zu lassen.
Dieser hatte aufgehört zu lächeln und mich mit größtem Respekt gemustert. Unmerklich hatte er mit dem Kopf genickt, was ich als Bewunderung verstanden hatte, aber noch mehr war – Anerkennung.
Am nächsten Tag verkaufte ich meine gesamte Radiergummisammlung für die horrende Summe von 500