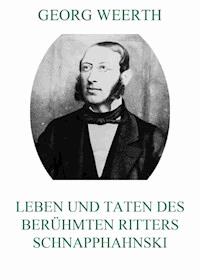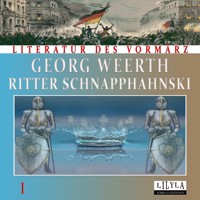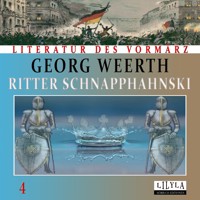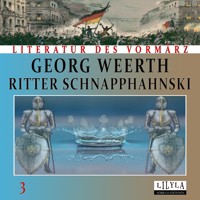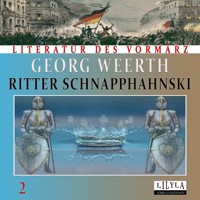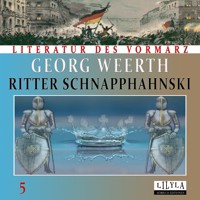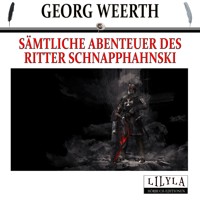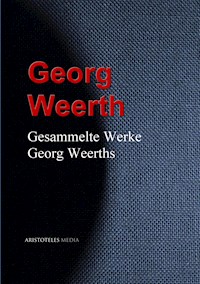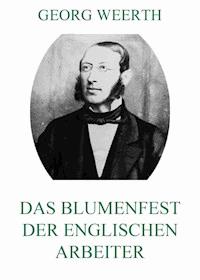
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im "Blumenfest" findet der Leser eine hochkarätige Sammlung der schönsten literarischen Skizzen des deutschen Schriftstellers und Satirikers.
Das E-Book Das Blumenfest der englischen Arbeiter wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Blumenfest der englischen Arbeiter
Georg Weerth
Inhalt:
Georg Weerth, der erste und bedeutendste Dichter des deutschen Proletariats
Das Blumenfest der englischen Arbeiter
Humoristische Skizzen aus dem deutschen Handelsleben
I - Der Lehrling
II - Der Korrespondent
III - Der Buchhalter
IV - Ein verschlissener Kommis
V - Der Reisende, wie er sein soll
VI - Der Reisende, wie er ist
VII - Der Makler
VIII - Die Spekulation
IX - Sassafraß
X - Der Herr Preiss in Nöten
XI - Der Buchhalter Lenz als Bürgergardist
XII - Wie sich der Herr Preiss nach den Zeitverhältnissen richtet
XIII - Der Herr Preiss über die Dinge im allgemeinen
XIV - Das Dasein des Herrn Preiss gewinnt eine welthistorische Bedeutung
Das Blumenfest der englischen Arbeiter, G. Weerth
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849639549
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Georg Weerth, der erste und bedeutendste Dichter des deutschen Proletariats
Aus: "Der Sozialdemokrat" Nr. 24 vom 7. Juni 1883
Handwerksburschenlied
Von Georg Weerth (1846)
Wohl um die Kirschenblüte
Da haben wir logiert,
Wohl um die Kirschenblüte
In Frankfurt einst logiert.
Es sprach der Herbergsvater:
"Habt schlechte Röcke an!"
"Du lausiger Herbergsvater,
Das geht Dich gar nichts an!
Gib uns von Deinem Weine,
Gib uns von Deinem Bier;
Gib uns zu Bier und Weine
Auch ein gebraten Tier."
Da kräht der Hahn im Spunde -
Das ist ein guter Fluß.
Es schmeckt in unsrem Munde
Als wie Urinius.
Da bracht' er einen Hasen
In Petersilienkraut,
Vor diesem toten Hasen
Hat es uns sehr gegraut.
Und als wir waren im Bette
Mit unsrem Nachtgebet,
Da stachen uns im Bette
Die Wanzen früh und spät.
Das ist geschehn zu Frankfurt,
Wohl in der schönen Stadt,
Das weiß, der dort gelebet
Und dort gelitten hat.
Dieses Gedicht unseres Freundes Weerth habe ich unter dem Nachlaß von Marx wieder aufgefunden. Weerth, der erste und bedeutendste Dichter des deutschen Proletariats, war von rheinischen Eltern in Detmold geboren, wo sein Vater geistlicher Superintendent war. Als ich mich 1843 in Manchester aufhielt, kam Weerth als Kommis seiner deutschen Firma nach Bradford, und wir verbrachten viele heitere Sonntage zusammen. 1845, als Marx und ich in Brüssel wohnten, übernahm Weerth die kontinentale Agentur seines Handlungshauses und richtete es so ein, daß er sein Hauptquartier ebenfalls in Brüssel nehmen konnte. Nach der 1848er Märzrevolution fanden wir uns alle in Köln zur Gründung der "Neuen Rheinischen Zeitung" zusammen. Weerth übernahm das Feuilleton, und ich bezweifle, ob je eine andere Zeitung ein so lustiges und schneidiges Feuilleton hatte. Eine seiner Hauptarbeiten war: "Leben und Thaten des berühmten Ritters Schnapphahnski", die Abenteuer des von Heine im "Atta Troll" so benamsten Fürsten Lichnowski schildernd. Die Tatsachen sind alle wahr; wie wir sie erfuhren, darüber vielleicht ein andermal. Diese Schnapphahnski-Feuilletons sind 1849 bei Hoffmann u. Campe gesammelt als Buch erschienen und noch heute äußerst erheiternd. Da aber Schnapphahnski-Lichnowski am 18. September 1848 mit dem preußischen General von Auerswald (ebenfalls Parlamentsmitglied) die den Frankfurter Barrikadenkämpfern zuziehenden Bauernkolonnen spionieren ritt, bei welcher Gelegenheit er und Auerswald von den Bauern verdientermaßen als Spione totgeschlagen wurden, richtete die deutsche Reichsverweserschaft eine Anklage gegen Weerth wegen Beleidigung des toten Lichnowski, und Weerth, der längst in England war, bekam drei Monate Gefängnis, lange nachdem die Reaktion der "N.Rh.Ztg." ein Ende gemacht hatte. Diese drei Monate hat er denn auch richtig abgesessen, weil seine Geschäfte ihn nötigten, Deutschland von Zeit zu Zeit zu besuchen.
1850/51 reiste er im Interesse einer anderen Bradfordcr Firma nach Spanien, dann nach Westindien und über fast ganz Südamerika. Nach einem kurzen Besuch in Europa kehrte er nach seinem geliebten Westindien zurück. Dort wollte er sich das Vergnügen nicht versagen, das wirkliche Original des Louis-Napoleon III., den Negerkönig Soulouque auf Haiti, einmal anzusehen. Aber er bekam, wie W. Wolff, 28. August 1856, an Marx schreibt, "Schwierigkeiten mit den Quarantäne-Behörden, mußte sein Projekt aufgeben und sammelte auf der Tour die Keime zu dem (gelben) Fieber, das er mit nach Havanna brachte. Er legte sich nieder, eine Gehirnentzündung trat hinzu und - am 30. Juli - starb unser Weerth in Havanna."
Ich nannte ihn den ersten und bedeutendsten Dichter des deutschen Proletariats. In der Tat sind seine sozialistischen und politischen Gedichte denen Freiligraths an Originalität, Witz und namentlich an sinnlichem Feuer weit überlegen. Er wandte oft Heinesche Formen an, aber nur, um sie mit einem ganz originellen, selbständigen Inhalt zu erfüllen. Dabei unterschied er sich von den meisten Poeten dadurch, daß ihm seine Gedichte, einmal hingeschrieben, total gleichgültig waren. Hatte er eine Abschrift davon an Marx oder mich geschickt, ließ er die Verse liegen und war oft nur schwer dazu zu bringen, sie irgendwo drucken zu lassen. Nur während der "Neuen Rheinischen Zeitung" war das anders. Warum, zeigt folgender Auszug eines Briefes von Weerth an Marx, Hamburg, 28. April 1851:
"Übrigens hoffe ich Dich Anfang Juli in London wiederzusehen, denn ich kann diese grashoppers (Heuschrecken) in Hamburg nicht länger ertragen. Es droht mir hier eine glänzende Existenz, aber ich erschrecke davor. Jeder andere würde mit beiden Händen zugreifen. Aber ich bin zu alt, um ein Philister zu werden, und jenseit der See liegt ja der ferne Westen ...
Ich habe in der letzten Zeit allerlei geschrieben, aber nichts beendigt, denn ich sehe gar keinen Zweck, kein Ziel bei der Schriftstellerei. Wenn Du etwas über Nationalökonomie schreibst, so hat das Sinn und Verstand. Aber ich? Dürftige Witze, schlechte Spaße reißen, um den vaterländischen Fratzen ein blödes Lächeln abzulocken - wahrhaftig, ich kenne nichts Erbärmlicheres! Meine schriftstellerische Tätigkeit ging entschieden mit der 'Neuen Rheinischen Zeitung' zugrunde.
Ich muß gestehen: so leid es mir tut, die letzten drei Jahre für nichts und wieder nichts verloren zu haben, so sehr freut es mich, wenn ich an unsere Kölner Residenz denke. Wir haben uns nicht kompromittiert. Das ist die Hauptsache! Seit Friedrich dem Großen hat niemand das deutsche Volk so sehr en canaille behandelt wie die 'Neue Rheinische Zeitung'.
Ich will nicht sagen, daß dies mein Verdienst war; aber ich bin dabei gewesen ...
O Portugal! O Spanien!" (W. kam gerade dorther.) "Hätten wir nur deinen schönen Himmel, deinen Wein, deine Orangen und Myrthen! Aber auch das nicht! Nichts als Regen und lange Nasen und Rauchfleisch!
Bei Regen mit langer Nase
Dein G. Weerth."
Worin Weerth Meister war, worin er Heine übertraf (weil er gesunder und unverfälschter war) und in deutscher Sprache nur von Goethe übertroffen wird, das ist der Ausdruck natürlicher, robuster Sinnlichkeit und Fleischeslust. Manche der Leser des "Sozialdemokrat" würden sich entsetzen, wollte ich die einzelnen Feuilletons der "Neuen Rhein. Zeitung" hier abdrucken lassen. Es fällt mir jedoch nicht ein, dies zu tun. Indes kann ich doch die Bemerkung nicht unterdrücken, daß auch für die deutschen Sozialisten einmal der Augenblick kommen muß, wo sie dies letzte deutsche Philistervorurteil, die verlogene spießbürgerliche Moralprüderie offen abwerfen, die ohnehin nur als Deckmantel für verstohlene Zotenreißerei dient. Wenn man z.B. Freiligraths Gedichte liest, so sollte man wirklich meinen, die Menschen hätten gar keine Geschlechtsteile. Und doch hatte niemand mehr Freude an einem stillen Zötlein, als gerade der in der Poesie so ultrazüchtige Freiligrath. Es wird nachgerade Zeit, daß wenigstens die deutschen Arbeiter sich gewöhnen, von Dingen, die sie täglich oder nächtlich selbst treiben, von natürlichen, unentbehrlichen und äußerst vergnüglichen Dingen ebenso unbefangen zu sprechen wie die romanischen Völker, wie Homer und Plato, wie Horaz und Juvenal, wie das Alte Testament und die "Neue Rheinische Zeitung".
Übrigens hat Weerth auch minder anstößige Sachen geschrieben, und von diesen werde ich mir die Freiheit nehmen, von Zeit zu Zeit einiges dem Feuilleton des "Sozialdemokrat" zuzuschicken.
F. Engels
Das Blumenfest der englischen Arbeiter
Die alte Turmglocke rief eben mit vernehmlicher Stimme, daß es 8 Uhr sei, und die sinkende Sonne setzte hinzu: »8 Uhr abends« – da klopfte es recht tüchtig an meine Tür; und herein trat Freund Jackson.
Ein stattlicher Mann, etwa vierzig oder fünfundvierzig Jahre alt. Er trug ungeheuer große Schuhe, mit Nägeln beschlagen, die Sohle einen Zoll dick. Ferner weiße baumwollene Strümpfe, die bis ans Knie reichten und sich dort in einer braunen Manchesterhose verliefen. Die grüne Weste stand ihm vortrefflich, noch besser aber der schon etwas abgetragene schwarze Frack, mit einer roten Tulpe im Knopfloch. Jackson behielt den Hut auf dem Kopf und die Hände in den Hosentaschen.
»Trinkt Ihr gerne Punsch?« fragte er mich und »Liebt Ihr die Blumen?« und »Wollt Ihr mit in die ›Alte Hammelsschulter‹ gehen?« – Die »Alte Hammelsschulter « ist aber eine Schenke am Abhange des nächsten Hügels.
Zu allem war ich bereit, und rasch eilten wir die Gasse hinunter. Um 8 Uhr abends auf den Gassen – in einer Fabrikstadt!
Da kann man vielerlei sehen.
Rechts und links öffnen sich die großen Türen der Magazine, der Werkstätten, der Fabriken, und in einem Augenblick sind die sonst so stillen Straßen voll von heimkehrenden Arbeitern. Man denke sich aber keine lustige Menge, die nach geschehener Arbeit jubelnd ins Freie stürzt, gleich einer Bande ausgelassener Jungen, die, der Schule und dem Stock des Magisters entlaufen, hurtig der Freude den Zügel schießen läßt – nein, die Knaben und Mädchen der Fabriken schleichen stumm und traurig ihrer Freiheit entgegen, denn ein Tag der angestrengtesten Arbeit hat ihre Füße gelähmt, ihre Arme zerschlagen, ihren Sinn verwirrt, und wie ein Alp reitet die Müdigkeit auf ihren armen Seelen. – Und nun die Männer und Frauen! Tiefer Ernst liegt auf ihren Gesichtern; und die Gesichter sind dunkel, schmutzig; nur hin und wieder hat ein voller, schwerer Schweißtropfen, der über Stirn und Wangen rieselte, eine weiße Straße in das staubige Antlitz gefurcht. Die Männer sprechen miteinander – keiner sieht den ändern dabei an –, die Köpfe sind gesenkt, und die Augen starren auf das Pflaster der Gassen.
So wandern sie vorwärts. Vielleicht werfen sie einen Blick auf die Pracht der Kaufläden, in denen eben beim Glanz von tausend Lichtern alle Wunder der Industrie zu schimmern anfangen. O die prächtigen Tücher, die feinen Spitzen, die schweren Atlasstoffe! Wie das flimmert und blitzt! Und dort die goldenen Uhren, die silbernen Schüsseln und die weichen Sessel, und drei Schritte weiter: wie es dort dampft und duftet! Da nicken die gebratenen Tauben zum Fenster hinaus, und rechts und links freundliche Rinderkeulen und Enten und ander verstorbenes Federvieh bescheiden im Hintergrund, in reizenden Gruppen. O schmackhafte Welt! O du zerlumpter, hungriger Arbeiter! – Rasch schreitest du vorüber. Die seidenen Tücher wehen – nur nicht für dich. Die Schüsseln blitzen – nur nicht für dich! Und Tücher und Schüsseln hast du doch selbst geschaffen – und einer gebratenen Ente ist es einerlei, ob sie im Magen eines Schurken oder eines ehrlichen Mannes begraben wird.
Dort an der Straßenecke stockt plötzlich der Zug der Vorübergehenden. Die Vordern bleiben stehen; die Folgenden müssen ebenfalls halten, und bald stehen Männer, Weiber und Kinder in einem dichten Haufen zusammen.
Aller Augen richten sich nach einem Anschlagzettel, der von der Wand des nächsten Gebäudes herunterhängt.
Es wird sehr still in dem ganzen Kreise. Da, mit einem Male entsteht ein Murmeln. Der größte Teil der Arbeiter kann nicht lesen – die Gelehrteren teilen ihren Kameraden daher den Inhalt des Plakats mit. Das Murmeln wird immer lauter; Männer und Kinder sprechen durcheinander, die Weiber flüstern und machen bedenkliche Gesichter. Manche der Lauschenden setzen ihre Töpfe oder Körbe, in denen sie das Mittagessen, den Tee oder Kaffee mit sich führten, zur Erde; und hin und wieder ballt sich eine kräftige Hand zur drohenden Faust; auch die Augen werden lebendiger – sie blitzen, sie leuchten, –, man sieht, die Leidenschaft zieht plötzlich in jede Brust ein – spät am Abend setzt sie die Geister jener Müden noch einmal in Flammen.
Wehe, wenn diese Geister erst zu vollem Bewußtsein erwachen! Es rollt ein düstrer Fluch von Mund zu Mund – dann ein Lachen – Zorn und Spott zuckt durch die bleichsten, die ältesten Gesichter – der Haufe stiebt auseinander. Wovon sprach wohl jener Anschlagzettel? – Jackson machte ganz gewaltige Schritte. In Zeit von zehn Minuten hatten wir schon die dumpfige Stadt hinter uns. Die dumpfige Stadt! Ewig eingehüllt in den dichtesten Kohlendampf, so daß man eine halbe Meile von den ersten Häusern auch kein Dach bemerkt. Nur am Sonntag wird es plötzlich hell, oben über der Stadt; aber nicht in den hunderttausend Köpfen da unten!
An jenem Abend aber, der kein Sonntagabend war, spien ein paar Hundert schlanke Fabrikschornsteine ihren letzten Rauch gen Himmel. Wir konnten daher schon von der Hälfte des Hügels aus fast kein Haus unten im Tale unterscheiden. Unten totale Finsternis, oben auf den Hügeln aber der herrlichste Abend!
Das Grün der Felder leuchtete in den letzten Strahlen der Sonne, in den Büschen wurden die Vögel noch einmal lebendig, dazu stürzten sich die Bäche rauschend in die Tiefe hinab und blitzten und funkelten, daß meinem Freund Jackson vor lauter Lust und Vergnügen die Augen schier übergingen – ach, und der große Yorkshire-Mann fing an zu singen, plötzlich, und brüllte – o Jackson! Da standen wir vor der Schenke »Zur alten Hammelsschulter«. In dieser Schenke hielten die Arbeiter eines gewissen Bezirkes der Grafschaft York ihr erstes diesjähriges Blumenfest.
Mit diesen Blumenfesten verhält es sich aber folgendermaßen.
Jeder Arbeiter, der aus dem Schmutz der Städte, aus dem Rauch der Fabriken, aus dem Dunst der Branntweinstuben – aber auch aus den Wogen einer Volksversammlung, aus der Wut einer Emeute [*Satzfehler? Hier würde "Meute" passen] den zarten Sinn, die Liebe zu einer Blume rettete, sucht entweder neben seiner Wohnung oder in dem Garten irgendeines Freundes einen kleinen Platz, den er sorgfältig mit Hacke und Spaten bearbeitet, den er noch sorgfältiger düngt, den er mit Latten und Stöcken gegen alles Ungemach zu schützen sucht und dem er seinen teuer erkauften Blumensamen, seine Tulpen- oder Hyazinthenzwiebeln anvertraut.
Kommt dann der Frühling heran, so verständigen sich diese blumenliebenden Arbeiter über einen Tag, an dem sie sich gegenseitig mit dem Resultat ihrer Gartenkunst bekannt machen wollen. Für die erste Zusammenkunft wird gewöhnlich die Tulpe bestimmt, für die zweite die Ranunkel, für die dritte und letzte die Aster und Georgine. Außerdem zahlt jeder einen Schilling in eine gemeinschaftliche Kasse, aus der die vorkommenden Kosten wie Miete des Saales, worin die Blumen ausgestellt werden, Honorar für die Blumenrichter und andere Sachen bestritten werden. Den Rest des Geldes verwendet man zum Ankauf eines Geschenkes für denjenigen, der die schönste Blume aufzuweisen hat. Diese Blumenausstellungen oder Blumenfeste werden in vielen Teilen Englands, namentlich aber in den nördlichen Provinzen jährlich dreimal von den Arbeitern gehalten. Sie stehen unter keiner höheren Protektion. Diese Blumenliebhaberei hat sich rein aus dem Volke entwickelt. Die Bourgeoisie weiß wie von so vielen andern Dingen nichts, so auch nichts Von dieser poetischen Leidenschaft der Arbeiter. Wie könnte es auch einem respektablen Mann einfallen, sich in die »Alte Hammelsschulter« zu verirren!
In dieser Schenke hatte man einen Saal oben im Hause für den Tag gemietet. Das Zimmer war voller Menschen. Aber welche Menschen! Prächtige Kerle, in Schmutz, Staub und Lumpen gewickelt, und dann ein gewaschenes Gesicht und jetzt ein neuer Hut auf einem unternehmenden Kopfe und weiter ein paar Lenden und ein paar Fäuste; und eine Brust, ein Schädel – ein Bursche, der dreißig Mann hintereinander niederboxen würde; aber auch recht verkommene Gesellen reckten sich in die Höhe; Leute, an denen die Not schon lange Zeit still genagt hatte, die vielleicht eben erst gesenkten Hauptes aus den Fabriken schlichen, wo sie zwölf Stunden gearbeitet, wo ihnen zwölf Stunden lang eine rasselnde Maschine das Jubellied der Industrie gesungen – und den eigenen Grabgesang.
Mochte der Staub ihrer Kleider, mochte die Furche auf mancher Stirn verraten, daß die ganze Gesellschaft dieser Blumengenossen eben nur Sklaven, arme Teufel, Gassenbuben und Lumpen waren – in dem Benehmen eines jeden, in der Art, wie sie miteinander sprachen, wie sie mir, dem Fremden, entgegentraten und mich bald freundlich, bald keck und herausfordernd anschauten, lag doch der Ausdruck jenes Bewußtseins, das einen Mann inmitten des gräßlichsten, aber unverschuldeten Elends, inmitten der tiefsten Verworfenheit trotz Staub und Fetzen zu einem Helden stempelt, jenes Bewußtsein der guten Fäuste, des guten Rechts und des unerschütterlichen Willens! – Und sind das nicht Helden, die vierzig, fünfzig, sechzig Jahre leben wie englische Arbeiter! Oh, wer beschreibt die Langmut des Volkes!
Unsere Blumengenossen lagen aber wie die lieben Heiden auf den Bänken herum; wer einen Rock besaß, hatte ihn ausgezogen und an die Wand gehängt. Jeder hielt eine irdene Pfeife im Munde und trug das Seinige dazu bei, den erschrecklichsten Kellergestank, der durch den Saal wogte, noch mehr zu befördern und zu verdichten. In der Mitte des Zimmers stand ein großer Tisch, auf dem in vielen kleinen Gläsern die herrlichsten Tulpen prangten, denn die Tulpe war es, welche man an jenem Tage in die Schranken führte. Es waren schöne Blumen, die in den Gläsern standen. Zuerst die einfarbigen, dann die gesprenkelten, hierauf die gestreiften und endlich einige Exemplare, die von der Natur mit ausnahmsweise sonderbaren Reizen ausgestattet waren. Ich hatte mich kaum mit all diesen Herrlichkeiten bekannt gemacht, als sich sämtliche Zuschauer von dem Tische entfernten und ebenfalls ihren Platz auf den Bänken im Hintergrunde des Zimmers einnahmen. Der größere Teil der Gesellschaft schien dort den weitern Verlauf des Festes schon seit längerer Zeit ängstlich abzuwarten.
Der Augenblick der Entscheidung rückte heran; dann, als alles niedersaß und bald um den Tisch herum ein freier breiter Raum war, öffnete man rechts und links die Türen des Saales, und herein spazierten würdig und freundlich die zwei höchsten Blumenautoritäten, die zwei berühmtesten Blumenkenner und -richter der Grafschaft York.
Ein Scharren, Murmeln, ein »Oh« und ein »Ah« der Gesellschaft, kurz, ein Getöse, das, zu dem sonderbarlichsten Wohllaut anschwellend, sich nur langsam in melodischen Kadenzen wieder verlor, zeigte hinreichend, wie sehr man die Gegenwart jener zwei ausgezeichneten Männer zu würdigen wisse. – Die Blumenrichter näherten sich dem Tulpentische. Ich meine, ich sähe die beiden Herren noch jetzt vor mir stehen. Der eine erfreute sich einer unendlich langen, dünnen Figur; ein kompletter Spazierstock, oben mit einem dicken Kopf darauf! Seine rote Nase leuchtete im Abendlichte, das durch die Fenster schaute; seine Hände saßen wie festgewachsen in den Hosentaschen, und die Beine schlenkerten durch den Saal, als ob sie die größeste Lust verspürten, sich jeden Augenblick von ihrem Eigentümer zu entfernen. Er stolperte den Tulpen entgegen, die alle seine Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen schienen, denn kein Gruß klang von seinen Lippen, als er ins Zimmer trat; er schien die ganze Versammlung gar nicht einmal zu bemerken; auch hielt er die Augen fest geschlossen, und nur ein lustiges Blinzeln und Blitzen, das durch die buschigen Wimpern brach, zeigte deutlich, daß ein enthusiastischer Kerl herantaumelte. Soll ich nun die Kleidung des Mannes schildern, so muß ich gestehen, daß sein Rock erschrecklich zerrissen war, daß seine Hose in früheren Jahren einmal ganz, seine Schuhe einmal erträglich gewesen, jetzt aber den Weg alles Irdischen zu wandern schienen; daß ferner das liebe Tageslicht sich in aller Glorie durch die Löcher des Hutrandes drängte, daß aber das Hemd des großen Blumenrichters blendend weiß war und aus den Brustfalten einen frischen Blumenstrauß hervorschauen ließ.
Die ganze Erscheinung hatte etwas Lumpig-Geniales, etwas Rührend-Lächerliches, was den Griffel eines Hogarth, eines Cruikshank, eines Hasenclever sofort in Bewegung gesetzt haben würde. »Seht Ihr«, sagte Jackson und klopfte auf meine Schulter, »das ist so ein Erzblumennarr. Ich habe freilich auch einen kleinen Hieb von dieser Liebhaberei und hänge im Frühjahr, wenn das Gras wieder aus dem Boden schaut, gewöhnlich mein eigentliches Geschäft an den Nagel, um Botanik zu treiben, das heißt: ich höre auf, Wolle zu kämmen, und werde ein Gärtner – aber so weit wie dieser Herr Richter habe ich es nie gebracht.
Meine Blumenliebhaberei bringt mir auch noch Geld ein; denn verdiene ich auch nicht soviel damit wie mit dem Wollkämmen, so habe ich doch wenigstens meinen Tagelohn, und der Aufenthalt im Grünen und die große Freude, welche mir die kleinste Pflanze macht, entschädigen mich so reichlich, daß ich gern mit allem zufrieden bin. Dieser Herr Richter, das versichere ich Euch, treibt aber den Blumenspektakel aus den uneigennützigsten Absichten.
Diesem Manne ist es nicht um Geld zu tun, nein, es ist reine Liebe zu den kleinen, lieblichen Dingern, die man Blumen nennt; es ist das Entzücken über die erste junge Blüte, was ihm mit unwiderstehlicher Gewalt das Werkzeug aus den Händen zieht und ihn hinaustreibt in die Felder, wo er oft tagelang umherirrt, bis ihn der Hunger wieder nach Hause zwingt. Oft verläßt er schon im Anfang April seine Wohnung und läuft auf die nächsten Dörfer. Gott weiß, wie er sich durchschlägt, denn Geld hat er nie bei sich. Aber die Bauern kennen ihn und lassen ihn die Nacht in irgendeiner Ecke schlafen; manchmal können sie auch seine Blumenkenntnisse benutzen und geben ihm dann zu essen und zu trinken.
So taumelt er weiter von Feld zu Feld, von Garten zu Garten. Einer von unsern Leuten fand ihn vorgestern bei Halifax hinter einer Hecke und brachte ihn natürlich hierher, denn auf sein Urteil kann man sich verlassen; er ist ein weiser, angesehener Mann, und wir geben ihm viel zu essen und 18 Pence per Tag extra.«
Dann machte mich Jackson auf den zweiten Blumenrichter aufmerksam. Er war von dem ersten, länglichen sehr verschieden, denn er war ein Grobschmied, groß und breit, wie fast alle Leute seines Zeichens. Auch in seiner Kleidung übertraf er den Herrn Kollegen bei weitem, denn er war von oben bis unten fein schwarz wie ein Pastor angezogen, er trug sehr reine Wäsche und weiße baumwollene Handschuhe, dazu war sein Gesicht sorgfältig von Staub und Ruß gesäubert, und auf dem glattgestrichenen stahlgrauen Haar saß in schiefer Richtung ein kleiner Hut mit sehr schmalem Rande. Wenn man den Mann zuerst sah und hörte, daß er ein Grobschmied sei, so mußte man unwillkürlich voraussetzen, daß er sich in seinem feinen Gewände nicht wohl fühlen könne und daß namentlich die riesigen Arme und die großen Hände wohl besser mit Hammer und Amboß umzugehen wüßten als mit zarten Tulpen, Rosen und Aurikeln. Wie erstaunte ich aber, als die gewaltige Figur des sinnigen Grobschmieds plötzlich in die lebendigste und artigste Bewegung geriet, als er in den gewähltesten Ausdrücken und mit einer bald lispelnden, bald volltönenden Stimme der Versammlung erklärte, daß jene rote Tulpe »Diama« sich dieses Jahr ausnehmend schön entwickelt habe, daß die gesprenkelte »Amsterdam« beinah die gestreifte Schwester »Antwerpen« an Lieblichkeit übertreffe und die blaßgelbe »Desdemona« mit der rotpunktierten »Hochland Mary« dieses Jahr kühn in die Schranken treten könne.
Dazu gestikulierte er mit einer Anmut und bewegte das feiste Unterkinn, indem er es bald tief in das Halstuch zurückzog, bald graziös darüber hin agierte, mit so vielem Ausdruck, daß Freund Jackson mir ein über das andere Mal versicherte, dieser Grobschmied sei ein ganz verdammt netter Kerl.