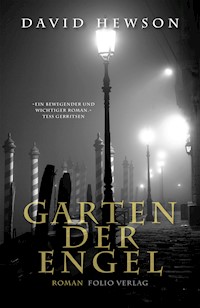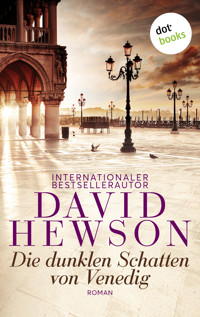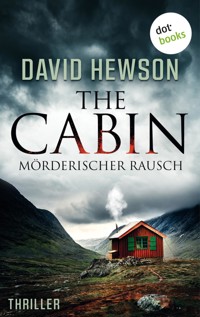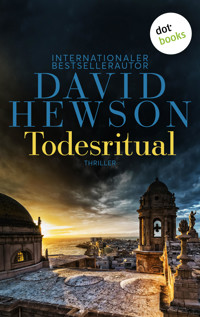Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Nic Costa
- Sprache: Deutsch
Die Schrecken hinter den Mauern des Vatikans: Der fesselnde Kriminalroman »Das Blut der Märtyrer« von David Hewson jetzt als eBook bei dotbooks. Drückende Hitze lastet auf ganz Rom – und doch hat der Polizist Nic Costa das Gefühl, sein Blut müsse gefrieren: In einer Kirche ist die Leiche eines Mannes gefunden worden, gehäutet wie der Märtyrer Bartholomäus. Der vermeintliche Täter ist mit seiner blutigen Trophäe in die Vatikanbibliothek geflohen und wird dort erschossen – vor den Augen seiner ehemaligen Freundin. War dies eine zufällige Begegnung, oder ist die Dozentin Sara Farnese tiefer in den Fall verwickelt? Schon kurze Zeit später stirbt ein weiterer Mann, den sie früher geliebt hat, einen grausamen Tod. Costa weiß, dass er schnell handeln muss, denn auch Sara selbst könnte auf der blutroten Liste des Killers stehen … »Kein anderer Autor hat mir Rom je so lebendig ins Gedächtnis gerufen – oder so düster und bedrohlich«, urteilt der internationale Bestsellerautor Peter James. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Das Blut der Märtyrer« ist der erste Band der packenden Nic-Costa-Reihe von David Hewson. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Drückende Hitze lastet auf ganz Rom – und doch hat der Polizist Nic Costa das Gefühl, sein Blut müsse gefrieren: In einer Kirche ist die Leiche eines Mannes gefunden worden, gehäutet wie der Märtyrer Bartholomäus. Der vermeintliche Täter ist mit seiner blutigen Trophäe in die Vatikanbibliothek geflohen und wird dort erschossen – vor den Augen seiner ehemaligen Freundin. War dies eine zufällige Begegnung, oder ist die Dozentin Sara Farnese tiefer in den Fall verwickelt? Schon kurze Zeit später stirbt ein weiterer Mann, den sie früher geliebt hat, einen grausamen Tod. Costa weiß, dass er schnell handeln muss, denn auch Sara selbst könnte auf der blutroten Liste des Killers stehen …
»Kein anderer Autor hat mir Rom je so lebendig ins Gedächtnis gerufen – oder so düster und bedrohlich«, urteilt der internationale Bestsellerautor Peter James.
Über den Autor:
David Hewson wurde 1953 geboren und begann bereits im Alter von 17 Jahren für eine Lokalzeitung im Norden Englands zu arbeiten. Später war er Nachrichten-, Wirtschafts- und Auslandsreporter bei der »Times« und Feuilletonredakteur bei »The Independent«. Heute ist er ein international bekannter Bestsellerautor. Sein Thriller »Todesritual«, auch bekannt unter dem Titel »Semana Santa«, wurde mit dem W. H. Smith Fresh Talent Preis für einen der besten Erstlingsromane ausgezeichnet und verfilmt. Er schrieb die Bücher zur dänischen Fernsehserie »The Killing« und seine Nic-Costa-Kriminalromane wurden weltweit zum großen Erfolg.
Bei dotbooks erscheinen von David Hewson die Nic-Costa-Kriminalromane »Das Blut der Märtyer« und »Der Kult des Todes«, außerdem der Thriller »Todesritual« und der Spannungsroman »Die dunklen Schatten von Venedig«.
Die Website des Autors: davidhewson.com
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »A Season for the Dead« bei Macmillan, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2003 by David Hewson
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2004 by Ullstein Buchverlage GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von Motiven von Vladimir Sazonov / shutterstock.com und elwynn / shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-007-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Blut der Märtyrer« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Hewson
Das Blut der Märtyrer
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Hedda Pänke
dotbooks.
Kapitel Eins
Die Hitze war unerträglich. Sara Farnese saß im Leseraum der Vatikanischen Bibliothek, blickte in den rechteckigen Hof hinaus und versuchte sich zu konzentrieren. Die wabernde Hitze ließ das Bild vor ihren Augen verschwimmen, und der gelbe, trockene Rasen wirkte wie ein Spiegelbild der gnadenlosen Sonne. Jetzt war es zwei Uhr. In einer Stunde würden draußen vor den Fenstern vierzig Grad herrschen. Rom war im August ein leerer Hochofen, der vom Seufzen ausgedörrter Geister widerhallte. Der laute Klang ihrer Schritte in den Fluren der ausgestorbenen Universität in San Lorenzo hatte Sara heute früh die Flucht ergreifen lassen. Die Hälfte der Geschäfte und Restaurants waren geschlossen. Leben fand nur in Museen und Parks statt, in denen vereinzelte Gruppen hitzemüder Touristen verzweifelt Schatten suchten.
Jeder, der seine fünf Sinne beisammen hatte, kehrte der Stadt in diesen Tagen den Rücken. Aber sie war geblieben, und jetzt zweifelte sie an ihrer Entscheidung. Hugh Fairchild hatte seinen Besuch aus London angekündigt. Der gutaussehende, kluge Hugh, ein Mann, der die Titel aller frühchristlichen Handschriften in sämtlichen Museen Europas aus dem Gedächtnis aufzählen konnte und sie wahrscheinlich auch gelesen hatte. Bei pünktlicher Landung des Flugzeugs musste er um zehn Uhr in Fiumicino angekommen sein und hatte inzwischen vermutlich seine Suite im Inghilterra bezogen. Für mich hat er noch keine Zeit, dachte Sara und verdrängte den Gedanken, dass in seinem Notizbuch noch weitere Namen stehen könnten, andere Kandidatinnen für sein Bett. Hugh war ein viel beschäftigter Mann. Von seinen fünf Tagen in Rom würden zwei Abende allein ihr gehören. Dann wollte er nach Istanbul weiterreisen, um an einer Juristentagung teilzunehmen.
Vermutlich bin ich nicht die Einzige, dachte sie. Nein, wahrscheinlich. Immerhin lebt er in London. Er hatte seine akademische Laufbahn aufgegeben, um in den Diensten der EU Karriere zu machen. Inzwischen verbrachte er eine von vier Wochen auf Reisen, flog nach Rom, New York, Tokio. Sie trafen sich höchstens einmal im Monat. Er war fünfunddreißig Jahre alt und auf eine fast zu perfekte Art attraktiv. Er hatte einen hoch gewachsenen, athletischen Körper, ein gut geschnittenes, ungemein sympathisches Gesicht und einen Wust widerspenstiger blonder Haare. Es war unvorstellbar, dass er nicht mit anderen Frauen schlief, und das schon bei der ersten Begegnung. Genau wie mit mir, dachte sie mit flüchtigen Gewissensbissen, während der Konferenz über die Konservierung alter Kunstschätze vor vier Monaten in Amsterdam.
Sara bereute es nicht. Sie waren beide erwachsen und unverheiratet. Und er ging bei aller Leidenschaft beim Sex kein Risiko ein. Hugh Fairchild war ein ungemein methodischer Mann, der in unregelmäßigen Abständen bei ihr auftauchte – ein Arrangement, das sie beide sehr befriedigte. Nach einem Essen in ihrer Wohnung nahe dem Vatikan würden sie heute Abend die Engelsbrücke überqueren, um irgendwo im Centro storico einen Kaffee zu trinken, und gegen Mitternacht zu ihr nach Hause zurückkehren, bis ihn morgen früh wieder Termine in Anspruch nahmen. Das verspricht eine höchst reizvolle Mischung aus intellektueller Anregung, angenehmer Gesellschaft und Erfüllung physischen Verlangens, dachte sie. Genügend jedenfalls, um die Zweifel verstummen zu lassen.
Sie versuchte, sich auf das Buch vor ihr auf dem Mahagoni-Schreibtisch zu konzentrieren. Der kostbare Foliant unterschied sich von den Bänden, die Sara Farnese für gewöhnlich in der Vatikanischen Bibliothek studierte. Es war De Re Coquinaria, das berühmte Kochbuch von Marcus Apicius, in einer Abschrift aus dem zehnten Jahrhundert. Sie hatte vor, Hugh ein Essen nach Rezepten aus dem Rom der Kaiserzeit zuzubereiten: Isicia omentata (gebratene Fleischklöße mit Pinienkernen), Pullus fiusilis (mit Kräutern gefülltes Hähnchen) und Tiropatinam (mit Honig gesüßter Auflauf). Damit wollte sie ihn weder beeindrucken noch ihre Beziehung auf eine neue Ebene heben. Im August hatten die besten Restaurants nun einmal geschlossen. Es war die einfachste Lösung, und darüber hinaus kochte sie gern. Er würde es verstehen oder zumindest nichts dagegen haben.
»Apicius?« Die plötzliche Frage hinter ihr ließ sie zusammenzucken.
Sara drehte sich um. Hinter ihr stand Guido Fratelli. Wie üblich lächelte er sie an. Sie versuchte, auch freundlich zu sein, obwohl sich ihre Freude über seinen Anblick in Grenzen hielt. Der Schweizergardist tauchte immer auf, wenn sie vorbeikam. Er schien genauestens über ihre Besuche informiert zu sein und besaß genügend Kenntnisse über ihre Arbeit, um ihr unerwünschte Unterhaltungen aufzudrängen. Er war etwa in ihrem Alter, neigte zur Korpulenz und wirkte unbändig stolz auf seine blaugelbe Uniform und den breiten Pistolengürtel aus schwarzem Leder. Aber seine Befugnisse beschränkten sich auf den Vatikan, in dem kaum etwas passierte. Schon der Petersplatz fiel in den Amtsbereich der römischen Polizisten. Und die waren von anderem Kaliber als dieser ruhige, fast furchtsame Mann. Inmitten der Alkoholiker und Drogenabhängigen rund um die Stazione Termini würde es Guido Fratelli keinen Tag lang aushalten.
»Ich habe Sie gar nicht hereinkommen gehört«, sagte Sara mit einem Hauch von Vorwurf in der Stimme. Sie schätzte die Stille in dem leeren Lesesaal und wollte nicht, dass sie durch Gespräche gestört wurde.
»Tut mir leid.« Unbewusst strich er über sein Pistolenhalfter. »Uns wurde beigebracht, möglichst lautlos zu sein. Man kann schließlich nie wissen.«
»Sicher.« Wenn Sara sich nicht irrte, war es im Verlauf von zwei Jahrhunderten im Vatikan zu gerade einmal drei Mordfällen gekommen: 1988 wurden der Kommandant der Schweizergarde und seine Frau aus persönlichen Motiven von einem Unteroffizier der Garde erschossen, und 1848 fiel der Governatore des Papstes dem Anschlag eines politischen Gegners zum Opfer. Da die städtische Polizei die Menge auf dem Petersplatz im Auge behielt, brauchte sich Guido Fratelli im schlimmsten Fall um anspruchsvolle Einbrecher zu sorgen.
»Sie lesen da ja etwas ganz anderes als sonst.«
»Ich habe vielseitige Interessen.«
»Ich auch.« Er spähte weiter neugierig über ihre Schulter. Guido suchte stets fieberhaft nach Gesprächsthemen. Vielleicht hielt er das für ein Training seiner detektivischen Fähigkeiten. »Ich lerne jetzt Griechisch, müssen Sie wissen.«
»Das da ist Latein.«
Sein Gesicht verdüsterte sich. »Oh. Üblicherweise lesen Sie Griechisch.«
»Üblicherweise.« Sie konnte eine gewisse Erheiterung über seine trübselige Miene nicht unterdrücken. Wahrscheinlich fragte er sich: Muss ich jetzt etwa beide Sprachen lernen?
»Vielleicht können Sie mir bei Gelegenheit einmal sagen, ob ich gut vorankomme?«
Sie zeigte auf ihr Computer-Notebook, in das sie die Hälfte der Rezepte bereits übertragen hatte. »Irgendwann einmal. Aber jetzt nicht, Guido. Ich habe zu tun.«
Sara wandte den Kopf ab und blickte wieder zum Fenster hinaus. Seine Gestalt spiegelte sich in der hohen Scheibe. Noch war Guido nicht zum Aufgeben bereit.
»Gut«, sagte er schließlich, nickte ihr im Fenster zu, drehte sich um und ging zur Tür. Sara hörte gedämpftes Lachen aus den Galerien im Stockwerk über ihr. Touristen. Mit genügend Einfluss, um Zugang zu diesen nicht öffentlichen Räumen zu erhalten. Wussten sie eigentlich, wie glücklich sie sich schätzen konnten? In den letzten Jahren verbrachte Sara mehr und mehr Zeit in der Bibliothek, nicht nur aus beruflichem Interesse als Dozentin für die Frühzeit des Christentums, sondern auch zu ihrem privaten Vergnügen. Sie hatte Blätter mit Zeichnungen und Gedichten berührt, die von Michelangelos Hand stammten. Die Liebesbriefe von Heinrich VIII. an Anne Boleyn ebenso gelesen wie seine Assertio Septem Sacramentorum gegen Luther, die dem englischen König zwar den Titel »Verteidiger des Glaubens« durch Leo X. einbrachte, ihn aber dennoch nicht im Schoß der römisch-katholischen Kirche halten konnte.
Vom beruflichen Standpunkt aus waren es die frühen Codices – die Handschriften und Inkunabeln –, die im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit standen. Allerdings konnte sie auch ihrem Drang nicht widerstehen, sich in die Sammlungen über Personen aus dem Mittelalter zu vertiefen. Es gab ihr das faszinierende Gefühl, Petrarca und Thomas von Aquin hören zu können. Ihre Stimmen hatten sich erhalten wie die Worte auf dem trockenen Velin. Und die gelegentlichen Tintenflecken auf den Blättern machten sie irgendwie menschlich, was Sara als wohltuend empfand. Denn bei aller Weisheit, bei aller Wortgewandtheit wären sie nichts ohne diese Menschlichkeit, auch wenn ihr Hugh Fairchild da wahrscheinlich widersprechen würde.
Sie hörte ein Geräusch von der Tür her, eine Art Schrei, nicht sehr laut, aber in dieser Umgebung irritierend. Im Leseraum der Vatikanischen Bibliothek schreit man nicht.
Sara hob den Kopf und stellte fest, dass ein ihr bekannter Mann auf sie zukam. Er durchquerte die durch die Fenster einfallenden Lichtstreifen mit zügigen, entschlossenen Schritten, die hier unangemessen wirkten. Die Klimaanlage begann zu dröhnen. Ein kalter Luftzug traf Sara, und sie fröstelte. Den Ausdruck auf seinem runden, bärtigen Gesicht konnte sie nicht deuten: Zorn oder Angst, vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Überrascht blickte sie ihm entgegen. Stefano Rinaldi, ihr Professorenkollege von der Universität, hielt eine große, offenbar gefüllte Plastiktüte in der Hand. Wie üblich trug er Schwarz, aber sein Hemd und die Hosen wirkten unordentlich, und es sah aus, als wären auf beidem feuchte Flecken. Seine Augen funkelten sie an.
Plötzlich empfand Sara Farnese eine unerklärliche Furcht vor dem Mann, den sie vor geraumer Zeit gut gekannt hatte.
»Stefano ...«, sagte sie, aber so leise, dass er es vielleicht gar nicht hörte.
Der Tumult hinter ihm nahm zu. Sie sah Leute wild mit den Armen fuchteln, einige begannen dem schwarz gekleideten Mann mit der Supermarkttüte in der rechten Hand nachzulaufen. In seiner rechten Hand bemerkte Sara jetzt etwas noch Verblüffenderes. Es schien eine Waffe zu sein, eine kleine, schwarze Pistole. Stefano Rinaldi, ein Mann, den sie nicht anders als gleich bleibend freundlich kannte, für den sie sogar einmal Zuneigung empfunden hatte, kam mit einer Waffe zielstrebig auf sie zu, und sie konnte sich den Grund dafür nicht einmal ansatzweise erklären.
Sara streckte die Arme aus, umfasste die hintere Kante des Schreibtischs mit beiden Händen und drehte ihn um neunzig Grad. Die Holzbeine quietschten auf dem Marmorfußboden, kreischten wie ein verwundetes Tier. Sie zerrte den Tisch an sich heran, bis ihr Rücken gegen das Fenster stieß. Sie wusste, dass sie sitzen bleiben, dem Mann die Stirn bieten musste, dass dieser alte Schreibtisch mit der Abschrift eines antiken römischen Kochbuchs und einem Notebook auf ihm einen gewissen Schutz vor der unbegreiflichen Gefahr bot, die sich ihr näherte.
Er war schneller bei ihr, als sie gedacht hatte, und rang keuchend nach Atem. Ein sonderbarer Glanz lag in seinen dunkelbraunen Augen.
Er setzte sich ihr gegenüber auf einen Stuhl und sah ihr ins Gesicht. Sara spürte, dass sie sich ein wenig entspannte. Im Moment hatte sie keine Angst. Er war nicht gekommen, um ihr etwas anzutun. Das wusste sie mit einer Sicherheit, die sie sich nicht erklären konnte.
»Stefano ...«, wiederholte sie.
Hinter ihm tauchten Gestalten auf. Sie entdeckte Guido Fratelli unter ihnen und fragte sich unwillkürlich, wie gut er seine Pistole beherrschte und ob sie vielleicht durch die zitternde Hand eines unerfahrenen Schweizergardisten sterben würde, der seine Waffe auf einen ihrer früheren Geliebten richtete, der aus unerfindlichen Gründen in der ehrwürdigsten Bibliothek von Rom durchgedreht war.
Stefanos linker Arm wischte über den Schreibtisch, fegte kurzerhand alles – die kostbare Apicius-Handschrift und ihren teuren Laptop – auf den Marmorboden.
Sara wartete schweigend. Sein Blick sagte ihr, dass er es so wollte.
Er hob die Plastiktüte und entleerte den Inhalt auf die Schreibtischplatte. »Das Blut der Märtyrer ist die Saat der Kirche«, sagte er mit lauter Stimme, die halb wahnsinnig und halb leblos klang.
Sara betrachtete das Etwas auf dem Schreibtisch. Es hatte die Konsistenz von noch feuchtem Pergament. Es war ein Material, auf dem Apicius geschrieben hätte, wäre es trocken gewesen.
Die Pistole noch immer in der linken Hand, begann Stefano das weiche Etwas vor ihr auszubreiten, streckte und straffte das sonderbare Material, bis es den ganzen Schreibtisch bedeckte, über die Kanten hinabhing und Ähnlichkeit mit etwas bekam, was Sara bekannt, aber in dieser Form auch fremd war.
Sie zwang sich, die Augen offen zu halten, versuchte krampfhaft, ihre Gedanken zu ordnen. Das Etwas, das Stefano so sorgfältig mit der flachen rechten Hand glättete wie eine kostbare Tischdecke, war die Haut eines Menschen. Eine helle Haut, leicht gebräunt und noch feucht, als wäre sie vor kurzem gewaschen worden. Sie war am Hals, den Handgelenken, Knöcheln und Genitalien, entlang der Wirbelsäule und an den Beinen durchschnitten worden, um sie in einem Stück abziehen zu können. Sara musste sich zusammenreißen, um sie nicht zu berühren. Nur um sich zu vergewissern, dass es kein böser Traum war.
»Was willst du?«, fragte Sara so ruhig, wie es ihr möglich war.
Die braunen Augen musterten sie, wandten dann den Blick ab. Stefano hatte Angst bei dem, was er da tat. Er fürchtete sich, schien aber auch fest entschlossen zu sein. Er war ein intelligenter Mann, keineswegs stur, aber voll und ganz auf seine Arbeit konzentriert, die sich, wie Sara sich jetzt erinnerte, um Tertullian drehte, den frühchristlichen Theologen und Polemiker, dessen berühmtes Dictum er gerade zitiert hatte.
»Welche Märtyrer?«, fragte Sara. »Was hat das alles zu bedeuten?«
Er war wieder ganz bei sich. Das sah sie an seinen Augen. Stefano dachte nach, suchte nach einer Erklärung.
Er beugte sich vor. »Sie ist noch da, Sara«, sagte er mit seiner tabakrauen Stimme. Aber er sprach so leise, dass niemand sonst seine Worte hörte. »Wir müssen uns beeilen. Sieh dir das an.« Er starrte die Haut auf dem Tisch an. »Ich wage nicht, mir vorzustellen ...« Entsetzen überzog sein Gesicht. »Denk an Bartholomäus. Du weißt doch Bescheid.«
Und dann wiederholte er noch einmal, lauter und mit einem wahnhaften Hauch in der Stimme, Tertullians Worte: »Das Blut der Märtyrer ist die Saat der Kirche.«
Mit irrlichternden Augen hob Stefano Rinaldi die Pistole, bis der kurze, schmale Lauf auf ihr Gesicht zeigte.
»In Deckung!«, schrie der Schweizergardist. »In Deckung!«
Guido Fratelli ist ein kompletter Schwachkopf, dachte Sara. Er hat nicht die geringste Ahnung, was hier vorgeht.
»Nein!« Abwehrend hob Sara eine Hand und sah mit Schrecken, dass Stefano die Hand mit der Waffe höher hob. »Schluss jetzt! Alle beide!«
Guido Fratelli riss den Mund auf und kreischte etwas Unverständliches. Er hatte die Beherrschung verloren. Total. Und Stefano sah sie nur stumm an, starrte sie mit seinen wehmütigen, verzweifelten Augen an, in denen so viel Fatalismus lag, dass es Sara ganz kalt überlief.
»Schnell«, sagte er. Mehr nicht.
»Nein, nicht«, sagte sie zu beiden Männern, wusste aber, dass es sinnlos war.
Guidos Pistole explodierte förmlich, und Saras Ohren schmerzten unerträglich. Stefano Rinaldis Schädel öffnete sich, Blut und Gewebe spritzten heraus. Fratelli tänzelte um den Toten herum und wünschte, er würde es wagen, die Leiche zu berühren. Die Pistole in seiner Hand zuckte, als hätte sie ein Eigenleben.
Sara schloss die Augen, hörte die Explosion, die Schüsse in dem sonst so stillen Raum, dem Hort unvergleichlicher Schätze.
Als es vorbei war, öffnete Sara Farnese die Augen wieder. Stefano lag noch immer auf dem Boden. Einer der Aufseher drückte laut schreiend seine Hände gegen den Magen, als hätte er Angst, etwas könnte aus ihm herausquellen, wenn er sie sinken ließ.
Sie betrachtete Stefanos Kopf. Er ruhte auf der mittelalterlichen Apicius-Abschrift. Dickes, dunkles Blut tropfte auf das Pergament.
Kapitel Zwei
Sie standen im Schatten der Kolonnaden auf dem Petersplatz, und Luca Rossi fragte sich, wie sehr die Sonne ihm heute bereits den kahlen Schädel verbrannt hatte. Als Folge des Bier- und Pizza-Gelages gestern Abend rumorte es bedenklich in seinem Magen. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, hatte man ihm heute früh auch noch den Jungen als Dienstpartner für die nächsten vier Wochen verpasst. Es war eine Art Strafe, für sie beide, nahm er an. Keiner von ihnen konnte im Moment als Werbung für die römische Polizei bezeichnet werden, und das aus unterschiedlichen Gründen. In seinem Fall war es einem sehr direkten, eindeutigen und für ihn verständlichen Umstand zuzuschreiben. Der Junge dagegen sah einfach nicht richtig aus, Punkt. Und wusste es nicht einmal.
Er betrachtete seinen Partner und seufzte. »Also gut. Ich weiß, dass du sonst keine Ruhe lässt. Also erzähl schon. Was ist der Trick?«
Nic Costa lächelte, und Rossi wünschte, er würde nicht so verdammt jung aussehen. Mitunter mussten sie zwielichtige Gestalten in der Umgebung des Platzes festnehmen. Und er fragte sich, von welchem Nutzen der schmale, pubertär wirkende Jüngling dann wohl wäre.
»Es ist kein Trick.« Noch nie waren sie gemeinsam Streife gelaufen. Sie kamen von verschiedenen Revieren. Rossi vermutete, dass der Junge nicht einmal wusste, warum ein älterer, korpulenter Polizist sein neuer Partner war. Er hatte nie danach gefragt. Er schien es einfach zu akzeptieren, er schien alles zu akzeptieren. Aber Rossi wusste einiges über ihn. Wie alle anderen auch. Nic Costa war einer von jenen Polizisten, den seine Kollegen für nicht wahr hielten. Er trank kaum. Er aß nicht einmal Fleisch. Er hielt sich fit und hatte sich einen Ruf als Marathonläufer erworben. Und er war der Sohn dieses verdammten Roten, über den die Zeitungen immer wieder berichteten und der seinem Sprössling eine höchst ungewöhnliche Leidenschaft vererbt hatte. Nic Costa war in Gemälde vernarrt, vor allem in die Bilder eines bestimmten Malers. Er kannte Aufenthaltsort und Herkunft jedes einzelnen Caravaggio in Rom.
»Für mich hört es sich an wie ein Trick.«
»Es ist eine Sache des Wissens.« Einen Moment lang sah Costa so alt aus, wie er war – siebenundzwanzig Jahre. Vielleicht, dachte der ältere Mann, steckt mehr in ihm, als auf Anhieb ersichtlich war. »Keine Taschenspielerei, sondern reine, echte Magie.«
»Na gut, Magie. Da drüben ...«, Rossi nickte zu den Mauern des Vatikan hinüber, »da hängen bestimmt Dutzende von den Dingern.«
»Nein. Nur ein Bild, die ›Grablegung‹. Es wurde ursprünglich für die Chiesa Nueva gemalt, von dort aber entfernt, und kam erst über Paris wieder nach Rom. Im Vatikan hat man Caravaggio nie sonderlich geschätzt. Er war dem Klerus immer zu revolutionär, nicht prächtig genug. Auf seinen Bildern haben die Menschen schmutzige Füße. Die Apostel hat er gemalt wie ganz normale Sterbliche, denen man auch auf der Straße begegnen kann.«
»Ist es das, was du an ihm magst? Das hast du von deinem alten Herrn, nehme ich an.«
»Es ist nicht das Einzige, was mir an ihm gefällt. Und ich bin ich, niemand anders.«
»Klar.« Rossi dachte an Costas Vater. Er war ein echter Unruhestifter, der seine Anschauungen konsequent vertrat und nie irgendwelche Bestechungen annahm, was ihn zu einem sehr ungewöhnlichen Politiker machte. »Also wo hängen noch Bilder von ihm?«
Der Junge nickte Richtung Fluss. »Sechs Minuten entfernt in der Kirche Sant’ Agostino. Das Gemälde hat zwei Titel: ›Die Madonna von Loreto‹ oder ›Die Madonna der Pilger‹.«
»Ist es gut?«
»Ihre Füße sind unübersehbar schmutzig. Der Vatikan fand es scheußlich. Es ist ein wunderbares Bild, aber ich kenne bessere.«
Rossi wirkte nachdenklich. »Für Fußball interessierst du dich wohl nicht, oder? Schade, sonst hätten wir ein prima Gesprächsthema.«
Sein Kollege schaltete den Funkscanner ein und griff nach den Ohrstöpseln. Rossi hob schnuppernd den Kopf.
»Riechst du die Kanalisation?«, knurrte er. »Da haben sie jede Menge Geld ausgegeben, um die größte Kirche auf Erden zu bauen. Der Papst residiert nur ein paar Meter entfernt. Aber es stinkt immer noch wie in den finstersten Gassen von Trastevere. Vielleicht zerhacken sie Leichen und spülen sie durch die Toiletten. Aber das werden wir nicht rauskriegen.«
Costa hantierte weiter am Funkgerät. Sie wussten beide, dass über ein Verbot dieser Geräte nachgedacht wurde.
»Hör mal, das geht mir langsam auf die Nerven«, murrte Rossi. »Wenn Falcone mitkriegt, dass du an dem Ding herumspielst, verpasst er dir einen Arschtritt.«
Costa zuckte lächelnd mit den schmalen Schultern. »Ich wollte nur Fußballnachrichten für dich finden. Na und?«
Lachend warf Rossi seine großen Hände hoch. »Eins zu null für dich. Ich gebe mich geschlagen.«
Sie blickten zu den wenigen Touristen hinüber, die matt über den weiten Platz schlurften. Selbst für die Handtaschenräuber ist es zu heiß, dachte Rossi. Die hohen Temperaturen senkten die Verbrechensrate in Rom wirksamer, als es ein paar Polizisten vermochten. Er konnte Costa nicht verübeln, am Scanner herumzuspielen. Es gefiel ihnen beiden nicht, dass es in der Stadt Orte gab, an denen sie nicht willkommen waren. Vielleicht hatte Costa etwas Antiklerikales in den Genen, obwohl er immer wieder beteuerte, im Gegensatz zu seinem Vater absolut apolitisch zu sein. Und der Vatikan war ein Bestandteil der Stadt, trotz gegenteiliger Beteuerungen der Politiker. Eine absurde Vorstellung, irgendein mieser kleiner Dieb könnte sich eine Handtasche schnappen, sich unter die Besucher in der Peterskirche mischen und plötzlich unberührbar werden, weil nur die Päpstliche Schweizergarde in ihren komischen blauen Uniformen und Kniestrümpfen zugreifen durfte.
Etwas Wichtiges würde Costa über seinen Scanner kaum hören. Dafür passierte einfach zu wenig im Vatikan. Aber schon das Hantieren mit ihm war ein Protest an sich. Wir sind da, lautete die Botschaft.
Rossi musterte eine lange Schlange schwarz gekleideter Ordensschwestern, die einer Frau mit einem roten Fähnchen am Stock folgte. Er blickte auf seine Armbanduhr und wünschte, die Zeiger würden sich schneller drehen.
»Geschafft«, verkündete er, fühlte aber zu seiner Überraschung plötzlich Costas Hand auf seinem Arm. Der junge Polizist lauschte ebenso intensiv wie aufgeregt.
»Jemand ist erschossen worden«, erklärte Costa. »Im Leseraum der Bibliothek. Weißt du, wo der ist?«
»Aber klar«, nickte der ältere Mann. »Für uns in der Mongolei.«
Costas braune Augen blickten ihn flehend an. »Da ist ein Mensch erschossen worden. Da werden wir doch nicht etwa tatenlos zusehen, oder?«
Rossi seufzte abgrundtief. »Noch einmal, zum Nachsprechen: ›Der Vatikan ist exterritoriales Gelände.‹ Wenn du willst, kann es Falcone dir noch deutlicher sagen.« Sehr deutlich! Rossi wollte sich die Unterhaltung nicht einmal vorstellen. Er schätzte sich glücklich, die letzten fünf Jahre außerhalb Falcones Reichweite verbracht zu haben. Er wünschte nur, es wäre noch länger gewesen.
»Stimmt. Aber das heißt doch nicht, dass wir uns nicht umsehen dürfen. Es gibt für uns kein Verbot, den Vatikan zu betreten. Wir dürfen nur niemanden festnehmen.«
Rossi dachte nach. Der Junge hatte Recht, bis zu einem gewissen Punkt.
»Mehr hast du nicht gehört? Nur, dass jemand erschossen wurde?«
»Reicht das nicht? Willst du etwa zur Dienststelle zurück und Falcone sagen, dass wir nicht einmal unsere Hilfe angeboten haben?«
Rossi tastete nach seiner Pistole und sah, dass Costa das Gleiche tat. Sie blickten die Via di Porta Angelica entlang zum Eingang der Päpstlichen Privatgemächer. Die Schweizergardisten, die dort sonst die Ausweise der Besucher kontrollierten, waren nirgendwo zu sehen, hielten sich vermutlich am Ort des Geschehens auf. Zwei römische Polizisten konnten einfach so hineinspazieren, ohne dass ihnen irgendwelche Fragen gestellt wurden. Es wirkte wie eine Einladung.
»Aber ich renne nicht«, murrte Rossi. »Nicht in dieser Gluthitze.«
»Ganz wie du willst.« Nic Costa nahm die Beine in die Hand, flitzte über den Platz und verschwand schon bald im Gebäude.
»Dieses junge Volk ...« Luca Rossi schüttelte den Kopf.
Kapitel Drei
Als Rossi etliche Minuten später die Bibliothek erreichte, hatte sich Nic Costa bereits davon überzeugt, dass der Mann auf dem Fußboden tatsächlich tot war und sein Kopf mindestens drei Einschüsse aufwies. Es war ihm nicht entgangen, dass der verletzte Aufseher von zwei verstört wirkenden Medizinern fortgeführt wurde. Und er hatte unauffällig ein paar Nachforschungen angestellt. Im Raum herrschte das nackte Chaos, was Costa sehr gelegen kam. Der verschreckte Guido Fratelli hielt Costa offenbar für einen Angehörigen der Vatikanverwaltung, was auch auf die drei weiteren Schweizergardisten zutraf, die den Raum betreten und festgestellt hatten, dass keine unmittelbare Gefahr bestand. Nun schienen sie auf Anordnungen von ihm zu warten. Costa sah keinen Grund, sie voreilig zu enttäuschen. In seinen vier Jahren bei der Polizei hatte er schon etliche Tote gesehen und auch ein paar Todesopfer von Schießereien. Aber ausgerechnet im Vatikan die Leiche eines Menschen und die Epidermis eines anderen zu finden, war eine ganz neue Erfahrung und eine, die er sich nicht entgehen lassen wollte.
Seine Gedanken überschlugen sich. Die fieberhaften Überlegungen verdrängten den Geruch im Raum fast aus seinem Bewusstsein, machten den penetranten Gestank nach Blut und die Art und Weise, wie er sich mit der durch die geöffneten Fenster eindringenden heißen Luft mischte, ein wenig erträglicher.
Er hörte sich Fratellis wirre Schilderung der Ereignisse an und konnte während der ganzen Zeit keinen Blick von der Frau wenden, die an der Wand auf einem Stuhl saß und alles beobachtete. Sie musste knapp dreißig sein und trug ein schlichtes, graues Kostüm. Sie hatte schulterlange, dunkle Haare, große grüne Augen und ein klassisch geschnittenes Gesicht, wie man es manchmal auf mittelalterlichen Gemälden sieht. Nein, nicht von Caravaggio, dafür war sie zu schön. Die Gesichter seiner Frauen verfügten nicht über diesen strahlenden Glanz, nicht einmal die Madonnen. Und diese Frau sah aus, als würde sie sich sehr beherrschen, um nicht zu explodieren.
Als der Gardist seine Schilderung beendet hatte, stand sie auf und kam zu ihm. Costa bemerkte, dass ihr graues Kostüm blutbespritzt war. Es schien sie nicht zu kümmern. Schock, dachte er. Aber lange konnte es nicht mehr dauern, bis ihr bewusst wurde, dass sie nur knapp dem Tod entgangen, dass direkt vor ihr ein Mann erschossen worden war. Die Haut lag noch auf dem Schreibtisch wie das abgelegte Kostüm irgendeiner schauerlichen Gruselparty. Nic Costa konnte sich nur schwer vorstellen, dass sie einmal einem Menschen gehört hatte.
»Sie sind von der römischen Polizei?«, fragte sie mit leichtem englischem oder amerikanischem Akzent.
»Ja.«
»Das dachte ich mir.«
Verdutzt und unwillig blickten die Schweizergardisten einander an, aber noch fehlte ihnen der Mut zum Protest. Sie warteten erst einmal ab.
Luca Rossi lächelte ihnen zu. Er hatte absolut nichts dagegen, dass der Junge die Initiative ergriffen hatte. Er ließ ihm gern den Vortritt. Schön, es entsprach vielleicht nicht ganz den Regeln, aber immerhin war Costa als Erster am Tatort gewesen und schien bereits alles im Griff zu haben.
»Ich glaube, Stefano wollte mir etwas mitteilen«, sagte die Frau zu seinem jungen Kollegen.
»Stefano? Der Mann, der Sie töten wollte?«
Sie schüttelte den Kopf, und Nic Costa bewunderte den Schwung ihrer schimmernden Haare. »Er wollte mich nicht töten. Der Schwachkopf da ...«, sie nickte zu Guido Fratelli hinüber, »hat die Situation offenkundig völlig falsch verstanden. Stefano Rinaldi wollte, dass ich mit ihm irgendwo hingehe. Aber zu ausführlichen Erklärungen kam er nicht mehr.«
Der Gardist wurde blutrot, murmelte etwas Unverständliches, verstummte dann wieder.
»Und was hat er zu Ihnen gesagt?«, erkundigte sich Costa.
»Er sagte ...« Sie brach kurz ab und dachte angestrengt nach. Kein Wunder, dachte Costa, dass sie Schwierigkeiten mit dem Erinnern hat. Sie hat zu vieles in zu kurzer Zeit erlebt. »Er sagte, dass sie noch immer da wäre. Dass ich an Bartholomäus denken soll. Und dass wir uns beeilen müssen.«
Nic Costa überlegte, ob er seinen ersten Eindruck von ihr revidieren musste. Vielleicht stand sie gar nicht unter Schock. Vielleicht war sie immer so kühl und distanziert.
Costa wollte gerade fragen, wohin dieser Rinaldi so schnell wollte, als ein bulliger Mann im schwarzen Anzug hastig auf sie zukam und ihm auf die Schulter tippte. »Wer zum Teufel sind Sie?«
»Polizei«, antwortete Costa absichtlich vage.
»Ihr Dienstausweis?«
Er zog ihn aus der Tasche und zeigte ihn dem Mann.
»Verschwinden Sie«, befahl der Schwarzgekleidete. »Sofort!«
Costa sah seinen Partner an. Die leichte Röte auf Rossis Wangen verriet seine Empörung über das anmaßende Vorgehen.
Luca Rossi machte einen Schritt auf den Neuankömmling zu und fragte: »Und mit wem haben wir die Ehre?«
Er sah aus wie ein Boxer, der zu Gott gefunden hat, dachte Costa unwillkürlich, mit seinem breiten, geröteten Gesicht, den pockennarbigen Wangen und der gebrochenen Nase. Am Revers seines schwarzen Sakkos steckte ein Kruzifix.
»Hanrahan«, knurrte er, und Costa versuchte erneut, einen Akzent zu identifizieren. Diesmal kam er auf halb Irisch, halb Amerikanisch. »Vom Wachschutz des Vatikan. Aber nun schiebt ab, Jungs. Überlasst die Sache uns.«
Costa schlug dem Mann leicht auf die Schulter, und die Verärgerung in dessen grauen Augen überraschte ihn. »Interesse an unseren Erkenntnissen, Mister Hanrahan? Wir wollten nichts anderes als hilfreich sein. Immerhin wurde im Vatikan ein Mensch erschossen. Und nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie haben sich mit Ihrem Auftritt reichlich Zeit gelassen. Unter Umständen konnten wir Schlimmeres gerade noch verhindern.«
Die Frau musterte die drei Männer aufgebracht. Sie fragte sich, ob es der richtige Zeitpunkt war, über Kompetenzen zu streiten, zuckte es Costa durch den Kopf. Und nicht zu Unrecht.
»Das ist eine Angelegenheit, die nur den Vatikan etwas angeht«, erklärte Hanrahan. »Wir sorgen für Aufklärung. Wenn wir Ihre Unterstützung brauchen sollten, werden wir Sie rufen.«
»Dieser Fall lässt sich keineswegs vatikanintern regeln«, widersprach Costa. »Er geht auch uns etwas an.«
Hanrahan stieß ein einziges Wort hervor. »Zuständigkeit.«
»Verstehe ich Sie richtig?«, erkundigte sich Costa. »Ihr unfähiger Schweizergardist hat einen Mann erschossen, und Sie beharren auf Ihrer Zuständigkeit?«
Hanrahan sah Guido Fratelli an. »Wenn es so war.«
Costa ging die paar Meter zum Schreibtisch und fasste die Haut an. Das Stück, das einmal einen Arm bedeckt hatte. Es fühlte sich klamm und kühl an. Mehr nach Mensch, als er angenommen hatte.
»Und was ist damit?«
Hanrahan starrte ihn finster an. »Worauf wollen Sie hinaus?«
»Worauf ich hinauswill?« Costa machte sich bewusst, dass der Mann nicht einmal Mitglied der Schweizergarde war, denn die trat nie ohne Uniform auf. Vielleicht gehörte er tatsächlich zur Security, aber er verteidigte sein Revier und schien am zeitraubenden Prozess der Indiziensuche und Wahrheitsfindung nicht interessiert. »Darauf, dass es irgendwo einen Körper geben muss, der dazu passt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht in den Mauern des Vatikan zu finden ist.«
»Commissario ...«, mischte sich die Frau ein.
»Entschuldigen Sie, Signora, nur noch einen Moment. Damit will ich sagen, Mister Hanrahan, dass wir es hier mit zwei Mordfällen zu tun haben. Und ich biete Ihnen eine Wette über jede x-beliebige Summe an, dass einer von beiden in unseren Zuständigkeitsbereich fällt, in dem wir über fähige und gut ausgebildete Mitarbeiter verfügen. Im Gegensatz zu Ihnen.« Er bedachte den armen Guido Fratelli, der inzwischen den Tränen nahe schien, mit einem vernichtenden Blick. »Wir sind zu verständnisvoller Kooperation bereit. Wie ist es, dürfen wir auf ein wenig Entgegenkommen von Ihnen hoffen?«
Hanrahan schüttelte den Kopf. »Sie haben nicht die geringste Ahnung, worum es hier geht.«
»Na, nun geben Sie sich schon einen Ruck.« Costa legte Hanrahan eine Hand auf die Schulter. »Wollen wir nicht dasselbe?«
»Nein.« Hanrahan verzog das Gesicht. »Ganz und gar nicht. Und jetzt ...«
Die Frau drängte sich zwischen die beiden Männer und sah Nic Costa direkt in die Augen. »Sind Sie mit dem Auto hier?«
»Selbstverständlich.«
»Er wollte, dass wir uns beeilen. Können wir vielleicht gleich losfahren?«
Wieder überraschte Costa ihre Ruhe. Während sie miteinander stritten, hatte sie angestrengt nachgedacht und versucht, das Rätsel zu lösen, das der Tote ihr hinterlassen hatte.
»Wissen Sie denn wohin?«
»Ich glaube schon. Es war dumm von mir, nicht sofort darauf zu kommen. Können wir los? Bitte.«
Nic Costa tätschelte Hanrahans Schulter. »Sehen Sie? Man muss nur die richtigen Fragen stellen.«
Kapitel Vier
Costa grübelte über die wirre Geschichte nach, die ihnen Sara Farnese erzählt hatte. Sie warf so viele Fragen auf, dass er sich Gedanken über ihren Geisteszustand machte. Vielleicht stand sie doch unter Schock, und das ganze Unternehmen war sinnlos.
»Warum zur Tiber-Insel?«, fragte er.
»Das habe ich Ihnen doch gesagt. Wir müssen zur Kirche auf der Insel.«
Rossi warf ihm vom Fahrersitz aus einen sonderbaren Blick zu, und Costa fragte sich, ob sein Kollege kalte Füße bekommen hatte. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, sich mit ihren Vorgesetzten in Verbindung zu setzen. Aber er hatte bislang keinerlei Beweise dafür, dass im Zuständigkeitsbereich der städtischen Polizei ein Verbrechen begangen worden war. Abgesehen davon wirkte die Frau sehr bestimmt, sie wollte offenbar so schnell wie möglich in diese Kirche. Costa hoffte darauf, sich bei Falcone ein paar Pluspunkte verdienen zu können.
»Und warum, wenn ich fragen darf?«
Sie seufzte so ungehalten, als wäre er ein begriffsstutziges Kind. »Stefano Rinaldi erwähnte Bartholomäus. Den Heiligen, der bei lebendigem Leibe gehäutet wurde. Stefano arbeitete auf diesem Gebiet, er kannte sich aus. Die Kirche auf der Tiberinsel wurde zum Gedenken an Bartholomäus errichtet. Etwas anderes fällt mir nicht ein.«
»Das ist alles?« Costa sah seine Hoffnungen schwinden.
»Das ist alles«, bestätigte sie spitz. »Es sei denn, Sie haben eine bessere Idee.«
Die beiden Polizisten sahen sich an. Der spärliche Verkehr ermöglichte ein zügiges Vorankommen am Flussufer entlang. Schon bald fuhren sie über den Ponte Cestio auf die kleine Isola Tiberina.
»Dieser Stefano Rinaldi war Ihr Freund?«, fragte Rossi, als sie vor der Kirche hielten.
Sara Farnese würdigte ihn keiner Antwort und sprang aus dem Wagen, bevor er ganz hielt.
»Außer sich vor Angst«, murmelte Rossi kopfschüttelnd. Auch die beiden Männer stiegen aus und blickten zur Kirche hinüber. Die Insel inmitten des Flusses war uraltes, unverfälschtes Rom. Kaum vorstellbar, dass hier irgendetwas nicht stimmen sollte. Sie standen auf einer kopfsteingepflasterten Piazza, auf der man abseits vom Verkehrslärm auf Bänken im Schatten sitzen konnte.
»Was meinst du? Sollten wir vielleicht Meldung machen?«, erkundigte sich Rossi.
Costa zuckte mit den Schultern. »Weshalb? Sie werden uns noch früh genug die Hammelbeine langziehen.«
»Hast Recht. Mal sehen, ob ich irgendwo einen Küster auftreiben kann. Wir brauchen bestimmt Schlüssel.«
Die Frau stand bereits vor dem Portal.
»Moment«, rief Costa. »Warten Sie.«
Aber sie drückte die Tür auf und war verschwunden. Fluchend rannte Costa ihr hastig hinterher und schrie Rossi zu, ihm zu folgen.
Das Gotteshaus war leer. Costa stand im Mittelgang, blickte auf die Reihen schimmernder Säulen und fühlte sich wie immer in Kirchen: unbehaglich. Er führte das auf seine Erziehung zurück. Kirchen hatten für ihn häufig etwas Unheimliches.
Sie spähten in die schwach beleuchteten Seitenkapellen und öffneten einige Türen, die in pechfinstere Nebengelasse führten.
»Hier ist nichts«, erklärte Sara Farnese.
Costa sah sich um, dachte nach. Sie wirkte enttäuscht, wie um eine Hoffnung betrogen.
»Es war den Versuch wert«, versicherte er. »Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen.«
»Die mache ich mir bereits«, entgegnete sie leise. »Aber hier muss es weitere Räumlichkeiten geben. Wir waren schon einmal hier, im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit. Die Kirche wurde auf einem Äskulaptempel errichtet. Vielleicht unterirdisch, in Kellergewölben.«
»Äsku ...?«
»Äskulap, der Gott der Heilkunst.« Sie sah ihn an. »Das wäre doch ein weiterer Hinweis. Oder?«
»Kann sein.« Costa resignierte. Im Kopf dieser Frau ging mehr vor, als er begreifen konnte. Er fragte sich, ob sie ihre Logik selbst noch verstand.
Rossi betrat das Kirchenschiff und schwenkte ein großes Schlüsselbund. Plötzlich verspürte Costa Verlegenheit darüber, an Rossi vorbei die Initiative an sich gerissen zu haben. Sein Kollege war älter. Besaß mehr Erfahrung.
»Wir haben uns schon überall umgesehen, denn es steht alles offen«, sagte Costa. »Nichts.«
»Dann sollten wir besser das Revier informieren.« Rossi schien erleichtert, die Verantwortung an andere abtreten zu können.
Wie gebannt starrte Sara Farnese auf eine kleine Tür links vor dem Altar. »Da drüben.«
»Da haben wir bereits nachgesehen«, wandte Costa ein.
»Nein. Es gibt hier einen Campanile. Wir haben den Zugang zum Glockenturm noch nicht gefunden.«
Costa lief zur Tür und schob sie auf. Der Raum dahinter war klein und dunkel. Costa zog seine Taschenlampe hervor und sah in ihrem Schein, was ihnen zunächst entgangen war. Die Treppe befand sich hinter einem mit einem Vorhängeschloss versehenen Gitter in der hinteren Ecke. Rossi stöhnte erst, suchte dann aber nach dem passenden Schlüssel, öffnete das Gitter und stieg in der Finsternis die Stufen hinauf.
»Großer Gott! Was war denn das?«
Rossis Entsetzensschreie hallten von den Mauern wider.
Costas tastende Hand fand einen Schalter. Eine Glühbirne erleuchtete das Erdgeschoss des Campanile und die steinerne Wendeltreppe, die in die Höhe führte.
Immer noch schreiend kam Rossi die Treppe heruntergestolpert. Sein kahler Schädel war rot von Blut. Es lief ihm über die Schläfen, in die Augen. Er zwinkerte heftig, wischte sich krampfhaft mit einem Taschentuch über den Kopf – und schrie unaufhörlich. Zum ersten Mal in seiner Polizeilaufbahn wurde Nic Costa plötzlich übel. Er befand sich jetzt dicht vor den Stufen, und im engen Schacht der Wendeltreppe roch es ekelerregend süßlich nach Fleisch, nach verwesendem Fleisch. Er richtete den Lichtstrahl seiner Taschenlampe nach oben. Von der Holzdecke über der Treppe tropfte langsam, aber unablässig Blut.
»Wir brauchen dringend Unterstützung.« Costa zog das Funkgerät aus der Tasche.
Er blickte Sara Farnese an und wollte seinen Augen nicht trauen. Sie drängte sich hastig an Rossi vorbei und eilte die Treppe hinauf. »Nein. Bleiben Sie hier!«, schrie er. »Rühren Sie da oben bloß nichts an! Auf keinen Fall! Hören Sie? Allmächtiger ...!«
Sein Partner wirkte wie von Sinnen. Er wischte sich fieberhaft das Gesicht, als wäre das Blut eine giftige Säure, die ihm die Haut zerfraß. Costa schaltete das Gerät ein und schickte einen Notruf. Er forderte Rossi auf, unten zu bleiben und auf seine Rückkehr zu warten. Der Ausdruck auf dem Gesicht des älteren Mannes gefiel ihm gar nicht. Er hatte etwas Wahnsinniges, etwas, das von übermenschlichem Grauen sprach. Nic Costa empfand ähnlich, aber Sara Farnese hatte die Stufen bereits bewältigt, und er wollte nicht, dass sie da oben allein war.
Er hörte, dass oben ein Schalter angeknipst wurde. Schummriges Licht fiel auf die Treppenstufen. Dann gab Sara Farnese ein Geräusch von sich, etwas zwischen Keuchen und Schreien. Es war ihre erste wirkliche Gefühlsäußerung seit dem Blutbad in der Vatikanischen Bibliothek vor einer halben Stunde.
»Verdammt«, fluchte Costa und nahm zwei Stufen auf einmal.
Sie war zu Boden gesunken und lehnte mit dem Rücken an der Wand. Sie hatte die Hand vor dem Mund, ihre grünen Augen wirkten riesig und schreckensstarr. Costa folgte ihrem Blick. Eine einsame Glühbirne beleuchtete die Toten, und Costa hatte Mühe, seinen Mageninhalt bei sich zu behalten.
Es befanden sich zwei Leichen im Raum. Die Frau war mit einem dunklen Rock und einer roten Bluse bekleidet. Sie hing an einem Seil von einem Deckenbalken. In der Nähe ihrer Beine lag ein alter Holzstuhl – entweder unter ihren Füßen umgestoßen oder von selbst umgestürzt, als sie versucht hatte, sich zu retten. Costa vermied allzu neugierige Blicke in ihr Gesicht, aber sie schien Mitte dreißig zu sein, mit strähnigen, blonden Haaren und lederähnlicher Haut.
Die zweite Leiche war zwei Meter entfernt an einen senkrechten Balken gefesselt: ein Mann mit goldblonder Haarmähne und vom Schmerz eines schrecklichen Todes verzerrten Gesichtszügen. Ein Knebel zwischen den Zähnen verzog seine blutleeren Lippen und schneeweißen Zähne zu einem ironischen Lächeln. Seine Arme waren hoch über dem Kopf an den altersschwarzen Balken gebunden. Seine Füße baumelten ein paar Zentimeter über dem Holzboden. Nur Kopf, Hände, Füße und Lenden waren durch Haut geschützt.
Fliegen umsurrten das nackte Fleisch. Ihr Summen erfüllte den kleinen, kreisrunden Raum. Und an die Wände war immer wieder und mit dem Blut des Toten der Satz geschrieben, den Sara Farnese heute zweimal aus Stefanos Mund in der Vatikanischen Bibliothek gehört hatte: »Das Blut der Märtyrer ist die Saat der Kirche«. Und genau hinter dem Mordopfer zwei Zeilen in englischer Sprache. Die Worte lasen sich wie der Anfang eines Gedichtes:
As I was going to St. Ives
I met a man with seven wives.
Nic Costa schluckte krampfhaft und warf einen Blick auf Sara Farnese. Sie konnte die Augen nicht von der blutigen, geschundenen Leiche losreißen. Sie sah aus, als würde sie jeden Moment den Verstand verlieren.
Mit zwei Schritten war er neben ihr, kniete sich zwischen sie und den Toten und griff nach ihrer Hand.
»Sie müssen hier weg. Unbedingt. Sofort.«
Sie versuchte, um ihn herum wieder die Leiche zu betrachten. Costa umfasste ihr Gesicht und zwang sie, ihn anzusehen.
»Das ist nichts für Sie. Sehen Sie nicht mehr hin. Bitte.«
Als Sara Farnese sich noch immer nicht rührte, hob er sie auf die Arme und trug sie so behutsam wie möglich die Treppe hinunter.
Rossi hatte den Treppenvorraum verlassen. Als Costa mit Sara Farnese vorbeikam, murmelte er, dass Verstärkung unterwegs sei. Costa trug sie ins Kirchenschiff und setzte sie in die erste Bank. Sie starrte blicklos auf den Altar. In ihren Augen standen Tränen.
»Ich muss dringend noch etwas erledigen«, sagte er. »Warten Sie hier auf mich?«
Sie nickte.
Costa bat Rossi, bei der Frau zu bleiben, holte tief Luft und lief wieder die Stufen in den ersten Stock des Glockenturms hinauf. Der Ausweis der Frau steckte in ihrer Handtasche. Die Kleidungsstücke des Mannes lagen auf einem unordentlichen Haufen neben seiner Leiche. In einer Sakkotasche fand Costa einen britischen Pass und einen Bordkartenabschnitt. Offenbar war er erst am Morgen aus London eingeflogen.
Zehn Minuten später trafen die Fachleute ein: Spurensicherer, Kriminaltechniker, Rechtsmediziner, ein ganzes Geschwader von Männern und Frauen in weißen Plastikanzügen, die ihn aus dem Weg haben wollten, um ihre Arbeit tun zu können. Angeführt von Teresa Lupo, der Pathologin, die alle Polizisten insgeheim bewunderten. Natürlich, es war vorhersehbar, dass Crazy Teresa sich einen solchen Fall nicht entgehen ließ. Vermutlich wusste sie, dass der Alte auch erscheinen würde. Der Revierklatsch besagte, dass zwischen den beiden neuerdings etwas lief.
Leo Falcone musterte die gehäutete Leiche so versonnen, als wäre sie ein Ausstellungsobjekt in einem Museum. Wie immer sah der Inspektor aus wie aus dem Ei gepellt. Er trug eine rote Seidenkrawatte über dem blütenweißen Hemd, einen hellbraunen Anzug und spiegelblank geputzte Schuhe. Mit total kahlem Schädel, walnussbraunem Teint und einem silbernen, sogfältig gestutzten Spitzbart sah er aus wie ein Schauspieler, der auf der Bühne den Teufel verkörpert. Er musterte Costa und sagte mit anzüglicher Bosheit: »Ich habe Sie losgeschickt, um Handtaschendiebstähle zu verhindern. Was hat das hier zu bedeuten?«
Eines Tages würde er vor allen Leuten ausrasten, dachte Costa. Irgendwann würde Falcone ihn dazu bringen.
»Die Frau war mit dem Toten aus der Bibliothek verheiratet«, sagte er. »Ich habe in ihrer Handtasche nachgesehen. Sie befindet sich bei den Kleidungsstücken des anderen Opfers.«
»Und der andere Tote?«, wollte Falcone wissen.
Am liebsten hätte Nic Costa ihn angebrüllt. Er hatte sich nicht um den Fall gerissen. Er konnte sich angenehmere Ermittlungen vorstellen. Vor allem wollte er nicht, dass Sara Farnese langsam, aber sicher den Verstand verlor, wenn sie zu begreifen begann, was sich vor ihren Augen ereignet hatte.
»Muss noch identifiziert werden«, antwortete er, drehte sich um und lief die Treppe hinunter.
Zu seiner Enttäuschung war Rossi nicht bei Sara Farnese geblieben. Costa machte ihn draußen vor der Kirche ausfindig, wo er im Schatten eines Baumes stand und gierig an einer Zigarette zog.
»Hat sie irgendetwas gesagt?«, fragte Costa.
Rossi schwieg. Das Verbrechen war schauerlich genug, aber Costa spürte, dass die fassungslose Erschütterung seines Kollegen nicht allein auf den Schock zurückzuführen war. Von seinem Kollegen ging etwas aus, das er sich nicht erklären konnte.
»Kein Wort«, äußerte Luca Rossi schließlich, sah Costa aber nicht an. Er verzog das Gesicht. »Ich hatte eine Heidenangst da drinnen. Ich habe mich echt nicht in den Raum da oben getraut. Mist ...«
»Die Sache würde doch niemanden kalt lassen.«
»Blödsinn!«, zischte Rossi. »Du bist da reinmarschiert, als mache es dir überhaupt nichts aus.« Er zeigte auf die Tatortermittler, die vor der Kirchentür standen und rauchten. »Mit ihnen ist es das Gleiche.«
»Sie sind genauso durcheinander. Glaub mir. Wir sind alle erschüttert.«
»Erschüttert?«, wiederholte Rossi höhnisch. »Falcone sieht aus, als könnte er neben der Leiche da oben in Seelenruhe sein Frühstück verputzen.«
»Luca ...« Costa verstummte kurz, fuhr dann aber entschlossen fort: »Was ist eigentlich los? Warum sind wir ein Team? Warum hat man dich zu uns versetzt?«
Bedrückt sah der ältere Mann ihn an. »Sie haben es dir also nie gesagt?«
»Nein.«
»Himmel.« Mit fahriger Hand drückte Rossi seine Zigarette aus und suchte sofort nach einer neuen. »Du willst es also unbedingt wissen, ja? Irgendwann wurde ich zu einem Verkehrsunfall geschickt. Passiert immer wieder, wie du weißt. Aber diesmal war es ein bisschen anders. Der Vater saß hinter dem Steuer, sturzbetrunken. Und vor ihm auf der Fahrbahn lag sein Kind. Glatt durch die Windschutzscheibe geschleudert. Tot. Sehr tot.«
Rossi schüttelte den massigen Kopf. »Aber weißt du, was die größte Sorge dieses Vaters war? Sich herauszureden. Er wollte mir allen Ernstes vormachen, er hätte keinen Tropfen getrunken.«
»Die Straßen sind voll von Idioten. Was wäre daran so neu?«
»Das werde ich dir sagen. Ich packte den Idioten am Kragen und nahm ihn mir vor. Gründlich. Wäre die Verkehrsstreife nicht gewesen, hätte ich den Mistkerl wahrscheinlich umgebracht.«
Costa warf einen Blick in die Kirche, überzeugte sich, dass Sara Farnese noch vor dem Altar saß. Als er zurückkam, blickten Rossis traurige Augen ihn durchdringend an.
»Ich wurde versetzt, weil man verhindern wollte, dass er Anzeige gegen mich erstattet. Ehrlich gesagt, macht es mir nichts aus, jedenfalls nicht mehr. Ich bin achtundvierzig, unverheiratet und nicht gerade gesellig. Meine Abende verbringe ich mit Bier und Pizza vor dem Fernseher, und bis zu dem Moment war es mir gleich. Völlig egal. Doch manchmal fällt es einem aus den überraschendsten Gründen wie Schuppen von den Augen. Mir ist das passiert. Und dir wird es irgendwann auch passieren. Vielleicht kommst du nicht mehr so mit wie früher, und es ärgert dich, dass irgendein superschlauer Neuer dir die Butter vom Brot nehmen will, und du erkennst, was für ein Mist das alles eigentlich ist. Vielleicht öffnen dir auch ernstere Dinge die Augen. Aber eines Tages begreifst du, dass es nicht nur ein Spiel ist. Menschen sterben absolut sinn- und grundlos. Und irgendwann bist du dran.«
»Nie habe ich gedacht, es könnte anders sein«, entgegnete Costa. Er glaubte, in Rossis Stimme persönliche Ressentiments gegen ihn zu hören. Das gefiel ihm nicht. »Geh nach Hause, Luca. Leg dich ein bisschen aufs Ohr. Ich komme hier schon klar.«
»Den Teufel wirst du. Glaubst du denn, ich will mir morgen Falcones Strafpredigt anhören?«
Costa griff in die Jackentasche seines Partners und zog die Zigarettenschachtel heraus. Sie war fast leer. »Nun, dann rauch noch eine. Wir können später weiterreden.«
Rossi nickte zur Kirche hinüber. »Und willst du noch etwas wissen? Ich werde es dir sagen. Aber ich bezweifle, dass du es hören willst.«
»Was?«
»Sie jagt mir Angst ein. Die Frau da drinnen. Wie kann sie nur so ruhig bleiben. Das ist doch nicht normal. Sie ist heute fast gestorben. Sie hat die Toten da oben gesehen ... Nein, erspar mir die Einzelheiten. Ich will nicht, dass Menschen ohne Haut durch meine Träume geistern. Es würde mir den Schlaf rauben. Aber sie macht den Eindruck, als ließe sie das alles völlig kalt. Als müsste es so sein.«
»Du hast sie da oben nicht erlebt, Luca«, schwang sich Nic Costa zu Sara Farneses Verteidigung auf. »Du kannst es nicht beurteilen. Und ich schätze, du warst auch nicht lange genug mit ihr in der Kirche. Du hast nicht erlebt, wie sie nicht wusste, wohin sie blicken sollte, und am liebsten in Tränen ausgebrochen wäre. Bei manchen Leuten dauert es länger. Das solltest du eigentlich wissen.«
Luca Rossi stieß ihm mit dem Zeigefinger derb gegen die Brust. »Du hast Recht. Ich habe es nicht gesehen.«
Crazy Teresa trat aus der Kirche, entdeckte sie, kam zu ihnen herüber und bettelte Rossi um eine Zigarette an. Er nickte ein bißchen mürrisch, und sie schlüpfte aus ihrem weißen Kunststoff-Overall. Sie war eine üppige Frau in den Dreißigern mit einem langen, schwarzen Pferdeschwanz. Irgendwie sah sie aus wie Rossi, ein bisschen durch den Wind. Sie trug die geräumigsten Jeans, die Costa je zu Gesicht bekommen hatte, und ein zerknautschtes pinkfarbenes T-Shirt. Teresa steckte sich die Zigarette an, blies eine Rauchwolke in die glutheiße Nachmittagsluft und setzte ein geradezu seliges Lächeln auf. »Tage wie heute lassen einen die Arbeit wieder schätzen. Findet ihr nicht auch. Jungs?«
Costa verdrehte die Augen und kehrte in die Kirche zurück.
Sie kniete vor dem Altar und betete mit weit offenen Augen, ihre Hände vor ihrem blutbespritzten Rock gefaltet. Costa wartete ein paar Minuten, bis sie fertig war. Er wusste, was ihre Blicke anzog. Hinter einer goldenen Ikone mit einem Christuskopf hing ein größeres Gemälde an der Wand. Es zeigte Bartholomäus kurz vor dem Märtyrertod. Seine Hände waren hoch über seinem Kopf an einen Holzbalken gefesselt, genau wie bei der Leiche im Glockenturm. Neben ihm stand ein finsterer Henker mit einem Messer und blickte ihm in die Augen, als wüsste er nicht recht, wo er anfangen sollte.
Schließlich stand Sara Farnese auf und setzte sich neben ihn auf die Bank.
»Wir können uns auch Zeit lassen«, sagte er. »Es braucht nicht sofort zu sein.«
»Stellen Sie ruhig Ihre Fragen. Ich möchte es lieber hinter mich bringen.«
»Das verstehe ich.«
Sie wirkte wieder ganz ruhig, und Costa dachte an Rossis Worte. Sara Farnese war wirklich eine ungemein beherrschte Frau.
»Was verband Sie mit diesem Stefano Rinaldi?«, fragte er. »In welcher Beziehung standen Sie zu ihm?«
Sie zögerte, aber nur kurz. »Er war Professor und gehörte meiner Fakultät an. Ich hatte eine Affäre mit ihm. Wollten Sie das hören? Aber nur kurz. Die Beziehung ist seit Monaten beendet.«
»Und die Tote im Campanile, seine Frau ...«
»Mary. Sie ist Engländerin.«
»Das habe ich den Ausweispapieren in ihrer Handtasche entnommen. Wusste sie davon?«
Sara Farnese sah ihn an. »Sie wollen alles sofort und auf der Stelle hören?«
»Nur wenn es Ihnen recht ist. Wir können es auch verschieben. Ich überlasse Ihnen die Entscheidung.«
Sara Farnese betrachtete wieder das Gemälde hinter dem Altar. »Sie kam dahinter. Damit endete unsere Affäre. Ich weiß nicht recht, warum sie überhaupt begann. Es war Freundschaft, aus der plötzlich mehr wurde. Stefano und Mary führten keine besonders glückliche Ehe. Aber das lag nicht an mir.«
Costa zog eine Plastikhülle aus der Sakkotasche. In ihr befand sich ein handbeschriebener Zettel. »Ich versuche lediglich Licht in die Vorgänge zu bringen. Urteile kommen mir nicht zu, und ich maße sie mir auch nicht an. Das hier habe ich in der Kleidung des anderen Toten gefunden. Offenbar eine Nachricht, die ihm heute früh auf dem Flughafen übergeben wurde. Sie besagt, dass Sie sich so schnell wie möglich hier in der Kirche mit ihm treffen wollen. Es sei sehr wichtig. Stammt die Nachricht von Ihnen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Woher wusste Rinaldi, dass er nach Rom kommen würde?«
»Keine Ahnung. Vielleicht habe ich in der Uni eine Andeutung gemacht. Ich weiß es wirklich nicht.«
»War der andere Mann Ihr Geliebter?«
Das Wort ließ sie zusammenzucken. »Wir ... haben uns hin und wieder getroffen. Er heißt Hugh ...«
»Fairchild. Ich weiß. Er hatte seinen Pass bei sich. Wollen Sie ihn sehen?«
»Warum?«
»Aus ihm geht hervor, dass er verheiratet ist.«
»Nein«, sagte sie kühl. »Der Pass interessiert mich nicht.«
»War Ihnen das bekannt?«
»Ist das wichtig?«
Was ist nur mit mir los, fragte sich Costa. Warum will ich das wissen? »Wahrscheinlich nicht. An die Wände wurde mehrmals dieser Spruch über das Blut der Märtyrer geschrieben. Und dann diese anderen Zeilen. Wer ist dieser Sankt Ives? Ein weiterer Heiliger?«
»Nein. Ein Ort in England.«
»Und sieben Frauen?«
»Ich wusste ja nicht einmal, dass er eine hat«, entgegnete sie bitter.
»Was hat sich Ihrer Meinung nach hier abgespielt?«
Sara Farneses grüne Augen funkelten ihn zornig an. »Sie sind der Polizist. Sagen Sie es mir.«
Costa hasste voreilige Schlüsse, aber genau das schien die Frau von ihm zu erwarten. Er zuckte mit den Schultern. »Jedem, der diese Nachricht sieht, bietet sich eine Erklärung förmlich an. Ihr Exfreund hat von Ihrem neuen Geliebten erfahren und beschlossen, ihn umzubringen und seine Frau gleich mit. Möglicherweise sogar auch Sie.«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Stefano mich nicht töten wollte. Und nennen Sie sie nicht ›Geliebte‹. Es waren Männer, mit denen ich gelegentlich geschlafen habe. In Stefanos Fall ist das Monate her.«
Costa konnte es nicht fassen. Selbst jetzt, kalkweiß, geschockt und mit tiefen Schatten unter den Augen, war Sara Farnese eine wunderschöne Frau. Er begriff nicht, warum jemand wie sie ein so oberflächliches, sinnloses Leben führen konnte.
»Menschen drehen aus den unterschiedlichsten Gründen durch«, sagte er. »Und aus den überraschendsten.« Männer gehen eine Treppe hinauf, und es tropft das Blut von Toten auf ihren Schädel. Menschen, die man liebt, verlassen morgens das Haus und kommen abends mit der Diagnose einer tödlichen Krankheit zurück.
»Mag sein.« Sie wirkte nicht überzeugt.
»Ich bedauere, dass ich Ihnen diese Fragen stellen musste. Aber Sie verstehen, dass es nötig war?«
Sie schwieg, blickte wie gebannt auf das Gemälde hinter dem Altar.
»Es ist nicht eindeutig bewiesen«, stellte sie sachlich fest.
»Was?«
»Dass Bartholomäus gehäutet wurde. Er starb den Märtyrertod, das ist sicher, aber vermutlich auf weniger drastische Weise. Enthaupten war die übliche Methode. Die frühe Kirche schmückte die Heiligenlegenden aus, um Zweifler bei der Stange zu halten. Um den Glauben in den noch jungen Gemeinden zu stärken.«
»Daher also der Spruch ›Das Blut der Märtyrer ist die Saat der Kirche‹?«
Sie sah ihn an. Überrascht, wie Costa fand.
»Gibt es Verwandte, die ich anrufen könnte? Freunde?«, fragte er.
»Niemanden, danke.«
»Niemanden? Und Ihre Eltern?«
»Meine Eltern sind lange tot.«
»Es gibt Fachleute, die in Situationen wie dieser helfen können. Psychiater.«
»Falls ich das für nötig halte, werde ich es Sie wissen lassen.«
Wieder musste er an Rossis Worte denken. In der Frau steckte mehr, als der erste Augenschein vermuten ließ.
»Beten Sie hin und wieder?«, fragte sie unvermittelt.
Costa zuckte mit den Schultern. »In unserer Familie ist es eher unüblich. Und ich weiß nie, um was ich bitten soll.«
»Oh, um eine Antwort auf die noch immer offenen Fragen. Warum Gott, wenn es ihn gibt, zulässt, dass guten Menschen Böses angetan wird, beispielsweise.«
»Gute Menschen? Der Engländer und der, der ihn getötet hat?«
Sie dachte nach. »Jedenfalls waren es keine schlechten Menschen, wenn Sie das meinen.«
»Hören Sie«, sagte Costa, ohne nachzudenken. »Sie können sich glücklich schätzen, keine Polizistin zu sein. Wir stellen uns diese Frage ständig, und nicht nur die. Warum sind die Reichen so reich und die Armen so arm? Warum durfte Stalin in seinem Bett sterben? Mein Vater ist Kommunist. Als Junge habe ich ihn das ständig gefragt und bekam ebenso regelmäßig eins hinter die Ohren.«
Nic Costa staunte. Der leise Anflug eines Lächelns überzog Sara Farneses Gesicht. Es veränderte sie völlig. Sie wirkte jünger, mädchenhafter, inniger, war nicht mehr die kühle, abgeklärte, elegante Frau, die sie gewöhnlich der Welt vorspielte. Plötzlich konnte er verstehen, dass sich ein Mann leidenschaftlich in sie verliebte.
»Familie ist unverzichtbar«, stellte Costa fest. »Sie schützt gegen die Welt. Ich beneide niemanden, der sich ganz allein gegen diesen ganzen Mist behaupten muss.«
»Ich würde jetzt gern gehen.« Sara Farnese stand auf und lief über den Mittelgang auf die Tür zu, hinter der die Sonne endlich etwas von ihrer Glut verlor und der Tag seinem Ende zuging.
Nic Costa folgte ihr.
Kapitel Fünf
Am nächsten Morgen um acht wurden Costa und Rossi in Falcones Büro zitiert. Der Inspektor wirkte mürrischer denn je, seine Stirn zeigte Dauerfalten. Jeder fürchtete sein Temperament, niemand räumte ihm sonderliche Führungsqualitäten ein. Aber Falcone war ein fähiger Mann, und davon gab es nicht genug in den oberen Polizeirängen. Er hatte etliche schwierige Fälle gelöst, was ihm große Beachtung in den Zeitungen einbrachte. Sein Einfluss reichte über die Polizei hinaus. Respekt war ihm in der Questura gewiss, aber nur wenig Sympathie.
Vor ihm auf dem Schreibtisch lagen die bisherigen Ermittlungsergebnisse im Fall Rinaldi.
Falcone hob die Papiere und wedelte ihnen damit vor den Gesichtern herum. »Dürftig«, knurrte er.
»Wir arbeiten bereits an einem umfassenderen Bericht«, erklärte Nic Costa. »Gegen zehn haben Sie ihn auf dem Tisch.«
Unbehaglich rutschte Rossi auf seinem Stuhl hin und her. Falcone starrte ihn an, als wollte er sagen: Jetzt spricht der Junge also schon für Sie?
»Haben Sie irgendetwas über diese Farnese?«, erkundigte sich Falcone.
Costa schüttelte den Kopf. »Was meinen Sie damit? Ob sie aktenkundig ist, ob Vorstrafen bekannt sind?«
»Genau das meine ich.«
»Sie ist sauber«, sagte Rossi. »Ich habe mich gestern Abend in unserer Datei überzeugt. Offenbar ist sie nicht einmal irgendwann zu schnell gefahren.«
Falcone beugte sich vor und zwang Costa, ihm in die Augen zu blicken. »Sie dürfen diese Dinge nicht außer Acht lassen.«
»Ich weiß. Tut mir leid.«
»Wie stellt sich der Fall dar?« Falcone lehnte sich zurück. »Der abgeschobene Freund beseitigt den neuen Freund und bringt seine Frau gleich mit um die Ecke?«
»Sieht ganz danach aus«, sagte Costa.
Falcone hob die Schultern. »Ich stimme Ihnen zu. Es sieht ganz so aus. Ich habe vorhin mit denen von der Spurensicherung gesprochen. Sie haben keine Hinweise darauf gefunden, dass sich außer den beiden Opfern und Rinaldi noch jemand im Glockenturm aufgehalten hat.«
»Und wo liegt dann das Problem?«
»Das Problem?« Falcone nickte Rossi zu. »Fragen Sie ihn.«
Costa sah seinen Partner an. Die gestrige Auseinandersetzung stand immer noch zwischen ihnen. Wir müssen uns unbedingt aussprechen, dachte er. Er schätzte den älteren Kollegen. Er wollte ihre Zusammenarbeit nicht mit Unstimmigkeiten belasten.
»Nun, Luca?«, fragte er.
Rossi runzelte die Stirn. »Das Problem ist der Zeitpunkt. Rinaldis Beziehung mit der Farnese endete vor drei, vier Monaten. Also warum jetzt?«
»Vielleicht hat er erst vor kurzem von dem Engländer erfahren«, spekulierte Costa. »Er musste sich anhören, wie sehr sie ihn mag, und bei ihm ist die Sicherung durchgeknallt.«
Falcone hob eine Hand. »Woher wollen Sie das wissen? In Ihrem Bericht steht nichts davon.«
Costa erinnerte sich an die Unterhaltung mit Sara Farnese. »Nein.«
»Wir müssen uns die Frau noch einmal vorknöpfen«, ordnete Falcone an. »Um Einzelheiten über die Beziehung zu erfahren. Wir brauchen Daten, Fakten, Motive.«
Costa nickte. »In Ordnung.« Rossi sah aus dem Fenster, kramte in seiner Jackentasche nach einer Zigarette. Wir haben ausführlich über die Sache gesprochen, dachte Costa. Es kann keine andere Erklärung geben.