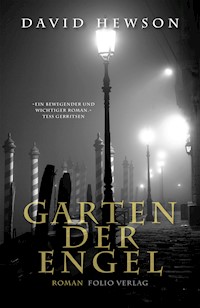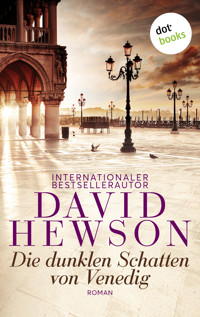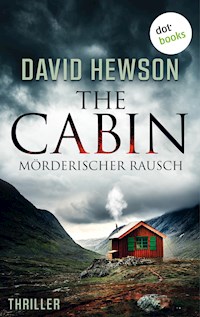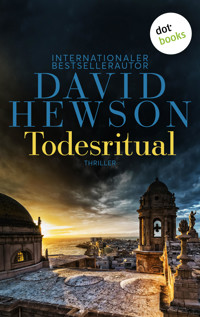Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wurde dem erfolgreichen TV-Historiker Marmaduke Godolphin seine intrigante Rücksichtslosigkeit zum Verhängnis? Godolphin ist alles andere als ein umgänglicher Zeitgenosse und berüchtigt für seinen Narzissmus. Um seine ins Stocken geratene Fernsehkarriere zu befeuern, plant der »Duke« die Inszenierung einer sensationellen historischen Entdeckung rund um zwei Morde an Mitgliedern der Medici-Familie im 16. Jahrhundert. Auch ehemalige Schüler:innen und Weggefährt:innen aus seiner Zeit in Cambridge hat er dazu nach Venedig eingeladen. Doch bevor es zur Enthüllung kommt, wird Godolphin tot in einem canale aufgefunden. Ermittlerin Valentina Fabbri hat Verdächtige genug. Sie bittet den pensionierten Archivar Arnold Clover um Mithilfe. Winterliches Venedig + ungleiches Ermittlerpaar + fesselnde Historie = große Unterhaltung! Nach dem Erfolg von "Garten der Engel" David Hewsons neuer Venedig-Krimi
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Ian Reid
DAVID HEWSON, geboren 1953, lebt in Kent. Er hat zwölf Romane geschrieben, die in Italien spielen. Mit siebzehn verließ er die Schule und arbeitete von da an als Reporter, u. a. für The Times, The Sunday Times und The Independent. Bekannt wurde er durch die Krimiserie um den römischen Kommissar Nic Costa und seine Roman-Adaption der dänischen TV-Serie Das Verbrechen. Venedig besucht er seit dreißig Jahren.
Bei Folio ist erschienen: Garten der Engel (2023).
DIE ÜBERSETZERIN
Birgit Salzmann, geboren 1964, studierte Deutsche Sprache und Literatur, Anglistik und Romanistik und übersetzt englischsprachige Literatur ins Deutsche. Nach Venedig zieht es auch sie seit dreißig Jahren. Sie lebt in Marburg.
DAVID HEWSON
DIE MEDICI-MORDE
EIN VENEDIG-KRIMI
Aus dem Englischen von Birgit Salzmann
FOLIO VERLAG
WIEN • BOZEN
Inhaltsverzeichnis
1 Auf signora capitanos Geheiß
2 Der Goldene Zirkel
3 Die Blut-passeggiata
4 Die Attentäter von einst
5 Der Nachlass Wolff
6 Geheimnisse
7 Die Palimpseste
8 Ein Ausflug nach Verona
9 Ende der Vorstellung
10 Der Zirkel, fest vereint
11 Ein Phantom in der Dunkelheit
12 Ein Dolch im Herzen
13 Asche auf dem Wasser
Anmerkung des Autors
Zitatnachweise
1
Auf signora capitanos Geheiß
Der Morgen, an dem ich herbeizitiert wurde, um einen Mordfall zu lösen, war sonnig, kalt und voller Tauben. Sie bevölkerten den Weg von meiner Wohnung in Dorsoduro über die Accademia-Brücke, vorbei an den Cafés auf der Piazza, wo eine ganze Schar der grauen Plagegeister unaufhörlich um eine Gruppe von Karnevalsbesuchern herumflatterte, die so unbedacht waren, ihr Gebäck im Freien zu essen.
Die Römer fürchteten die Eule, Edgar Allan Poe fürchtete den Raben. Ein alter Bauer, den ich in meiner Kindheit in Yorkshire kannte, behauptete immer, wenn ein Rotkehlchen ins Haus flöge, sei das die Prophezeiung des Todes. Es sei denn, es passierte im November, dann blieben alle am Leben. Vielleicht sind Tauben, „geflügelte Ratten“, zu gewöhnlich, zu verfressen und zu lästig, um Vorboten des Todes zu sein. In diesem Fall kamen sie ohnehin zu spät. Die Leiche lag schon auf dem Seziertisch, was der Grund dafür war, dass ich an diesem eisigen Februartag quer durch Venedig lief, während mich diese flügelschlagenden Biester nervten. Beinah kam es mir vor, als gurrten sie eine Warnung: Es ist Carnevale, es ist bitterkalt, überall Fremde, hinter Masken verborgen. Nichts in dieser Stadt ist wirklich oder offenbar, beständig oder ohne Gefahr. Nimm dich in Acht.
Obwohl ich mir das sicher nur einbildete. Irgendetwas an Venedig weckte immer die seltsamsten Fantasien in mir.
Mein Ziel lag kurz hinter dem Dogenpalast und der berühmten byzantinischen Basilika, dem altehrwürdigen Mittelpunkt der Stadt, der jahraus, jahrein Heerscharen von Touristen anzog. Der kleine Campo San Zaccaria hingegen war wie gewöhnlich leer. Nur wenige der unzähligen Menschen, die ziellos über die Piazza schlenderten, schienen zu wissen, was sich unweit der Uferpromenade Riva degli Schiavoni mit ihrem unzählige Male abgebildeten Ausblick über das Becken von San Marco hinüber zum Campanile von San Giorgio befand, der sich einsam auf seiner eigenen kleinen Insel erhebt.
Am Ende einer schmalen Seitengasse gelangte man zu der wunderschönen Kirche San Zaccaria, in deren stimmungsvoll beleuchteter Krypta, die wegen der nahe gelegenen Lagune fast das ganze Jahr unter Wasser steht, die ersten Dogen beigesetzt wurden. Passenderweise, wie ich fand, waren doch zwei von ihnen von Verschwörern und einer wütenden Meute irgendwo in den Gassen rund um den Campo ermordet worden.
Einst stand auf dem Areal ein Kloster, dessen Obstgarten die Nonnen, die es bewohnten, unter dem Druck des Dogen verkauften, damit die Republik die Piazza San Marco bauen konnte. Das kleine Gotteshaus, das bis heute überdauert hat, ist älter als die berühmte Basilika in seiner Nachbarschaft. Benannt wurde es nach Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers, der von Herodes’ Soldaten beim Kindermord von Bethlehem getötet wurde und ebenfalls in der Krypta beerdigt sein soll. Da er außerdem Grabstätten in Aserbaidschan, Konstantinopel und Jerusalem besitzt, scheint San Zaccaria, wie er auf Venezianisch heißt, ein weitgereister Mann gewesen zu sein, obwohl sein Name heutzutage für viele nichts weiter als die Bezeichnung einer Vaporetto-Haltestelle ist.
Nachdem ich mich den größten Teil meines Lebens auf die ein oder andere Weise mit Geschichte beschäftigt habe, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass Venedigs Vergangenheit genauso ist wie die anderer Orte: veränderlich, dehnbar, leicht abzuwandeln, um sie der jeweiligen Sichtweise desjenigen anzupassen, der sie erzählt. Nur umfassender, außergewöhnlicher, glanzvoller. Schließlich bezieht sich das italienische Wort storia zugleich auf Geschichte und Fiktion. Und die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist schmal, manchmal kaum erkennbar.
Über dem Altar von San Zaccaria prangt Giovanni Bellinis Madonna mit Kind und Heiligen, eines der größten, wenn auch kaum beachteten, Meisterwerke der Stadt. Gemälde von Tintoretto, Van Dyck, Jacopo Palma und dessen Großneffen Palma il Giovane schmücken die Kapellen und die Wände des Hauptschiffs. Hin und wieder mache ich einen einsamen Ausflug in diese Kirche. Um einfach nur dazusitzen, ein Atheist, fasziniert von den Visionen des Paradieses und einer Welt stiller Ordnung und festen Glaubens. Heute hatte ich jedoch nur den Radau der Tauben im Kopf, die laut auf dem Dach gurrten und scharrten.
***
AN DIESEM WOLKENLOSEN, klirrend kalten Vormittag stand mir keine stille Kontemplation im Kirchenschiff von San Zaccaria bevor. Mein Ziel war deutlich profaner: das Hauptquartier der Carabinieri, ein hübsches ockerfarbenes Gebäude neben der Kirche, früher vielleicht Teil des ehemaligen Klosters. Ich weiß es nicht, und ich hatte nicht vor, danach zu fragen. Mit der Polizei hatte ich noch nie zu tun gehabt, abgesehen von dem einen Mal, als jemand direkt vor unserem Haus in Wimbledon unseren Ford Escort demoliert hatte; damals war sie sehr nützlich gewesen. Jetzt, so stellte sich heraus, hatte mich ein weiblicher capitano zu sich gerufen. Die Frau war Mitte bis Ende dreißig, hatte den wachen, intelligenten Blick einer Universitätsdozentin gepaart mit einer schlanken Gestalt, lackierten Fingernägeln und der perfekt sitzenden Frisur einer venezianischen Dame aus gehobenen Verhältnissen. Sie trug die traditionelle Carabinieri-Uniform, dunkelblau mit roten Lampassen, auffallend gut geschnitten für meine Begriffe, maßgeschneidert vielleicht. Jacke und Hose sahen aus wie frisch aus der Reinigung und ihre Besitzerin, als käme sie direkt aus dem Schönheitssalon.
„Signor Clover“, sagte sie mit ruhiger, selbstsicherer Stimme, die formell, aber nicht unfreundlich klang. „Nehmen Sie doch Platz.“ Davon gab es nur einen, gegenüber ihres Schreibtischs, in einem kleinen Büro, in dem sich außerdem nur noch ein Telefon und ein Computer befanden. Wie bei Scotland Yard wirkte es nicht gerade. „Danke, dass Sie gekommen sind.“
„Ich nahm an, ich hätte keine Wahl.“
„Stimmt“, antwortete sie. „Die hatten Sie nicht.“
Ich hoffte, ich würde nicht zittern. Inzwischen lebte ich seit drei Monaten in Venedig. Meine Papiere waren nach all den Terminen bei Stempel schwingenden Paragrafenreitern sicher in Ordnung. Kein Anlass also, mit einem der üblichen Probleme zu rechnen, mit denen man als Ausländer in Italien manchmal konfrontiert war. Trotzdem machte mich irgendetwas an dieser Frau nervös. Mein ganzes Wissen über Verhöre – wenn man es überhaupt Wissen nennen konnte – stammte aus Fernsehserien. Die mir, nun ja, irgendwie spektakulärer erschienen. Dieses Treffen hatte etwas Vertrautes, Persönliches, was die Atmosphäre in gewisser Weise noch unangenehmer machte.
„Capitana …“ Ich sah auf das Namensschild auf ihrem Schreibtisch. „Fabbri“, sagte ich.
Und erntete einen missbilligenden Blick.
„Capitano. Der Titel bezeichnet den Dienstgrad und hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich hätte ihr Italienisch für besser gehalten.“
Valentina Fabbri besaß einen scharfen Laserblick, der dem meiner verstorbenen Frau in nichts nachstand. Ich hatte das Gefühl, in dem stickigen, kleinen Raum darunter zu schrumpeln.
„Mein Italienisch war nicht das Problem, sondern mein Kenntnisstand.“
„Nennen Sie mich Valentina, wenn das einfacher für Sie ist.“
„Ich frage mich, warum Sie mich …“
„Aber Arnold, ich bitte Sie. Das wissen Sie doch sicher. Ich habe eine Leiche am Hals.“ Sie klang, als würde der Gedanke daran sie furchtbar ärgern. „Beziehungsweise in einem Kühlfach im Ospedale Civile. Eine verdammte Leiche. Die Leiche eines berühmten britischen Historikers. Eines Lords.“
„Eines Ritters“, stellte ich klar. „Das ist nicht dasselbe.“
„Ich räume meinen Fehler ein.“
Etwas, das nicht allzu oft vorkam, ihrem Tonfall nach zu urteilen.
„Wie kann ich da behilflich sein?“
„Es ist Carnevale. Wir haben alle Hände voll damit zu tun, uns um betrunkene Ausländer in albernen Kostümen zu kümmern, die aufeinander losgehen und am Ende irgendwo im Kanal landen.“
„Genau das ist passiert, nehme ich an? Ein tragischer Fall von Straßengewalt.“
„Bei uns? In Venedig?“ Sie reagierte empört. „Nein. Das hier trägt sämtliche Merkmale von Mord, von kaltblütigem, vorsätzlichem Mord. Aber die einzigen Morde, die wir hier kennen, sind die in den lächerlichen, von Ausländern verfassten Krimis. Im realen Leben ist das undenkbar. Inakzeptabel. Venedig ist eine Stadt der Schönheit, der Kunst und der Kultur. Und eine, die so viele Touristen wie möglich über den Piazzale Roma hereinschleust, um sie dann so schnell wie möglich wieder loszuwerden.“ Sie beugte sich nach vorn. „Lebend.“ Ein Stoß mit ihrem lackierten Zeigefinger in meine Richtung. „Immer … lebend.“
„Ein verständliches Anliegen, das Ihre Besucher sicher zu schätzen wissen.“
„Sie und ich, wir wissen beide, dass Ihr berühmter Historiker nicht von einem Venezianer umgebracht wurde. Wir wissen, dass die Lösung des Rätsels in Ihrem – wie nennen Sie es – in Ihrem Vergoldeten Kreis liegt.“
„Goldener Zirkel.“
„Exakt. Also, Sie sitzen alle seit gestern in Haft. Zusammen mit der jungen Amerikanerin, die den Mann und seinen Sohn hierher begleitet hat.“
„Miss Buckley sollte wohl seine Produzentin werden.“
„Sollte sie das? Keiner derjenigen, die ich in Gewahrsam habe, scheint jedenfalls vor Trauer zu vergehen.“
Ich sagte nichts.
„Das überrascht Sie offenbar nicht?“
„Sie werden ihre Gründe haben.“
„Ganz genau. Und die würde ich gerne erfahren. Ihre Gründe. Die Wahrheit. Die steht mir zu. Luca Volpetti, jemand, den ich schätze und respektiere, nicht zuletzt weil er eine Weile mit meiner Cousine ausgegangen ist, hat mir gesagt, Sie seien ein kluger, einfallsreicher Mann. Und dass Sie die Beteiligten alle kennen.“
Vielen Dank auch, Luca, dachte ich. „Sie sind mir bekannt. Flüchtig. Die Amerikanerin aber nicht, ebenso wenig wie der Sohn.“
Sie überprüfte ein paar Notizen vor sich. „Immerhin. Ihnen sind diese Leute bekannter als sonst irgendwem. Sie sind ebenfalls Engländer. Also haben Sie vielleicht mehr Einblick ins dunkle Labyrinth ihrer Gedankengänge als ich. Volpetti sagt, Sie hatten mit dem sonderbaren Vorhaben zu tun, das den Toten hierherführte.“
„Ebenso wie er selbst, aber …“
„Um es ganz deutlich zu sagen: Das Problem muss vom Tisch. Sie und ich werden uns darauf konzentrieren, es zu lösen. Unverzüglich. Ich möchte, dass der Fall bis heute Abend geklärt ist.“
Mit dem ersten Teil dieser Aussage hatte ich gerechnet. Mit der Frist allerdings nicht.
„Nehmen Mordermittlungen gewöhnlich nicht deutlich mehr Zeit in Anspruch? Ich meine … Spurensicherung? Gerichtsmedizin? Alles, was man im Fernsehen so sieht?“
Ihr Aufstöhnen signalisierte mir, dass meine Frage lächerlich war. „Wir sind in Venedig. An Carnevale. Nicht im Fernsehen. Ich will, dass die Sache bis heute Abend erledigt ist. Franco, mein Mann, betreibt das Il Pagliaccio, das Restaurant. In der Nähe der Accademia. Kennen Sie es?“
Das vornehmste und teuerste Schickimicki-Lokal im vornehmsten und teuersten sestiere der Stadt.
„Ein wenig jenseits meines Budgets, was ich so höre. Außerdem …“ Ich deutete auf mein Outfit. Ein mindestens fünfzehn Jahre altes Tweedjackett. Darunter ein rotkariertes Holzfällerhemd, ein Weihnachtsgeschenk von Gott weiß wann. Zerschlissene Jeans Marke Billigheimer. Und an dem Haken hinter der Tür hing der Dufflecoat, den ich aus Wimbledon mitgebracht hatte, gute zehn Jahre alt. „… habe ich nicht das Gefühl, dem Dresscode zu entsprechen.“
„Franco testet heute Abend ein neues Menü. Ich habe ihm versprochen, es zu probieren und ihm zu sagen, was er falsch gemacht hat. Halb acht. Es wäre mir sehr daran gelegen, dass der Fall bis dahin … erledigt ist.“
„So schnell?“
„Ich bin von Natur aus optimistisch. Sie etwa nicht?“ Sie hielt einen Moment inne. Dann legte sich langsam ein Lächeln über ihr Gesicht und verschwand kurz darauf wieder. „Helfen Sie mir, Arnold. Lassen Sie uns den Sachverhalt gemeinsam aufklären. Danach dürfen Sie mich zum Abendessen begleiten. Meinetwegen im Schlafanzug. Feinste Küche der Lagune, vom ersten bis zum letzten Gang. Es gibt risotto di gò, mit frischen Grundeln. Moeche. Weichschalenkrebse.“ Sie schnipste mit den Fingern. „Canoce, Fangschreckenkrebse mit so kräftigen Scheren, dass sie Ihnen den Finger brechen können. Und Wein von den besten Winzern des Veneto, der Sie ein Vermögen kosten würde, wenn Sie dafür zahlen müssten. Hätten Sie gerne Fisch und Wein? Zum Nulltarif?“
Bei meinem schmalen Geldbeutel lebte ich in der Regel von Supermarktessen, Pizza und einem gelegentlichen Döner. „Das wäre schön.“
„Wäre es das?“ Sie sah mich fest an. „Dann müssen wir jetzt anfangen und dieses verdammte Rätsel lösen.“
Ich blickte mich in dem kleinen Büro um. Von draußen drang kein Laut herein. Im Hauptquartier der Carabinieri schien man erstaunlich entspannt. „Allein, capitano?“
„Valentina, sagte ich. Allein. Was glauben Sie denn, wie viele Leute mein Mann kostenlos durchfüttern will? Wir schaffen das schon. Ein Toter. Eine Handvoll Verdächtige, von denen keiner die Wahrheit sagen will. Ein Klecks, wie ihr Engländer sagt.“
„Ein Klacks. A piece of cake.“
„Apropos Kuchen …“
Sie nahm den Telefonhörer ab und rasselte ein paar Anweisungen herunter. Kurz darauf kam ein junger Mann in Uniform herein und stellte zwei Espresso und vier sfogliatelle, muschelförmige neapolitanische Blätterteigteilchen, auf den Schreibtisch. „Ihre Lieblingssorte. Mit Zabaglione-Creme gefüllt.“
„Das stimmt. Woher …?“
„Volpetti natürlich. Denken Sie nach, Arnold. Stellen Sie Zusammenhänge her. Lassen Sie uns die Geschichte logisch angehen. Das ist Ihre Stärke, sagt Luca. Ich brauche Ihre Fähigkeiten jetzt mehr denn je.“
„Verstehe.“
„Beginnen Sie am Anfang. Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen. Über Marmaduke Godolphin und seinen Goldenen Zirkel. Warum sie alle hier sind. Wie sie zueinander stehen. Lassen Sie uns diese Leute mit derselben scharfsinnigen Präzision untersuchen, die eine Pathologenfreundin von mir anwendet, um im Ospedale Civile den Leichnam unseres unglücklichen Opfers zu sezieren.“
Der Anfang. Danach fragen die Leute immer. Dabei ließ sich nie genau sagen, wo Geschichten wirklich ihren Anfang nahmen. Gewöhnlich sah man das Ende, und auch die Mitte war ziemlich deutlich zu erkennen. Aber der Ursprung, die Keimzelle, aus der alles entsprang, verbarg sich irgendwo in der dunklen Vergangenheit und wollte nicht ans Licht. Oder war, und das kam ebenso oft vor, von Menschen verfälscht worden, die der Geschichtsschreibung ihren Stempel aufdrücken und die Spuren für andere verwischen wollten.
Draußen schlugen die Kirchenglocken neun. Das Gurren der Tauben war zu hören, während die Schläge verhallten.
„Ich warte“, murmelte sie und pochte mit ihren rot lackierten Nägeln auf den Schreibtisch.
„Also gut“, sagte ich. „Aber ich muss Sie warnen. Es könnte eine Weile dauern.“
WÄHREND ICH JOHN DONNES MAXIME, dass jeder Tod ein Verlust für uns ist, eigentlich zustimme, muss ich zugeben, dass manche Tode größere Verluste darstellen als andere. Sir Marmaduke Godolphin, trotz der Fülle seiner akademischen Auszeichnungen, seiner dubiosen Ritterwürde und – für ihn das Wichtigste – seines Ruhms als einer der bekanntesten TV-Historiker Großbritanniens, ein offensichtlicher Hohlkopf, fiel in diese Kategorie.
Was nicht heißt, dass es mich gefreut hätte, dass er in einer kalten Februarnacht mit Perücke auf dem Kopf, Dogenkostüm am fülligen Leib, aufgetakelt wie ein Renaissance-Gigolo auf der Suche nach Kundschaft und mit einem Dolch in der Brust bäuchlings im schmutzigen Wasser des rio San Tomà trieb, während sein Leben langsam in der übelriechenden, grauen Tiefe versickerte.
Warum auch? Bis zu seinen letzten paar Lebenstagen in Venedig kannte ich den Mann kaum. Er und sein Goldener Zirkel ergebener Anhänger waren mir lediglich aus Cambridge flüchtig bekannt, wo sich unsere Wege gelegentlich gekreuzt hatten. Dort war Godolphin einmal der Mann der Stunde unter den Wissenschaftlern gewesen, und ein Frauenschwarm, besonders nachdem die BBC ihn zum Gesicht ihrer populären Dokumentarfilmreihe über das griechische, das römische und andere Kaiserreiche auserkoren hatte. Ein paar Jahre nachdem ich mein Studium beendet hatte, hörte er auf, Marmaduke Godolphin, Professor für Altphilologie und Geschichte, zu sein, und verwandelte sich in Duke Godolphin; kleiner Professor wurde großer Medienstar. Duke über Persien. Duke auf Cäsars Spuren. Duke lüftet die Geheimnisse der Tudors.
Wie einst die römischen Massen, die zu Brot und Spielen ins Kolosseum strömten, begeisterte sich das Volk für seine lockere, munter verkürzte Nacherzählung der Geschichte. Eine Tatsache, die ich mit Verblüffung beobachtete. Für mich waren seine populärwissenschaftlichen Reportagen eintönige Filmchen ohne Tiefgang, voller effektheischender „Rekonstruktionen“, mit denen dieser, zugegeben charismatische, Typ in Jeansjacke, Safaristiefeln und mit einem Strahlelächeln im Gesicht lässig die Welt beglückte. Die dazugehörigen Bestseller, die er veröffentlichte, sorgten für noch mehr Ruhm und Reichtum. Marmaduke Godolphin war für Millionen Menschen das Gesicht der Vergangenheit.
Ich hingegen, ein Jahrzehnt jünger, war zu der Zeit ein staatlich geförderter Student aus einer Sozialsiedlung in Rotherham, ein einfacher junger Mann mit einem Stottern und nordenglischer Sprachfärbung, viel zu arm und vor allem viel zu proletarisch, um seinem erlauchten Kreis anzugehören. Ich kam weder von Eton, noch reichte meine Erblinie bis zur normannischen Eroberung zurück, was die automatische Vorherbestimmung für Oxbridge und zukünftiges Ansehen bedeutete. Stattdessen steuerte ich auf einen guten Abschluss in Geschichte und englischer Literatur zu, was mir in den frühen Achtzigern den Weg in die ruhige, anonyme Welt des Archivwesens ebnete, zuerst bei der Historical Manuscript Commission, anschließend, nachdem wir dem Public Record Office angegliedert worden waren, in den National Archives in Kew.
Duke Godolphin baute seine schillernde Karriere mithilfe der altbewährten Vetternwirtschaft innerhalb der oberen Zehntausend auf. Während er in der hippen Londoner Medienlandschaft von Studio zu Studio und von Bett zu Bett zog, verbrachte ich meinen Arbeitsalltag in der Vorstadt und vertiefte mich in dicke Bände mit Korrespondenz über britische Außenpolitik, angefangen bei den persönlichen diplomatischen Depeschen der Plantagenets bis zu den Geheimakten ausländischer Spione im Dienst unserer Majestäten von Elizabeth I. bis zu Queen Victoria.
Als junger Mann träumte ich manchmal von einer Beförderung, vor allem, weil mir die Vorstellung gefiel, eines Tages den Titel Keeperof the Public Records zu tragen. Keeper of the National Archives hatte aus irgendeinem Grund nicht denselben Klang. Allerdings wurde mir, wenn die jährlichen Beurteilungen eintrafen, stets mitgeteilt, dass Arnold Clover, der der Institution schon sein ganzes Erwachsenenleben lang treu diene, zwar ein gewissenhafter, fleißiger Archivar sei, dass ihm jedoch die entsprechenden Führungsqualitäten fehlten, die, wie es schien, für einen höheren Posten wichtiger waren. Das Stottern, das inzwischen nur noch gelegentlich auftrat, war dabei sicher ebenso wenig hilfreich wie die Tatsache, dass ich meinen typischen Yorkshire-Tonfall nicht ganz abschalten konnte.
Zu der Zeit, als ich mich dem Ruhestand näherte, war Marmaduke Godolphin ein allseits bekannter Ritter des Reiches, der ständig in der Flimmerkiste zu sehen und im Radio zu hören war und über alles, vom aktuellen Zeitgeschehen bis zu Geschichte, Moral und Religion, lautstark schwadronierte. Ein selbst ernannter Universalgelehrter, ein sensationsgieriger Polemiker, der angefangen bei der Todesstrafe bis hin zur Cancel Culture in jeder Zeitung, jedem Fernsehsender, jedem Radioprogramm energisch seine Meinung kundtat.
Im Lauf der Jahre waren seine Fernsehauftritte weniger geworden, vielleicht weil sich der allgemeine Geschmack geändert hatte. Godolphin gehörte noch zur alten Garde, darauf war er stolz. Er sprach ein älteres Publikum an, das am liebsten Geschichten über Englands großartige Vergangenheit hörte, und hielt sich offenbar für bürgernah. Ziemlich seltsam, angesichts seiner Herkunft, seines Vermögens und seiner klaren Abneigung gegen jeden, den er als Repräsentanten des gemeinen Volks betrachtete. Während Gerüchte über sein ausschweifendes Liebesleben von Zeit zu Zeit ihren Weg in die Klatschspalten der Boulevardpresse fanden, blieb er, zumindest auf dem Papier, glücklich verheiratet mit Felicity, einer seiner ehemaligen Studentinnen, die inzwischen Chefproduzentin bei der BBC geworden war. Mit der Frau, die seiner Fernsehkarriere auf den Weg geholfen und ihn von einem unter vielen TV-Sprechern zum Star seiner eigenen Serie gemachte hatte.
Nun, mit Mitte siebzig, aber dynamisch wie eh und je, war er ein Mann, mit dem man rechnen musste. Er hatte Vorstandsposten in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen inne, die nur dem exklusiven britischen Klüngel, den Großen und Mächtigen, offenstanden. Das Haus of Lords war abgemachte Sache, hätte man meinen können, wenn nicht die Gerüchteküche über sein Privatleben und seine gelegentlichen dubiosen Finanztransaktionen ihm im letzten Moment einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Vielleicht hatte er es aber auch einfach versäumt, die richtigen Politiker zu schmieren. Es interessierte ihn offenbar auch nicht sonderlich. Er war ein wohlhabender Mann mit einem Sohn namens Jolyon – kein gewöhnlicher Name für einen Godolphin –, der an seiner Stelle die Rolle des TV-Historikers übernommen hatte. Seltsam, wie die Briten manchmal sind, waren seine Bewunderer auch von seiner Fortentwicklung vom Fernsehwissenschaftler zum nationalen Besserwisser begeistert, zum unkonventionellen Typ, der sich gerne als patriotischer Engländer präsentierte und den Mut besaß auszusprechen, was andere sich nicht zu sagen trauten. Er war „die Stimme des Volkes“, nicht, dass er sich herablassen würde, auch nur einen Moment in dessen Gesellschaft zu verbringen, es sei denn, um rasch eins seiner Bücher zu signieren und danach sofort zum Trinken, Dinieren und Debattieren in höhere Sphären zu entschwinden.
Für mich gingen indessen vierzig, meist glückliche, Jahre zu Ende. Jahre, in denen ich mich täglich mit Papier, Pergament, Wachs und Tinte beschäftigt hatte. Man wird der Freude an historischen Dokumenten niemals überdrüssig. Nicht ihres Geruchs, nicht des angenehmen Gefühls, über weiches Pergament zu streichen, nicht des optischen Genusses, so viele schöne Schriftarten und Druckstile zu betrachten, all die Spuren, die Alter, Abnutzung und Brand- und Wasserschäden hinterlassen haben. Vor allem aber nicht der Erkenntnis, dass so viele Hände – die Hände von Monarchen, Staatsmännern, Bischöfen, samt der mörderischen Scheusale unter ihnen – genau diese fragilen Seiten auch schon einmal hielten. Selbst jetzt, in Venedig, vermisse ich das vertraute Vergnügen, diese kostbaren Schriftstücke in den stillen Winkeln des Nationalarchivs in Kew anzuschauen, obwohl schon lange vor meiner Abreise klar war, dass die Tage, an denen ich sie wirklich würde anfassen können, gezählt waren. Die Schrecken der Digitalisierung hatten uns erreicht. Bald schon, so verkündeten die ewig enthusiastischen jungen Leute aus der IT-Abteilung, würden wir kein einziges der alten Dokumente mehr aus seinem Schuber in den fahrbaren Regalen nehmen müssen. Bestenfalls für die billigen Dokumentarfilme von Leuten wie Jolyon Godolphin, der in seines Vaters Fußstapfen getreten war. In Zukunft würde ein Schlagwort genügen oder ein Metadatenschnipsel, um ein Digitalisat aus dem Datenspeicher aufzurufen. Unnötig, auf die in Jahrzehnten erworbene Kompetenz eines erfahrenen Archivars – mittlerweile ein belächelter Berufsstand – zurückzugreifen, eines Experten, der wusste, wo er nachsehen musste und welches Dokument mit einem anderen zusammenhing, das manchmal weit entfernt in den eng geschlossenen Aktenreihen stand.
Lange Zeit zuvor war ich mit der Entwicklung eines Schlagwortsystems zur Interdependenz beauftragt gewesen, dessen Begriffe teils von mir selbst, größtenteils von anderen stammten. Meine Aufgabe hatte darin bestanden, ein Netz zuverlässiger Verbindungen innerhalb unseres riesigen Bestandes erkennbar und auch schwer auffindbare Archivalien denjenigen zugänglich zu machen, die sie benötigten, selbst wenn unsere Besucher oftmals nicht mehr als eine vage Vorstellung davon hatten, was sie eigentlich suchten. Als Archivar hat man praktisch ein ganzes Archiv im Kopf, Regal um Regal, Quelle um Quelle, Seite um Seite. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich noch immer die komplette Abteilung für auswärtige Angelegenheiten in Kew vor mir und kann im Geist die Zusammenhänge herstellen, vom Camp du Drap d’Or bis zur britischen Herrschaft über Indien, von der Seeschlacht von Lepanto bis zum Zweiten Weltkrieg.
Meine geliebte Eleanor lernte ich bei der Begutachtung eines vermeintlich anonymen Berichts über die Schlacht von Azincourt kennen, den sie, unendlich klüger als ich, sofort als schlecht gemachte Kopie aus Holinshed’s Chronicles identifizierte. Sie war einfache Archivarin und, typisch für öffentliche Einrichtungen, ergaben sich für sie kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Das Einzige, was man ihr großzügig zugestand, war eine Tätigkeit im Sachgebiet Internationale Beziehungen, sodass wir gelegentlich Reisen zu den großen europäischen Bibliotheken unternahmen, Eleanor dienstlich und ich als selbstzahlender Begleiter. Stets geschätzt, nie befördert, das war das Schicksal meiner Frau, sicher weil sie mit ihrer Meinung nie hinter dem Berg hielt und schon gar nicht, wenn sie es mit Dummköpfen zu tun hatte. Kaum ein Jahr später waren wir verheiratet. Große Sprünge konnten wir mit unseren Beamtengehältern nicht machen, aber das spielte keine Rolle. Sie war eine Frau mit gesundem Menschenverstand, wenn es ums Leben im Allgemeinen und ums Geld im Besonderen ging. Und vor allem, was die Planung für die Zukunft betraf, die wir uns aufbauen wollten, wenn der Arbeitsalltag in Kew erst einmal vorbei war.
Wir bekamen keine Kinder – ein Umstand, den wir mit der Zeit zu akzeptieren lernten. Außerdem hatten wir weder nahe Angehörige noch sonstige Bindungen in England. Nach unserer Pensionierung ins Ausland umzusiedeln, erschien uns nicht nur vernünftig, sondern unvermeidlich. Wir waren überzeugte Europäer und reisten trotz unserer bescheidenen Mittel gerne, vorzugsweise mit dem Zug, weil man auf diese Weise so viel mehr sah.
Wir lernten in der Abendschule Italienisch, sie schneller als ich, und bald darauf unternahmen wir Erkundungstouren nach Italien, um nach geeigneten Wohnorten zu suchen. Nachdem wir Rom als irrsinnig teuer und Florenz als zu touristisch ausgeschlossen hatten, entschieden wir uns für eine bescheidene Sackgasse am Rand von Dorsoduro in Venedig als den Ort, an dem wir gemeinsam unseren Lebensabend verbringen wollten. Mit unseren Ersparnissen und dem Erlös, den wir für unser Reihenhaus in Wimbledon erzielen würden, könnten wir uns, versicherte sie mir, eine kleine Erdgeschosswohnung in einer ruhigen Gegend fernab der Menschenmassen leisten, von unserer Pension leben und alle Annehmlichkeiten genießen, die Italien zu bieten hat.
Eleanor war überglücklich.
Das Ganze erschien uns wie ein Traum.
Und das sollte es auch bleiben.
DREI TAGE VOR UNSERER GEMEINSAMEN Pensionierungsfeier, sieben Wochen vor der Übernahme der Wohnung, die sie in der Nähe von San Pantalon für uns gefunden hatte, brach Eleanor zu Hause zusammen. Nie werde ich das dumpfe Geräusch vergessen, mit dem sie zu Boden stürzte. Ich fand sie mit glasigem Blick, nach Luft ringend am Fuß der Treppe, und während ich noch überlegte, was ich tun, was ich sagen oder was ich denken sollte, zuckte sie kurz mit den Lippen und blieb dann reglos liegen. Völlig panisch rief ich den Notdienst, aber sie war bereits tot, das wusste ich. Ein Herzinfarkt, sagte der Arzt, aufgrund einer Vorerkrankung. Sie hatte in der Vergangenheit schon gelegentlich das Krankenhaus aufgesucht, öfter, als ich wusste, offenbar. Nur ein kleines Zipperlein, hatte sie immer gesagt. Nichts, weshalb ich mir Sorgen machen müsste. Erst im Nachhinein erfuhr ich, dass die Ärzte ihr schon Monate zuvor mitgeteilt hatten, dass sie an einer ernsthaften Herz-Kreislauf-Erkrankung litt, die nicht behandelbar war. Hätte ich das geahnt, hätte ich nie zugestimmt, das Haus zu verkaufen. Wir hätten niemals in Erwägung gezogen, aus dem kalten, grauen England in das Paradies zu flüchten, von dem wir glaubten, dass es uns in Italien erwartete. Das wusste Eleanor natürlich.
Sie wurde eingeäschert. Zur Trauerfeier kamen ein paar Kollegen aus Kew und irgendein entfernter Cousin, von dem ich noch nie gehört hatte und der in der Hoffnung auftauchte, vielleicht im Testament bedacht worden zu sein. Von wegen. Schon kurz darauf, und immer noch zu keinem klaren Gedanken fähig, saß ich im Flugzeug Richtung Marco Polo Airport und in ein neues Leben, das ganz anders sein würde, als ich es je gewollt hatte. Aber mir blieb keine Wahl. Der Kaufvertrag für die kleine Wohnung war unterschrieben; unwiderruflich, erklärte mir der venezianische Makler, wenn überhaupt, dann nur verbunden mit hohen Kosten. Außerdem hatten wir das Haus in Wimbledon an ein junges Paar verkauft, das todunglücklich gewesen wäre, hätte ich einen Rückzieher gemacht. Schmerz und Trauer empfand ich selbst schon genug. Ich hatte kein Interesse daran, sie auch noch weiterzugeben. Abgesehen davon, was hielt mich denn noch in England?
Die ersten Wochen in Venedig, in denen ich versuchte, meinen Verlust zu verkraften und mich in meinem fremden neuen Zuhause zurechtzufinden, bleiben bis heute verschwommen. Das Einkaufen und die Bürokratie verwirrten mich anfangs, ebenso wie die Aussprache, die so anders klang als in der Abendschule in Wimbledon. Doch bald schon gewöhnte ich mich ein. Oft wird behauptet, Venezianer seien kühl und abweisend Fremden gegenüber, wenn sie nicht gerade Geld bringen würden. Das ist unfair und missinterpretiert vorsichtige Zurückhaltung als Unhöflichkeit. Da mein Italienisch recht leidlich war – auch wenn ich manchmal gerügt wurde, weil ich angeblich wie ein Römer sprach –, konnte ich mich in Geschäften und Cafés nach einiger Zeit problemlos verständigen. Es dauerte nicht lange, bis ich bestimmte Lokale gefunden hatte, die ich regelmäßig aufsuchte, um einen Espresso zu trinken oder ein günstiges Mittagessen zu mir zu nehmen, und nach einer Weile wurde ich als Stammgast eingestuft. Als ausländischer Einwohner Venedigs, nicht als Tourist. Diese Unterscheidung war wichtig.
Als ich mich langsam eingelebt hatte, erreichte mich die E-Mail eines alten Freundes aus Kew mit Neuigkeiten von zu Hause, außerdem ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, das so großzügig und passend war, dass ich mit Tränen in den Augen auf die Nachricht starrte. Er hatte seine Verbindungen spielen lassen und mir Benutzerausweise für alle großen Bibliotheken der Stadt besorgt – für die Biblioteca Nazionale Marciana mit ihren riesigen Beständen; für die einzigartige und etwas außergewöhnliche Bibliothek der Fondazione Querini Stampalia, einem historischen Palazzo, der dank Carlo Scarpa einen moderneren Touch erhalten hatte; für die Bibliothek der Fondazione Giorgio Cini auf San Giorgio Maggiore. Sogar ein kleines Museum auf der anderen Seite der Lagune war dabei, das sich der Geschichte des Lidos widmete.
Und das Allerbeste: Ich bekam uneingeschränkten Zugang zum Archivio di Stato di Venezia, das zum größten Teil in einem ehemaligen Klostergebäude untergebracht war, das an die Basilica dei Frari grenzte, die sich gerade einmal zwei Minuten Fußweg von meiner neuen Wohnung entfernt befand. Zusammen mit seinen ausgelagerten Beständen umfasste das Archiv mehr als siebzig Regalkilometer Originaldokumente aus der Zeit seit dem großen Stadtbrand 976 und sogar einige aus der Zeit davor. Es waren so viele, dass die meisten davon oft jahrelang nicht angeschaut wurden. Für jemanden wie mich der Himmel auf Erden. Ein Zuhause fern von zu Hause. Das wiedergewonnene Paradies.
Von den Archivmitarbeitern wurde ich freundlich aufgenommen, nachdem ich ihnen von meiner Tätigkeit in Kew erzählt hatte, insbesondere von Luca Volpetti, einem sympathischen Archivar des höheren Dienstes, der auf dem Lido wohnte. Er war gebürtiger Venezianer, ein Junggeselle, der jede Bar, jedes Café und Restaurant kannte und mich bald schon unter seine Fittiche nahm. Luca zeigte mir Winkel und Ecken der Stadt, von deren Existenz nur wenige Außenstehende wussten, wundervolle Palazzi, die nur denjenigen offenstanden, die dorthin eingeladen waren, feine Gesellschaften, die sich der Musik, der Literatur und der Kunst widmeten. Und, ganz praktisch gesehen, wo man gut und preiswert essen konnte.
Auf sein Zureden hin wurde ich freiwilliger Mitarbeiter im Archivio di Stato, wo ich gelegentlich den ein oder anderen englischen Besucher herumführte – auf publikumswirksame Werbung verzichtete man hier – und ab und zu mit meinem Rat aushalf, wie wir vielleicht einige der drängenden Probleme der Sammlungen angegangen wären, hätten wir uns im eher egalitären Gebäude in Kew befunden und nicht in dem prachtvollen, wenn auch etwas sanierungsbedürftigen ehemaligen Kloster eines Franziskanerordens. Als das Jahr zu Ende ging, stellte ich fest, dass ich nur noch selten an England zurückdachte, an diesen finsteren fernen Ort.
Aber England sollte zu mir kommen.
DER COUNTDOWN BIS ZUM mysteriösen Ableben Marmaduke Godolphins begann mit einem Treffen mit Luca Volpetti an einem Februardonnerstag im Carnevale. Es war das erste Mal, dass ich dieses alljährliche Fest erlebte, das, neben der Biennale, wohl wichtigste Großereignis Venedigs. In den Touristengegenden der Stadt flanierten Besucher in Masken und Kostümen, die meisten davon traditionell, einige extravagant, ein paar ziemlich skurril. Vielen, die zum ersten Mal her reisten, schien es nicht in den Sinn zu kommen, dass es an der Adria in Norditalien um diese Jahreszeit kalt sein könnte. Folglich kamen nicht wenige in dünnen Sommerkleidern und stellten rasch fest, dass sie nachts, wenn die Temperaturen selten über den Gefrierpunkt stiegen, froren wie die Schneider. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich nicht über Touristen lustig zu machen, wie ignorant, laut und lästig sie manchmal auch sein mochten. Sie brachten Geld in die Stadt und verließen sie schnell wieder. Eines so begrüßenswert wie das andere, schien mir.
Luca hatte mich mit einem geheimnisvollen Beiklang in der Stimme zu Hause angerufen und vorgeschlagen, uns irgendwo abseits dieses ganzen Verkleidungs-Humbugs zum Mittagessen zu treffen: in der Osteria Ai Pugni, einem unauffälligen kleinen Lokal in der Nähe des Campo San Barnaba, das bei Einheimischen, vor allem bei den Mitarbeitern der nahe gelegenen Universität Ca’ Foscari, sehr beliebt war. Ringsum stieß man überall nur auf Touristenfallen, wo ein Teller einfache Spaghetti locker fünfzehn Euro oder mehr kosten konnte. An den engen Tischen im hinteren Teil des Ai Pugni bekam, wer sich auskannte, eine Auswahl täglich wechselnder Nudelgerichte für die Hälfte und ein gutes Glas Wein aus dem Veneto zum kleinen Preis.
Mein neuer Freund verspätete sich ausnahmsweise. Als er nach einer Weile mit wehendem tabarro durch die Tür eilte, schnappte er nach Luft.
„Alles in Ordnung?“, fragte ich, während die Kellnerin meinen Teller mit Winterradicchio-Gorgonzola-Walnuss-Pasta und ein Glas Roten hinstellte.
„Ich fürchte, nein. Ich bin aufgeregt. Völlig aus dem Häuschen. Dabei bin ich normalerweise die Ruhe in Person, wie du weißt.“ Eine glatte Untertreibung. „Das ist ziemlich beunruhigend in unserem Beruf, meinst du nicht?“
„Ungewöhnlich, würde ich sagen. Unangenehm. Unerwünscht vielleicht. Da hilft sicher ein Glas Wein.“
„Eine Flasche Prosecco, Anna!“, rief er der Chefin zu. „Etwas Feines für Arnold und mich. Den Le Vigne di Alice.“
Die Betreiberin des Lokals war eine hübsche junge Frau, die sich bei unseren regelmäßigen Besuchen immer persönlich um uns kümmerte. „Der Vigne kostet siebenundzwanzig Euro, Luca. Hast du im Lotto gewonnen?“
Er überlegte einen Moment stirnrunzelnd, bevor er ebenfalls eine Portion Radicchio-Pasta bestellte. Das dunkelrote Salatgemüse stammte von Sant’Erasmo, Venedigs Gemüseinsel, eine Garantie für hervorragenden Geschmack.
Luca, der nicht nur ein charmanter, immer gut gelaunter Mann war, sondern sich auch stets teuer und elegant kleidete, trug an diesem Tag ein klassisches Cape mit silberner Schließe, einen breitkrempigen Filzhut zum Schutz vor der Kälte und einen so langen Schal, dass er mich entfernt an Doctor Who erinnerte. Und nun zum Geschäft, signalisierte die schwungvolle Art, mit der er das alles auf dem Platz neben sich ablegte.
Während er sein Junggesellenleben genoss, machte er kein Geheimnis daraus, dass er der Freund und Geliebte zweier Professorinnen an der Ca’ Foscari war, eine von ihnen verheiratet, die zweite verwitwet, die beide voneinander wussten und sich ganz zufrieden mit dem Arrangement zeigten. Das galt anscheinend auch für den Ehemann, der neben anderen Damen in der Stadt auch der verwitweten Professorin gelegentlich einen Besuch abstattete. Venedig unterschied sich doch ziemlich von Wimbledon, zumindest von dem Wimbledon, das ich kannte.
„Nicht so, wie du denkst“, antwortete er Anna. „Aber ja. Ich hab gewissermaßen das große Los gezogen.“ Er lächelte mir zu und nahm meine Hand. „Genau wie unser englischer Freund hier. Du errätst nie, was ich erfahren habe, Arnold“, sagte er zu mir. „Es geht um eine sensationelle Entdeckung. Komm. Lass uns essen und trinken. Dann gebe ich dir eine Hausaufgabe. Und morgen triffst du einen berühmten Landsmann von dir. Sir Marmaduke Godolphin.“
Als ich den Namen hörte, war ich baff. Was ich Luca sagte, und zwar auf Englisch, was wiederum ihn verwirrte.
„Baff? Dieses Wort kenne ich nicht. Was soll das heißen, baff?“
„Ziemlich erstaunt“, war alles, was ich als Erklärung antworten konnte.
„Er ist ein Ritter, Arnold. Er tritt im Fernsehen auf. Kennst du ihn?“
„Flüchtig. Wir waren zur selben Zeit in Cambridge, obwohl ich bezweifle, dass er mich je zur Kenntnis genommen hat. Ich war ein einfacher Student und mein Mentor jemand, von dem er nichts hielt; Godolphin dagegen war ein Star-Professor. Ich würde eher sagen, ich weiß, wer er ist. Im Fernsehen ist er in letzter Zeit nicht mehr oft zu sehen. Jedenfalls nicht mehr als Moderator einer Geschichtsserie. Inzwischen hat er sich eher auf Politik verlagert. Gastbeiträge, Kommentare. Als besserer TV-Sprecher. Beziehungsweise TV-Schreier, ehrlich gesagt. So was in der Art.“
„Nun, in diesem Fall ist er etwas Historischem auf der Spur.“ Der Prosecco und sein Essen kamen. Anna schenkte uns zwei Gläser ein. „Der Mann hat Großes vor in Venedig. Das wird einschlagen wie eine Bombe.“
Darauf stieß er mit mir an. Wir tranken einen Schluck vom teuersten Schaumwein, den ich seit meiner Ankunft in Venedig versucht hatte. Er lag deutlich über dem Durchschnitt: schön trocken, perfekt gekühlt, nicht zu viel Kohlensäure. Luca strahlte vor Freude und machte sich genüsslich über die Pasta mit dunkelrotem Radicchio und Käse auf seinem Teller her. „Es wird ein Treffen hochkarätiger Wissenschaftler geben. Einige der bekanntesten Namen auf ihrem Gebiet. Und alle versammeln sich hier in Venedig, um dabei zu sein, wenn Godolphin der Welt seine Entdeckung präsentiert.“
„Seine Entdeckung?“
„Eine weltbewegende Entdeckung, wie er sagt. Und du irrst dich, mein Freund. Er erinnert sich sehr wohl an dich.“ Er erhob wieder sein Glas. „Der Mann bittet dich um deine persönliche Unterstützung.“
Es verschlug mir einen Moment die Sprache. „Und worum geht es genau?“, fragte ich dann.
„Das wüsstest du wohl gern.“
„Richtig, Luca. Also … raus mit der Sprache.“
Er fuchtelte mit den Armen, wie er es häufig tat. „Mir hat er auch nicht viel verraten. Er lässt sich nicht in die Karten schauen, wie ihr so schön sagt. Sein Geheimnis bleibt geheim, bis er es lüftet. Auch für seine ehemaligen Schüler, denke ich. Denn um die handelt es sich bei den berühmten Koryphäen, die er aus diesem Anlass eingeladen hat.“
Meine Gedanken wanderten zurück nach Cambridge vor all den Jahren. Der Goldene Zirkel. Godolphins Auserwählte. Sie waren unzertrennlich gewesen und ihm wie zahme Welpen auf Schritt und Tritt durch College und Fakultät gefolgt. Und sein Glanz hatte offenbar auf sie abgefärbt. Sie hatten auf der ganzen Welt Karriere gemacht, wenn auch nicht ganz so große wie er selbst. „Sie heißen nicht zufällig Caroline Fitzroy, Bernard Hauptmann und George Bourne?“
Luca sah mich erstaunt an. „Woher wusstest du das?“
„Ich hab geraten. Ist wohl so ’ne unschöne Angewohnheit von uns Archivaren.“
„Pah.“ Er winkte ab und trank noch einen Schluck. „Ich rate dauernd und sage es keinem. Das tun wir doch alle, machen wir uns nichts vor. Ja. Die drei.“
„Und seine Frau? Felicity?“
Er kniff die Augen zusammen. „Die Tatsache, dass ein Mann in Begleitung seiner Ehefrau nach Venedig reist, ist nicht so ungewöhnlich. Das war also nicht geraten.“
Ich hatte ihre Berufswege grob verfolgt. Felicity hatte ihren früheren Lehrer geheiratet und ihm dann geholfen, seine Karriere bei Funk und Fernsehen voranzutreiben. Caroline arbeitete inzwischen an der Sorbonne. Hauptmann, der es ebenfalls auf die Sicherheit einer Anstellung auf Lebenszeit angelegt hatte, in Harvard. George Bourne, der Sympathischste von allen, wenn ich mich recht erinnere, hatte es irgendwie ins Verlagswesen geschafft, wo er leidlich vorankam, bis er sich Marmaduke Godolphins Beziehungen zum TV annahm. Dank Felicitys erfolgreicher PR-Maßnahmen für die zahlreichen Fernsehserien ihres Mannes stieg auch sein Stern, während Godolphins geistige Ergüsse in Taschenbuchform sich jedes Jahr als Weihnachtstitel verkauften wie warme Semmeln. Nicht nur Archivare stellen Verbindungen her und pflegen sie. Infolge des kommerziellen Erfolgs mit seinem früheren Professor bekleidete Bourne inzwischen eine höhere Position mit einem hochtrabenden Titel in einem der großen internationalen Verlagshäuser.
„Ich habe sie alle damals in Cambridge ab und zu gesehen“, erklärte ich. „Sie schienen sich ziemlich nahezustehen. Wie viel davon echte Freundschaft war und wie viel Berechnung, kann ich nicht sagen. Die Erfolgreichen neigen zur Unzertrennlichkeit, selbst wenn sie irgendwann anfangen, sich zu hassen. Es überrascht mich wenig, dass das selbst vierzig Jahre später anscheinend noch zutrifft.“
„Hmm.“ Luca wusste offenbar nicht recht, wie er das verstehen sollte.
„Ich bin Archivar, und ich werde immer einer bleiben. Ich versuche zwischen allem, was mir begegnet, Zusammenhänge herzustellen. Genau wie du. Mag sein, dass ich pensioniert bin, aber lebenslange Angewohnheiten kannst du nicht abstellen.“
„Ein Glück!“ Er öffnete seine alte, ziemlich ramponierte Ledertasche. „Wir werden deine Angewohnheiten nämlich brauchen. Hier sind meine Anweisungen von Godolphin. Und deine. Und bevor du nachfragst … ja, wir werden bezahlt. Dreihundert Euro am Tag für jeden, mindestens fünf Tage, in bar. Hab ich von einhundert hochgehandelt. Ich hab ihm erklärt, dass unsere Zeit kostbar ist. Da stimmst du mir doch sicher zu.“
Das war mehr Geld, als ich je an einem Tag verdient hatte. Godolphin musste an einer ziemlich großen Sache dran sein. „Und wofür genau?“
Luca nahm zwei Bücher heraus und platzierte sie zwischen den Tellern und Gläsern auf dem Tisch. Es waren Geschichtsbücher, beide über die Medici. „Um das zu tun, was Leute wie wir gewöhnlich tun. Nach historischem Gold schürfen. Der Mann hat eine Materialsammlung entdeckt, die gerade auf dem Weg hierher ist. Er hat guten Grund zu der Annahme, dass sich darin zwei bedeutende Dokumente verbergen, die von großem allgemeinen Interesse sind. Schriftstücke, die unseren Blick auf die Geschichte verändern werden. Zumindest auf einen bestimmten Teil davon.“
„Was für Dokumente? Und welcher Teil der Geschichte?“
Er trank einen Schluck Prosecco und lächelte. „Ich hab keine Ahnung. Zuerst der Bestand, dann die Entdeckung. Du kennst die Abläufe.“
Bestand. Ein archivkundlicher Fachbegriff, den ich schon länger nicht mehr gehört hatte. Ein Bestand umfasst gewöhnlich die Gesamtheit des bei einer Behörde, einer natürlichen oder juristischen Person entstandenen Archivguts. Er ist auf der ersten Stufe der sachlichen oder nach Provenienzen gegliederten Struktur eines Archivs angesiedelt, kann in verschiedene Serien gleichförmiger Akten in alphabetischer, numerischer oder chronologischer Reihenfolge aufgeteilt werden, anschließend in Akten mit mehreren Einzeldokumenten und schließlich in die einzelnen Dokumente selbst.
Man stelle sich Folgendes vor:
Ein Rollwagen voller Kartons, die den Briefwechsel eines Monarchen enthalten – ein Bestand.
Die Kartons, in denen sich die Briefe aus einem bestimmten Jahr befinden – eine Serie.
Die Sammlung der Briefe des betreffenden Jahres, die die Korrespondenz mit dem Premierminister umfassen – eine Akte.
Ein einzelner Brief, der zum Beispiel den Unmut über den ein oder anderen Vorfall ausdrückt – ein Dokument.
Bestand ➝ Serien ➝ Akten ➝ Dokumente.
Zur Erschließung von Archivgut gehört natürlich noch viel mehr, aber das ist das Kernstück des Prozesses.
„Um welchen Bestand geht es?“, fragte ich.
Luca prostete mir wieder zu.
„Den Nachlass eines verstorbenen Antiquars. Und darin enthalten die Sammlung bisher unbekannter Regierungsunterlagen von Gian Gastone de’ Medici, Großherzog der Toskana. Dem letzten seiner Erblinie.“
Das erschien mir unmöglich. „Über die Medici ist doch in Florenz mit Sicherheit schon alles erforscht und archiviert? Wo um alles in der Welt sollte jemand wie Marmaduke Godolphin …“
Luca begann erneut, mit den Händen zu fuchteln, so heftig, dass er beinah die Dame hinter sich getroffen hätte. „Keine Ahnung, und es interessiert mich auch nicht. Er sagt, er habe die Archivalien auf privatem Wege erworben. Sie werden in Kürze in einen verschlossenen Raum im Archiv gebracht. Alles ziemlich undokumentiert. Unberührt, wie mir scheint, seit der letzte bedauerliche Medici fett und betrunken in seinem Bett das Zeitliche gesegnet hat. Godolphin ist überzeugt davon, dass sich ein wahrer Schatz darunter befindet. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu finden.“
„Wann ist Gian Gastone gestorben?“
Er holte ein kleines Notizbuch hervor, das er immer dabeihatte, und sah nach. „9. Juli 1737.“
Anna, die stets aufmerksam hinter der Theke stand, bemerkte, dass plötzlich Stille zwischen uns eingetreten war. Sie kam herüber und räumte die Teller ab, während wir Espresso bestellten.
„Eine Sammlung offizieller Regierungspapiere des letzten Großherzogs der Toskana lag dreihundert Jahre lang irgendwo unangetastet herum?“, fragte ich. „Und ist jetzt im Besitz Marmaduke Godolphins?“
„Korrekt“, antwortete Luca, ohne mir dabei in die Augen zu sehen.
„Warum sucht er nicht selbst, was er gerne hätte?“
Luca antwortete mit dieser Geste, die Italiener so lieben. Er runzelte mit heruntergezogenen Mundwinkeln die Stirn und zuckte mit den Schultern. „Vielleicht denkt er, als so berühmter Mann sei es unter seiner Würde, in verstaubten Papieren zu wühlen. Oder er glaubt, dass die Entdeckung spektakulärer wirkt, wenn sie von Leuten wie uns gemacht wird. Immer mit der Ruhe. Lass uns doch erst mal anfangen. Die Schatztruhe, die er geliefert hat, ist wohl gar nicht so groß. Wir müssen bloß die beiden Schriftstücke finden, die ihn interessieren. Als Belohnung wird er, außer uns zu bezahlen, die gesamte Sammlung dem Archiv überlassen. Stell dir das vor!“ Er grinste. „Von den Forschungsmöglichkeiten mal ganz abgesehen … in Florenz werden sie ausflippen.“
Zwischen den beiden Städten existierte eine jahrhundertealte Rivalität.
„Und was springt für ihn dabei raus?“ Marmaduke Godolphin hatte garantiert sein Lebtag noch keine selbstlose Tat vollbracht.
„Eine Fernsehserie vielleicht? Die Chance, seine Karriere wiederzubeleben, wenn sie, wie du sagt, in letzter Zeit abgeflaut ist? Noch mehr Ruhm? Geld? Keine Ahnung. Wen kümmert’s? Die Sache wird Spaß machen, mein englischer Freund. Das ist doch genau unser Ding. Etwas aufzuspüren, das den Normalsterblichen entgeht. Und eine ordentliche Entlohnung gibt’s obendrein. Aber zuerst …“ Er schob mir die Bücher über den Tisch, „müssen wir, sagt unser Auftraggeber, uns schlau machen.“
„Und worüber?“
Er schlug eins der Bücher auf und deutete auf einen ganzseitigen Kupferstich. Der zeigte zwei Männer, die sich mit Dolchen in den Händen an die Kehle gingen und verzweifelt um ihr Leben kämpften. „Über Mörder. Killer. Hinterhalt.“
2
Der Goldene Zirkel
„Sie sprechen wirklich wie ein Römer“, sagte Valentina Fabbri, als die Kirchenglocke zehn schlug.
„Ich glaube, unsere Lehrerin kam von da.“
„Sehen Sie?“ Sie deutete mit ihrem Kugelschreiber auf mich. „Verbindungen herstellen. Das ist es, was Sie tun. Das ist es, was auch ich tun muss.“
Ein kurzer Anruf am Empfangstresen. Und zwei weitere Espresso wurden gebracht. Ich fragte mich, wie viele ich wohl noch trinken müsste, bevor dieser seltsame Tag zu Ende ging.
„Haben Sie schon etwas aus dem Krankenhaus gehört?“, fragte ich.
„Worüber?“
„Über die Autopsie. Sie sagten, er würde, nun ja …“
Eleanors Lachen, als ich einmal ohnmächtig wurde, weil ich mich beim Rasieren geschnitten hatte, klang mir plötzlich im Ohr.
„Seziert, Arnold. Auseinandergeschnitten. Das ist üblich in solchen Fällen. Godolphin hatte getrunken, er war verletzt und ist in einem rio zu Tode gekommen. Man wird Untersuchungen durchführen, die uns sicher bald weitere Fakten liefern werden. Fürs Erste reicht das aber, denke ich.“
„Die Mordwaffe?“ Danach fragten sie in Kriminalromanen immer, und auf einmal war ich neugierig darauf, mehr zu erfahren. „Haben Sie sie gefunden?“
„Sie steckte in seiner Brust. Ein Dolch. Ein Stilett, genauer gesagt, ziemlich auffällig verziert. Das Opfer hatte es von einem mysteriösen Bewunderer geschenkt bekommen. Aber das wissen Sie, glaube ich, schon.“
„Ich bin ein bisschen zartbesaitet“, räumte ich ein, während mir leicht mulmig wurde.
„Eine lange schmale Klinge. Der Mann wurde von zwei Stichen getroffen. Der erste war relativ harmlos und hinterließ nur eine oberflächliche Wunde. Der zweite allerdings ging deutlich tiefer. Offenbar müssen wir von einem Dolchstoß ins Herz ausgehen, wenn wir diesen Fall lösen wollen.“
„Ins Herz?“ Ich rang erschrocken nach Luft.
Sie warf mir einen merkwürdigen Blick zu. „Nichts davon wurde bisher öffentlich gemacht. Alles, was die von der Presse wissen, ist, dass er verletzt wurde. Das muss auch so bleiben.“
Ich trank die Hälfte des Espressos und das kleine Glas Wasser, das ich dazu bekommen hatte, und fragte mich, was sie wohl glaubte, wem ich es erzählen könnte.
„Wissen Sie, warum Godolphin Sie hier ausfindig gemacht hat?“
„Ich weiß nur das, was er sagte, als wir uns getroffen haben.“
„Und das wäre?“
Inzwischen hatte ich ausreichend Zeit gehabt, mir zu überlegen, wie ich diese Geschichte erzählen wollte. In meiner Version, das war entscheidend. „Anscheinend wurde mein Name von einem Mann namens Wolff erwähnt, der ihm das betreffende Material verkauft hat. Er hatte wohl irgendwelche Verbindungen nach Kew und dort erfahren, dass ich inzwischen im Ruhestand und nach Venedig gezogen bin.“
„Wer ist dieser Wolff?“
„Ich glaube, wir ziehen voreilige Schlüsse.“
„Sie meinen, die Tatsache, dass Sie Godolphin aus Cambridge kannten, war nur Zufall?“
„Wie schon gesagt, wir kannten uns nicht. Cambridge nimmt jedes Jahr Tausende Studierende auf.“
„Haben Sie ihn beneidet, diesen Professor?“
Was für eine merkwürdige Frage. „Warum sollte ich?“
Das schulterzuckende Stirnrunzeln, mit dem sie antwortete, glich fast dem von Luca. „Er war berühmt. Er war vermögend. Er hatte Frauen, junge Frauen, wie es scheint. Und er genoss einen hervorragenden Ruf in Wissenschaftlerkreisen.“
„Ich glaube, Sie könnten so einige Wissenschaftler finden, die Letzteres bezweifeln würden.“
„Trotzdem …“
Es war wichtig, diesen Punkt von Anfang an deutlich zu machen. „Ich habe niemals irgendwen beneidet. Ich hatte das Glück, ein angenehmes Arbeitsleben in Gesellschaft der Frau zu verbringen, die ich mehr geliebt habe als alles auf der Welt. Und jetzt darf ich hier sein, ein Witwer am Ort seiner Träume. Auch ohne Eleanor fühle ich mich in Venedig zu Hause, genau wie sie es sich gewünscht hätte. Selbst wenn Marmaduke Godolphin jetzt nicht im Ospedale Civile liegen und mit Skalpellen und Sägen bearbeitet werden würde, niemals hätte ich mit ihm tauschen wollen. Nicht eine Sekunde.“
Sie trank ihren Espresso aus. „Setzen Sie Ihre Geschichte fort, bitte. Ich finde sie …“, sie fuhr mit der Hand durch die Luft, „faszinierend.“
LUCA VOLPETTI KONNTE OFFENBAR keinen weiteren Aufschluss über unseren seltsamen Auftrag geben. Also genossen wir den Rest unseres Mittagessens bei heiterem Geplänkel über Venedig, das Wetter und die Lokalpolitik. Schließlich brachte Anna uns zwei Stück Mandelkuchen als Entschädigung für den teuren Prosecco. Als wir die verspeist hatten, warf sich mein Freund wieder in seinen tabarro, gefolgt von Hut und Schal, und machte sich auf den Weg zu einem Rendezvous mit der Dozentin für Nahoststudien, die gleich um die Ecke wohnte. Ihr Ehemann war wohl für ein paar Tage nach Mailand gereist, und sie sehnte sich nach Gesellschaft.
Ich blieb noch da und begann über den Umstand nachzugrübeln, dass Marmaduke Godolphin, ein Mann, den ich vierzig Jahre zuvor das letzte Mal gesehen hatte, und da auch nur aus der Ferne, sich entschlossen hatte, gerade mich in einem fremden Land aufzuspüren. Und aus welchem Grund? Um mir eine erfreuliche Summe Geld anzubieten, damit ich ihm meine Fähigkeiten als Archivar zur Verfügung stellte, um zwei mysteriöse Dokumente zu finden, die sich in einem ebenso mysteriösen Bestand verbargen.
Das kam mir alles ziemlich merkwürdig vor. Ich hatte einiges an grundlegender Literatur über die weitverzweigte Dynastie der Medici gelesen, wie wohl fast jeder, der sich auch nur flüchtig für italienische Geschichte interessiert. Gian Gastone war ein bedauernswerter Mann gewesen, der in seinen letzten Lebensjahren den Niedergang seines Großherzogtums mitansehen musste, meist von seinen schmutzigen Laken im Palazzo Pitti aus, betrunken, fettleibig und verwirrt. Währenddessen wurde er in seinem verwahrlosten Schlafgemach täglich von einer Reihe junger Männer besucht, die man bei Hof ruspanti nannte und die ihm auf Geheiß ihres verdorbenen Herrn gefällig waren.
Die Vorstellung, dass ein so erbärmlicher Libertin großartig Korrespondenz betrieben haben sollte, erschien mir ziemlich verwegen. Im Übrigen irrte Luca sich, als er den alten Narren als den letzten Medici bezeichnete. Er hatte eine Schwester, Anna Maria Luisa, die an seinem armseligen Sterbebett saß und alles erbte. In einem erstaunlichen Akt der Großzügigkeit vermachte sie später fast sämtliche Paläste und Kunstschätze der Medici dem toskanischen Staat, unter der Bedingung, dass nichts davon aus Florenz entfernt werden dürfe. Dem patto di famiglia, dem „Familienpakt“, den sie im Oktober 1737 unterzeichnete, war es zu verdanken, dass ein so großer Teil des kulturellen Erbes von Florenz sich bis heute vor Ort befand. Alles, was irgendwie von Bedeutung war, wurde mit Sicherheit in den dortigen Archiven aufbewahrt. Obwohl es angesichts der chaotischen Zustände während der letzten Jahre Gian Gastones vielleicht möglich war, dass einige Dokumente aus dem Palazzo Pitti in private Hände gelangt sein könnten. All das war jedoch reine Spekulation, bis Luca und ich das Material zu sehen bekommen würden, das Godolphin nach Venedig bringen ließ. Und sich die Gelegenheit ergäbe, ihn zu fragen, wo um alles in der Welt er es her hatte.
NACHDEM ICH IN MEINE WOHNUNG bei San Pantalon zurückgekehrt war, sah ich mir als Erstes die beiden Bücher genauer an, die wir zur Vorbereitung lesen sollten. Es handelte sich um ernstzunehmende historische Untersuchungen, nicht um dieses populärwissenschaftliche Geschwafel, für das er selbst bekannt war. Vor mir lagen teure Forschungsbände voller schwieriger Fachbegriffe, mit seitenweise Fußnoten, Bibliografien und anderen Anhängen. Sterbenslangweilig für den Laien, offen gesagt.
Eins musste man Godolphin lassen, er war in der Lage, gute Storys fürs breite Publikum zu erzählen. Ich hatte über die Jahre einige seiner Bücher überflogen und sie durchaus lesenswert gefunden, wenn auch ausgesprochen ungenau, was selbst allgemein bekannte Fakten betraf. Der Mann verpackte etliche zweifelhafte Geschichten in einen spannenden Erzählton – die Berichte über die grausamen Taten Neros und Caligulas, die Zeugnisse über die Verbrechen Richards III., die These, Caravaggio habe nach einem tödlich endenden Streit bei einer Tennispartie aus Rom fliehen müssen –, als wären es unbezweifelbare Tatsachen und nicht vielleicht die Erfindungen von Autoren, oft Jahre nach den Ereignissen zu Papier gebracht, die noch mit jemandem ein Hühnchen zu rupfen hatten. Doch dieser nachlässige Umgang mit historischen Fakten tat seinen Verkaufszahlen keinen Abbruch. Zu jeder seiner Fernsehserien erschien ein Buch, das es regelmäßig auf die Bestsellerlisten schaffte.
Die Preisschilder an den schweren Bänden, die Luca mir gegeben hatte, gaben zu erkennen, dass niemand außer Universitätsbibliotheken dazu bestimmt war, sie zu erwerben. Zumindest durfte man mit Inhalten rechnen, die akademischen Maßstäben standhielten beziehungsweise einigermaßen den Tatsachen entsprachen. Meine Erfahrungen als Archivar, der es häufig mit Leuten zu tun hatte, die solche Werke produzierten, waren, muss ich sagen, gemischt. Bei einigen handelte es sich um gewissenhafte Forscher, die unvoreingenommen an unsere Bestände herangingen, andere wussten praktisch schon vorher, was sie suchten, und waren fest entschlossen, alles widersprüchliche Material zu meiden, das ihre Version der Ereignisse infrage stellen könnte.
Wo genau diese zwei Bände diesbezüglich einzuordnen waren, wusste ich nicht. Das Interessanteste an beiden Titeln waren jedenfalls die Namen auf den Buchdeckeln:
Caroline Fitzroy und Bernard Hauptmann.
Ich sah sie vor mir, damals in Cambridge, als wir alle noch jung waren und, sie zumindest, sorglos. Caroline war eine energische Frau gewesen, überaus sportlich und immer in Eile. Sie ging rudern, engagierte sich in jedem studentischen Club – ob er sich der Politik, der Kultur oder dem Debattieren widmete –, der sie aufnahm. Für sie gab es weder lange Abende in der union bar, der Kneipe der Studentenvereinigung, noch ausgedehnte Pubtouren in der Stadt, zumindest soweit ich mich erinnern konnte. Die Arbeit, das Hofieren Godolphins und der Weg zum heiß ersehnten First Class Honours, den sie selbstverständlich erlangte, waren alles, was für sie zählte.
Es war ein offenes Geheimnis, dass sie mit ihm schlief. Und was das betraf, war sie nicht allein. Niemanden interessierte so etwas damals, und wenn doch, dann hielt er geflissentlich den Mund. Heutzutage würde Godolphin aufgrund seiner sexuellen Eskapaden und der Tatsache, dass er Gefälligkeiten im Bett mit guten Noten belohnte, von der Uni gejagt. Zu jener Zeit wurde so etwas, wenn nicht akzeptiert, dann zumindest unter den Teppich gekehrt, als Gepflogenheit des Universitätslebens dem Klatsch der Studierenden überlassen. Seit Jahrhunderten brachten Lehrende ihre Studentinnen dazu, mit ihnen ins Bett zu gehen. Wozu groß Wirbel darum machen? Vor allem, wenn solche kleinen Techtelmechtel einem zu einem besseren Abschluss und größeren Karrierechancen verhalfen und die Gelegenheit boten, Kontakte zu knüpfen, auf die man später im Leben zurückgreifen konnte. Wie ich schon zu Luca gesagt hatte, Archivare waren nicht die Einzigen, die Verbindungen herstellten.
Felicity, seine spätere Frau, gehörte auch zu Godolphins zahlreichen Eroberungen. Sie, so erinnerte ich mich, war still und ein bisschen schüchtern gewesen, obwohl sie gelegentlich in die union bar und zu Partys kam, wo sie nie lange blieb, aber eigentlich den Eindruck machte, als würde sie das gerne, wenn sie nur den Mut dazu aufbringen könnte. Sie war groß und schlank, gazellenhaft, fand ich, von hübscherer und auffälligerer Erscheinung als Caroline, wenn auch angeblich weniger klug. Ein annehmbarer Abschluss war, genau wie für mich, alles, was die Zukunft für sie bereithielt, doch als sie später anfing, bei der BBC zu arbeiten, heiratete sie ihren ehemaligen Lehrer, sichtlich schwanger, während sie zum Traualtar schritt. Also bekam sie am Ende vielleicht doch noch den Preis, nach dem sie sich gesehnt hatte. Ich bezweifle allerdings, dass es einer war, den sich viele andere auch gewünscht hätten. Männer wie Godolphin, so schien mir, legten ihre Gewohnheiten niemals ab. Er war ein Weiberheld, und er ging ziemlich unverhohlen damit um. In späteren Jahren verfolgten ihn Gerüchte über sexuelle Annäherungsversuche, die über die laxen moralischen Normen der damaligen Zeit hinausgingen. Ein paar kurze Zeitungsmeldungen erschienen. Zwei junge Frauen hatten sich bei der Universitätsleitung beschwert. Sie wurden angehört und als Querulantinnen abgewiesen, als gekränkte Verehrerinnen, die ihm etwas anhängen wollten, weil Godolphin sie von der Bettkante gestoßen hatte. Zum Skandal kam es nie. Und bald schon wurde die nächste Fernsehserie gedreht und die zweifelhaften Geschichten waren vergessen. Wenn auch vielleicht nicht von Felicity.
Dann war da noch Bernard Hauptmann. Groß, gut aussehend, athletisch und sehr amerikanisch. Ebenfalls ein begeisterter Ruderer – er hatte es beinah ins Team für das traditionelle Bootsrennen geschafft – und das selbst ernannte Oberhaupt von Godolphins Goldenem Zirkel. (Wüsste ich doch bloß noch, wer diesen Begriff erfunden hatte, er passte einfach wie die Faust aufs Auge.) Hauptmann besaß ein Luxushirn in einem Luxuskörper und achtete darauf, dass das auch keinem entging. Es wurde gemunkelt, er habe gleichzeitig mit Caroline und Felicity etwas gehabt, neben Godolphin vielleicht – im wahrsten Sinne des Wortes womöglich. Keiner von uns gewöhnlichen Studenten wusste, was in diesen Kreisen so passierte. Wir waren sowohl gesellschaftlich als auch intellektuell von ihren privaten Vergnügungen ausgeschlossen. Ein Publikum in der ersten Reihe, bei heruntergelassenem Vorhang.
Hauptmann beendete sein Studium ebenfalls mit einem First und kehrte kurz darauf nach Amerika zurück, um in Harvard zu lehren. Meine Tätigkeit im Archiv erforderte nur einmal eine Reise über den Atlantik, zu einer langweiligen Tagung in einer langweiligen Stadt – St. Louis, wenn ich mich recht entsinne –, dabei blieb es.