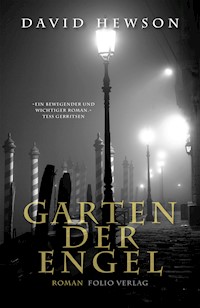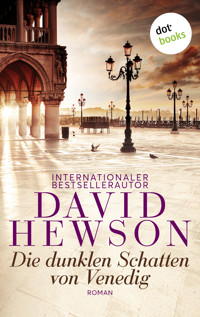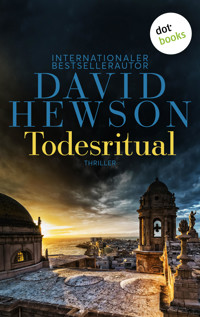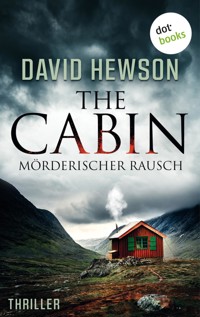
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auch alte Sünden werden bestraft: Der packende Thriller »The Cabin – Mörderischer Rausch« von David Hewson jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Moment der Grausamkeit, der sie alle auf ewig verfolgen wird … Hal Jamieson würde alles dafür geben, seine Jugendsünde vergessen zu können – jene Nacht in den wilden 70ern, die er mit seinen Studentenfreunden in einer abgelegenen Hütte im Wald verbrachte, um Drogen zu nehmen. Als einer von ihnen im Rausch ein abscheuliches Verbrechen beging, stellte die Gruppe sich gegen ihn und lieferte ihn der Polizei aus. Aber ist der Schrecken damit wirklich vorbei? Nun, Jahrzehnte später, wird der angeblich geläuterte Täter aus der Haft entlassen. Hal ist sicher, dass der eiskalte Psychopath alles daran setzen wird, ihn und die anderen zu finden, um grausame Rache zu nehmen. Aber wie soll er ihn aufhalten? »Ein komplexer, geschickt mit den Vermutungen der Leser spielender Thriller.« Freundin Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde psychologische Thriller »The Cabin – Mörderischer Rausch« von David Hewson wird die Fans von Harlan Coben begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Moment der Grausamkeit, der sie alle auf ewig verfolgen wird … Hal Jamieson würde alles dafür geben, seine Jugendsünde vergessen zu können – jene Nacht in den wilden 70ern, die er mit seinen Studentenfreunden in einer abgelegenen Hütte im Wald verbrachte, um Drogen zu nehmen. Als einer von ihnen im Rausch ein abscheuliches Verbrechen beging, stellte die Gruppe sich gegen ihn und lieferte ihn der Polizei aus. Aber ist der Schrecken damit wirklich vorbei? Nun, Jahrzehnte später, wird der angeblich geläuterte Täter aus der Haft entlassen. Hal ist sicher, dass der eiskalte Psychopath alles daran setzen wird, ihn und die anderen zu finden, um grausame Rache zu nehmen. Aber wie soll er ihn aufhalten?
eBook-Neuausgabe November 2022, Dezember 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Epiphany« bei Harper Collins Publishers, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Epiphanias« bei Ullstein.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by David Hewson
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 by Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Anthony Photography
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (ma)
ISBN 978-3-98690-392-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Hewson
The Cabin – Mörderischer Rausch
Thriller
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Wir sehen die Vergangenheit nicht in chronologischen Sequenzen. Es mag von Nutzen sein, sie narkotisiert, mit hier und da angebrachten Daten, auf dem Tisch auszubreiten, aber was wir wissen, strudelt in Wellen und Spiralen aus uns und unserer eigenen Zeit hervor.
EZRA POUND
Guide to Kulchur
Teil 1
Desert Rose
Prolog: Spaltung
Engel werden nicht zu Engeln gemacht, weil sie heiliger sind als Menschen oder Teufel, sondern weil sie keine Heiligkeit voneinander erwarten, nur von Gott.
William Blake
Heiligabend 1975, Palo Alto, Nordkalifornien
»Wie das glitzert.«
Der Blick aus fünfjährigen Augen huscht durch das Schaufenster, bleibt an goldenen und silbernen Figürchen hinter der Scheibe hängen: eines mit einem Taktstock in der Hand, ein anderes mit einer winzigen Violine, beide angetrieben von einem Uhrwerk.
»Guck mal, Florrie. Wie das glitzert.«
Der Spitzname nervt sie. Sie kommt sich dämlich vor in diesem fremden Land, in dieser albernen weißen Verkleidung, die ihr bis auf die Knöchel reicht, mit den doofen Goldflügeln auf dem Rücken. Findet es peinlich, in dieser fremden, unvertrauten Umgebung so herumstehen zu müssen.
Sie schaut ihren Bruder an, versucht ihre Wut, ihren inneren, namenlosen Schmerz auf ihn zu verlagern, schaut ins Schaufenster, sieht die Spiegelung zweier kleiner, geisterhafter Gestalten im fahlen Wintersonnenlicht, sieht, wie sich ihre weißen Hemden im Wind leicht bauschen. Wie niedlich, wie niedlich, hatten die Vorübergehenden gesagt, und jedes Wort machte sie wütender. Wie niedlich, wie niedlich, ihre Mutter war stehengeblieben, hatte sie angeschaut, bewundert, die kleine Kodak Instamatic herausgezogen, sie vor dem Schaufenster fotografiert, hatte »nur eine Minute« gesagt – nur eine Mami-Minute, dachte das Mädchen – »wartet kurz hier«. Es gab noch einiges zu erledigen, und im Geschäft war es so voll.
Sie spürte, wie die Kälte in ihr emporstieg.
»Red nicht solchen Schwachsinn, Miles. Auch wenn’s schwerfällt. Aber versuch es wenigstens.«
Ihre Stimme verfügt über die Autorität der zwanzig Minuten früher Geborenen. Sie ist der ältere Zwilling, und das hat immer wie eine Wand zwischen ihnen gestanden, als etwas Spürbares und Selbstverständliches, das nicht erwähnt werden muß. Zwanzig Minuten, zwanzig Jahre. Kein Unterschied. Der Abstand ist greifbar. Sie fühlt sich überlegen, ständig, selbst als Fünfjährige. Fühlt sich verantwortlich und gibt ihm die Schuld für diese Last.
Hinter ihnen rumpelt ein großer Laster die University Avenue hinab, spuckt Dieselwolken aus, füllt ihre Köpfe mit lautem, schmerzhaftem, beängstigendem Lärm. Die Staubwolke hängt in der Nachmittagsluft und senkt sich dann langsam herunter. Schwarze Flecken tauchen auf ihren makellos weißen Hemden auf wie faule Stellen auf der weichen Haut halbreifer Pfirsiche. Sie spürt, wie der schwache, leicht beißende Winterwind die an ihrem Rücken befestigten Flügel bewegt. Die Goldfolienblättchen machen ein raschelndes Geräusch. Der Dieselgeruch vermischt sich mit dem Zimtaroma aus der zwei Häuser entfernten Bäckerei.
Miles greift nach ihrer Hand, kleine, pummelige Finger, die nach Sicherheit, Beruhigung, Wärme suchen. Sie ballt die Hand zur Faust, so fest sie nur kann. Verwehrt ihm den Zugang. Es kommt ihr gut, richtig, korrekt vor. Erwachsen.
»Warum braucht sie so lange? Warum? Florrie? Warum?«
Da ist dieses dünne, hohe, hartnäckige Quengeln, dieses Nörgeln, das an ihr zerrt, ein Schauspieler, der nie seinen Einsatz verpaßt. Sie schließt die Augen, schließt sie so fest, daß es weh tut, verschränkt ihre Arme, schiebt die kleinen Fäuste unter die Achseln, läßt ihr lautes Schweigen über sie beide hinwegbranden, öffnet dann mit abgewandtem Kopf wieder die Augen, starrt ins Schaufenster: Gold und Silber, Rot und Grün. Ein leuchtendroter Weihnachtsmann erwidert ihr Starren über ein funkelndes Saxophon hinweg. Plattenspieler für Kinder ragen aus den Geschenkpackungen der Weihnachtsdekoration hervor. Noten liegen um die Instrumente verstreut, wie Blätter, die von einem unsichtbaren Baum gefallen sind.
Aus dem Inneren des Ladens, das Gesicht durch das Blitzen der Schaufensterscheibe etwas verschwommen, schaut ein junger Mann zu ihnen heraus. Sanft hält er eine Gitarre am Griffbrett, als hätte sie ein eigenes Leben, ein kostbares Leben, mit eigenen, inneren Werten, ein Leben, das geschützt werden muß. Am Revers seiner billigen Baumwolljacke ist ein weißes Plastiknamensschild befestigt. Sie entziffert die Buchstaben, einen Namen, der durch ihre Gedanken huscht, um Wiedererkennen kämpft, dann davonschwimmt, träge an den Rand ihres Gedächtnisses treibt.
Er schaut zu den Kindern, verwirrt, vielleicht ein bißchen besorgt, und lächelt dann freundlich – zwei kleine Engel, die am Heiligabend stockstill auf der University Avenue stehen. Dann dreht er sich um, hört eine Stimme (das merkt sie, ohne den Klang zu hören, und denkt, vielleicht ist es Mutter, vielleicht hat sie endlich gefunden, was sie wollte, sich daran erinnert, daß es uns gibt, daß wir hier draußen auf sie warten) und ist verschwunden.
»Florrie?«
Höher jetzt, wie der Wasserkessel kurz vor dem Kochen auf dem Küchenherd zu Hause, in der kühlen, grünen, unendlichen Weite von Cambridgeshire, wo die Geräusche anders sind, die Gerüche anders sind, wo die Dinge eine beruhigende Vertrautheit haben, die niemanden bedroht, nicht mal die Kinder.
Wo wir jetzt sein sollten, denkt sie. Nicht an diesem fremden Ort, wo niemand unseren Namen kennt und das dauernde Lächeln die Qualität billiger Weihnachtsdekorationen hat: oberflächlich, vorübergehend, jederzeit bereit, sich vom kleinsten Windstoß vertreiben zu lassen.
Manchmal (und das begann, bevor sie ins Flugzeug stiegen, das begann schon im weiten Grün, in einem Schlafzimmer, das weder ihres noch seines war), manchmal kann sie dieses Versteinertsein tief in sich spüren, dieses schwarze, harte Gefühl, das kommt und geht. Manchmal ist es so hart, daß es sie beängstigt, daß es sie Dinge denken läßt, die sie nicht glauben kann: ihr Vater tot, ihre Mutter verrückt, Autos, die zusammenprallen, Flugzeuge, die vom Himmel fallen, das Ende der Welt.
Und ihr Bruder verschwunden. Dieser Gedanke kommt oft, öfter als jeder andere.
Manchmal hört sie etwas, in einer lauten, klaren Stimme, die weder männlich noch weiblich ist. Worte, die sie nicht versteht, Worte, die sie gehört hat, aber niemals laut aussprechen darf (was die Worte aber nicht davon abhält, in ihrem Kopf zu hallen, zuerst mit der Stimme, die aus der Härte kommt, dann mit ihrer eigenen inneren Stimme, immer und immer wieder).
Am Anfang ließ sie die Versteinerung einfach dort liegen, kalt in ihrem Bauch, bis sie aus eigenem Antrieb verschwand.
Aber es gibt Momente, die inzwischen immer häufiger werden, in denen sie die Härte als angenehm empfindet, darauf wartet, daß sie kommt. Sie willentlich herbeiführt und die Stärke genießt, die sie dann durchströmt. Wie jetzt.
»Florrie!«
Sie schaut ihn an, und er wünscht sich, nie den Mund aufgemacht zu haben. Ihre Augen sind von einer Schwärze erfüllt, die er wiedererkennt und die er nicht mag. Aus Gewohnheit preßt er sofort den Arm eng an den Leib, weil stockstill vor Moores Musikladen standen, miteinander verschmelzen. Die goldenen Federn ihrer Flügel gingen in der plötzlichen Windbö ineinander über, machten sie zu einem einzigen himmlischen Geschöpf.
Sie umschließt ihn mit ihren Flügeln, und plötzlich ist es dunkel um ihn. Heiße Freude durchströmt sie, als sie ihn schluchzen hört, als sie die innere Stimme
drei Quarks für Muster Mark
monoton singen hört, unzusammenhängenden Blödsinn, als ihr die Stimme Worte ins Ohr flüstert, Worte, die sein Entsetzen anfeuern, bis sie sein Jammern als wilde, laute Vibration in ihrem Schädel wahrnimmt, ein schrilles, schmerzhaftes Heulen, das lauter und lauter wird und schließlich alles andere übertönt.
Die Härte spendet ihr Trost durch ihre geheime Komplizenschaft, ihrer Einladung zur Verschwörung, und sie meint, sie fast sehen zu können, wie einen Film zwischen dieser Welt und einer anderen, eine perfekte, nahtlose Glasscheibe, hart, glänzend, ohne Eingang und Ausgang, ohne Möglichkeit des Scheiterns, ohne versteckte Winkel, in denen sich eine Lüge verbergen läßt.
Sein Jammern hört auf. Jetzt kann sie hören, wie die Worte aus ihr hervorbrechen, durch ihre Zähne zischen, von ihren Lippen gleiten zusammen mit den Spucketropfen, entstanden vor lauter Eile beim Hervorstoßen, ohne überhaupt zu wissen, was die Worte bedeuten.
Sie spürt sein Zittern, weiß, daß der richtige Zeitpunkt gekommen ist, hebt ihre goldenen Flügel. Die fahle kalifornische Sonne erleuchtet sein Gesicht, und einen Moment lang ist sie von Triumph erfüllt, spürt ihren Sieg und eine helle, heiße, erwachsene Hitze.
Doch diesmal ist es mehr, mehr, als sie erwartet hat, mehr er weiß, wie weh es tut, wenn sie ihm das Handgelenk verdreht.
»Das sag’ ich Mami«, piepst er, flach, automatisch, in einer Stimme, die bereits die Niederlage hingenommen hat, eine Drohung ohne Gewicht, wie der Wind, der durch die University Avenue streicht. »Wenn Mami aus dem Laden kommt, dann sag’ ich’s ihr.«
Sie lächelt, und er fröstelt unter seinem dünnen weißen Hemd. Die Goldflügel sind so schwer. Er ist müde, ihm ist kalt, und er fühlt sich einsam.
Ihr Gesicht verzerrt sich wie das einer schlechten Schauspielerin; so, denkt Miles, wie Mädchen das immer machen, wenn sie einem etwas Gemeines antun wollen.
»Der kleine Engel Gabriel«, sagt sie langsam und betont, und da ist ein Brennen in seinen Augen, das er nicht ausstehen kann, das er zurückhalten möchte, über das er aber keine Kontrolle hat.
Sie beugt sich vor und berührt sanft seine Wange. Ihre Hand ist eiskalt, doch er meint, Schweiß daran zu spüren, Feuchtigkeit auf ihrer Haut.
»Der kleine Engel Gabriel«, wiederholt sie, und er spürt, wie sie ihn mit Finger und Daumen fest, erbarmungslos in die Wange kneift.
Zwischen den niedrigen Läden an der University Avenue frischt der Wind plötzlich auf, bläst durch die Blätter auf der Straße, wirbelt alte Zeitungen und weggeworfenes Papier auf, läßt die Menschen, die in letzter Minute Weihnachtseinkäufe machen, ihre Hüte festhalten und sich fragen, was sie hier eigentlich tun, wo sie doch zu Hause vor dem Fernseher sitzen, sich zum Kirchgang fertigmachen oder sich einen Drink mixen könnten, um die vor ihnen liegenden Tage, die Jahre, das allzu schnell vergehende Leben zu überstehen.
Von der anderen Straßenseite sah es so aus, als würden die zwei kleinen Kinder, die in ihren niedlichen Kostümen als sie wollte. Seine Augen rollen unkontrolliert hin und her. Aus seiner Kehle kommt ein Geräusch, das eher tierisch als kindlich ist.
Sie streckt ihre vergoldeten Flügel hoch über seinen zusammengekauerten Körper, so hoch, daß ihr die Arme weh tun. Wie ein kleiner, in seinem Nest gefangener Vogel erhebt er sich, die Augen schießen hierhin und dahin, suchen nach einem Fluchtweg, dann fliegt er davon, ein flatterndes Etwas aus Weiß und Gold, das vor ihr flieht.
Die Versteinerung in ihr löst sich auf, zieht sich wie rasch ablaufendes Wasser zurück. Die Stimme schweigt. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, wie sie geklungen hat. Ihr ist kalt. Das Gewicht der Flügel drückt schmerzhaft auf ihren Rücken, und ihre Schultern sacken nach vorne.
Als die Mutter schließlich zurückkommt, ist sie wieder fünf Jahre alt. Keine Erklärungen, keine Begründungen, nur Tränen und ein beängstigendes neues, unkindliches Gefühl, das so mühelos, mit einer solchen Leichtigkeit in ihre Welt eingedrungen ist, daß sie nicht weiß, ob es jemals wieder vergehen wird.
Miles ist verschwunden; und was sie entsetzt, was ihr das Gefühl gibt, die Welt unter ihren Füßen erzittern zu spüren, ist die Erinnerung an ihren letzten Gedanken, als er aus dem bedrohlichen Schutz ihrer Flügel floh. Die plötzliche, unumstößliche Gewißheit, daß es endgültig war und kein Zurück mehr gab.
Daß er, egal, wie oft sie sich entschuldigte, wie oft sie die Figuren auf der Tapete im Schlafzimmer zählte, für immer verschwunden war.
Daß er, in seiner Flucht vor ihr, auch vor der Welt geflohen war.
Kapitel 1: Die smaragdgrüne Stadt
LORENZO:
Der Mann, der nicht Musik hat in ihm selbst,
Den nicht die Eintracht süßer Töne rührt,
Taugt zu Verrat, zur Räuberei und Tücken;
Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht,
Sein Trachten düster wie der Erebus.
Trau keinem solchen! – Horch auf die Musik!
William Shakespeare
Der Kaufmann von Venedig
5. Aufzug, 1. Szene
Ohne dekorative Musik ist Zeit nichts weiter als ein Haufen langweiliger Produktionstermine oder Zahlungstermine.
Frank Zappa
Awop-bop-a-loo-bop alop-bam-boom.
Little Richard
Heiligabend 1995, Seattle, Washington State
Vorbei an der Sexbar mit der Leuchtreklame – die Hälfte der Birnen kaputt, die Schrift aber immer noch lesbar –, die »einhundert schöne nackte Frauen (und eine häßliche)« verspricht, vorbei am Spezialgeschäft für Papageien, dem Christlichen Landhandel, der Reihe heruntergekommener Pfandhäuser und Pornoläden, den Fischständen, an denen große Pazifiklachse für die staunenden Videokameras der Touristen durch die Luft fliegen, drei Stockwerke tiefer, vorbei an den Zauberläden und feministischen Buchhandlungen, den Ständen mit orientalischer Papierfaltkunst, dem kleinen Imbiß, an dem man scharfes, ampelrotes Chiligelee auf dünnen braunen Brotscheiben probieren kann, hinter dem Krach der Menge, dem Krächzen aufdringlicher Bettler, den Klängen eines auf der Straße gespielten Klaviers (Bruce Hornsby, etwas unsauber, aber trotzdem eine gute Imitation), tief im Inneren von Pike Place, dieser unterirdischen Urgemeinschaft von Flüchtlingen aus Einkaufszentren und sich treiben lassendem, abgewracktem menschlichem Strandgut, sitzt Paul Dunsany am Mischpult, spielt mit den Reglern vor sich, versucht einen Weg zu finden, wie er Ordnung in das Klanggewirr bringen kann, das durch die fest an seine Ohren gepreßten Kopfhörer zu ihm dringt.
Schon wieder ein Haufen Kids, die meinen, sie wären die Wiedergeburt von Nirvana. Bis hin zu dem blondgefärbten Haar des Leadsängers. Noch ein Haufen Kids, die es nicht kapiert haben.
Er beobachtet, wie sich das Band auf der alten, achtspurigen U-Matic dreht, sieht für einen kurzen Moment die Magnetpartikel auf dem dünnen braunen Plastikband zu den elektronischen Klängen, die der Tonkopf ausspuckt, hierhin und dorthin tanzen, schiebt den Baßregler hoch und denkt, mit einiger Schwierigkeit, an Ry Cooder, versucht sich an ein paar Takte ferner, hinreißender Gitarrenmusik zu erinnern. Hinter dem von Zigarettenrauch verschmierten Fenster starren die Jungs zu ihm herauf, warten auf ein Zeichen, warten auf ein kleines Wunder. Karierte Holzfällerhemden, unrasierte, nichtssagende Gesichter, langes schmutziges Haar. Die übliche Uniform. Die Uniform Seattles, entstanden in diesen grauen Industriestraßen.
Er zuckt die Schultern, macht den Mix etwas rauher und stellt im Kopf die Rechnung auf. Vielleicht hundertzwanzig Dollar für die gesamte Session, und wenn man das Band aufrauht, alles bis zum Anschlag hochdreht, denken sie am Ende, es würde besser klingen als beim Spielen.
»Prima«, sagt er schließlich ins Mikrofon und versucht, sich nicht übermäßig gelangweilt anzuhören. »Geht einen Kaffee trinken. Geht spazieren. Ihr kriegt das Band, wenn wir das Geld kriegen.«
Sie zucken die Schultern, gehorchen, räumen ihre Sachen zusammen: zwei billige Strat-Kopien, einen unidentifizierbaren Baß und ein elektronisches Schlagzeug für zweihundert Dollar. Dum dum, denkt Dunsany, dum dum didi dum. Vermutlich von einem Teenager in Tokio in den Mikrochip des Systems eingegeben. Willkommen im Zeitalter der Digi-Musik: drei Griffe auf der Gitarre und Schlagzeugrhythmus aus einer Sega-Maschine.
Du wirst zu alt für so was, sagt er sich bereits zum dritten Mal an diesem Morgen. Treib hunderttausend auf, richte ein neues Elektronikstudio ein, überlaß Frank und dem kleinen Computergenie die ganze Sache, lehn dich zurück, spiel wirkliche Musik, entspann dich.
Hunderttausend. Ein kleines, trockenes Lachen bildet sich irgendwo in seinem Hals, macht sich bemerkbar, wird zur Kenntnis genommen und verschwindet wieder, zu träge, sich in Klang umzusetzen, zu abgestumpft, der Lunge den nötigen Atem abzuringen.
Dunsany schimpft wieder auf die Rhythmusmaschine, deren blecherner Klang ihm noch im Ohr dröhnt, hält aber mitten im Satz inne. Das schwarze Telefon auf der Konsole klingelt. Er schaut durch die offene Tür des Kontrollraumes in das schmuddelige kleine Büro. Das kleine Computergenie hängt mit der Nase am Farbmonitor, völlig vertieft in ein Steuerungsprogramm, kriegt nichts mit. Frank ist nirgends zu sehen. Dunsany seufzt, nimmt eine der drei Weihnachtskarten, wedelt die Zigarettenasche weg, greift zum Telefon und sagt: »Pike-Studios, Musik für Ihre Ohren, Versorgung anderer Teile zum Tagespreis.«
Am anderen Ende ist es still, und er hebt automatisch, ohne zu wissen warum, die Hand, fährt mit dem Zeigefinger über die glatte, dünne Linie der Narbe, die sich von seinem rechten Auge fast bis zum Kinn erstreckt. Sie ist inzwischen beinahe unsichtbar, hauptsächlich am Fehlen der Bartstoppeln zu erkennen. Dunsany ist letzten Monat zweiundvierzig geworden. Jemand brachte einen Kuchen mit ins Zanzibar, hatte ihn in der Pause vor ihm aufgebaut. Er nahm einen Bissen, lächelte, lehnte ab. Zu alt für Haschkuchen; der Geschmack von Redhook, frisch gezapft, kalt, bernsteinfarben, schien angebrachter, passender. Sein Haar ist jetzt kurz geschnitten, noch immer voll und kastanienbraun, reicht etwas über die Ohren und gerade bis an den Kragen. Er trägt eine runde, eulenhafte Schildpattbrille, und seine Wangen werden allmählich schwer. Ähnelt mehr einem dieser modischen Werbefritzen als einem Musiker. Andere Zeiten, andere Menschen.
»Paul?«
Er erkennt die Stimme, und diesmal fängt die Narbe tatsächlich an zu pochen, ein schwacher, kalter Schmerz direkt unter der Haut.
»Paul? Hast du die Zeitung gelesen? Ist es zu fassen?«
Er braucht einen Moment, um sich zu orientieren, zu kapieren, um der Stimme, die so nahe klingt, aber ein zeitlich und auch räumlich so fernes Echo im Timbre ihres Klanges hat, ein Gesicht zu verleihen.
»Hal?«
»Wer denn sonst?«
Es scheint Jahre her zu sein. Es ist Jahre her. Immer noch der Bostoner Akzent, nicht so ausgeprägt wie vor zwei Jahrzehnten, aber vorhanden, mit der Stimme, der Person verschweißt, unsichtbar, ein Merkmal, das durch den Telefondraht dringt und Hal identifiziert.
Dunsany sucht nach Worten, sucht nach einem Bild, einer Vorstellung des Mannes am anderen Ende der Leitung. Es irritiert ihn, daß die Erinnerung von vor zwanzig Jahren viel stärker, viel realer ist als die ihres letzten, eher zufälligen Treffens in einem Restaurant am Wasser, wo sie die Fähren auf dem Sund beobachteten und sich krampfhaft bemühten, Worte zu finden, die sie auch jetzt noch verbanden ...
Schließlich stammelt Paul Dunsany etwas, um ihrem Gespräch ein wenig Leben einzuhauchen. »Wie geht’s denn so, Hal? Und wie geht’s Louise? Verdienst du immer noch die Megakohle und ziehst Kinder groß, damit die Schulen in Bellevue was zu tun haben?«
»Spar dir den Smalltalk. Liest du überhaupt Zeitung, oder bist du nach wie vor zu sehr damit beschäftigt, den fünften Beatle zu spielen?«
»Also manchmal, Hal, läßt du dein Alter ganz schön raushängen. Mit dem fünften Beatle kannst du heutzutage nichts mehr reißen.«
»Was du nicht sagst. Ich werd’s mir merken. Hast du überhaupt eine Ahnung, warum ich anrufe?«
Seine Stimme hat einen merkwürdigen Klang, einen, den Dunsany zuvor selten gehört hat. Irgendwo in der Tiefe schwingt Furcht mit, der hohe, unverkennbare Ton der Panik.
»Klär mich auf.«
»Himmel. Es kam überall in den letzten fünf Tagen, im Fernsehen, auf den Titelseiten ...«
»Ich hab’ manchmal einfach viel zu tun.«
»Sieht so aus. Eines Tages könntest auch du erwachsen werden und merken, daß es in dieser Welt einen Unterschied zwischen Aktivität und Arbeit gibt. Das ist ein Zeichen, mein Freund. Das erste Zeichen, daß du erwachsen wirst.«
»Ich werd’s mir merken.«
»Das bezweifle ich. – Quinn. – Ich weiß ja, daß du seit damals ein Problem mit deinem Erinnerungsvermögen hast, aber sagt dir der Name irgendwas, alter Freund? Klingelt’s da bei dir?«
Dunsany atmet scharf ein, und jetzt schmerzt die Narbe wirklich. Seine Haut zieht sich so krampfhaft zusammen, daß er den Beginn einer Migräne im Hinterkopf spürt. Etwas schwirrt durch seine Gedanken, eine wilde Mischung aus Formen, Farben und Menschen.
»Quinn gibt’s in meinem Leben nicht mehr. Das weißt du. Es hätte ihn von Anfang an nicht geben sollen.«
»Nein. Hat es aber. In unser aller Leben, ob es uns nun gefiel oder nicht. Und jetzt kommt er zurück. Ist das nicht nett?«
Paul Dunsany spürt, wie sich sein Magen verkrampft, ist erstaunt darüber, fragt sich, warum.
»Wenn ich nachher auflege, Paul, möchte ich, daß du rausgehst und dir eine Zeitung kaufst, ein paar Minuten in der wirklichen Welt verbringst und dir klarmachst, was da draußen vorgeht, außerhalb deines Kopfes, wo wir anderen zu Hause sind.«
»Quinn hat lebenslänglich gekriegt, Hal. Wir können ihn vergessen.«
»Hatte lebenslänglich gekriegt, Paul. In deinem Wolkenkuckucksheim kannst du diese Dinge vielleicht ignorieren, aber wir anderen müssen uns mit dieser seltsamen Spezies, die sich Anwälte schimpfen, auseinandersetzen. Anwälte tun schlimme Dinge, Paul. Dinge, die wir nicht wollen. Sie lesen Bücher, beugen das Gesetz, kriegen Geld von der Regierung, das es ihnen ermöglicht, ihre Nase in Dinge zu stecken, die sie nichts angehen. Lies die Zeitung, Paul. Quinn ist draußen. Seit heute. Das hat Schlagzeilen gemacht. Nicht ganz so sehr, als wenn sie Charles Manson freigelassen hätten, mit einer Millionenrente und einem Satz Küchenmesser zur freien Verfügung. Nicht ganz so sehr. Aber fast.«
»Das ist unmöglich.«
»Siehst du, du unterschätzt die Anwälte schon wieder. Natürlich ist es möglich. Was meinst du wohl, wozu diese Leute da sind? Hätten sie Quinn jetzt geschnappt, wäre ihm der elektrische Stuhl so gut wie sicher gewesen. Aber das haben sie nicht. Sie haben ihn vor zwanzig Jahren geschnappt, als das Leben nicht unbedingt das war, was es heute ist, besonders, wenn der Richter beim Verkünden des Urteils die falsche Sockenfarbe trug. Irgendein verdammter Anwalt hat die Gerichtsakten durchgeschaut und ist auf Verfahrensfehler gestoßen, so daß sie ihn freilassen mußten. Nicht unbedingt eine Begnadigung, aber wenn er erst mal draußen ist, wird er sich deswegen kaum anstellen. Machen wir uns doch nichts vor, wir wissen beide, wir wissen alle, daß er seine Strafe verdient hatte. Und mehr.«
Dunsany überlegte: Wußte er das wirklich? Oder war es etwas, das er einfach nur hingenommen hatte?
»Was machen wir jetzt?«
»Du machst gar nichts. Verhältst dich nur ruhig. Sprichst mit niemandem. Wenn jemand mit dir darüber reden will, läßt du es mich wissen. Arbeitest du Weihnachten?«
»Pike Place Studios – wir schlafen nie. Ja. Ein paar Jungs haben für morgen gebucht, also werde ich hier sein.«
»Gut. Wenn was ist, ruf’ ich dich an. Solange wir zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Dafür werde ich sorgen. Im Gegensatz zu dir habe ich was mit dem Geld angefangen, das wir mitgebracht haben, und kann mir einiges leisten. Aber keine Sorge. Ich werde dich nicht zur Kasse bitten. Ich will nur, daß wir uns darüber einig sind, wie wir die Sache angehen.«
Dunsany versuchte, sich die Konsequenzen auszumalen. Es war unmöglich; so, als würde man versuchen, zwei Noten auf dem Griffbrett zu greifen, die zu weit auseinander liegen, wie sehr man auch die Finger spreizt.
»Danke«, sagte er schließlich.
»Schon gut. Wenn wir alles richtig machen, kann uns nichts passieren, Paul. Aber du kennst Quinn. Welche Tricks dir dein Gedächtnis wegen der Sache damals auch immer spielen mag, du weißt, daß er uns alle ans Messer liefern kann, wenn er mit der Polizei oder der Presse oder irgend jemandem redet.«
»Ja«, sagte Dunsany und überlegte erneut, ob er wirklich wußte, daß es stimmte?
»Und Maus?«
Das schien alles so weit weg. Dunsany spürte, wie die Jahre um ihn herumschwirrten.
»Du meinst Margie?«
Die Stimme am anderen Ende schwieg. Er wußte nicht, wie sehr dieser Hal Jamieson es vertragen konnte, verbessert zu werden.
»Ja«, sagte Jamieson schließlich. »Margie. Weißt du, wo sie ist? Was sich da tut?«
»Nein.« Dunsany schüttelte den Kopf, obwohl es niemand sehen konnte. »Das ist alles so lange her, Hal. Die ganze Sache liegt so weit zurück. Glaubst du, wir hätten so lange in Verbindung bleiben können?«
»Nein. Aber ich mußte fragen. Das weißt du, nicht wahr?«
»Ja«, sagte Dunsany, ohne darüber nachzudenken.
»Wann fängt denn ein Musiker dieser Tage an zu arbeiten?«
Und endlich, als hätte es sich aus einem verborgenen und halb vergessenen Ort vorgearbeitet, lag etwas von Freundschaft in seiner Stimme, eine Mischung aus Entschuldigung und Verwirrung über die Entwicklung der Dinge nach so langer Zeit. »Nur falls ich dich anrufen muß. Ich weiß, ihr Bohemiens habt eine seltsame Tageseinteilung.«
Aus reiner Gewohnheit schaute Dunsany auf die Uhr. Es war Viertel vor zehn morgens. Drei Stunden Schlaf, seit sie in der Zanzibar Schluß gemacht hatten. Er brauchte einen anständigen Kaffee, der so schmeckte, als hätte er irgendwann mehr als eine flüchtige Bekanntschaft mit der als Koffein bekannten Substanz gemacht. Er mußte nachdenken. Er mußte diesen Haufen junger Brüllaffen loswerden, die jetzt wieder im Studio aufgetaucht waren und »Santa Claus Is Coming to Town«, arrangiert von Bruce Springsteen, anstimmten.
»Morgen ab zehn. Bis was weiß ich.«
»Und, Paul?«
»Ja?«
»Geh los. Kauf dir eine Zeitung. Werd nüchtern. Reiß dich zusammen. Könnte sein, daß du es brauchst.«
Dunsany nickte, legte den Hörer auf, zündete sich eine Zigarette an, ließ die Asche in die Spalten des Mischpultes fallen.
»Quinn«, sagt er leise vor sich hin. Und zwanzig Jahre seines Lebens verpufften wie eine Rauchwolke.
Kapitel 2: Joni und der Detektiv +
All the tears
All the rage
All the blues in the night
If my eyes could see
You kneeling in the silver light
If you’re out there can you touch me?
Can you see me? I don’t know
If you’re out there can you reach me?
Lay a flower in the snow
Robbie Robertson/Martin Page,
»Fallen Angel«
Der kleine Zubringerzug fuhr unter dem Sea-Tac-Flugplatz im Kreis, immer rundherum, brachte sie vom Flugsteig zum Flughafengebäude, und sie war nur fähig, ihr Spiegelbild im dunklen Fensterglas zu betrachten, teilnahmslos, müde, blaß, ihre blonden Locken zerzaust, und sich zu fragen, warum? Sie war weit weg von London, weit weg von dem einzigen Ort, den sie auch nur entfernt als Zuhause bezeichnen konnte. Sie fühlte sich ausgelaugt, ein wenig schwindlig nach dem neunstündigen Flug, und es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren. Es fiel ihr schwer, überhaupt zu denken. Die Zeit lief rückwärts an diesem seltsamen, fremden Ort, und während ihr Körper ihr sagte, daß es Mitternacht sei, teilte ihr die Armbanduhr mit, es sei fünf vor vier am Nachmittag.
Als der Zug hielt, schloß sich Joni Lascelles der aus den Türen strömenden Menge an, ging zum Gepäckband, wartete auf ihren schlichten schwarzen Koffer und überlegte, wie sie sich an diesem neuen Ort, auf diesem neuen Kontinent orientieren sollte. Zum ersten Mal hatte sie diesen großen Treck unternommen, zum ersten Mal hatte sie vom Flugzeug aus beobachtet, wie sich die Welt in Eis verwandelte, als sie über das Dach der Erde geflogen waren, von einem Ozean zum anderen. Sie hatte so viel in die Sache investiert, das weit über Geld hinausging, weit darüber hinaus, und trotzdem war sie nicht bereit, war sie unvorbereitet. Es war alles so schnell geschehen, die hastigen Vorkehrungen nach der Beerdigung, das eilige Umorganisieren der Verantwortlichkeiten in der kleinen Anwaltskanzlei, in der sie arbeitete, die Telefonate mit Amerika, um Hilfe zu finden, Menschen aufzuspüren, die man zu Hause einfach in den Gelben Seiten nachschlagen konnte.
Warum tat sie das alles? Warum mußte es hier sein?
Der kleine Koffer fiel auf das Gepäckband, sie nahm ihn hoch, ging zum Ausgang und wartete auf den Flughafenbus in die Stadt. Es hätte aufregend sein sollen; ein neuer Ort, eine neue Welt. Es roch anders: feucht, chemisch unter der Feuchtigkeit, aber überlagert mit etwas Salzigem und Elementarem, das vom Meer stammte. Der Tag trug einen Schleier aus grauem, irisierendem Nebel. Man konnte nur ein paar hundert Meter weit sehen. Eine Einschätzung war nur aufgrund von Gerüchen möglich, und die waren so industriell exotisch, so seltsam, so weit von dem entfernt, was sie erwartet hatte, daß es ihr unwirklich vorkam. Hier hätten Fichten, Grizzlybären, breite Flüsse, hohe, schneebedeckte Berge sein sollen. Statt dessen nur dieser graue Schleier und der Geruch von Dieselöl und Fabriken, der den salzigen Nebel vom Meer überlagerte.
An der Außentür des Flughafens hing ein Kranz und darunter, als wenn irgend jemand das vergessen könnte, standen die Worte: »Fröhliche Weihnachten für alle Sea-Tac-Kunden und ein glückliches Jahr 1996.«
Sie betrachtete den Kranz aus Blättern und roten Blumen und dachte: Sie sehen Weihnachten, ich sehe eine Beerdigung. Die Welt interpretierte das eine, sie interpretierte etwas anderes. Im Geist sah sie das Bild des kleinen, aus den fünfziger Jahren stammenden Krematoriums im Norden Londons, ein heller Fichtensarg, der über die Rampe verschwand, Orgelmusik vom Band, drei Trauergäste, außer ihr selbst, und zwei davon aus dem Sanatorium. Ein Leben, das dreiundfünfzig Jahre gewährt hatte, das, begonnen während der Bombardierung Londons, den kalten Krieg und Elvis, die Suez-Krise und Jackson Pollock, Stalin und Gorbatschow, Bernstein und die Beatles erlebt hatte. Ein Leben, das in eine seltsame Starre verfallen war, eine enervierende Bernsteinhülle, als es gerade hätte am besten sein, als es gerade hätte erblühen sollen. Und all dieses in Staub verwandelt, aus der Welt genommen in wenigen – sie könnte sie zählen – Sekunden, die in dem kleinen Backsteingebäude verstrichen, das ohne weiteres als Wartehalle für den städtischen Bus durchgegangen wäre.
Aber dort, wo sie jetzt ist, gibt es keinen Hunger. Dort, wo sie jetzt ist, gibt es keinen Schmerz.
Joni Lascelles bestieg den Flughafenbus, bezahlte das Fahrgeld, betrachtete die vorbeiziehende Gräue, die, als sie sich der Stadt näherten, von riesigen, klotzigen, nur halb zu sehenden Bürotürmen und den vagen Formen der Fußgänger durchbrochen wurde, durch den Nebel eilenden Figuren, die nicht stillstehen, die Feuchtigkeit nicht in sich aufnehmen wollten. Ihre Müdigkeit ließ ein wenig nach, als sie die Menschen auf der Straße sah, und sie konnte leidenschaftslos, distanziert über ihr eigenes Leben nachdenken, über dessen Form und über die vor ihr liegende Arbeit. Und es war die Arbeit, auf die es ankam, sonst nichts. Es mochten noch andere Dinge geschehen, während sie hier war, und sie wußte, was dieser Gedanke bedeutete, obwohl sie ihn nicht ausfüllen, ihm keine Form geben mochte. Diese seltsamen, kurzen, hektischen Affären, die innerhalb von Tagen, höchstens Wochen aus dem Nichts über Leidenschaft zur Langeweile führten, waren ein Teil von ihr, eine Facette ihres Charakters, die sie nicht kontrollieren, auch nicht im Ansatz verstehen konnte. Wenn das passierte, dann passierte es eben. Aber die Arbeit hatte Vorrang, war wichtiger als alles andere.
Der Bus hielt vor ihrem Hotel. Es war alt, das Mauerwerk vom Smog und vom salzigen Sprühwasser des Ozeans gezeichnet. Sie trat durch die schmale Eingangstür, trug sich unter dem nur halb interessierten Blick des Portiers ein, ging in ihr Zimmer, legte sich aufs Bett, betrachtete die Zimmerdecke und wartete. Es war der Tag vor Heiligabend. Die Zeit existierte nicht mehr; oder wenn sie es tat, hatte sie sich verändert, hatte ihre Form verloren, war auf dem Flug über die Welt unbeständig, unzuverlässig geworden. Sie sah auf die Uhr, begann auszupacken, hörte nach der Hälfte auf, legte sich wieder aufs Bett und schlief ein.
Es war fast zehn Uhr morgens, und sie war seit vier Uhr wach, hatte auf dem Bett gelegen und an nichts Bestimmtes gedacht. Tom Cordobes kam zehn Minuten zu früh, ohne sich dafür zu entschuldigen. Er sah zu, wie sie einige Notizen und einen Block aus ihrem Koffer nahm und ihn dann, mit einer fast verstohlenen Geste, unter das Bett schob. Er ließ sich auf dem Korbstuhl nieder, griff nach einer Zigarette und wartete. Schließlich setzte sie sich auf das Bett, zog den zerkratzten Couchtisch heran, lächelte matt und sagte: »Es wäre mir lieber, wenn Sie es nicht täten.«
Ein Blick aus kalten blauen Augen, so undurchdringlich wie der Nebel, der jetzt die Stadt einhüllte.
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
Tom Cordobes schnaubte, klopfte mit der unangezündeten Marlboro auf den kleinen Hotelzimmertisch und steckte sie dann zurück in die Schachtel. Plötzlich fühlte er sich alt. Er hätte wohl doch nicht mit dem Auto hier hochfahren sollen, durch ganz Oregon, diese unendlich lange Strecke durch menschenleeres Gebiet. Aber das senkte die Kosten. Man konnte natürlich fliegen und sich vor Ort ein Auto mieten, doch wenn dann die Rechnung nicht bezahlt wurde, und das kam heutzutage immer öfter vor, war der Verlust noch größer. Und er dachte nicht daran, nach London zu fliegen, falls er auch bei diesem Auftrag seinem Geld hinterherlaufen mußte.
»Sie klingen wirklich sehr englisch«, sagte er und bemühte sich rasch, seine Grimasse hinter einem Lächeln zu verbergen. Was für eine blöde Bemerkung. Tom Cordobes war ein Meter achtzig groß, ging auf die sechzig zu und hatte die kräftige Figur eines jüngeren, muskulöseren Mannes, der etwas aus dem Leim gegangen ist. Er trug einen hellen, verknitterten Anzug und hellbraune Lederschuhe, so auf Hochglanz poliert, daß man ihnen das Alter fast nicht ansah. Sein Gesicht war gebräunt und wettergegerbt, runzlig wie ein Stück Leder, das zu lange in der Sonne gelegen hat. Er hatte einen graumelierten Zapata-Schnurrbart, der aus seiner Zeit als Motorradpolizist stammte. Tom Cordobes schaffte sich Dinge an und vergaß dann, sich wieder von ihnen zu trennen. Der Schnurrbart war eines davon, genau wie die Sammlung von Roy-Orbison-Platten und der Wohnwagen bei Milpitas, unten in Kalifornien, der ihm als Wohnung und Büro diente, seit die Steuern in San Jose so unmöglich hoch geworden waren, so hoch, daß es nur vernünftig schien, den Anrufbeantworter, den Computer und das Fax auszustöpseln und im Wohnwagen wieder zu installieren. Wenn man bescheiden genug lebt, braucht man nicht so viel Geld zu verdienen, hatte sich Cordobes damals gesagt. Und als die Polizeipension mit jeder Rechnung, die ihm auf den Frühstückstisch flatterte, weniger und weniger zu werden schien, hatte er vergessen, welcher Teil der Gleichung als erster kam.
Er schob seine Visitenkarte über den Tisch. Das Pequod Hotel an der Ecke Dritte Straße und Lenora war nicht gerade der Ort, an dem man erwartete, eine schicke englische Anwältin zu treffen. Es war die Art Gegend, die Makler als »kommend« bezeichneten, was für Tom nichts anderes hieß, als daß die Pseudobohemiens Schlange standen, um ein Loft zum Renovieren zu ergattern, auf der Straße aber immer noch über Penner stolperten, wenn sie ihre Futons über die Türschwelle schleppten. Die Straße vor dem Hotel war grau und dreckig – soviel hatte er in dem dichten, undurchdringlichen Nebel, der über Nacht vom Puget-Sund hereingeweht war, ausmachen können. Der Verkehrslärm wurde dadurch zwar gedämpft, war aber immer noch deutlich zu hören, selbst durch das geschlossene Fenster. Dreimal war er auf den dreihundert Metern vom Parkplatz bis zum Hotel von zwielichtigen Typen angerempelt worden. Das Zimmer war groß, doch die Möbel wirkten wie vom Sperrmüll: ein großes Doppelbett mit einer durchgelegenen Matratze, zwei Stühle, ein zerkratzter Couchtisch, darüber hing ein billiger, vergilbter Kronleuchter, der nicht genug Licht gab, um den Staub in den Ecken sichtbar zu machen.
»Haben Sie sich das Hotel selbst ausgesucht, Miss?«
Sie warf ihm einen erstaunten Blick zu. Einen so direkten Blick, daß er beinahe rot wurde.
»Das Reisebüro hat es für mich gebucht.«
Mehr nicht.
»Na ja, ich rate Ihnen nur, nicht allein in dieser Gegend herumzulaufen. Ein paar Blocks weiter, drüben am Pike Place mit all den Touristen, ist es kein Problem. Aber diese Gegend hier ist, wie soll ich sagen, noch sehr verbesserungsbedürftig. Und es wird noch eine Weile dauern.«
»Vielen Dank«, sagte sie und schob ihrerseits eine Visitenkarte über den Tisch. Er griff danach: Lascelles und Soames, Anwaltskanzlei, mit einer Londoner Adresse, die ihm nichts sagte. Darüber stand: Joni Lascelles, Seniorpartner.
Senior. Diese Senioren werden auch täglich jünger, dachte Tom Cordobes.
In einer anderen Zeit, als er noch mit dem Polizeiwagen durch Palo Alto gegondelt war und sich wie der Zar aller Reußen gefühlt hatte, hätte er sie als »Mädchen« bezeichnet, und niemand hätte ihm widersprochen. In jenen Tagen widersprach niemand Tom Cordobes, nicht, wenn ihm sein Leben lieb war.
Joni Lascelles war schlank, schon beinahe hager, etwa ein Meter zweiundsiebzig groß und trug enge dunkelblaue Levis und einen schwarzen Rollkragenpullover. Am Handgelenk baumelte ein schmales Silberarmband, dazu eine teuer aussehende Armbanduhr. Sie trug kein Make-up, und das machte sie irgendwie noch bemerkenswerter; runde, große, etwas vortretende hellblaue Augen in einem offenen, attraktiven Gesicht, Augen, die einen scheinbar unverwandt anschauten. Und ein Mund, der stets halb offen stand, selbst wenn sie nicht sprach; ein ausdrucksvoller Mund, der, wie der Rest ihrer Gesichtszüge, fast zu übertrieben, fast zu groß wirkte. Auf dem Kopf ein blonder Lockenwust, zweifellos gefärbt, aber mit einer Selbstsicherheit in der Farbwahl, die darauf deutete, daß es keine Rolle spielte. Exakt so wollte sie aussehen, erklärte sie damit, mit einer Deutlichkeit, daß es selbst ein Mann in Cordobes Alter verstand – wie ein Hippiemädchen. Wie eine aus der Achtundsechzigergeneration, nur war sie sauberer, smarter und wissender, hatte dieses Aussehen gewählt und sich nicht dem Druck hartnäckiger Gleichaltriger gebeugt. Irgendwo in ihrer Handtasche, das wußte er einfach, hatte sie eine runde, undurchsichtige Sonnenbrille mit Nickelrahmen, und wenn Joni Lascelles sie aufsetzte, würde sie wie eines der Gesichter auf den Plattenhüllen aussehen, auf denen man Dopereste fand, wenn man die Häuser der Hippies durchsuchte: gelassen, starrend und vielleicht ein bißchen wild hinter der Fassade. Cordobes konnte sich nicht entscheiden, ob er sie attraktiv, vielleicht sogar schön fand, oder ob sie etwas Leeres, Ausdrucksloses im Gesicht hatte, wie viele dieser jungen Leute heutzutage, die man sich gar nicht genauer anschauen wollte, weil es Zeitverschwendung sein könnte. Was immer es war, sie war nicht reizlos. Und von wegen senior, sie war höchstens fünfundzwanzig, wenn nicht sogar viel jünger, das ließ sich immer schwerer sagen.
Ihm ging auf, daß er sehr lange geschwiegen, sich zu intensiv mit ihrem Aussehen beschäftigt hatte. Als er spürte, wie sie ihn musterte, wäre er beinahe wieder rot geworden. Dann lächelte sie, ein breites, offenes Lächeln, das ebenmäßige, strahlend weiße Zähne zum Vorschein brachte, so daß er nicht anders konnte, als das Lächeln zu erwidern. Wenn sie lächelte, war Joni Lascelles einfach nur liebenswert. Es war, als würde man von einem gewaltigen, leuchtenden Wärmestrahl erfaßt. Tom Cordobes hielt sich also nicht damit auf, die Aufrichtigkeit dieses Lächelns zu bezweifeln, sondern fragte sich nur, wie oft dieses kleine Wunder geschah und ob es irgendwo einen glücklichen Mann gab, für den es hin und wieder privat angeschaltet wurde.
»Irgendwie habe ich den Faden verloren«, sagte Cordobes.
»Schon gut.« Sie lächelte immer noch, und alle Leere war aus ihrem Gesicht verschwunden. Manche Frauen können einen mit ihrem Charme glatt von den Bäumen locken, sagte sich Cordobes, aber es war lange her, seit er so einer begegnet war. Die einzigen hübschen jungen Frauen, denen er heutzutage begegnete, bezichtigten ihn meist, ihre Ehe zerstört zu haben. So wie es in seinem Geschäft nun mal lief.
»Zunächst sollten wir wohl das Finanzielle regeln.«
Joni griff nach ihrer Handtasche und zog eine blaue Geldtasche aus Plastik heraus, wie man sie in der Bank bekommt, vollgestopft mit Dollarscheinen. Sie zählte eine Handvoll davon ab und legte die Scheine auf den Tisch.
»Hier sind die tausend Dollar Vorschuß, wie von Ihnen verlangt. Mit den zweihundertfünfzig Dollar pro Tag plus Spesen, die Sie am Telefon erwähnten, bin ich einverstanden.«
Cordobes steckte das Geld ein und wünschte sich, es liefe immer so reibungslos.
»Es gibt eine Menge, was ich wissen muß, Miss. Zum Beispiel, wie Sie überhaupt auf mich gekommen sind.«
»Nachforschungen«, sagte sie und beließ es dabei.
»Könnten Sie das etwas näher erklären? Ich meine, es gibt Dinge, die ich nicht zu wissen brauche, aber andere muß ich wissen. Im Moment habe ich das Gefühl, nicht sonderlich viel zu wissen. Warum ausgerechnet ich? Man kriegt in Milpitas dieser Tage nicht übermäßig viele Aufträge aus London. Ich würde mir gerne einbilden, es sei eine Ehre.«
Sie holte einen teuren Füller aus ihrem Aktenkoffer und begann sich Notizen zu machen. Er kam sich vor, als würde er auf eine medizinische Untersuchung vorbereitet.
»Sie waren während der Quinn-Sache Polizeilieutenant in Palo Alto.«
»Ja. Woher wissen Sie das?«
»Wie schon gesagt, Nachforschungen.«
»Wenn Sie so gut im Nachforschen sind, wozu brauchen Sie dann mich?«
Sie dachte darüber nach. Die Frage schien ihr zu gefallen.
»Es ist eine Sache, jemanden alte Zeitungen durchschauen zu lassen und sie mit dem aktuellen Staatsregister lizensierter Privatdetektive zu vergleichen, Mr. Cordobes. Das können wir telefonisch von London aus erledigen; jetzt müssen Nachforschungen vor Ort angestellt werden, und das ist wirklich nicht unser Gebiet.«
»Und was ist Ihr Gebiet? Sind Sie Strafverteidigerin oder was?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wir beschäftigen uns mit Zivilrecht. Ich weiß nicht, wie man es hier nennt, aber wir befassen uns mit Nachlässen, Testamenten, Verfügungen. Solchen Sachen.«
»Klingt ziemlich langweilig.«
»Meinen Sie?«
»Wenn ich das so sagen darf. Und es handelt sich bestimmt nicht um eine Zeitungssache? Ich habe gehört, daß der National Inquirer an der Sache dran ist, daß ganze Horden von Sensationsreportern dem fabelhaften Quinn auf der Spur sind und ihn mit haufenweise Geld überschütten wollen, nur um rauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Wenn Sie da die Pfoten drin haben, Miss, sollten Sie mir das auf der Stelle sagen. Ich habe Regeln, nach denen ich arbeite, und wenn es in die Privatsphäre geht, dann kann es für mich ziemlich häßlich werden, falls es schiefläuft.«
Sie ging zum Nachttisch, griff nach einer Flasche Mineralwasser, schraubte sie auf und goß sich ein Glas ein.
»Möchten Sie auch etwas?«
Er verzog das Gesicht. »Haben Sie je gehört, was W. C. Fields von dem Zeug hielt?«
»Sie meinen, daß Fische darin ficken?«
Und diesmal wurde er wirklich rot, tief unter der Walnußbräune, und sie wußten es beide.
Er sagte nichts.
»Ja, Mr. Cordobes.« Joni Lascelles lächelte ihn an. »Mehrmals, glaube ich.«
Sie setzte sich wieder und stellte das Glas auf die Resopaltischplatte. Cordobes hörte das Prickeln der kleinen Blasen im Glas und merkte, daß er nicht fortfahren konnte, bevor sie sich beruhigt hatten.
»Es ist ein alter Witz. Ein schlechter Witz. Entschuldigen Sie.«
»Keine Ursache.« Sie lächelte immer noch. »Ich bin volljährig. Und um Ihre Frage zu beantworten, nein. Unser Klient ist keine Medienorganisation. Unser Klient ist genau die gleiche Art von Klient, die wir immer haben. So langweilig das auch sein mag. Ein Nachlaß, der angefochten werden kann oder auch nicht, je nachdem, was wir über die Vorgänge in Palo Alto vor zwanzig Jahren herausfinden können. Ich bin sicher, daß ich Sie an eines nicht zu erinnern brauche: Auch wenn Ihre Zeitungen Quinn als eine Art Massenmörder zu betrachten scheinen, gab es damals in Palo Alto nur einen nachgewiesenen Todesfall, den die Polizei ihm aber nicht anlasten konnte.«
»Nicht anlasten. Nein. Das ist nicht dasselbe wie nicht schuldig.«
»Vor Gericht ist es allerdings genau dasselbe.«
»Sie sind die Anwältin. Ich bin nur ein Expolizist, der mit dem ganzen Scheiß fertig werden mußte, und ich sage Ihnen, daß Quinn bis zum Hals in Sachen verwickelt war, bei denen Ihnen die Haare zu Berge stehen würden. Wir haben noch nicht mal die Hälfte davon erfahren, wenn Sie meine Meinung wissen wollen.«
»Nein«, sagte sie, und die Härte in ihrer Stimme verblüffte ihn. »Das ist genau das, was ich nicht will, Mr. Cordobes. Meinungen zählen nicht bei dieser Art von Fall, über den wir hier sprechen.«
»Testamentssachen? Vermächtnisse? So was in der Art?«
»So was in der Art. Wir haben einen Nachlaß, der geregelt werden muß und auch geregelt werden wird, wenn wir keine weiteren Informationen von Mr. Quinn erhalten. Wenn er sich andererseits bereit erklärt, eine einfache Aussage zu machen, ohne Voreingenommenheit, ohne Schuldige zu benennen ...«
»Aha«, sagte Cordobes und meinte, jetzt endlich kapiert zu haben.
»Dann«, fuhr sie fort, »würde der Nachlaß anders geregelt werden.«
»Es geht um den Unterschied«, sagte er, »zwischen einer toten und einer vermißten Person. Wenn jemand tot ist, kann man ihn aus dem Testament ausschließen, wenn er aber noch vermißt wird, muß man entsprechende Vorkehrungen oder so was treffen.«
»Genau. Damit brauchen Sie sich aber nicht zu befassen. Wir verlangen nur von Ihnen, Mr. Quinn zu finden, das Gespräch zu organisieren, wenn er einverstanden ist, und das wär’s dann. Wir sind bereit, die Sache zwei Wochen lang zum vereinbarten Preis zu finanzieren, und wenn sich bis dahin nichts entschieden hat, werden wir die Idee aufgeben.«
Cordobes nickte. »Ziemlich blöder Zeitpunkt, das zu versuchen – über Weihnachten.«
Sie sah ihn durchdringend an. »Was bleibt uns denn anderes übrig? Irgendwann wird Quinn garantiert mit jemandem reden. Wenn er von den Medien Geld dafür bekommt, wird das seine Aussage in den Augen des Gerichtes vermutlich ungültig machen. Entweder sprechen wir als erste mit ihm oder gar nicht.«
»Ja. Verstehe.«
Joni Lascelles beendete ihre Notizen und legte den Block auf den Tisch.
»Können Sie das für uns tun?«
Cordobes zuckte die Schultern. Er wurde zu alt dafür, den Leuten etwas vorzumachen.
»Wie ich schon am Telefon sagte, ich kenne Leute im Obispo-Gefängnis. Gute Leute. Es ist ihnen zuwider, daß Quinn überhaupt rauskommt. Und das macht sie ein bißchen vorsichtig bei dem, was sie sagen. Verstehen Sie, kann sein, daß nicht nur die Medien hinter dem Kerl her sind. Eine Menge Verrückte würden ihn liebend gern abknallen, wenn sie die Chance dazu bekämen. Gibt eine gute Jagdtrophäe fürs Arbeitszimmer ab. Und ich kann mir nicht vorstellen, daß viele was dagegen hätten.«
»Und?«
»Und wie ich schon am Telefon sagte, habe ich einen ziemlich guten Tip aus Obispo, daß der Mann auf dem Weg hierher ist. Aber mehr war nicht rauszukriegen. Und mit hier meine ich den Staat Washington, der ein einziges Riesenversteck ist. Es ist ein Anfang, kein sehr guter, aber es ist ein Anfang.«
»Was haben Sie also als nächstes vor?« fragte sie, und Tom Cordobes merkte, daß er sich nicht gerne ausfragen ließ, besonders nicht von jemand so Jungem, absolut nicht.
»Als nächstes muß ich sehen, welche Verbindungen es gibt. Ich schätze, daß er einen Grund hat, hierherzukommen, daß jemand dafür bezahlt. Seine Eltern sind tot. Ich habe mir seine Unterlagen angesehen. – Ich mag zwar alt sein, Miss Lascelles, doch auch ich besitze einen Computer. – Die Eltern haben ihm ein bißchen Geld hinterlassen, von dem er allerdings nicht leben kann. Vielleicht kümmere ich mich als erstes um Verbindungen, Zusammenhänge, suche nach Leuten, die Mitte der siebziger Jahre von Palo Alto hierhergezogen sind, vielleicht kommt dabei was raus. Das ist das Beste, was ich im Moment vorschlagen kann.«
Joni Lascelles nickte und lächelte enthusiastisch. »Gut, genau das, was ich mir auch dachte. Soviel ich gelesen habe, war Quinn Teil einer bestimmten Subkultur. Das könnte uns weiterhelfen.«
Sie lächelte ihn an, und es war schwer, sich von diesen Augen zu lösen. »Sie meinen, er war ein Hippie?«
»Genau«, sagte sie, und er konnte spüren, wie ihr Eifer beim Sprechen übersprudelte, konnte ermessen, wie wenig sie sein Interesse an ihr wahrnahm. »Und schauen Sie sich die Zeit an. Auch noch ein später Hippie. Haight Ashbury war 1975 längst vorbei. Die Dinge hatten sich weiterentwickelt. Es war keine allgemeine Szene, zu der er gehörte, es war eine Zeitschleife, etwas, das in der Vergangenheit hängengeblieben war wie eine Fliege im Bernstein.«
»Ja«, sagte Cordobes und grinste. »Und wissen Sie, das ist interessant. Eine nette, junge Anwältin, die sich für Zeitgeschichte interessiert. Das ist ungewöhnlich. Das ist wirklich ungewöhnlich.«
Im Zimmer wurde es still, was Tom Cordobes nichts ausmachte. Überhaupt nichts. Er mochte Joni Lascelles, könnte vielleicht lernen, sie noch viel mehr zu mögen, konnte die Arbeit gebrauchen und würde ihr auf jeden Fall die Nummer des billigen Motels am Stadtrand dalassen, bevor er das Pequod verließ, falls sie ihn zwischen den regelmäßig zu erstattenden Berichten sprechen wollte.
Aber es wäre ihm äußerst unangenehm gewesen, wenn diese nette junge Anwältin denken würde, er wäre vertrottelt oder so was.
Kapitel 3: Die Scheune
Man hüte sich, zu freimütig zu sein; nur Hunden steht es zu, sich den ganzen Tag lang zu paaren.
Friedrich Nietzsche
1975, bevor das ausgedehnte Gresham-Woods-Einkaufszentrum gebaut und der Grundwasserspiegel von halb Palo Alto und Menlo Park abgesenkt wurde, führte der San-Jacinto-Creek manchmal auf seinem langen, gewundenen Weg von der Quelle in den Los-Altos-Hügeln noch ein bißchen Wasser mit sich. Der kleine arroyo mäanderte träge den ganzen Weg hinunter durch trockenes, unbebautes Buschland bis hin zum großen Highway des El Camino Real, der alten spanischen Siedlerstraße, wo er in einem Abzugskanal nahe der CalTrain-Bahnlinie von San Francisco nach San Jose und darüber hinaus verschwand, um dann irgendwo bei der University Avenue ins öffentliche Abwassersystem zu münden. Das Flußbett war gewöhnlich beim Erreichen des Highways knochentrocken, bis auf den Greshamwald, ein paar Hektar mit Eukalyptusbäumen, deren Rinde in der kalifornischen Sonne abblätterte und deren Blätter die Luft ständig mit dem unangenehmen Geruch von Hustenbonbons erfüllte, die aber genug Schatten für ein wenig Schlamm und vielleicht sogar ein Rinnsal brackigen Wassers abgaben.
Der Bach führte mitten durch den Wald, hatte ein fast drei Meter sechzig hohes Steilufer und trennte Palo Alto von Menlo Park. Die Bäume boten den Landstreichern, die ihren Weg aus der Stadt hierhergefunden hatten, gewöhnlich als Mitreisende auf den Güterzügen, ein wenig Schutz. Die Penner verdreckten das steinige Flußbett mit Einkaufswagen, leeren Flaschen, Bierdosen und Plastikbeuteln. Wenn man nahe genug kam, vorbei an den Spielfeldern, wo die Sportbegeisterten von Stanford Fußball und Rugby spielten, konnte man über die unübersehbaren Anzeichen ihrer schattenhaften Unterwelt stolpern. Ein widerlicher Gestank nach Fäkalien und Urin drang unter den Plastiktüten hervor, die am Fuße der Eukalyptusbäume lagen; er kämpfte einen täglichen Kampf gegen den schweren Geruch der Blätter und der Benzin- und Dieselwolken, die vom El Camino herüberwehten. Niemand würde eine Prognose gewagt haben, wer in diesem Kampf gewann.
Es war zehn Uhr morgens, und Roscoe Sutter – von den Einwohnern der Scheune seit dem Moment ihres Einzugs nur Muttley, der Murmler genannt – biß hungrig in die Reste eines kalten, fettigen Hamburgers, den er auf der Straße in der Nähe der Oasis-Bar gefunden hatte. Morgen würden die Kirchenleute zur University Avenue kommen, richtig sentimental werden und den Obdachlosen ein ordentliches Weihnachtsessen spendieren. Er war noch nicht dort gewesen, denn er hatte die letzten zwei Winter in der Stadt verbracht, bis es ihm da zu gefährlich wurde, aber er hatte bereits davon gehört: kostenloses Essen, Wärme, vielleicht etwas zum Anziehen. Das würde er sich keinesfalls entgehen lassen, aber im Moment war er mit einem weggeworfenen Hamburger durchaus zufrieden.
Roscoe Sutter saß auf dem Boden, den Rücken an einen Baumstamm gelehnt, und aß, ohne nachzudenken. Sein verwirrter Geist nahm das unvertraute Geräusch aus dem Flußbett, den sanften Klang fließenden Wassers, nur halb wahr. Etwas bewegte sich zu seiner Linken, auf dem Pfad über die Eisenbahnschienen, und er drehte sich wider besseren Wissens danach um. Ein langhaariger Junge in ausgebeulten Jeans schlurfte gedankenverloren über den Pfad, die Hände tief in den Taschen vergraben. Roscoe spürte, wie die Wut in ihm aufstieg, bis in seine Kehle, und daß er sich nicht dagegen wehren konnte. Die Collegekids taten ihm nichts, außer ihn zu verspotten. Niemand hatte ihn verprügelt, seit er die Stadt verlassen hatte, woran er sich auch erst gewöhnen mußte. Aber sie hatten etwas an sich, das ihn in Rage brachte, und wenn er einmal angefangen hatte, konnte er nicht mehr aufhören.
Er begann wortlos zu murmeln, gerade laut genug, daß der Junge es hören konnte. Es war eine Angewohnheit, die Sutter nicht in der Gewalt hatte und der er seinen Spitznamen verdankte. Der Junge lauschte eine Weile dem aus dem schattigen Eukalyptusgehölz dringenden übellaunigen Gemurmel und ahmte es dann nach
rassenfrassenrassenfrassenrassenfrassenrassenfrassen
ahmte es so exakt nach, daß der alte Landstreicher immer wütender wurde. Muttley, der Cartoonhund, immer da, immer einsatzbereit. Und kein Dick Dastardly, der ihn in Schach hielt. Hal Jamieson fragte sich, wer zuerst auf den Namen gekommen war. Michael? Vermutlich. Er kam auf die meisten Sachen, außer bei Dope (das war Hals Stärke). Er hatte die Regeln aufgestellt, nach denen sie in der Scheune lebten, und niemand wußte so recht, wie es passiert war.
Hal Jamieson hörte mit dem Murmeln auf, sobald Muttley außer Hörweite war, atmete tief durch den Mund ein und hoffte, er würde es bis zur Vordertür schaffen, ohne noch mal den gräßlichen Gestank aus dem Wald in die Nase zu kriegen. Er schaffte es nicht. Wieder zuviel geraucht, dachte er, und erstickte fast an seinem Lachen.
Die Scheune war schon vieles gewesen, aber nie eine Scheune. Auch dieser Name stammte von Michael, und er war irgendwie hängengeblieben. 1973, als die Baulöwen das Land um den San Jacinto unter die Lupe nahmen und ernsthaft eine Bebauung rechts und links vom El Camino in Erwägung zogen, war das Gelände in einen vorübergehenden Zustand des Verfalls geraten. Niemand wollte riskieren, dort Bauland zu kaufen, aber es wollte auch keiner verkaufen, falls sich gerade dieses Stück steinigen Bodens als idealer Platz für einen neuen Wendy’s-Drive-in oder, mit etwas Glück, den nächsten Nordstrom-Laden erwies. Eine Starre legte sich über die Gegend, bis das von der Ostküste heranflutende Geld zur Ruhe kam und beschloß, sich irgendwo niederzulassen. Da aber niemand genau wußte, wann und wo das passieren würde, wurden die kleinen Häuser und Grundstücke in der Nähe des Waldes, erreichbar über ungepflasterte Privatwege, immer stärker vernachlässigt und gerieten täglich mehr in Vergessenheit.
Die Scheune war ein einstöckiges Holzhaus, das in den zwanziger Jahren als Landhandelsgeschäft gedient hatte, als Orangensaft der heißeste Verkaufsschlager des Tals war. Das war die Zeit vor den Mikroprozessoren, die Zeit vor dem Internet. Damals lebte das Tal vom Obstanbau und schickte Ströme von Orangensaft nach San Francisco und darüber hinaus, der Tropfen für Tropfen aus den gutgepflegten Obstplantagen an den Hängen des Tals stammte, entlang des flachen, eiszeitlichen Flußbettes, bewässert von den Bächen aus den rechts und links aufragenden, braungezackten, wie für die Ewigkeit bestimmten Bergen. Im Laufe der Jahre, als der Obstanbau anderen Industriezweigen Platz machte, als Stanford wuchs und neue Firmen wie Hewlett-Packard und Xerox aus den Garagen von Professoren, die ihre akademischen Gehälter aufbessern wollten, hervorwuchsen, ging der Landhandel bankrott, der Laden wurde zu einer Art Wohnung umgebaut und eine Reihe von Besitzern kamen und gingen, blieben nie lange. Was nicht daran lag, daß das Haus häßlich war. Es war aus braunem Holz, hatte ein großes Wohnzimmer, von dem drei Schlafzimmer abgingen, eine schmale kleine Küche, ein Badezimmer und zwei Nebengebäude. Es gab viel schlimmere hier in der Gegend, und einige wurden hübsch angemalt, mit einem Gartenzaun versehen und für einen anständigen Preis an die neue Flut von Akademikern und Berufstätigen, die in den fünfziger Jahren in zunehmender Zahl ins Tal strömten, verkauft. Das waren neue Leute, professionell, zukunftsorientiert. Aber sie mochten das Tal. Ihnen gefielen die alten Städtchen und Dörfer, die ein wenig europäisch wirkten. Ihnen gefiel es, daß die Gegend Stil und Klasse und etwas Etabliertes hatte, was in den wachsenden Vororten der Stadt nicht der Fall war. Alt bedeutete gut, vor allem, wenn es um Häuser ging. Aber es mußte die richtige Art von alt sein.
Das Problem war, daß die Scheune sich immer wieder als Bestätigung des Spruchs eines alten Immobilienmaklers erwies: Das Wichtigste ist die Lage, die Lage und die Lage. Kaum anderthalb Kilometer entfernt lag der ausgedehnte, Wohlstand vermittelnde Campus von Stanford mit seinen geschmackvollen Gebäuden, dem gepflegten Gelände und diesem flachen, geordneten Aussehen, das verkündete: Kommt her, Jungs, und ihr werdet mit allem, was ihr anpackt, Erfolg haben. Aber es war einfach zu weit weg von der Scheune, die auf der falschen Seite der alten spanischen Straße lag, ungewaschen, ungepflegt, mitten in einem Wald, der nach einer Mischung von unterirdischem Männerklo und Drogerie roch. Die Sonne drang nur selten durch das Gewirr schattiger Eukalyptusbäume, es gab keine richtige Straße, nur einen gewundenen Feldweg, und alle dreißig Minuten oder so, wenn man es am wenigsten erwartete, kam das Donnern der Räder, das Schrillen der Dampfpfeife, und CalTrain schickte ein riesiges, so langsames und schweres Eisenmonster über die Schienen, daß man das Zittern der Bodenbretter spüren konnte.
1968 entdeckte ein gerade aus Vietnam zurückgekehrter Air-Force-Lieutenant, der etwas von seinem mit Rauschgifthandel verdienten Geld loswerden wollte, das zum Verkauf angebotene Grundstück in einer Broschüre, rief einen ihm bekannten Makler an, hielt die Sache für riskierenswert und kaufte das Haus plus einiger Hektar des umliegenden Eukalyptuswaldes. Er wohnte in Austin, Texas, und sah sich das Ganze niemals an, selbst als es auf jeder Titelseite abgedruckt war, auf jedem Bildschirm im ganzen Land auftauchte. Drei Jahre später verkaufte er es mit siebenhundert Prozent Gewinn und hielt sich für einen intelligenten und glücklichen Mann.
Anfang 1975 war sich der Air-Force-Lieutenant nicht so sicher gewesen. Er hatte eine beträchtliche Summe investiert, aber es kam nichts zurück. Also wandte er sich an einen örtlichen Makler und bat ihn, Mieter zu finden; egal wen, Hauptsache, sie zahlten im voraus und verlangten keine dämlichen Vereinbarungen im Vertrag, die ihnen Sicherheit, Rechte oder sonst was garantierten, was einem schnellen Verkauf im Wege stünde, falls der Markt plötzlich anzog.
Michael Quinn hatte die Anzeige in der Lokalzeitung gesehen. Wie alle anderen, die er in Stanford kannte, war er in einem Studentenheim untergebracht. Studentenheime waren sauber, eine Beruhigung für die Eltern und garantierten ein bestimmtes Maß an Versorgung. Aber sie stellten auch Regeln, Bestimmungen, Einschränkungen auf. Dinge, die einen einsperrten, einem vorschrieben, was man zu tun hatte. Innerhalb von zwei Tagen hatte Quinn sich die Einzelheiten über das Mietobjekt besorgt, die erste Jahresmiete mit erstaunlicher Leichtigkeit von seinen Kommilitonen in der Elektroingenieur-Fakultät zusammengekratzt und den in seinem Namen ausgestellten Mietvertrag unterschrieben. Alle anderen Namen ließ er raus, falls etwas schiefgehen sollte, was bei all dem Dope und dem anderen Zeug, das da umgeschlagen werden sollte, durchaus passieren konnte. Nicht, daß irgend jemand vorhatte, dort tatsächlich zu wohnen, zumindest nicht ständig. Es war einfach ein Ort, wo man sein konnte, ohne von den falschen Leuten beobachtet zu werden.
Die einzige Regel sei, daß es keine Regeln gäbe, sagte Michael Quinn am Einzugstag. Und so war es dann auch im großen und ganzen gelaufen.
Hal Jamieson schob die Tür auf. Sie war so gut wie nie abgeschlossen. Es gab nichts sonderlich Wertvolles, außer einer zerkratzten Stereoanlage, einer guten Schallplattensammlung und Dope im Werte von durchschnittlich zweitausend Dollar, je nachdem, wie gut er in der Stadt abgeschnitten hatte und ob man den Wert daran bemaß, was er bezahlt hatte, was seine Kunden bezahlten oder was, um es in der Polizeisprache auszudrücken, der »Straßenpreis« war.
»After the Goldrush« dröhnte aus den Lautsprechern der Stereoanlage; Neil Youngs hohe Stimme durchschnitt das dämmrige Innere des Raumes. In der Ecke auf der anderen Seite, über das Plattencover gebeugt, die langen, blonden, glatten Haare auf das sonnengebräunte Foto des Sängers herabhängend, drehte jemand einen Joint. Hal schaute genauer hin.