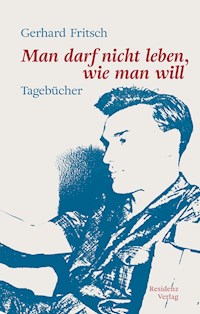2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Lande Sanharum ist ein über Jahrtausende untätiger Vulkan ausgebrochen, gerade zu der Zeit, als Prinz Garpath auf dem Weg zu Kunelda ist, der Prinzessin von Sanharum, der er sein Herz zu Füßen legen will. Beide sind höchst besorgt und suchen einander. Doch noch kennen sie die Gefahr nicht, die ihnen droht, denn der Ausbruch des feuerspeienden Berges war kein Zufall. Das blutrünstige Volk der Dracca, das tief unter der Erde haust, hat das Feuertor geöffnet und bringt Tod und Verderben über das Land, das von Menschen und Zwergen bewohnt ist. Die Not schmiedet Bündnisse, doch gegen die gnadenlosen Bestien der Unterwelt, die auf der Jagd nach dem Blut der Unsterblichkeit sind, stehen sie auf verlorenem Boden.
Gut und Böse hat hier viele Facetten. Gemeine und friedvolle Charaktere werden einfühlsam beschrieben, ihre Gedankengänge verfolgt und ihre Absichten angedeutet. Mysteriöse Zufälle scheinen Einfluss auf das Schicksal der Helden zu nehmen, und … na ja, … die ansonsten knorzigen Zwerge muten trotz aller erlebten Gräuel an, als könnten sie die Ahnen unserer heutigen Gartenzwerge sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Blut der Unsterblichkeit
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorspann
Gerhard Fritsch – Das Blut der Unsterblichkeit
2. eBook-Auflage – April 2016
© Betts & Atterbery im vss-verlag, Frankfurt
Titelbild: © Armin Bappert - Pixabay.com
Lektorat: Hajo Nitschke
Gerhard Fritsch
Das Blut der Unsterblichkeit
Dank an Alois Wilfling für die Unterstützung bei den Gedichten sowie allen anderen Personen, die (meist) unwissentlich als Vorlage für einzelne Charaktere dienten oder auf andere Weise zum Gelingen des Romans beigetragen haben.
DIE HÖHLEN DES ASCHKNA
Es herrschte geschäftiges Treiben im und am Berg. Zwerge eilten in die Stollen hinein, andere kamen mit Säcken und Körben heraus, trugen ihr Gut zu einem Schmelzofen, den man am Berghang gebaut hatte, und leerten es dort aus. Unablässig wurde der Ofen geschürt und mit einem Blasebalg die Hitze gehalten. Andere reparierten Werkzeuge, schafften Holz herbei, verarbeiteten die guten Stücke zu Stützbalken, Handkarren, Leitern und anderen Gegenständen, das weniger Gute und der Abfall kamen als Brennmaterial zum Rennofen. Zwerginnen kochten Gemüsebrühe und buken Brot, sammelten Beeren, Kräuter und Pilze, bereiteten Getränke und Salben, und wuschen Kleidung. Im Inneren der Stollen wurde unablässig gemeißelt und Stein gebrochen. Niemand von der Zwergenschaft wollte länger als unbedingt nötig an dem Ort bleiben, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft sich ein verwunschener Berg befand.
Die Erzmine war schon lange Zeit bekannt, sie war auch sehr ergiebig, aber man war nicht darauf angewiesen. Nur jetzt wollte man in kurzer Zeit möglichst viel von dem kostbaren Rohstoff zu den Essen nach Minbichhall im Schnattbartberg schaffen, um einen Auftrag des Menschenkönigs Karsomeid zu erledigen, der bei den Zwergen eine umfangreiche Liste von Beschlägen, Ketten, Nieten, Stangen und anderen Bauteilen für die Erneuerung seiner Burganlage geordert hatte. Nur missmutig wurde der Auftrag angenommen, die Herstellung solch grober Utensilien war der Kunstfertigkeit von Zwergenhänden eigentlich unwürdig. Aber andererseits erteilten die Menschen oft auch bessere Aufträge, zum Beispiel die Anfertigung von Schmuck oder hochwertigen Gebrauchsgegenständen wie Pokale, Gold- und Silberbesteck oder besondere Waffen, Rüstungen und dergleichen. Wichterich, der König der Schnattbartzwerge, hatte sich von den Gesandten Karsomeids unter Andeutung weiterer, besserer Aufträge überreden lassen, und so hatte der König gemeinsam mit dem Zwölferrat beschlossen, einen Trupp von fünfundsiebzig Zwergen zum Aschkna, dem Nachbarberg des Rotkopf, zu schicken.
Als die Arbeiten am Aschkna soweit abgeschlossen waren, beschloss Unterstein Gramlich, ein der Ingenieurwissenschaft Kundiger aus dem Stamm der Vilich, zu Erkundungszwecken noch am Berg zu verweilen. Er hatte bei der Arbeit unter Tage weiterführende Spalten und Kavernen Richtung Rotkopf entdeckt, die zwar schwer zugänglich waren, die er aber erforschen wollte. Vielleicht, so dachte er, würde ihm ja eine bedeutende Entdeckung gelingen, eine Diamant-Ader, oder eine Kultstätte prähistorischer Zwergenstämme, wer weiß? Der Forscherdrang hatte ihn erfasst, und gerne hätte er ein paar Gehilfen bei sich gehabt, die ihn bei der Arbeit unterstützten, aber niemand meldete sich, obwohl er eindringliche Reden hielt und seine Zuhörer bei ihrem Stolz zu packen versuchte. Niemand gab es zu, aber Zwerge sind abergläubisch, und so hatte jeder eine andere Ausrede parat, musste heim zur Familie, erwartete Besuch von Verwandten, fühlte sich nicht gut, musste beim Vorrätesammeln helfen oder Reparaturen durchführen.
Keiner von den Vilich und Vilin hatte je etwas Unangenehmes am Rotkopf erlebt, und auch niemand kannte einen, dem dort etwas zugestoßen wäre, auch nicht vom Hörensagen. Aber es war eben ein geheimnisumwitterter, verwunschener Ort, so zumindest wurde es jedem Zwerg von Kindheit an eingebläut. Den Rotkopf müsse man in Ruhe lassen, denn er sei der Stein, den Giganten einst auf das Grab von schwefelspeienden Ungeheuern geworfen haben. In Ruhe lassen, damit die Scheusale nicht geweckt werden, wurde gesagt.
Es hatte Unterstein Gramlich auch nichts genützt, dass er beteuerte, er würde nur unterm Aschkna forschen und an den Grenzen des Rotkopfs sofort kehrtmachen. Selbst oberirdisch war es noch ein Weg von gut einem halben Tagesmarsch bis dorthin. So machte er sich notgedrungen alleine auf den Weg, ausgerüstet mit Pickel, Schaufel, Proviant und einer Laterne. Bald hatte er das Ende des bekannten Teils des Bergwerks erreicht. Im unerforschten Bereich des Höhlen- und Tunnelsystems kam er nur langsam voran. Immer wieder musste er Hindernisse überwinden, Schutt aus dem Weg räumen, Steilwände hoch- und hinunterklettern, Wasserläufe durchqueren und sich durch Engstellen zwängen. Schließlich aber wurde die Höhle wieder besser begehbar und vor allem trockener. Der Gang führte abwärts und bald bemerkte er, dass die Farbe des Gesteins sich änderte. Er wusste, dass er sich jetzt an der Schwelle zum Rotkopf befand.
Jetzt umkehren, wo ich noch nichts Absonderliches entdeckt habe?, fragte er sich. Der Rotkopf ist genauso harmlos wie der Aschkna, ich gehe noch ein wenig weiter.Eine geologische Besonderheit ist das schon, wenn die Höhle von einer Gesteinsschicht in eine andere hineinreicht.
Gramlich kam nun schnell voran. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und untersuchte den Fels, doch er fand keine Spuren eines Metalls oder von Edelsteinen. Sein Zeitempfinden sagte ihm, dass es jetzt gegen Abend war, als der Gang plötzlich weiter wurde und in einen großen unterirdischen Dom mündete, in dessen Mitte sich ein kleiner See gebildet hatte. Er bemerkte Fledermäuse und weit oben einen Lichtschimmer. Ein Ausgang, gut so, ich brauche also nicht den selben Weg zurückgehen. Dass sich hier noch nie ein Zwergenstamm niedergelassen hat, konnte Gramlich kaum verstehen. Auf der anderen Seite des Sees führte der Stollen weiter den Berg hinunter. Kaum zu glauben, dass das alles natürlichen Ursprungs sein soll, dachte er bei sich. Der Gang war mittlerweile so breit und hoch, dass ein Hirsch hätte hindurchgehen können, ohne mit dem Geweih anzustoßen. Der Zwergen angeborene gute Orientierungssinn, der sie im Berg genauso sicher leitete wie außerhalb, sagte ihm, dass der Stollen nun spiralförmig in die Tiefe führte. Ganz unvermittelt aber endete der Weg, oder besser gesagt, er war durch Geröll versperrt.
Muss ziemlich alt sein, mutmaßte er. Zwergenknochen sind das nicht, viel zu groß. Aber was dann? Er sah sich um und entdeckte als nächstes ein komplett erhaltenes Skelett. Er inspizierte es, maß es ab, drehte den Schädel. Bei dessen Anblick fröstelte ihn. Sag mir einer, was das war! Menschen bestimmt auch nicht. Elfen?, nein, Orks?, auch nicht. Der Schädel sieht aus wie der eines großen Vogels mit stumpfem Schnabel! Oder wie der einer Riesen-Eidechse. Aber das übrige Skelett passt nicht dazu. Das Ding, was immer es war, muss aufrecht gegangen sein wie ein Zwerg. Und es scheint einen Schwanz gehabt zu haben.
Gramlich ging weiter durch die große Halle. Er hielt die Laterne hoch, um einen möglichst weiten Bereich auszuleuchten. Trotzdem war die Sicht nur einige Schrittlängen voraus deutlich genug, um Hindernisse zu erkennen und Gegenstände genau einzuordnen. Überall in der Halle lagen Skelette oder einzelne Knochen, darunter auch sehr große, aber andersartige, die wohl von Reittieren stammen könnten, mutmaßte Gramlich. Zum anderen Ende der Kaverne hin sah er Umrisse freistehender Felsen. Er ging weiter, um nach einem weiteren Ausgang aus der Höhle zu suchen. Dabei näherte er sich den vermeintlichen Felsbrocken. Plötzlich stockte ihm der Atem. Sein Herz pochte wie wild und er nahm instinktiv eine Abwehrhaltung ein. Die Felsen entpuppten sich als lebensechte Figuren von furchterregendem Aussehen, groß wie zwei erwachsene Zwerge übereinander, echsenähnliche Köpfe, umgurtet mit dicken Riemen, an denen Messer, Äxte und andere Gegenstände befestigt waren, Schwert oder Speer in der Klauenhand haltend, in typischer Abwehrhaltung verharrend. So etwas hatte Gramlich noch nie gesehen.
Sind die lebendig?, fragte er sich. Sie bewegen sich nicht, die Augen haben keinen Glanz! Doch Vorsicht, es könnte eine Falle sein, Echsen können sehr lange in bewegungsloser Starre aushalten.
Gramlich hob einen Stein auf und warf ihn auf die nächststehende Gestalt. Der Stein prallte ab und fiel zu Boden, sonst geschah nichts.
Klingt wie Stein auf Stein. Noch immer zitternd vor Aufregung lauschte er in die Dunkelheit hinein. Aber außer dem Ploppen der Wassertropfen war absolut nichts zu hören. Figuren, Statuen aus Stein gehauen, sagte sich Gramlich, aber so perfekt, dass sie wie lebendig aussehen. Er nahm einen zweiten Stein und schleuderte ihn mit aller Kraft, diesmal genau auf den Kopf der Figur. Wieder prallte der Stein ab und fiel zu Boden.
Na also, lebendig ist der nicht, der Schlag hätte sogar einer Echse das Maul verzogen. Er tastete die Gestalt mit der Hand ab. Alles an ihr bis ins kleinste Detail war aus Stein. Aber wer kann so etwas erschaffen? Keine mir bekannte Rasse kann solche Figuren aus Stein herausschlagen, nicht einmal die Elben, glaube ich. Und wer oder was war da Modell dafür? Komisch auch die Formation der Gestalten. Wer so gut bildhauen kann, der stellt seine Kunstwerke in Königspaläste, schön in Reih und Glied, aber nicht so wirr durcheinander wie hier!
Gramlich war mittlerweile zwischen einige Reihen dieser seltsamen Gestalten hindurch gewandert. Er hatte seine Angst wieder abgelegt und war sogar wieder zu Späßen aufgelegt. Mit dem Pickelstiel knuffte er die Steinfiguren in die Seite oder auf das Knie und machte derbe Späße dabei. Dann befand er sich am Ende der Halle. Dort war ein Ausgang, der aber von einer Skulptur versperrt war, die alle anderen an Größe und Abscheulichkeit deutlich übertraf. Sie stellte mit Sicherheit einen Krieger dar, der mit dem Oberkörper und einem Bein in der Halle stand, in der linken Hand einen großen Schild schützend vor sich haltend, in der anderen Hand ein Instrument, das Ähnlichkeit mit einem Morgenstern hatte, nur dass die nach vorne zeigende Spitze sehr viel länger war als die übrigen. Die Gestalt schien damit zu zielen. Der hintere Teil des Unterleibs, das linke Bein und der Schwanz waren im Gang verborgen. Ungläubig starrte Gramlich auf das Gebilde vor ihm. Der soll den Anführer darstellen. Wahrlich ein Meisterwerk der Steinmetzkunst.Aber irgendetwas stimmt da nicht. Welcher Künstler würde sein bestes Stück so ins Abseits stellen? Wie hat er es überhaupt hier hinstellen können? Gar nicht, der Schwanz ist im Gang um einen Pfeiler gekringelt. Sowas gibt es doch gar nicht. Als wenn sie die Halle und den Gang erst nachher herausgemeißelt hätten.Nur eins ist sicher: ich habe hier etwas Einzigartiges entdeckt. Wahrscheinlich das Werk einer uralten Kultur.Die eigentlichen Behausungen sind offenbar noch weiter unten. Gramlich sah, dass in dem halb versperrten Gang Steinstufen nach unten führten. Er drängte sich zwischen den gespreizten Beinen des Ungetüms hindurch. Wieder lauschte er, ob irgendein Geräusch zu hören war. Aber er vernahm wie vorher nur das Tropfen des Wassers im Berg. Die Treppe war aus einer Felswand herausgehauen und führte in die Tiefe. Auf der einen Seite war Fels, auf der anderen der Abgrund. Sie musste früher ein Geländer gehabt haben, das erkannte Gramlich an den Einkerbungen, die auf den Stufen und an der Seite des Eingangs angebracht waren.
Keine zwei Schritte hinter der großen Kreatur stand die nächste, jetzt wieder eine kleinere, ihre Bewegungsrichtung war nach unten gerichtet, wie auf der Flucht. Die linke Klaue war so geformt, als wollte sie sich am Handlauf des imaginären Geländers festhalten. Missgelaunt über die neuerliche Behinderung versetzte Gramlich dem steinernen Scheusal einen Tritt ins Hinterteil. Er hatte mit Wucht getreten, seinen ganzen Ärger hineingelegt. Und genau das war nun sein Verhängnis. Dieses Mal stand die Statue nicht wackelfest mit beiden Füßen auf dem Boden, sondern sehr labil mit nur einem Fuß halb auf einem Treppenabsatz. Das andere Bein befand sich wie mitten in einer schnellen Bewegung noch in der Luft, den Fuß noch nicht aufgesetzt. Der Halt, den das Geländer ursprünglich gegeben hatte, war nicht mehr vorhanden. Ein ganzes Erdzeitalter hatte die Figur in dieser Stellung ausgehalten, doch der mürrische Tritt eines alternden graubärtigen Zwerges brachte sie und das ganze Land um den Rotkopf aus dem Gleichgewicht. Der Koloss kippte nach vorne und drehte sich dabei um die eigene Achse, wobei sein rechtes, angewinkeltes Bein Gramlich, der nicht mehr nach hinten ausweichen konnte, von der Treppe fegte und mit sich riss. Beide stürzten in die Tiefe.
Das Ungeheuer aus Stein krachte auf eine Steinplatte und zerbarst in mehrere Teile. Durch die Wucht des Aufpralls bildeten sich Risse, ein paar Augenblicke später bröckelte die Platte nach unten weg und landete in einem Aufenthaltsraum, den Dracca-Wachen gerne nutzten, um sich von ihren Inspektions-Märschen auszuruhen, die sie durch das Labyrinth von Kontrollgängen am Rande des unterirdischen Reiches Ugor führte.
Die beiden Soldaten Drass-Wragg und Sisch-Krack staunten nicht schlecht, als die Decke über ihnen plötzlich herunterstürzte und ein Dracca-Schädel aus Stein auf sie herabstarrte. Der war nämlich erst einmal in der Öffnung stecken geblieben. Erst kurz darauf drückte sein Gewicht die Ränder des entstandenen Lochs noch weiter durch und er krachte auf den Boden des Raums. Dafür hing jetzt Gramlich an der Decke. Er war schwer verletzt mit dem Gürtel an einer Kante hängengeblieben. Die Soldaten hatten noch nie einen Bewohner der Oberfläche der Erde gesehen. Sie konnten sich noch keinen Reim aus dem Vorfall machen, aber das fremde Wesen zog sie vollkommen in seinen Bann. Sein kräftiges dunkelrotes Blut tropfte herab, sie witterten die Wärme, die von seinem Körper abstrahlte und spürten den Herzschlag in seiner Brust. Ungläubig verharrten sie an dem Tisch, an dem sie noch vor wenigen Atemzügen ihre Mahlzeit aus zähem, getrocknetem Gurrfleisch kauten und stierten Zunge zischelnd auf den Zwerg. Die Sinneseindrücke lösten in ihrem Körper unzähmbare Begierden aus. Speichel sammelte sich im Gaumen, der Magen vibrierte, der Herzschlag beschleunigte sich und die Muskeln und Sehnen spannten sich. Wie bei einem Raubtier vor dem Sprung stieg ihre Anspannung. Die beiden Dracca-Soldaten hatten nicht gelernt, in solch einer Situation besonnen zu reagieren, sie wurden nur noch von ihren Instinkten beherrscht, uralten Instinkten, die das Überleben in einer absolut feindseligen Welt sichern sollten. Gleichzeitig peitschten sie nach vorne.
Unterstein Gramlich hatte durch den Sturz schwere innere und äußere Verletzungen erlitten. Als die Steinplatte unter ihm barst und der Monsterkopf in dem entstandenen Loch verschwand, hatte er Licht wahrgenommen, wie in einem kerzenbeleuchteten Raum, nur gleichmäßig grünlich schimmernd. Er spürte seine Lebensenergie versiegen. Mit halb geöffneten Augen gewahrte er unter sich zwei der Monster, die sich diesmal aber bewegten und Glanz in den schwarzen Pupillen hatten. Er wertete es als Traum. Das letzte, was er sah, war eine mit scharfen Krallen bewehrte Klaue, die sich in seinen Kopf bohrte und ihm das Licht und das Leben raubte.
Die Dracca hatten den Zwerg von der Decke heruntergerissen und ihm mit ein paar schnellen Klauenhieben Kleidung und Körper zerschnitten. Wie Tobsüchtige machten sie sich über den geschundenen Leichnam her, schlürften das Blut, rissen Gliedmaßen ab und schlangen hastig ganze Fleischbrocken unzerkaut hinunter. Beinahe wären sie im Wetteifer um die besten Stücke miteinander in Streit geraten. Sie knurrten und fauchten sich bereits gegenseitig an, doch die gemeinsame Aufgabe, die sie seit langem verband und so etwas wie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit bei ihnen entwickelte, verhinderte Schlimmeres. Einer nahm auf den anderen gerade so viel Rücksicht, dass jeder ausreichend befriedigt sein konnte mit der Ration, die er abbekam. Das Würgen und Schmatzen nahm bald wieder ab, zuletzt nahmen sie Messer zu Hilfe, mit denen sie die Reste von den Knochen abschabten. Klebrig hingen Blut- und Fleischpartikel an ihren Rachen, die sie mit Krallen und Zunge säuberten.
Wortlos setzten sie sich daraufhin wieder auf die Bank und betrachteten die Trümmer und Gegenstände, die auf dem Boden verteilt lagen.
„Wir müssen es melden“, beendete Sisch-Krack das Schweigen.
Drass-Wragg sah ihm in die Augen und nickte. „Von dem, der da lebendig war, sollten wir besser nichts sagen. .... Wir hätten ihn nicht verzehren dürfen.“
„Wir können sagen, dass er schon tot war“, schlug Sisch-Krack vor.
„Dann hätten wir ihn auch nicht fressen dürfen. Am besten, wir beseitigen die Spuren von ihm und melden nur den Steinkopf.“
„Wir müssen hier alles absichern, vielleicht sind noch mehr von denen da oben.“
Sie einigten sich darauf, die Überreste Gramlichs sowie seine seltsamen Werkzeuge verschwinden zu lassen, den Boden zu reinigen und dann Meldung zu erstatten. Körperreste, Kleidung, Rucksack, Laterne und Pickel des Zwergs warfen sie in eine Felsspalte, von der sie wussten, dass sie tief unten in einen Glutofen mündete. Das Blut auf dem Steinboden, das mittlerweile eingetrocknet war, scheuerten sie säuberlich ab und verteilten darüber Steinmehl der heruntergebrochenen Decke.
„So, das müsste reichen“, sagte Drass-Wragg. „Ich gehe Meldung machen, du bleibst hier und passt auf.“
Sisch-Krack deutete mit der Hand auf den gereinigten Boden und erwiderte: „Gib acht, dass du über das da das Maul hältst.“
„Das musst gerade du sagen“, zischte Drass-Wragg zähnebleckend und verließ den Raum.
Als er auf der Hauptwache den Vorfall erzählte, wollte ihm keiner glauben. Ein lebensgroßer Dracca-Steinkopf, perfekt gearbeitet, der plötzlich durch den Fels bricht, das konnte sich niemand vorstellen. Leqaz-Thunk, der Hauptwächter Ugors, der zufällig anwesend war, hörte sich die Geschichte schweigend an und schickte daraufhin zwei Läufer, die nachsehen sollten, ob das Geschilderte tatsächlich so vorzufinden war. Drass-Wragg musste solange warten, bis die beiden zurückkehrten und alles bestätigten.
Sodann wurde ein ganzer Trupp Soldaten zur betroffenen Wachstation abkommandiert, der dort umgehende Untersuchungen durchführen bzw. ermöglichen sollte. Leqaz-Thunk selbst und eine Reihe hochrangiger Dracca, die über die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügten, begaben sich zu der Unglücksstelle und inspizierten die Lage genauestens. Natürlich entdeckten sie ziemlich bald auch die ganze Galerie von Steinstatuen in der großen Halle hoch über dem Kontrollgang. Zunächst ließen sie alle Gebilde unberührt an Ort und Stelle. Leqaz-Thunk und eine Handvoll ausgewählter Dracca, Gelehrte, Ingenieure und Militärführer, begaben sich nach Wemrass, der Hauptstadt des Reiches, in der sich der Palast Rhott-Mypors, des Herrschers von Ugor, befand. Hier an der Schaltzentrale des Schattenreiches wollten sie ihre Erkenntnisse vortragen, Meinungen äußern und über die weitere Vorgehensweise beraten.
Wemrass befand sich in der Mitte einer riesigen Kuppel tief im Inneren der Erde. Im Zentrum dieses Hohlraums, der etwa die Ausmaße des gesamten Miron-Gebirges erreichte, erhob sich ein kegelförmiger Fels, der an seiner Spitze mit der Deckenwölbung des Doms verbunden war. Die Stadt, die am Fuße dieser Erhebung lag, zählte etwa fünftausend Bewohner, die in ein- oder zweistöckigen Steinbauten lebten. Der Palast selbst befand sich im Inneren der gigantischen Felsnadel. Außer dem Portal und der hinaufführenden Steintreppe waren alle Gänge und Räume in der Anlage aus dem Fels gehauen. Die Residenz des Herrschers befand sich viele Stockwerke über den höchsten Bauwerken der Stadt. Von der Stadt aus zu sehen waren nur die Fenster und der Balkon vor dem Thronsaal, aus denen ein geheimnisvolles dunkelrot schimmerndes Licht nach außen drang. Manchmal sah man Rhott-Mypor dort oben stehen, seinen durchdringenden Blick auf das Treiben seiner Untertanen gerichtet. In solch einem Fall schien sich das Leben in der Stadt zu verändern: Lastenträger schleppten schwerere Lasten als sonst, Boten eilten schneller, Schmiede hämmerten um die Wette und Bauhandwerker stimmten ihre Handgriffe präziser aufeinander ab. Niemand stand müßig herum, lautes Schreien verebbte und man sah oder hörte niemanden streiten.
Niemand blickte nach oben, als hätte keiner bemerkt, dass ihr Herrscher ein Auge auf sie geworfen hatte.
Genauso war es auch, als die Delegation mit Leqaz-Thunk an der Spitze in Wemrass eintraf. Eines der Mitglieder schlug vor, in einer der Bewirtungsunterkünfte eine Stärkung einzunehmen, ehe sie den Palast aufsuchten, aber Leqaz-Thunk, der die Situation erkannte, winkte ab. Im Gegenteil, er trieb sie zu mehr Eile an. Im Laufschritt erreichten sie das bewachte Portal, wo sie ungewöhnlich genau kontrolliert wurden. Von vier schwerbewaffneten Soldaten eskortiert rannten sie die einhundertfünfzig Steintreppen hinauf zum eigentlichen Palasteingang, wo sie einer erneuten Überprüfung unterzogen wurden.
Erst als sie die Pforte ins Palastinnere überschritten hatten, verlangsamten sie ihr Tempo wieder. Sie wurden jetzt von vier grimmig dreinblickenden Palastwachen über endlos nach oben führende Treppengänge bis zum Thronsaal geleitet.
Rhott-Mypor, der über die Vorgänge um die mysteriösen Steinskulpturen längst informiert war, saß bequem auf seinem breiten Herrschersessel, hinter dem ein dicker Vorhang den Blick auf die Schale mit dem magischen Licht versperrte. Nur er hatte Zutritt zu diesem abgetrennten Bereich, aus dem er die nie versiegende Kraft für seine uneingeschränkte Macht schöpfte.
„Sei mir gegrüßt, Leqaz-Thunk, mein Freund, ich erwarte euch schon seit zwei Schattenzeiten“, begann Rhott-Mypor und blickte auf die große Anzeigenscheibe im Saal, deren Zeiger auf die schwarzrote Hälfte mit der geflügelten Schlange zeigte, dem Lebenssymbol der Dracca.
Leqaz-Thunk verneigte sich tief und entgegnete: „Sei gegrüßt, allgewaltiger Herrscher, die Gegebenheiten vor Ort sind schwer zugänglich und zwangen uns zu verweilen, um dir nun umso genauer berichten zu können“.
„Bemühe dich nicht um Ausreden, was dort verborgen ist, weiß ich längst“, giftete Rhott-Mypor, „sag mir besser, zu welchem Schluss ihr gekommen seid“. Er schaute zu den im Hintergrund wartenden Delegationsmitgliedern, die in diesem Moment von den Wachen unsanft auf die Knie gestoßen wurden. „Wer sind sie überhaupt, haben sie kein Maul, um zu reden?“
Einer der Palastwächter stieß dem ersten der Gelehrten mit dem Schaft seines Speers in die Seite: „Rede, du bist gefragt“.
Jeder der Dracca stellte sich nun vor und beschrieb kurz, welche Arbeiten er an der Fundstelle leitete.
„Gut, gut“, heuchelte Rhott-Mypor in freundlicherem Ton, „was glaubt ihr, woher die Stein-Dracca kommen und was das alles bedeuten soll? Sind es Steinmetzarbeiten unserer Vorfahren oder hat sich irgend ein Zwergen- oder Elbenstamm erdreistet, Dracca in solch hässlichen Posen darzustellen?“
„Steinstatuen sind es unzweifelhaft“, meldete sich der Materialwissenschaftler unter den Gelehrten zu Wort, „aber ob sie die Arbeit eines Steinhauers sind, will ich bezweifeln. Das Material ist härter als Granit, damit kann die Weichbrut an der Oberfläche nicht umgehen, und mir ist nicht bekannt, dass je jemand aus unserem Volk sich für so eine Kunst interessiert hätte.“
„Was willst du damit sagen?“, fauchte ihn der Herrscher an.
„Die ältesten unserer Chroniken berichten von einer Entscheidungsschlacht gegen die Zyasen, in deren Verlauf Jochacca vom Blitzhammer Cereastors geblendet wurde und zu Stein erstarrt sein soll“, erklärte der Geschichtskundige, der damit seinem Kollegen zu Hilfe kam. „Dadurch verloren die Dracca ihren mächtigsten Krieger und mit ihm die wertvollste Waffe im Kampf gegen das Lichtgesotte, den Jochacca-Sporn, die furchteinflößende alles vernichtende Feuer-Geißel. Es ist zwar nicht überliefert, wie diese Waffe ausgesehen hat, aber die größte der gefundenen Skulpturen hält einen merkwürdigen Gegenstand in der Hand. Sein Verwendungszweck ist uns nicht bekannt.“
„Du meinst, es sind unsere versteinerten Urahnen?“, raunte Rhott-Mypor, dem der Gedanke um einen wiedererweckten Kult um Jochacca im Kopf umging.
„Dafür spricht auch, dass sie noch größere Flügel haben als wir, mit denen sie wahrscheinlich über die Berge fliegen konnten“, mutmaßte der Naturkundler.
„Und die Tatsache, dass ihre Aufstellung einem geordneten Rückzug gleicht“, ergänzte der Militär.
„Wenn es so ist, sollten wir die Statuen hierher in die Hauptstadt schaffen“, schlug Leqaz-Thunk vor, „für alle sichtbar, gleichermaßen als Vorbild und Mahnmal.“
„Wie erklärt ihr euch, dass eine der Figuren plötzlich in den Abgrund gestürzt ist?“, wollte Rhott-Mypor wissen, stützte sich auf die linke Armlehne seines breiten Throns und nahm von einem Diener einen dampfenden Kelch mit vergorenem dunkelbraunem Gurrblut entgegen.
„Ein Beben vielleicht, Herr“, antwortete einer der Delegierten und vergaß nicht, sich dabei zu verbeugen.
„Beben kommen immer von unten“, widersprach der Materialkundler, „das hätten wir bemerkt.“
„Dann eben ein größerer Nager, oder einer von den sonstigen Weichbrutrassen dort oben.“
„Ihr wisst es also nicht!“, dröhnte Rhott-Mypor in bedrohlichem Tonfall. „Was habt ihr eigentlich so lange dort gemacht? Nichtsnutziges Pack, ich sollte euch in den Glutofen werfen, dass die Schuppen auf euren blöden Schädeln schmelzen!“
Von Schleim durchsetzte Gurrblutreste sabberten von seinen Lefzen herab und zerstäubten im Wortschwall. Die zuvorderst Stehenden bezahlten den Wutausbruch mit Speichelspritzern auf ihrem Gesicht, ließen sich aber vorsorglich nichts anmerken.
Leqaz-Thunk, der dem Herrscher aufgrund jahrelanger problemloser Unterwürfigkeit am freundlichsten gesonnen war, versuchte beschwichtigend die Situation zu erklären: „Wir haben alles doppelt und dreifach durch- und untersucht, aber keinerlei Spuren irgendeiner Fremdeinwirkung gefunden. In der großen Halle haben wir allerdings einige Löcher entdeckt, durch die kein Dracca passt. Ob sie ganz nach außen führen, wissen wir nicht. Andererseits wird wohl kein Lebewesen, das so klein ist, dass es dort hindurch schlüpfen kann, in der Lage sein, eine dieser Steingestalten umzuwerfen, geschweige denn durch die Türe zu schleppen und in den Abgrund zu stoßen.“
Der Geschichtskundige meldete sich zu Wort und wandte ein: „Was ist, wenn die Zyasen zurückgekommen sind? sie wären in der Lage, mit ihrem Cereastorhammer ein Beben von oben zu erzeugen.“
Ein Raunen machte sich unter den Teilnehmern breit, das von furchtsamem Abwägen getragen war.
Wutschnaubend unterbrach Rhott-Mypor die aufkommende Diskussion mit einer zornigen Handbewegung.
„Könnte, wäre, alles nur Vermutungen. Hört, was ich anordne: die Steingestalten werden hierher nach Wemrass gebracht, was dann mit ihnen geschieht, werden wir, werde ich dann entscheiden.“
Leqaz-Thunk wollte einen Einwand vorbringen, aber Rhott-Mypor schnitt ihm das Wort ab. „Zweitens“, fuhr er fort, „wird die Halle dort oben mit all ihren möglichen Ausgängen ausgeräuchert, und zwar gründlich. Danach werden wir drittens ein bewachtes Tor zur Oberfläche offenlassen, das wir als Erkundungsstützpunkt und für Beutezüge nutzen werden. Die Leitung der Mission wird Ovtarrhad übernehmen, der, anders als viele andere“, er schaute in die Runde, “durch zuverlässige Arbeit mein vollstes Vertrauen erworben hat“.
Betreten blickten die Mitglieder des Untersuchungsrats zu Boden, und Rhott-Mypor, zufrieden mit der Reaktion seiner Untertanen, setzte seine Ansprache fort: „Leqaz-Thunk wird ihm assistieren.“
Er wartete einen Augenblick und beendete seine Anweisungen: „Ich gehe davon aus, dass niemand etwas dazu sagen möchte. Begebt euch auf die Wache und wartet auf die Einsatzbefehle Ovtarrhads. Leqaz-Thunk, du bleibst in der Stadt, bis Ovtarrhad kommt, und erklärst ihm die Situation.“
Die Wachen drängten die Gruppe zum Ausgang, und Rhott-Mypor begab sich hinter den Vorhang, um am züngelnden dunklen Licht der magischen Kristallkugel Kraft zu tanken.
DIE ÖFFNUNG DES FEUERTORS
Leqaz-Thunk und Ovtarrhad überwachten die Vorgänge zur Öffnung des Feuertors, wobei Leqaz-Thunk mehr für die technischen Arbeiten zuständig war, Ovtarrhad für alles andere. Erst mussten die Steinskulpturen freigelegt und abtransportiert werden. Das erwies sich als schwieriger, als man erwartet hatte. Durchgänge mussten aus dem Fels geschlagen, Rampen gebaut oder aufgeschüttet, Kräne und Karren montiert werden. Der steile Abstieg stellte größte Anforderungen an alle Beteiligten. Deshalb entschied man sich später für den Bau eines Aufzugs, mit dem die Steingestalten relativ sicher nach unten gebracht werden konnten. Trotzdem war größte Vorsicht beim Anheben und Wegbringen der Figuren geboten, vor allem die feingliedrigen Extremitäten, Gliedmaßen und was sie in der Hand hielten, Lanzen, Axtstiele, aber auch Krallen, Flügel, Schwänze, brachen bei der geringsten Berührung mit der Felswand ab.
So mancher Dracca bezahlte dafür mit barbarischer Strafe. Am aller schwierigsten war der Abtransport der größten aller Figuren, Jochacca. Man war sich mittlerweile sicher, dass sie Jochacca darstellen sollte oder sogar der versteinerte Körper Jochaccas selbst war.
Weitere Nachforschungen waren angestellt worden, und alte Unterlagen aus entfernteren Teilen des Reiches aufgetaucht, die das nahelegten. Die Steinfigur steckte in einem Durchgang fest, mit einer Hand sich am Fels festhaltend, ein Bein in der Halle, das andere zurückgesetzt im Gang, der Rücken gekrümmt, um nicht am Türsturz anzustoßen. Am schlimmsten jedoch war der Schwanz, der sich hinter dem Durchgang sogar noch um die Ecke bog. Die Skulptur musste natürlich unter allen Umständen unversehrt bleiben, immerhin handelte es sich um den letzten Groß-Gewaltherrscher der Oberflächenära.
Die Dracca kannten glücklicherweise ein Werkzeug, mit dem man Stein wie Käse schneiden konnte, es war jedoch nur sehr restriktiv einsetzbar, denn das Material, aus dem es bestand, sonderte eine hochgiftige Strahlung ab, die nach kurzer Zeit zum Tod führte. Ovtarrhad und Leqaz-Thunk waren zwar nicht zimperlich im Umgang mit ihren Leuten, aber der Selbsterhaltungstrieb gebot hier doch etwas Rücksichtnahme gegenüber der eigenen Rasse.
Normalerweise wurden deshalb für solche Arbeiten Angehörige versklavter Völker herangezogen. Aber auch diese konnten nicht uneingeschränkt eingesetzt werden, zum einen, weil der Steinschneider theoretisch auch als Waffe hätte eingesetzt werden können, gegen die die Dracca machtlos gewesen wären, zum anderen, weil ein zu hoher Verschleiß an Sklaven organisatorische Probleme mit sich gebracht hätte.
Letztendlich jedoch konnten alle Skulpturen geborgen und nach Wemrass geschafft werden. Trotz größter Anstrengung aller Beteiligten, ob freiwillig oder erzwungen, dauerte es mehr als zweihundert Rotationen, bis alle Figuren auf dem extra dafür eingeebneten Heldenplatz vor dem Portal des Herrscher-Palastes aufgestellt waren.
Die Mythen und Erzählungen über die Steinzeugen waren deren Eintreffen in der Hauptstadt vorausgeeilt, weshalb sich sehr rasch großes Interesse um die Figuren regte. Von der weitverbreiteten Scheu, sich vor der Obrigkeit zu präsentieren, war in diesem Falle plötzlich nichts mehr zu spüren.
Kaum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, strömten Besucher aus allen Teilen des Reiches heran, um die Skulpturen zu bestaunen, die immerhin in Sichtweite des Palastes aufgestellt waren. Besonders um das Ebenbild von Jochacca bildete sich innerhalb kürzester Zeit ein wahrer Kult heraus: man huldigte ihm, legte Opfergaben nieder, verfiel in verklärtes Lächeln, wenn man zu den Glücklichen gehörte, die es schafften, die Plastik zu berühren. Letzteres wurde nämlich schon sehr bald unterbunden, da man der Meinung war, die Dracca würden Stücke abbrechen oder mit ihren Krallen zumindest Kratzspuren hinterlassen. Die Besucher durften nur auf vorgezeichnetem Weg und nur hintereinander, nicht nebeneinander, an den Figuren vorbeimarschieren. Überall war Aufsichtspersonal aufgestellt, das für Ordnung sorgte. Und wegen dieser Umstände wurde schon nach wenigen Rotationen Eintritt abkassiert.
Trotzdem, Wemrass blühte förmlich auf, überall Besucher, die versorgt werden wollten. Händler boten Speisen und Getränke auf öffentlichen Plätzen an, Künstler fertigten Nachbildungen an und boten sie feil, Handwerker Gurte und andere Ausrüstungsgegenstände, wie Jochacca sie getragen hatte.
Rhott-Mypor beobachtete das ganze Geschehen mit Argwohn. Die Verehrung Jochaccas und die Rituale, die sich um ihn herausbildeten, drohten einer eigenen Gesetzmäßigkeit zu folgen. Er fürchtete vor allem den sich abzeichnenden Machtgewinn der Priesterschaft und damit einhergehend den Verlust an eigener Autorität. Andererseits konnte er die Begeisterung der Massen nicht verbieten, ohne innere Unruhen zu riskieren. Jochacca war immerhin so etwas wie eine Gottheit. Und Religion konkurrierte seit jeher nahezu in allen Kulturen der Erdgeschichte in hohem Maße mit der Macht weltlicher Herrscher. Um sich selbst wieder mehr ins Zentrum des öffentlichen Interesses zu rücken, ließ Rhott-Mypor verbreiten, dass die Rettung der Skulpturen vor dem Zugriff der Weichbrutrassen in erster Linie ihm zu verdanken sei und dass die Bedrohung, die von der Oberwelt ausging, noch nicht gebannt sei. Alle Dracca sollten daher jederzeit zum Kampf bereit sein und den Anweisungen der Obrigkeit unbedingt und unverzüglich Folge leisten. Der Herrscher selbst, so ließ er verbreiten, sei die gegenwärtige Wiederverkörperung der großen Dracca-Imperatoren der Vorzeit und deshalb in allen seinen Entscheidungen unfehlbar.
Die Hohepriester gaben sich damit zähneknirschend zufrieden, vor allem deswegen, weil sie ohnehin auf die Hilfe des Militärs angewiesen waren. Dadurch hatte Rhott-Mypor vorerst wieder die Zügel in der Hand und alle seine Befehle konnten mit der neuen Religion in Verbindung gebracht werden. Auf Zwangsmaßnahmen konnte daher weitestgehend verzichtet werden. Sogar Freiwillige meldeten sich daraufhin, die bei den weiteren Arbeiten unterhalb des Rotkopfs helfen wollten. Dass diese Arbeiten nicht der Verteidigung beziehungsweise Abschottung dienten, sondern der Öffnung einer Pforte zur Oberwelt und einer damit verbundenen Aggression gegen die Bewohner des dortigen Landes, wurde ihnen nicht gesagt.
Die Arbeiten konnten somit forciert werden, die eingesetzten Kräfte wurden öfter abgewechselt, unproduktive Ruhepausen waren nicht mehr nötig, an mehreren Stellen konnte gleichzeitig gearbeitet werden, und nicht zuletzt konnten auch öfter Dracca zur Bedienung des Steinschneiders abgezweigt werden. Letzteres geschah im Allgemeinen still und heimlich, die Betroffenen wurden zuerst einige Male anderen Gruppen zugeteilt, schließlich unter einem Vorwand abgerufen und gebeten, den Dracca oder Sklaven, der den Steinschneider bediente, abzulösen, was sie auch voller Stolz ausführten, da sie um die tödliche Gefahr nicht wussten. Die Entsorgung übernahmen ausnahmslos Sklaven, die des Sprechens nicht mächtig waren. Auf diese Weise verschwanden an die zweihundert Dracca spurlos, ohne dass ihr Fehlen Aufsehen erregte. Als im Nachhinein Rückfragen eintrafen, weil die Arbeitskraft der Verstorbenen vermisst wurde, wusste niemand etwas über deren Verbleib zu berichten.
Die Arbeiten kamen so zügig voran. Nach Leqaz-Thunks Plänen wurde ein Kanal von einer Magma-Kammer, die sie Helbrass nannten, zum ausgekühlten Schlot des erloschenen Vulkans Rotkopf gelegt, und oben, wo der Berg die Erdoberfläche durchbrach, wieder abgezweigt in ein halb verfallenes Höhlensystem, dessen Ausgang sich auf Höhe des Wasserfalls am Schlohjoch befand, was die Dracca zu dieser Zeit aber noch nicht wussten.
Dort im oberen Bereich kam es bei den Vorbereitungen zu einem kleineren Zwischenfall, der sich aber dank der Weitsicht Ovtarrhads für das weitere Geschehen als sehr nützlich erwies. Tief im Inneren des Rotkopfs, dort wo noch heiße Aufwinde des ehemaligen Vulkans den Stein erwärmten, hatte sich Swississch eingenistet, eine Schlange mit den Ausmaßen eines Baumstammes. Einhundert Jahre hatte sie sich dorthin zurückgezogen und geschlafen, doch nun wurde sie durch Lärm und Erschütterungen in ihrer Ruhe gestört. Der erste Dracca-Arbeiter, der nichtsahnend in ihre Kammer eindrang, sah sie nicht und fühlte ihre Gegenwart nicht, denn weder Gehirnströme noch Körperwärme verrieten sie. Ihr siebenter Sinn aber erfasste alle Geräusche und Bewegungen um sie herum. Regungslos beobachtete sie, wie der Dracca sich in ihrer Höhle zu schaffen machte, und Zorn stieg in ihr auf. Adrenalin schoss in ihr Blut und ließ es pulsieren, es wurde ihr heiß im Kopf und unmerklich spannten sich die Muskeln ihres Körpers.
Gerade, als der Dracca merkte, dass irgend etwas nicht stimmte, schnellte Swississchs Kopf blitzschnell nach vorne und biss zu. Sie spürte sofort die zähe, sehnige Haut ihres Opfers. Schade, dachte sie, ihre Zähne in warmem Fleisch hatte sie in angenehmer Erinnerung, aber sie hielt sich nicht mit der Suche nach einer geeigneteren Stelle auf, sondern rollte den Dracca ein und drückte zu.
Ein dumpfer Aufschrei war das letzte, was dieses Swissisch unbekannte Wesen von sich gab. Die unbändige Kraft ihrer Muskeln zerdrückte seinen Körper, dass die Knochen splitterten und die Gedärme rissen. Die nächsten Dracca, die den Unglücksort erreichten, mussten mitansehen, wie ihr Kamerad gerade im Schlund der Schlange verschwand, mit dem Kopf zuletzt. Man rief Ovtarrhad herbei, der entscheiden sollte, was mit dem Ungetüm zu geschehen habe, der aber ermahnte die erhitzten Gemüter, die den sofortigen Tod der Bestie forderten, zur Zurückhaltung. Wenn die Schlange hier heruntergekommen war, müsse es einen Weg nach draußen geben, belehrte er sie. Und darüber wolle er sie erst befragen, vielleicht würden sie sich dadurch viel Mühe einsparen und schneller zum Ziel kommen.
Nachdem er mit ihr gesprochen hatte, empfand er Bewunderung für Swississch. Ihre Kraft, Klugheit, Umsicht und Erfahrung beeindruckten ihn sehr. Er bezeichnete sie als >zu ihnen gehörend<, da in ihr ebenso Echsenblut fließe wie in den Dracca. Von ihr erfuhr Ovtarrhad vieles über das Land und deren Bewohner rund um den Rotkopf, geradezu gierend hörte er ihr zu, als sie über die Warmblüter der Oberwelt erzählte, deren Angst vor ihr, und den Genuss, den sie verspürte, wenn sie einen noch lebenden Körper verschlang.
Ovtarrhad erkannte so viele gemeinsame Neigungen und Interessen, dass er ihr schließlich sogar einen Pakt anbot: ein respektvolles Dulden untereinander, und gegenseitige Hilfe im Kampf gegen die Feinde der Oberwelt. Ovtarrhad meinte zwar weniger Kampf als vielmehr Jagd, aber dass es zu Komplikationen kommen könnte, wusste er aus Erfahrung. Von anderen Ausgängen zur Erdoberfläche war bekannt, dass besonders Menschen sich beizeiten zusammenrotteten oder einzelne, besonders mutige und kräftige Exemplare vorschickten, um die Dracca bei ihren Unternehmungen zu stören. Swississch kam dabei geradezu wie gerufen. Einerseits würde sie die Aufmerksamkeit allein schon wegen ihrer Größe auf sich ziehen und dadurch von den Dracca ablenken, andererseits konnte sie auch bei Helligkeit Wache halten und beobachten, was rund um den Rotkopf vor sich ging. Im Gegensatz zu den Dracca schadete ihr nämlich Tageslicht nicht. Im Gegenteil, sie liebte es sogar, während der warmen Jahreszeiten in der Sonne zu liegen und auf Beute zu warten. Zumindest hatte sie das so in Erinnerung, denn sie hatte die letzten einhundert Jahre geschlafen, aber das war ihr selbst nicht so lange vorgekommen.
Swississch machte sich auf den Weg nach oben. Für andere Wesen kaum begehbar, wand und schlängelte sie sich mühelos durch das Labyrinth enger Spalten, unwegsamer Höhlen und verkeilter Felsbrocken an die Oberfläche. Sie war mit dem Ausgang der Unterredung zufrieden. Nach ihrer Einschätzung hätte es durchaus zu einem Gerangel mit der aufgebrachten Meute dieser seltsamen Kreaturen kommen können, und Kampf unmittelbar nach Einnahme einer - wenn auch kleinen - Mahlzeit, noch dazu mit mehreren Gegnern, war immer unangenehm. So aber hatte diese komische Flügelechse ihr den einen Artgenossen gar nicht nachgetragen. Außerdem wäre es sowieso der letzte gewesen. Irgendwie vertrug sie dieses Wesen nicht, die Haut war zäh und verdaute kaum, stinkende Fäulnisgase durchströmten ihren Leib, und ihr Magen drehte sich vor Übelkeit. Nachdem ein Tag vergangen war, würgte sie den verbliebenen Rest hoch und spie ihn wieder aus. Gleich darauf kreuzte ein Reh ihren Weg, das sie mit besonderer Hingabe verspeiste, denn es war die erste artgerechte Nahrung seit einhundert Jahren.
Die Dracca indes bauten weiter an dem Korridor, der das Feutertor öffnen sollte. Sie wussten jetzt, dass sie auf dem richtigen Weg waren, manchmal konnten sie die frische Luft von außerhalb schon riechen. Auch mussten sie auf einen allzu korrekten Ausbau nicht mehr achtgeben, denn der Druck der Eruption würde den Rest schon erledigen.
Bald darauf war es soweit, alle Vorbereitungen waren getroffen, als letztes musste nur noch das Schleusentor, das die Helbrass vom Kanal trennte, geöffnet werden. Es ließ sich nicht verschweigen, dass es sich dabei um eine besonders gefährliche Arbeit handelte, deshalb griff man auf Kerkerinsassen zurück, denen man Amnestie versprach, wenn sie die herausbrechende Feuerwalze überlebten. An der Schleuse selbst schoss die flüssige Glut der Helbrass mit ungebändigter Kraft hervor, weiter oben jedoch folgte das Feuer dem vorbereiteten Weg und ergoss sich, wie von Leqaz-Thunk berechnet, in einer kontrollierten Eruption über die südwestliche Flanke des Rotkopfs.
Zwanzig Rotationen vergingen, bis der Druck, mit dem die Helbrass an die Oberfläche drängte, nachließ und der Glutstrom versiegte. Jetzt erst konnte das Schleusentor wieder geschlossen werden. Das erkaltende Gestein wurde von den Dracca zu Treppen, Gewölben und geraden Mauern geformt. Nach fünf weiteren Rotationen verließ Ovtarrhad mit einer Handvoll Soldaten zum ersten Mal den Berg. In den Folgenächten wurde die nähere Umgebung erkundet und eine Aufgabenverteilung vorgenommen. Höhlen rund um den Rotkopf und an den Hängen der angrenzenden Berge wurden als Vorposten und Zwischenlager eingerichtet, sie wurden mit jeweils zwei Dracca besetzt, die auf sich selbst angewiesen waren, d.h. sich selbst Nahrung besorgen und sich im Ernstfall verteidigen mussten. Die Unterschlupfe waren notwendig, um näher an den Siedlungen und Verkehrswegen der Weichbrutrassen operieren zu können, denn die Dracca konnten nur bei Nacht die schützende Dunkelheit ihrer Schattenwelt verlassen.
Bei einer neuerlichen Zusammenkunft mit Swississch erfuhr Ovtarrhad von einem Einhorn, das sich irgendwo in den angrenzenden Wäldern herumtreiben sollte. Swissisch hatte es nicht selbst gesehen, aber eines ihrer Opfer, ein Feldhase, hatte ihr davon erzählt, „und der“, so zischelte sie mit absoluter Gewissheit, „hat mich nicht belogen“.
Nach einer Weile fügte sie hinzu: „Einhörner, musst du wissen, sind sehr selten. Sie verfügen über magische Kräfte. Ich würde mich gerne mit einem messen oder eines fressen.“
Ovtarrhad war nur unvollständig über diese Art von Lebewesen informiert, er hatte einmal gehört, dass das Blut von Einhörnern Unsterblichkeit verleiht und versteinerte Geschöpfe durch Tränen von Einhörnern wieder zum Leben erweckt werden können. Warmes Wohlgefühl durchströmte seinen Magen, in seinen Gedanken sah er die Steinskulpturen von Wemrass aus ihrer Starre erwachen. Und dem wiedererweckten Jochacca höchstpersönlich gebührte die Ehre, diesem hässlichen Wesen mit einem einzigen Horn und widerwärtigem weißen Fell den Hals aufzuschneiden, um den besonders verdienstreichen Anwesenden, zuallererst aber ihm selbst, den Kelch mit dem Elixier der Unsterblichkeit zu reichen.
SILI GRAMLICH
Zwei Mondumläufe waren vergangen, seit vierundsiebzig Zwerge von ihrer Mission am Aschkna zurückkehrt waren, der Fünfundsiebzigste war dort geblieben, weil er noch weiter forschen wollte. Nirka Gramlich und ihr Sohn Sili machten sich von Tag zu Tag mehr Sorgen.
„Mutter, ich werde zum Aschkna gehen und ihn suchen“, sagte Sili eines Abends beim Essen.
„Kommt nicht in Frage, du bleibst hier, sonst bin ich ganz alleine, das willst du doch nicht, oder?“, wehrte Nirka ab.
Sili aber drängte: „Wir müssen doch etwas unternehmen, was ist, wenn er im Berg eingeschlossen ist, sich einen Fuß gebrochen hat, oder wer weiß was sonst passiert ist? Ich werde gehen und ihn suchen, du brauchst dir keine Sorgen um mich machen, ich bin alt genug und vorsichtig genug, mir wird nichts passieren.“
„An einem verwunschenem Ort nützt Vorsicht und Erfahrung nicht viel, das hätte besser auch dein Vater berücksichtigen sollen“, entgegnete Nirka, doch Sili unterbrach sie:
„Der Rotkopf ist verwunschen, Mutter, nicht der Aschkna, das hat Vater bestimmt beherzigt.“
„Warte“, flehte ihn Nirka an, „ich habe Marka Wichterich gebeten, auf den König einzuwirken. Sie sollen einen Suchtrupp aussenden.“
„Ach, hör mir doch damit auf, bis da etwas geschieht, vergeht noch einmal ein ganzer Mondumlauf. Da muss erst der Zwölfer-Rat einberufen, hin und her beraten, auf Gleichberechtigung geachtet und abgestimmt werden. Außerdem wird Wichterich erst einmal bocken, wenn der Vorschlag von seiner Frau kommt. Das wäre ja beschämend und ehrverletzend für ihn, wenn die wichtigen Anregungen und Beschlüsse nicht von ihm, sondern von der Gemahlin des Königs kommen. Glaub mir, bis sich da etwas bewegt, bin ich längst wieder zurück.“
Nirka hatte Tränen in den Augen, sie nahm ihren Sohn in die Arme und beschwörte ihn:
„Sili, liebster Sohn, wenn auch dir etwas geschieht, werde ich das nicht überleben. Bleibe doch hier, oder gehe wenigstens zuerst zum König, dass er dir Unterstützung mitgibt.“
„Mutter, ich bin ein erwachsener Zwerg, habe das Tarnen und Pirschen gelernt und ich kenne allerlei kleinen Zauber, der mich vor Schaden bewahrt. Sieh doch ein, dass du mich nicht wie einen kleinen Jungen einsperren kannst. Ich muss gehen, Aber ich verspreche dir, nach fünf Tagen erfolgloser Suche kehre ich zurück.“
Nirka sah ein, dass sie ihren Sohn nicht zurückhalten konnte. Sie packte ihm warme Strümpfe, kraftvolles Grewürzbrot, einige Leckereien sowie Heilkräuter und Salbe für den Fall, dass er sich verletzen würde, ein. Er sollte wenigstens ein paar Annehmlichkeiten auf der Reise erfahren und dabei vielleicht an seine Mutter denken, wie gut sie zu ihm war.
„Eine Bitte habe ich noch, Mutter“, sagte Sili beim Aufbruch, „wenn du Betesa siehst, sag ihr, ich bin in ein paar Tagen zurück, sie soll sich keine Sorgen machen.“
Betesa war ein hübsches Zwergenmädchen mit dunkelblonden Zöpfen, fleißig und begabt in der Heilkunst und in häuslichen Dingen, die Tochter eines Nachbarn. Ihr gegenüber bemühte er sich um ein besonders freundschaftliches Verhältnis, war zuvorkommend wo er nur konnte und überhäufte sie mit Komplimenten. Aber wie bei Zwergen so üblich, war er in Liebesangelegenheiten alles in allem sehr schüchtern.
„Das hättest du ihr selbst sagen müssen, das hätte sich gehört!“, rief Nirka ihm nach.
„Bitte, Mutter!“, erwiderte Sili und war im Wald verschwunden.
OVTARRHAD
Ovtarrhad flog durch die dunklen Galerien und Hallen des unterirdischen Reiches Ugor, um seinem Herrscher von der erfolgreichen Öffnung des Feuertors Bericht zu erstatten. Die Dracca hatten einen Verbindungskanal zwischen einem seit vielen Generationen verstopften Vulkanschlot und einem uralten Tunnelsystem gegraben, das in grauer Vorzeit von einer Schattenzwergrasse bewohnt war. Der Plan gelang exzellent: Nachdem das glutflüssige Magma mit hohem Druck in die Gänge schoss und die darin herrschende Feuchtigkeit zusätzliche Explosionen verursachte, flog das Feuertor mit jähem Getöse aus der Verankerung und zerbarst in tausend Splitter.
Ein paar Dutzend Dracca waren in der freigewordenen Glut verschmort, aber das war zu erwarten gewesen, und der Verlust würde durch den gewonnenen Nutzen mehr als wettgemacht werden.
Rhott-Mypor wird zufrieden sein mit der Nachricht und mit mir, sagte sich Ovtarrhad in Gedanken, und er dachte an aufregende und abwechslungsreiche Aufgaben, die ihm bevorstanden.
Er wusste, dass er in dieser Zeit unentbehrlich sein würde, da er einer der Hybriden war, die über die Fähigkeit des Fliegens verfügten und daher in kurzer Zeit weite Distanzen zurücklegen konnten.
Wenn ein neues Tor geöffnet oder wie in diesem Fall wieder geöffnet wurde, war es wichtig, die Gunst der Stunde zu nutzen, bevor die Wesen der Oberwelt die Gefahr erkannten und den geöffneten Bereich mieden. Und er hatte noch eine Nachricht, die der Herrscher mit großem Interesse aufnehmen würde.
Ovtarrhad legte auf seiner Reise zum schwarzen Tempel mehrere Pausen ein, denn seine letzte Nahrungsaufnahme war großzügig ausgefallen und lag ihm schwer im Magen.
Genaugenommen war es ein Misserfolg, überlegte er, hoffentlich hat mich keiner der Dracca beobachtet, sonst muss ich es am Ende noch vor Rhott-Mypor erklären.
Er hatte nicht damit gerechnet, dass ein so armseliger Tollpatsch wie dieser Mensch durch so unverschämtes Glück hatte entkommen können.
Er wird nicht weit gekommen sein, sagte er sich, ist wahrscheinlich im Gebirgsbach ertrunken. Menschen sind Weichlinge, zwanzig, dreißig Herzschläge unter Wasser und sie sind ersoffen.
Ovtarrhads Puls hatte sich in Vorfreude auf den bevorstehenden Genuss bereits beschleunigt, als seine Sinne die Angst des Menschen erfassten. Er spürte schon den sich sammelden Speichel in den Winkeln seines Mauls und wollte seine Hochstimmung noch steigern, indem er sein Opfer nicht gleich riss, sondern noch ein paar Atemzüge länger verfolgte, in die Enge trieb, seine Panik steigerte. Für Reptiloide wie die Dracca und ihn, einen Dracca-Gargo-Hybriden, sind Angst und ähnliche Gefühle gleichsam mentale Nahrung, die sie in höchste Verzückung versetzen. Sein Opfer schrie in Todesangst, als seine Flucht vor dem reißenden Gebirgsbach zum Stehen kam. Ovtarrhads glühende Augen fixierten den Menschen, und mit den Sinnesorganen in seiner Stirn verschlang er dessen hilfeflehende Schwingungen. Mit einem ansatzlosen Peitschenhieb seines Schwanzes schlug er ihm das Messer aus der Hand und wollte sich gerade auf ihn stürzen, um ihm sein pochendes Herz aus dem Leib zu reißen, als es passierte: der Mensch kippte nach hinten in das Wasser und wurde sofort weggespült. Blitzschnell versuchte Ovtarrhad seine messerscharfen Krallen im Fleisch des Mannes einzuhaken, aber er ritzte ihm nur die Haut und zerschnitt sein Gewand. Die Beute stürzte mit dem Wasserfall in die Tiefe, wo sie unter glattgeschliffenen Felsbrocken verschwand. Die weitere Verfolgung wäre zu umständlich gewesen. Außerdem bestand kein Anreiz darin, im und unter Wasser und Felsen zu jagen um letztlich nur einen toten Leichnam an Land zu ziehen.
Verärgert kletterte Ovtarrhad auf die Klippe über dem Wasserfall und brüllte einen markerschütternden Wut- und Kampfschrei in die Nacht. Seine dämonenhafte Gestalt zeichnete sich gegen den fahlen Lichtschein des Mondes ab, der in dieser Nacht hinter einem dünnen Wolkenschleier zu sehen war. Enttäuscht über sein Missgeschick wandte er sich ab und begab sich auf die Suche nach dem Pferd des Mannes, das dieser wegen des undurchdringlichen Dickichts eine Meile landabwärts zurückgelassen hatte. Sein unbeirrbarer Geruchsinn führte ihn mit tödlicher Sicherheit zum Ziel, dessen Witterung er längst aufgenommen hatte. Er wusste um das Pferd, denn der Mensch hatte den Geruch des Tieres an sich und den Ausdünstungen des Pferdes waren die seltsamen Abriebspuren eines Menschen beigemengt. Als sein wärmeempfindliches Organ ihm das rötlich schimmernde Abbild des Reittieres in sein Gehirn projizierte, prüfte er instinktiv die Windrichtung, um die beste Position für seinen Angriff auszuloten und dieses Mal zu einem schnellen Erfolg zu kommen. Ovtarrhad wollte nicht mehr Zeit als nötig verlieren, zog seinen Langdolch aus der ledernen Scheide, die er sich seitlich um die Brust geschnallt hatte und flog die letzten zwei Baumlängen mit vorgehaltener Waffe auf die angebundene Stute zu. Es ging sehr schnell. Der Stich fuhr hinter der Schulter schräg abwärts direkt ins Herz und tötete das Huftier sofort. Nur ein kurzes Röcheln war zu vernehmen. Mit flink und präzise ausgeführten Schnitten öffnete der Dracca-Gargo die Bauchhöhle des toten Pferdes und fraß von den noch warmen Eingeweiden. Nur die besten Stücke nahm er sich, Herz, Lunge, Leber, danach noch bestes Muskelfleisch, und hastig schlang er es hinunter. Zuletzt öffnete er den Schädel des Tieres und verspeiste das Gehirn.
Nun war sein Heißhunger gestillt, zweihundert Schlafphasen waren vergangen, seit er das letzte Frischfleisch eines warmblütigen Säugers gefressen hatte. Zufrieden streckte er seine Glieder und brach zu einem kurzen Erkundungsflug rund um das Schlohjoch auf, bevor er die Rückreise ins Innere der Erde antrat.
KÖNIG KARSOMEID
König Karsomeid stand auf den Zinnen seines Palastes hoch über der Stadt und schaute gen Osten in den Nachthimmel. Der Mond zeichnete die Silhouette der umgebenden Berge des Miron-Gebirges gegen die Dunkelheit ab.
„Zwanzig Tage lang hat die Erde am Schlohjoch im Miron-Gebirge gebebt und Glut gespieen, aber wie es scheint, sind die Dämonen der Unterwelt jetzt besänftigt. Was meint Ihr, Malax? Bleiben die Nächte wieder ruhig?“
Malax, der Seher und Ratgeber des Königs, starrte unverändert in die Nacht. „Was den Donner und das Glutspucken anbelangt, scheint es so, wie Ihr sagt, mein König, aber ob das Miron-Gebirge noch ist, wie wir es kennen, muss die Zukunft weisen. Südlich des Schlohjochs verläuft die Pass-Straße nach Radogar, wenn sie zerstört ist, werden wir viele Entbehrungen erdulden müssen. Die Händler werden ausbleiben und wir werden nicht kaufen und tauschen können. Schon jetzt ist die Lage nicht zum Besten, mein König, die Wintervorräte gehen zu Ende und seit zwei Monddurchläufen kam niemand von außerhalb unserer Gefilde in die Stadt. Wir wissen nicht, ob dort Ähnliches geschehen ist.“
„Da redet Ihr recht“, entgegnete Karsomeid, „auch sorge ich mich wegen Kunelda. Das liebe Kind frägt jeden Tag, ob es Nachricht von Prinz Garpath aus Radogar gibt, der in diesem Frühjahr die Reise zu uns antreten wollte. Sie erhofft sich, dass er um ihre Hand anhält. Ihr solltet Kundschafter ausschicken, die Ausschau halten und uns von der Lage Bericht erstatten sollen.“
Malax, dem wieder einmal die Vergesslichkeit des alternden Königs auffiel, sah ihm nun in die Augen: „Das ist längst geschehen, Ihr selbst habt es angeordnet. Fünf Kundschafter machten sich bereits auf den Weg, aber nur einer kam bisher zurück. Gerade auf diesen allerdings - sein Name ist Prokop - ist wenig Verlass. Er tölpelt seit seiner Rückkehr wie ein neugeborenes Kalb daher und plappert nur wirres Zeug. Er behauptet, er wäre nächtens von schrecklichen Ungeheuern verfolgt worden und hätte sein Leben nur dem glücklichen Zufall zu verdanken, dass er bei der Flucht im unwegsamen Gelände in den Bach gefallen und von diesem fortgespült wurde.“
„Ihr glaubt ihm nicht?“, fragte Karsomeid.
„Nun, wie sollte ich“, gab Malax zu bedenken. „Sein Verhalten ist das eines Kranken, der sich allzu sehr den berauschenden Getränken zuwendet. Sobald man ihn nur danach fragt, wie die Ungeheuer, die ihn angeblich verfolgt hatten, ausgesehen haben, beginnt er schon zu zittern, kauert sich in eine Ecke und fleht um Schutz und Hilfe. Die meiste Zeit hockt er in der Schänke am Stadttor und gibt sich dem Trunke hin. Wenn die Wirtsstube schließt, bettelt er bei den Wachtleuten am Tor darum, dass sie ihn in den Kerker sperren. Da er einmal einer der ihren war und die Wächter Mitleid mit ihm haben, lassen sie ihn dann auf der Wache schlafen. Als nächstes wird er wohl seine Hütte verkaufen, und dann dauert es nicht mehr lange, bis er ganz zugrunde geht.“
„Und von den anderen hat man nichts gehört?“, fragte der König.
„Nein, sie sind überfällig. Normalerweise hätten sie spätestens am fünften Tage wieder zurück sein müssen, seit Aufbruch des ersten Kundschafters sind aber schon zwanzig Tage vergangen. Wahrscheinlich sind die Wege und Straßen nicht mehr begehbar. Vermutlich mussten sie die Pferde stehen lassen und sind zu Fuß weitermarschiert. Eines der Pferde ist zur Stadt zurückgekehrt, es war ordnungsgemäß abgesattelt, nichts deutet auf einen Sturz oder einen Kampf hin. Und Prokop, wie gesagt - sein Pferd ist verschollen - er selbst kam zu Fuß zurück und brach aus Erschöpfung vor der Stadtmauer zusammen. Morgen bei Tagesanbruch macht sich euer Schwager Hagir mit sechs Mann auf den Weg, um nach den verschollenen Männern und nach Prinz Garpath zu suchen.“
„Weiß Kunelda davon?“ unterbrach Karsomeid den Seher, „Hagir ist ihr Oheim und Lehrer, sie wird mitreiten wollen.“
„Nein, niemand hat es ihr gesagt, Hagir selbst hat allen Beteiligten bei Strafe untersagt, etwas von ihrem Vorhaben weiterzuerzählen“, versicherte Malax dem König.
Kunelda unterdessen, deren Gemach an die Palastterasse grenzte, hatte in den letzten Tagen ohnehin nur leichten Schlaf gehabt. Immer wieder wurde sie von unruhigen Träumen wachgerüttelt. Ihre Gedanken kreisten sorgenvoll um Garpath, den sie im letzten Spätsommer beim Burgfest kennengelernt hatte und der ihr seit dieser Zeit flaue Gefühle in der Magengrube verursachte, wenn sie nur an ihn dachte. Er hatte ihr versichert, noch nie ein holderes Geschöpf unter der Sonne gesehen zu haben und ihr ewige Liebe geschworen. Sein Herz brenne vor Sehnsucht nach ihr, flüsterte er ihr beim Abschied ins Ohr, und sobald es seine Pflichten erlaubten, die er seinem Vater und seinem Volk schuldete, würde er wiederkommen und um ihre Hand anhalten.
Nun aber sollte er schon längst hier sein, das hätte sie sich zumindest gewünscht. Täglich dachte sie sich neue Geschichten aus, die das Ausbleiben Garpaths erklären sollten. Einmal war es eine Krankheit seines Vaters, die ihn an der Abreise hinderte, ein andermal ein wichtiger Staatsbesuch, der seine Anwesenheit erforderte. Manchmal dachte sie an einen späten Wintereinbruch im Miron-Gerbirge, der die Wege unpassierbar machte, dann wieder an ein lahmendes Pferd, das ihn zur Umkehr zwang. Schlimmere Vorstellungen, wie ein Überfall von Räubern oder der Absturz von einem unbefestigten Gebirgsgrat, versuchte sie immer zu verdrängen, doch von Tag zu Tag rückten sie mehr ins Zentrum ihrer Befürchtungen. In dieser Nacht rüttelte sie ein Traum aus dem Schlaf, in dem Garpath gerade unterhalb des Schlohjochs ritt, als eine Felsspalte sich öffnete und glutspeiende Feuerdämonen sich wütend auf ihn stürzten. Noch wälzte Kunelda sich in ihren Kissen. Sie wehrte sich gegen die Bilder des Albtraums und wusste nicht, ob sie schon aufgewacht war, als Stimmen von der Terasse her an ihr Ohr drangen. Klarer wurden die Worte, auch ihr Name fiel, und langsam trennten sich Traum und Wirklichkeit. Schlaftrunken und mit noch zusammengekniffenen Augen torkelte sie zum Fenster und erspähte durch die Ritzen der Klappläden hindurch ihren Vater und dessen Ratgeber Malax in ein wie es schien ernsthaftes Gespräch vertieft. Der frische Windhauch, der durch die Fensterläden hereinwehte, trieb Kunelda den letzten Schlaf aus den Augen und sie hörte die letzten Worte der Unterhaltung nun ganz deutlich. Worte, die sie eigentlich nicht hätte hören sollen. Und sogleich wusste sie, wie ihr nächster Tag beginnen würde.
CHYNROTT
Chynrott hatte sich als erster gemeldet, als Kundschafter gesucht wurden, die die Lage am Schlohjoch inspizieren sollten. Vielleicht, so dachte er, könnte er sich außer der versprochenen Bezahlung für die Operation noch ein paar Extravorteile für sich verschaffen.
Da das Schlohjoch nicht weit von der Grenze zu Radogar lag, konnte es schon mal vorkommen, dass sich ein Schaf oder vielleicht sogar ein Pferd >zufällig verlief<, das man dann entweder hier oder in Radogar verkaufen konnte. Die Art der Bezahlung fasste er dabei sehr weit. Außer Geld, Schmuck und Edelmetall nahm er auch Naturalien entgegen, wozu er auch weibliche Reize zählte. Mitunter lief ein Tauschgeschäft auch anders herum: er nahm sich erst, was er begehrte, und bezahlte dann mit was er wollte, manchmal auch mit gar nichts.