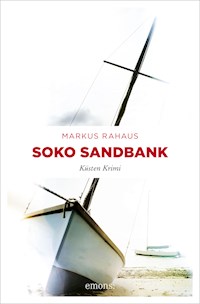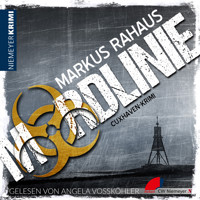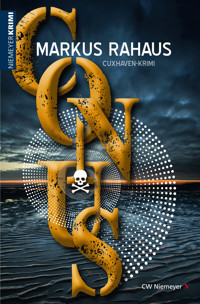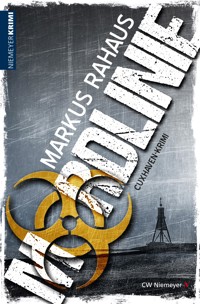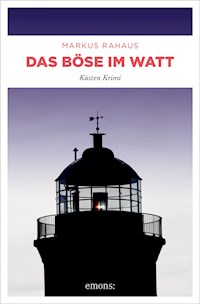
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ermittler Duo Olofsen/Greiner
- Sprache: Deutsch
Glänzend recherchiert und packend erzählt. Festgebunden an eine Fahrwassertonne in der Elbe wird die Leiche eines renommierten Architekten gefunden. Sein letztes Projekt: ein exklusives Hotel in spektakulärer Lage am Ende des Cuxhavener Leitdamms. Bis auf eine Kanüle mit einer unbekannten Substanz gibt es keine Hinweise auf Täter oder Motiv. Haben etwa die Gegner des Bauvorhabens zu radikalen Methoden gegriffen? Das erfahrene Ermittlerduo Arne Olofsen und Martin Greiner versucht Licht ins Dunkel zu bringen und taucht ein in einen Sumpf aus Intrigen, Hass und unbändiger Gier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Rahaus, Jahrgang 1970, lebt mit seiner Familie im Cuxland. Der promovierte Virologe beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Fotografie, veröffentlicht regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften und zeigt seine Bilder im Rahmen von Ausstellungen und Vorträgen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Pitopia/Martina Berg
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-930-3
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Stephanie.Das Licht findet seinen Weg.
Prolog
Australien, Queensland, in der Nähe von Cairns
Die Sonne stand hoch am wolkenlosen, strahlend blauen Himmel, ein warmer Wind strich durch das karge Buschland und über den sandigen Reitplatz, bevor er gegen die alten, verwitterten Bretter des windschiefen Pferdestalls prallte. Sand wirbelte über den Boden, Laub raschelte an den hin- und herwiegenden Ästen der umstehenden Bäume. Der Stall hatte schon deutlich bessere Tage gesehen, das Holz war von der Sonne ausgeblichen, von Wind und Regen verwittert. Das Dach hatte eine pittoreske Schieflage eingenommen, als komme es direkt aus einem Gemälde der alten Romantiker.
Das große Tor stand offen, einer der beiden Flügel schwang leise knarzend hin und her. Auf beiden Seiten reckten sich hohe Bäume in den Himmel, ihre Kronen formten ein dichtes und sattgrünes Blätterdach, das kühlenden Schatten auf die Fläche vor dem Tor warf. In einiger Entfernung hinter dem Stall erhob sich ein ehrwürdiges Herrenhaus. Auch wenn die cremeweiße Farbe an der einen oder anderen Stelle schmutzig angelaufen war oder gar abblätterte, strahlte das zweigeschossige Haus noch immer eine Eleganz aus, wie sie im australischen Queensland nicht mehr allzu häufig anzutreffen war.
Vor der imposanten Freitreppe, die auf die Veranda hinaufführte, erstreckte sich eine gekieste und von Grünflächen flankierte Auffahrt. Mehrere Fahrzeuge parkten auf einem kleinen Parkplatz. Hinter dem Haus wucherte dichte Vegetation, Büsche und Bäume in vielfältigen Größen und Grüntönen.
»Was hat sie nur?« Eine junge Frau, Ende zwanzig, trat aus dem Stall hinaus. Sie war durchtrainiert, schlank und groß gewachsen, trug enge Jeans, ein hellblaues Shirt und Reitstiefel. Mit einer Hand strich sie sich eine brünette Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihre Worte klangen besorgt.
Hinter ihr folgte ein älterer Mann mit gepflegtem Vollbart, kahlem Schädel und einer kleinen runden Brille mit Drahtgestell. Mit seinen Lederschuhen und der Tweedjacke passte er so gar nicht auf eine Farm im Buschland. Dr. William McPhearsons Miene spiegelte Ratlosigkeit wider. »Ich weiß es nicht, Kathy. Aber ich verspreche dir, dass ich es herausfinden werde. Ich kümmere mich seit mehr als zwanzig Jahren um die Pferde deiner Familie.«
Die junge Frau wandte sich um. »Vorgestern war Sheela noch völlig okay. Ich verstehe das einfach nicht. Wir sind zusammen ausgeritten, runter zum Sandy Creek. Eine wunderschöne Tour war das. Anschließend hat sie noch hier draußen gestanden und ein wenig von den Gräsern geknabbert, die unter den Bäumen wachsen.« Sie zeigte auf den Platz vor dem Stall. »Ich habe sie abgetrocknet und gebürstet.«
»Kathy«, sagte McPhearson und legte eine Hand auf ihre Schulter. »Mach dir keine Sorgen. Ich bin Tierarzt, und die Gegend hier kenne ich seit Jahrzehnten. Du weißt selbst, dass Infektionen der Atemwege bei Pferden immer mal wieder vorkommen können. Das ist nicht schön, aber es ist behandelbar. Wie ein Schnupfen bei uns Menschen.«
»Meinen Sie?« Kathy war noch nicht überzeugt. »Ich habe Sheela, seit sie ein kleines Fohlen war. Sie war immer topfit.«
McPhearson ließ ihre Schulter los und machte ein paar Schritte auf die Bäume zu. Das Gras dort war grün und saftig. Auf den ersten Blick konnte McPhearson keine giftigen Gewächse erkennen. Er hob den Kopf und blickte in das Blättermeer über ihm. Dutzende Vögel saßen in den Ästen, mehrere Rosakakadus hockten weit oben in der Krone. Einer von ihnen beäugte den Mann unter ihnen skeptisch, die anderen hatten die Köpfe ins Gefieder gesteckt. An einem Ast auf der anderen Seite des Baumes hingen, mit dem Kopf nach unten, ein gutes Dutzend Flughunde.
Kathy folgte seinem Blick. »Wunderschön, nicht wahr? Ich liebe diese Vielfalt. Diese Ranch ist der schönste Ort der Welt.« Ihre Worte ließen die Sorge um Sheela einen kurzen Moment in den Hintergrund treten.
»Sogar Flughunde habt ihr hier.« McPhearson zwinkerte ihr zu. Die kleine Ablenkung schien ihr gutzutun. »Die putzigen Kerlchen in ihren braunen Mänteln sind mir bei meinen früheren Besuchen gar nicht aufgefallen.«
»Die sind erst seit einigen Wochen hier«, antwortete Kathy. »Auf einmal sind sie aufgetaucht und geblieben. Vielleicht werden es noch mehr. Ich fände das klasse.«
Ein Motorengeräusch ließ die beiden aufhorchen.
»Da kommt Betty«, sagte McPhearson. »Sie bringt meine Tasche mit, die ich ungeschickterweise in der Praxis habe stehen lassen. Nun können wir Blutproben nehmen und im Labor untersuchen lassen. Außerdem werde ich Sheela prophylaktisch ein Breitbandantibiotikum verabreichen. Ich bin sicher, es wird ihr schneller besser gehen, als die Ergebnisse der Blutuntersuchung vorliegen.«
McPhearson und Kathy kehrten in den Stall und zur Box von Sheela zurück. Das Pferd war eine wunderschöne Achal-Tekkiner-Stute mit einem für diese Rasse beeindruckenden Stockmaß von mehr als einem Meter sechzig. Sie stammte aus der eigenen Zucht. Kathys Vater, Thomas Andres, hatte die beiden Elterntiere vor vielen Jahren mit großem Aufwand aus Kasachstan nach Australien importiert. Das Fohlen Sheela war ein Geschenk zu Kathys fünfundzwanzigstem Geburtstag gewesen, seitdem waren die beiden unzertrennlich. Jetzt warf das normalerweise so stolze und temperamentvolle Pferd Kathy einen ängstlichen Blick zu. Irgendetwas war ganz und gar nicht in Ordnung. Das sonst metallisch glänzende kurze Haar der Füchsin war stumpf und feucht von Schweiß. Das Tier war unruhig, der Atem rasselte hörbar. Kathy schlang die Arme um den Hals des Pferdes, eine Träne lief über ihre Wange.
Betty, die Assistentin des Tierarztes, sprang aus dem Wagen, den sie nur wenige Meter neben dem Tor zum Pferdestall geparkt hatte, lief sofort in den Stall und steuerte zielstrebig auf McPhearson zu. Sie war einige Jahre älter als Kathy und wirkte mit ihrem sehnigen und sonnengebräunten Körper trotz der langen Haare recht burschikos. Die große Arzttasche trug sie lässig neben dem Körper.
»Hallo, Betty –« Weiter kam der Tierarzt nicht. Aus der Box erklangen laute Geräusche, ein verzweifelt klingendes Pferdewiehern.
Kathy schrie auf. »Sheela!«
Der Tierarzt und seine Assistentin liefen zur Box.
»Sheela!« Kathy kreischte hysterisch. »Helft ihr!«
»Verdammt! Was passiert hier?« Betty wandte sich erschrocken an ihren Chef.
Die Stute war mit den Vorderbeinen eingeknickt, ihr Kopf gegen die seitliche Wand der Box geschlagen. Blut lief aus einer Wunde am Ohr und tropfte in das Heu auf dem Boden. Das Tier schwitzte und zitterte stark. Es versuchte, sich wieder aufzurichten, aber die Beine versagten ihren Dienst, und so rutschte das Pferd an der Wand entlang zu Boden. Es wieherte schmerzverzerrt, schlug mit einem der Hinterläufe aus und verdrehte die Augen, sodass nur noch die weißen Augäpfel zu sehen waren.
Kathy, die einen panischen Schritt nach hinten gemacht hatte, wollte zu ihrem Pferd stürmen, doch McPhearson hielt sie mit aller Kraft zurück. »Bleib hier. Es ist gefährlich.«
»Nein!«
In einem Anfall aus Schmerz und Angst bäumte sich die Stute ein weiteres Mal auf, Blut und Schaum spritzten aus ihrem Maul, dann kippte sie auf die Seite. Heu stob auf, noch mehr Blut spritzte aus der Wunde am Kopf.
»Sheela!« Kathy war außer sich. Sie riss sich von McPhearson los und rannte zu ihrem Pferd.
Sheela rührte sich nicht mehr.
Kathy fiel auf die Knie, warf sich der Stute an den Hals, ohne sich daran zu stören, dass nun auch ihr eigenes Gesicht blutverschmiert war. Sie begann, hemmungslos zu weinen.
Der Tierarzt trat neben sie und ging ebenfalls in die Hocke. Bedachtsam legte er eine Hand auf den Hals des Tieres und schloss die Augen. Kaum merklich schüttelte er den Kopf.
Sheela war tot.
Mit langsamen Schritten ging Betty auf die andere Frau zu und zog sie behutsam hoch. Wie ein nasser Sack hing Kathy schluchzend in ihren Armen, die sie kaum halten konnten.
McPhearson erkannte ihre Notlage und stand auf. Er stützte Kathy und führte sie aus dem Stall heraus in das Sonnenlicht. »Betty«, sagte er. »Nimm Blutproben und Abstriche. Dann bring die Proben sofort ins Labor. Ich kümmere mich um Kathy.«
***
Deutschland, Berlin, Hotel Adlon
Konstantin ließ sich erschöpft in einen der eleganten Sessel in seiner Suite im Berliner Hotel Adlon fallen und grinste seine Frau an. Seine Hand fuhr zuerst langsam über den weichen Stoff der Armlehne, dann einmal durch seine Haare, als wollte er die Haptik vergleichen.
Charlotte Brauker stand am Fenster. Sie hatte die Gardinen zur Seite geschoben und genoss die Aussicht auf das Brandenburger Tor. Obwohl sie und ihr Mann nicht zum ersten Mal in einem gehobenen Luxushotel nächtigten, war ein Aufenthalt im Adlon immer noch etwas Besonderes. Es waren nicht nur der Prunk und das edle Ambiente, es war gelebte Geschichte. Aber heute war es ein ganz besonderes Gefühl, das sie gleichzeitig in Hochstimmung versetzte und ihr Angst machte. Die Hochstimmung kam daher, dass am heutigen Tag Konstantin – und damit auch sie selbst – einen weiteren Schritt auf der Leiter nach oben geklettert war. Unwohlsein beschlich sie, da ihr immer klarer wurde, dass der Schritt nach oben einfacher war, als oben zu bleiben. In diesem Moment sehnte sie sich nach etwas anderem, ohne genau benennen zu können, was dieses andere sein könnte.
Mit einem Schwung, der diese Gedanken vertreiben sollte, drehte sie sich ihrem Mann zu. »Du warst großartig. Dein Entwurf ist großartig. Das ganze Projekt ist großartig. Wer kommt schon auf eine solch geniale Idee und hat dann auch noch den Mut und die Beziehungen, die Umsetzung möglich zu machen?«
Konstantin lachte auf und ließ dabei zwei Reihen perfekt gebleichter weißer Zähne sehen. »Zeig mir die Urkunde noch einmal. Ich kann es noch immer nicht richtig glauben. Danach will ich Champagner und dich.«
Charlotte, noch in ihrem elfenbeinfarbenen Abendkleid mit dem tiefen Ausschnitt, schwebte zu dem kleinen Beistelltisch und nahm den vergoldeten Rahmen in beide Hände. Sie schwebte weiter zu ihrem Mann und setzte sich seitlich auf seinen Schoß. »Dann hören Sie mir jetzt genau zu, Herr Stararchitekt«, hauchte sie ihm mit lasziver Stimme ins Ohr. Mit einer kurzen Bewegung warf sie ihre langen Haare nach hinten. Konstantin konnte nicht anders, als in ihr Dekolleté zu starren. Die Antwort im Lendenbereich folgte augenblicklich.
Charlotte straffte sich. »›Herrn Diplom-Ingenieur Konstantin Brauker‹«, intonierte sie, »›als Anerkennung für das hervorragende und visionäre Design des Projektes Ocean Corner Resort‹.«
Sie hielt kurz inne und küsste ihren Mann lustvoll auf den Mund. »Eine Auszeichnung in purem Gold für dich, mein Schatz.«
Konstantin griff nach dem Rahmen und betrachtete die darin liegende Urkunde. Das obere Drittel des Blattes zierte ein Schild mit einem silberschwarzen Zirkel, dessen nach unten gerichtete Arme ein goldenes Winkelmaß kreuzten – das Wappen der Architekten von Berlin, die die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hatten. »Ocean Corner Resort«, sinnierte er.
»›Zukunftsweisend, nachhaltig, ein Bindeglied zwischen der Kraft der Natur und des Menschen‹.« Charlotte nestelte an Konstantins Krawatte und dem obersten Hemdknopf. »Und bevor wir morgen diese noblen Hallen wieder verlassen müssen, um das Ocean Corner Resort ein Stückchen näher an das Licht der Realität zu bringen, will ich deinen Stechzirkel spüren. Hier und jetzt. Sofort, tief, hart, innovativ und nachhaltig.«
EINS
Am Montag, eine gute Woche nach dem Event im Hotel Adlon in Berlin, arbeitete Konstantin wieder in seinem Atelier. Der riesige Schreibtisch war übersät mit Papieren, Zeichnungen, Berechnungen und Notizen. Auf einem Bleistift kauend starrte er auf sein eigenes Spiegelbild in der nahezu bodentiefen Fensterscheibe. Wie so oft in der letzten Zeit war es spät geworden. Draußen war die Maisonne längst untergegangen und hatte ihren Platz der Dunkelheit überlassen. So konnte er die vielen Segel- und Motorboote in der Marina im neuen Hafen nicht mehr sehen.
Vor knapp einem Jahr hatte Konstantin sein Architekturbüro von Cuxhaven nach Bremerhaven verlegt, in den zweiten Stock eines der neuen Gebäude direkt zwischen der Weser und dem Neuen Hafen. Die maritime Atmosphäre inspirierte ihn, die Räumlichkeiten boten allen Platz und Komfort, der ihm zuvor gefehlt hatte. Für ihn fühlte es sich an, als wäre mit dem Umzug die Kreativität explodiert. Er plante sogar, sich in Kürze Verstärkung zu holen und am neuen Standort ein Team mit allen wichtigen Kompetenzen aufzubauen. Wahrscheinlich einen Ingenieur und noch einen weiteren ausgebildeten Architekten. Der Umstand, dass seine Reputation rasant stieg, führte auch dazu, dass die Aufträge kamen. Der Erfolg klopfte an die Tür und brachte Arbeit mit.
Konstantin war allein, seine Assistentin war schon längst im Feierabend, und Michaela, die Nachwuchsarchitektin, die er bereits vor einigen Wochen eingestellt hatte, hatte ein paar Tage Urlaub genommen. Er würde sich auch in ein paar Minuten ins Auto setzen und endlich nach Hause fahren.
»Aber jetzt solltest du endlich das letzte Problem dieses Tages lösen«, sagte er zu sich selbst. Es ging um ein paar extravagante Sonderwünsche, die ein Kunde zu der Fensterfront seines neuen Bürogebäudes hatte. Schwierig, aber nicht unlösbar.
Er trat dichter an die Scheibe heran, um doch ein wenig von dem sehen zu können, was da draußen war. Seine Gedanken drehten sich um gewölbtes Glas, Stahlkonstruktionen, Gewichte, Winkel, Abschattung und Zeitschienen.
Plötzlich schnippte er mit den Fingern und stürmte an den Schreibtisch zurück. »So machen wir das. Das kann gehen.«
Eilig schob er einen Stapel Papiere zur Seite und hämmerte mit flinken Fingern auf die Tastatur des Computers. Die beiden riesigen Monitore erwachten zum Leben und füllten sich mit Tabellen und Zeichnungen.
»Das ist perfekt.« Konstantin klatschte begeistert in die Hände. Doch bevor sein Eigenlob weitere Höhen erklimmen konnte, summte das Telefon. Irritiert blickte er von den Bildschirmen auf und sah sich um. Telefon? Um diese Uhrzeit? Wo stand das olle Ding nur? Er schob weitere Papierberge hin und her, und schließlich fand er das Gerät auf einem Hocker neben dem Schreibtisch. »Ja?«
Ein Rauschen ertönte. Es war die auf das Telefon weitergeschaltete Sprechanlage der Tür des Gebäudes. »Konstantin Brauker? Sind Sie das?« Die Stimme klang stark verzerrt.
»Wer sonst«, antwortete Konstantin. »Aber wer sind Sie, und was wollen Sie um diese Uhrzeit?«
Abermals rauschte und knackte es, sodass Konstantin von der Antwort nur den letzten Teil verstand. Er sollte sich dringend bei der Hausverwaltung über die schlechte Sprachqualität der Anlage beschweren.
»– Expressservice. Eine eilige Dokumentenlieferung für Sie. Was für ein Glück, dass Sie noch da sind.«
»Wieso jetzt noch? Was für Dokumente?«, fragte Konstantin irritiert.
»Das weiß ich nicht. Ich bin nur der Bote. Öffnen Sie bitte. Ich benötige Ihre Unterschrift.«
»Jaja.« Konstantin drückte den Türöffner. »Zweiter Stock.« Er legte den Hörer wieder auf, verließ sein Büro und wandte sich der Eingangstür zu. Kaum hatte er sie geöffnet, hörte er auch schon die schweren Schritte im Treppenhaus.
»Mensch, machen Sie doch das Licht an –« Weiter kam Konstantin nicht. Eine harte Faust krachte mit voller Wucht in seinen Magen. Der ebenso überraschende wie harte Schlag presste alle Luft aus seinen Lungen. Konstantin krümmte sich zusammen wie ein Klappmesser und taumelte nach hinten. Mit einer Hand konnte er sich gerade noch am Rezeptionstresen festhalten.
»Hier kommt eine Lieferung für dich.« Der vermeintliche Bote war eingetreten und hatte mit einer geschickten Fußbewegung die Tür hinter sich ins Schloss geworfen. Er griff mit der rechten Hand in die Innentasche seiner Jacke und zog einen länglichen Gegenstand hervor. Eine Spritze mit aufgesetzter Kanüle.
Ein Adrenalinschub durchfuhr Konstantins Körper und verdrängte den Schmerz. Unter Aufbietung aller Kraft richtete er sich auf und starrte den Eindringling trotzig an. Der wirkte überrascht, aber nicht besorgt.
»Ich erwarte keine Lieferung.« Konstantin versuchte, das Zittern in seiner Stimme zu unterdrücken. »Hauen Sie ab, bevor es böse endet.«
Der andere lachte auf. »Es soll sogar böse enden. Für dich.« Damit schlug er erneut zu.
Das Adrenalin hatte Konstantin im Griff. Behände tänzelte er einen Schritt zur Seite, sodass der Schlag ins Leere ging. Verdutzt starrte der Fremde erst seine Faust, dann Konstantin an, der seinerseits nun mit einem Schwinger von rechts zum Angriff überging.
Der andere erwischte seinen heranfliegenden Arm mit einer Hand, riss ihn mit einem plötzlichen Ruck zu sich hin und rammte Konstantin ein Knie in die Seite. »So wird das nichts, du Kirmesboxer.«
Konstantin schrie auf. Er fiel zur Seite, dem Tresen entgegen. Mit einer Hand fing er sich ab, mit der anderen griff er nach der gläsernen Wasserflasche, die dort stand, drehte sich einmal blitzschnell um die eigene Achse und hämmerte sie seinem Widersacher, unterstützt durch einen animalischen Schrei, an den Kopf.
Der andere ließ die Spritze fallen, die er trotz seiner Schläge noch immer in der Hand gehalten hatte, sackte geräuschlos zu Boden und bewegte sich nicht mehr.
Die Flasche hatte den Schlag erstaunlicherweise unbeschadet überstanden, und Konstantin stellte sie zurück an ihren Platz auf dem Tresen.
Der Adrenalinspiegel sank schlagartig, und Konstantin ging schwer atmend neben dem anderen auf die Knie. Ihm wurde schwindelig.
Der Mann neben ihm starrte ihn vorwurfsvoll aus leeren Augen an, ein dünnes Rinnsal Blut lief aus seinem Ohr.
Konstantin rappelte sich auf. »Verfluchte Scheiße«, jammerte er. »Verfluchte Scheiße.«
Er torkelte zum Telefon, griff nach dem Hörer und wählte eine Nummer. »Du musst kommen. Sofort«, schrie er, kaum dass das Gespräch angenommen wurde.
Dreißig Minuten später beugte sich Charlotte Brauker vor und betrachtete den vor ihr liegenden Mann mit einer Mischung aus Ekel und Interesse. Das Blut an dessen Ohr war mittlerweile eingetrocknet.
Konstantins panischer Anruf hatte sie dazu gebracht, alles stehen und liegen zu lassen. Noch in Hausschuhen hatte sie nach einer Jacke gegriffen und sich mit dem Auto auf den Weg nach Bremerhaven gemacht.
»Wer ist das?«, fragte sie.
Konstantin saß auf einem Stuhl. Mit seinen beiden Zeigefingern massierte er seine Schläfen. »Keine Ahnung. Er hat sich als Expressbote ausgegeben, und ich bin trotz der Uhrzeit darauf reingefallen. Wahrscheinlich haben die Lutschinskis ihn geschickt. Der wollte mir irgendetwas spritzen. Bestimmt irgendein Gift.«
Bei diesen Worten deutete er auf die Spritze, die noch auf dem Boden unter dem Tresen lag. Charlotte hob sie auf. Zuerst betrachtete sie die Spritze aus zusammengekniffenen Augen, dann funkelte sie ihren Mann böse an. »Du hast mir hoch und heilig versprochen, in dieser Sache alles unter Kontrolle zu haben.«
»Verdammt, Charlotte.« Konstantin sprang auf und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Schon vor Wochen habe ich mit Wladimir Lutschinski gesprochen. Ich habe ihm unmissverständlich erklärt, dass ich nicht mehr mitmache. Es war okay für ihn.«
Charlotte lachte kurz auf. »Es war okay für ihn. Klar wäre es okay für ihn – aber erst, nachdem er dich zum Schweigen gebracht hat. Ich habe es geahnt, dass du tiefer drinsteckst, als du es wahrhaben wolltest. Du wärst nie –«
»Wäre, wäre, Fahrradkette, wie bereits Lothar Matthäus sagte«, ätzte Konstantin. »Wir haben jetzt und hier ein Problem, das wir lösen müssen. Und zwar ohne Polizei. Zeit zum Klugschwätzen können wir uns später noch nehmen.«
»Schon klar.« Sie warf einmal kurz die Arme in die Luft. »Lass mich nachdenken.«
Die Lichter in der kleinen Gaststätte »Tastyria« oben auf dem Altenbrucher Deich waren längst ausgeschaltet. Der Parkplatz war leer. Vor dem Deich, an der Marina, standen nur wenige Laternen, deren Licht die Dunkelheit nicht vertreiben konnte. Die umliegenden Wiesen lagen in Finsternis, hier und dort war das gedämpfte Blöken eines Schafes zu hören. Linker Hand war in der Ferne das beleuchtete Siemens-Werk zu erkennen. Draußen auf der Elbe blinkten die roten und grünen Lichter der Fahrwassertonnen.
»Lass jetzt niemanden mehr hier sein«, murmelte Konstantin vor sich hin, als er mit dem Wagen die schmale Straße am Schöpfwerk vorbei auf die Dicke Berta zufuhr.
Der dreizehn Meter hohe und schwarz-weiß gestreifte Leuchtturm von Altenbruch lag ebenfalls im Dunkeln. Sein Leuchtfeuer, das in vergangenen Zeiten den Schiffen auf der Elbe den Weg gewiesen hatte, war schon vor vielen Jahren verloschen.
Konstantin hielt vor dem Tor an der Deichkrone und stieg aus dem Wagen. Er stellte erfreut fest, dass kein Schloss am Tor vorhanden war. Der Bolzenschneider, den er aus irgendeinem Grund immer im Kofferraum hatte, konnte also dort bleiben. Er gab dem Tor einen Stoß, und mit einem leisen Quietschen schwang es auf.
Langsam und mit ausgeschalteten Scheinwerfern fuhr er den Wagen so dicht wie möglich an die Bootsanleger der Marina heran.
In der kleinen Hafenanlage herrschte gespenstische Stille. Dicht an dicht wogten die an den Stegen vertäuten Boote in der seichten Bewegung des Wassers. Keines der Wasserfahrzeuge war beleuchtet, nirgendwo war eine Stimme zu hören.
Gut, dachte er, manchmal hat man auch Glück.
Ganz vorne am Anleger, kurz vor den Sieltoren, gab es sogar einige Meter freien Platz am Steg. Normalerweise lag hier eines der Boote der Berufsfischer, aber heute Nacht war es nicht im Hafen. Perfekt.
Jetzt musste er warten, bis Charlotte eintraf. Ein schneller Blick auf die Uhr bestätigte ihm, dass es nicht mehr lange dauern sollte. Sie war eine sichere Skipperin, um Längen besser im Umgang mit ihrem zehn Meter langen Motorboot als er selbst, und würde keine Probleme haben, es auch in der Dunkelheit hier in der engen Marina zu manövrieren.
Abermals blickte Konstantin auf die Uhr.
Plötzlich durchdrang ein leises, tiefes Brummen die Stille. Es kam von der Wasserseite.
Konstantin hob den Kopf und hielt Ausschau nach einem Schatten, den kleinen weißen Schaumkronen der Bugwelle, irgendetwas. Da – er entdeckte die beiden Positionslichter, jede weitere Beleuchtung hatte Charlotte ausgeschaltet.
Sekunden später glitt die »Charkon« nahezu geräuschlos an den Anleger, nur einmal ertönte kurz das Rasseln des Bugstrahlruders, als Charlotte den Bug des Bootes an den Anleger drückte.
Konstantin griff nach der Reling und hielt das Boot fest. Geschickt kletterte Charlotte auf den Steg und vertäute Bug und Heck an den Pollern des Anlegers.
»Schnell jetzt. Auf die Badeplattform mit dem Paket. Ich will wieder los, raus aus diesem engen Hafen«, flüsterte sie. »Und ich brauche deinen Bolzenschneider und einen dicken Stein.«
»Wozu?«
»Hör auf zu fragen und mach hin«, herrschte Charlotte ihn an. »Deine Brieftasche brauche ich auch. Hast du noch deinen Kamm im Handschuhfach liegen?«
»Ja.« Konstantin hatte keine Ahnung, was Charlotte vorhatte, wagte aber nicht, zu fragen.
»Den brauche ich auch. Ich werde ihn im Wasser auswaschen und dann deinen Freund hier«, sie deutete auf die verpackte Leiche, »einmal damit kämmen. Ein paar von seinen Haaren können wir unter Umständen später noch gut gebrauchen.«
»Woran du alles denkst«, sagte Konstantin leise.
Nach wenigen Minuten war es geschafft. Das Paket lag hinten auf der extragroßen Badeplattform des Bootes, Konstantin hatte es schnell mit einigen Tampen gesichert.
Mit leisem Brummen sprangen die Motoren wieder an. Konstantin, der auf dem Steg zurückblieb, löste die Leinen, und schon schob sich das Gefährt langsam vom Steg weg. So leise, wie es gekommen war, steuerte das Boot mit langsamer Fahrt in Richtung der Elbe.
Konstantin atmete schwer aus. Ihm wurde ein wenig schwindelig. Auf welchen Wahnsinn hatte er sich da nur eingelassen? Erst die Sache mit den Lutschinskis – das war schon dumm genug gewesen – und jetzt diese Geschichte.
Er kehrte zum Auto zurück. Die Nacht war noch nicht vorbei. Charlotte würde ihren Teil des Plans erfüllen, aber er hatte auch noch einiges zu erledigen. Der Motor startete, Konstantin lenkte den Wagen zurück über die Döschers Trift und bog am Ende des Weges nach rechts auf die Alte Marsch. Der Weg führte ihn an Feldern, alten Baumbeständen, Höfen und einigen neuen Häusern vorbei. Alles lag in dunkler Stille. An der Kreuzung auf die B 73 bog er abermals rechts ab und verließ den Kreisverkehr in Richtung Hafen. Trotz der Uhrzeit herrschte hier mehr Betrieb, die Industrieanlagen waren beleuchtet, denn hier wurde auch während der Nacht gearbeitet.
Über die Neufelder Straße erreichte Konstantin die Baudirektor-Hahn-Straße. Rechter Hand, auf dem Gelände von Cuxports, standen eingezäunt und in endlosen Reihen die Autos, die auf ihre Verschiffung nach Großbritannien warteten, links erhoben sich schemenhaft die Masten der im neuen Fischereihafen liegenden Fischtrawler, die demnächst zu Fangfahrten in den Nordatlantik aufbrechen würden.
Konstantin passierte die Mützelfeldtwerft und stoppte den Wagen schließlich am Lübbertkai. Das Impfzentrum in den Hapag-Hallen hatte für heute seine Pforten geschlossen, dennoch herrschte überall geschäftiges Treiben. In der Seeschleuse lag ein Krabbenkutter aus Greetsiel, der auf die Elbe hinauswollte. Noch waren beide Schleusentore geschlossen, aber sowohl auf dem Kutter als auch an Land wuselten emsig Menschen herum, die die Festmacher prüften, Fender ausbrachten oder einfach nur eine Zigarette rauchten.
Nein, dachte Konstantin enttäuscht, diese Ecke hier ist für mein Vorhaben völlig ungeeignet. Er musste sich eine andere Stelle suchen. Plötzlich schnippte er mit dem geistigen Finger. Er wusste, wohin er musste.
Nach dem Überqueren der hinteren Schleusenüberfahrt passierte er die Niederlassung des LAVES, fuhr an den alten Fischhallen in der Präsident-Herwig-Straße vorbei, bog dann zweimal rechts ab. Über die Kapitän-Alexander-Straße erreichte er die Durchfahrt der Hochwasserschutzwand, die auf die Hafenkaje führte.
Wie erhofft war hier alles menschenleer. Im vorderen Teil versperrten hohe Metallzäune den Zugang zu den Schiffsanlegern, weiter hinten waren drei Taucher-O.-Wulf-Schlepper festgemacht. Erleichtert stellte Konstantin fest, dass auch dort alles in Dunkelheit lag. Die schmale Straße knickte nach rechts ab, und dann war er dort, wo er hinwollte. Konstantin hielt an und blickte sich um.
»Perfekt«, flüsterte er.
Vor ihm lag ein nach drei Seiten offenes Betonplateau, an jeder Seite acht oder zehn Meter lang. An der Kopfseite erhoben sich zwei Dauben aus dem Wasser, links wartete ein gewaltiger Poller auf Tauwerk.
Zu seiner Rechten befanden sich jenseits des Hafenbeckens das Steubenhöft und die Hapag-Hallen, der Krabbenkutter war zwischenzeitlich aus der Seeschleuse herausgefahren und passierte gerade die Hafeneinfahrt.
Schräg vor Konstantin lagen in einer Entfernung von bestimmt einhundert Metern das Feuerschiff Elbe 1 und die Alte Liebe, die Sicht zu den übrigen Schiffsanlegern im dortigen Bereich des Hafens war durch die Schlepper versperrt.
»Perfekt«, wiederholte er.
Er öffnete die Beifahrertür seines Autos und holte ein paar Dinge aus dem Handschuhfach, die er anschließend in seinen Jackentaschen verstaute. Konstantin schluckte. Nun kam der heikle Part. Wenn er Pech hatte, würde das ganze völlig verrückte Vorhaben schon hier scheitern.
Er überprüfte die Handbremse des Wagens. Gelöst. Er stellte den Automatikhebel auf N und ließ alle vier Seitenfenster herunter. Dann trat er hinter den Wagen und stemmte sich gegen die Kofferraumhaube. Er schob mit aller Kraft, die er aufbringen konnte.
Zunächst geschah nichts, dann setzte sich der Wagen langsam in Bewegung. Bis zur Kante waren es gute vier Meter.
Der Wagen rollte schneller, Konstantins Muskeln begannen bereits zu schmerzen. Er ging zwar regelmäßig joggen und hielt sich durchaus für fit, aber derartige körperliche Betätigung war er nicht mehr gewohnt.
Eine Glasscherbe knirschte unter einem Reifen.
Der Wagen rollte schneller.
Noch zwei Meter.
Noch schneller.
Ein Meter.
Konstantin stieß einen stummen Schrei aus, um mehr Adrenalin und weitere Kräfte zu mobilisieren.
Ein halber Meter.
Dann rumpelte und knallte es, die Vorderreifen waren über die Kante gerollt, der Unterboden des Wagens knallte auf den Beton. Aber der Schwung war groß, der Wagen rutschte weiter, Stück um Stück. Konstantin presste, drückte und schob wie ein Wahnsinniger. Schweiß stand auf seiner Stirn, seine Knie zitterten, Arme und Beine schmerzten. Nur noch ein paar Zentimeter.
Plötzlich geschah es.
Die vordere Hälfte des Wagens sackte langsam nach unten, die Hinterräder lösten sich vom Untergrund. Konstantin drückte noch einmal. Dann rutschten seine Hände vom Metall des Wagens ab, er stürzte, schlug auf Knien und Händen auf. Es knirschte wieder, Metall kratzte auf Beton, das Hinterteil des Wagens wippte in der Luft.
Einen Moment fürchtete Konstantin, es würde nicht reichen, das Hinterteil des Wagens würde in die Waagerechte zurückkippen und einfach so stehen bleiben. Er sprang auf, stemmte sich von unten gegen die Stoßstange. Abermals ein hässliches Knirschen – und der Wagen kam ins Rutschen.
Endlich. Mit einem Klatschen schlug der Kühlergrill auf die dunkle Wasseroberfläche auf. Fast senkrecht tauchte der Wagen dann ein. Augenblicklich strömte Wasser durch die geöffneten Fenster ins Innere, es blubberte, schmatzte und spritzte.
Dann war er weg.
Viel schneller, als Konstantin gedacht hatte, beruhigte sich die Wasseroberfläche wieder. Es sah aus, als wäre nichts geschehen. Konstantin krabbelte auf allen vieren an die Kante und starrte nach unten.
Dunkelheit.
Er kippte auf die Seite und blieb einfach liegen.
Gute zwei Stunden waren vergangen. Konstantin hatte sich nach einer Weile wieder aufgerappelt, sich den Schmutz von der Kleidung geschlagen und die Hafenanlage zu Fuß verlassen. Dicke Wolken verdeckten mittlerweile den Mond, nur die Straßenlaternen auf der Fährstraße beleuchteten die nächtliche Szenerie. Die Klappbrücke war geschlossen, aber um diese Zeit waren weder Autos noch Fußgänger unterwegs. Konstantin war allein.
Auf der Kapitän-Alexander-Straße setzte er sich auf die Treppenstufen des Käptn’s Store. Wie er so dasaß und das Stress- und Adrenalinniveau langsam abnahm, kam die Angst, spürte er den Schmerz überall in seinem Körper. Dieser Abend, diese Nacht war zu viel für ihn, der doch eigentlich nur Architekt sein wollte. Das Schlimmste: Es war noch längst nicht vorbei.
Bevor er sich weiter seinen Zweifeln widmen konnte, erregte ein Motorengeräusch seine Aufmerksamkeit. Ein Wagen näherte sich. Konstantin vernahm das typische Holpern, als der Wagen über die Schwellen der Klappbrücke fuhr. Dann sah er das Auto seiner Frau.
Sie lenkte das Fahrzeug auf den Parkplatz vor dem Käptn’s Store, den sie zuvor als Treffpunkt abgesprochen hatten.
»Alles gut gelaufen?«, fragte sie ihn, nachdem sie ausgestiegen war.
Konstantin verzog das Gesicht. »Definiere ›gut gelaufen‹.«
Sie trat auf ihn zu und nahm ihn fest in die Arme. Fast hätten seine Beine nachgegeben.
»Was machen wir hier nur?«
»Wir nehmen die Dinge in die Hand.«
»Ist das richtig?«
»Für diese Diskussion ist es zu spät«, antwortete sie ein wenig schroffer als beabsichtigt. »Was ist mit dem Wagen?«
»Ist weg.« Auch Konstantin klang nun sehr kurz angebunden. »Der Typ?«
»Auch weg.«
»Wie?«
»Das willst du nicht wissen«, sagte Charlotte.
»Doch.«
»Nein«, beschied sie ihm in einem Tonfall, der keine weitere Diskussion zuließ. »Steig ein, wir müssen weiter.«
Der Anweisung folgend setzte sich Konstantin auf den Beifahrersitz. »Hat dich in der Marina jemand gesehen? Irgendetwas Auffälliges, das Schwierigkeiten machen könnte?«
Charlotte schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht. Den Blutfleck auf der Badeplattform habe ich, so gut es in der Dunkelheit ging, abgewaschen.«
»Blutfleck?«
»Auch das willst du nicht wissen.«
Sie fuhren schweigend.
Anders als Konstantin zuvor auf seinem Weg nach Cuxhaven blieb Charlotte auf der B 73. Bald passierten sie Altenbruch und näherten sich Otterndorf. Nach weiteren zehn Minuten erreichten sie ihr Ziel.
»›Campingplatz See Achtern Diek‹«, las Konstantin das Schild an der Einfahrt vor.
Sie stoppte den Wagen auf dem Parkplatz vor dem kleinen Supermarkt. »Das letzte Stück gehen wir zu Fuß.«
Konstantin nickte. »Und du bist dir sicher, dass die Ferienwohnung leer ist?«
»Ja«, antwortete sie sofort. »Tatsächlich habe ich gestern noch mit Anne telefoniert. Sie hatten im letzten Jahr so viele Probleme mit Gästen, dass sie beschlossen haben, die Hütte erst einmal nicht mehr zu vermieten.«
»Aha«, sagte Konstantin, den diese Details nicht interessierten.
»Abgereist, ohne zu putzen. Geschirr kaputt oder geklaut. Immer wieder Beschwerden über dies und das. Ich frage mich wirklich, was mit den Leuten heutzutage los ist.«
»Es gibt Leute, die machen bekloppte Sachen, ohne an die Konsequenzen zu denken«, sagte Konstantin.
Charlotte warf ihm einen Blick zu. »Was du nicht sagst.«
Sie bogen von der Deichstraße in einen schmalen Seitenweg ein. Auch hier war alles ruhig, die Ferienhäuser lagen im Dunkeln. Das einzige Geräusch kam von dem Kies, der unter ihren Schuhsohlen knirschte.
Vor einigen Hütten parkten Autos mit auswärtigen Kennzeichen, auf dem akkurat getrimmten Rasen standen Fahrräder, Kinderspielzeug lag herum.
»Was ist mit Anne, taucht die plötzlich hier auf?«, wollte Konstantin wissen.
Wieder schüttelte Charlotte den Kopf. »Nein, sie hat ununterbrochen über ihren vollen Terminkalender gejammert. Ihr Mann ist zu einer Tagung in München. Der wird auch nicht unerwartet hier aufkreuzen.«
»Gut.«
»Wir sind da.«
Sie standen vor einem dunkelroten Holzhäuschen. Der Parkplatz vor der Haustür war leer, die Vorhänge an den Fenstern zugezogen. Das Haus war eindeutig unbewohnt.
»Hast du einen Schlüssel?«, fragte Konstantin.
Charlotte lachte kurz auf.
»Hätte ja sein können.« Konstantin ließ die Schultern hängen. »Aber ich schätze, auf einen Einbruch kommt es jetzt auch nicht mehr an.«
Sie gingen auf die Hinterseite der Hütte zu. Dort gab es einen kleinen Garten mit Terrasse, einen Grill, in dem noch Reste von Holzkohle lagen.
»Die Terrassentür sollte ich wohl besser nicht eintreten«, stellte er sarkastisch fest.
»Nein. Aber an der Seite müsste es Fenster geben.« Charlotte bückte sich und hob einen kleinen Findling auf. »Damit sollte es gehen.«
Konstantin wog den Stein in der Hand.
»Halte deine Jacke vor die Scheibe und schlag mit dem Stein zu«, sagte sie.
»Du kennst dich aus.«
»Jetzt mach schon«, drängte sie.
Genau wie Charlotte vermutet hatte, gab es an der Seite zwei Fenster, wahrscheinlich lagen die Schlafzimmer dahinter. Die Sicht zur Nachbarhütte wurde durch ein dichtes Gebüsch versperrt – sehen würde also niemand etwas, hören wahrscheinlich auch nicht.
Mit einer Hand hielt Konstantin seine Jacke vor die Scheibe, dann schlug er mit dem Stein zu. Es klirrte, Scherben fielen innen zu Boden, aber es war kaum zu hören.
»Gut gemacht«, sagte Charlotte.
Konstantin griff durch das Loch in der Scheibe und drehte den Hebel. Sofort schwang das Fenster nach innen auf. Vorsichtig kletterte er in die Hütte. Dann langte er wieder hinaus, griff seine Frau an den Schultern und zog sie zu sich. Sie küssten sich lange und intensiv. »Ich liebe dich.«
»Ich dich auch«, antwortete sie atemlos. »Versteck dich hier, bleib nur in der Hütte, geh auf keinen Fall raus. Ich kümmere mich um den Rest, besorge dir etwas zu essen und ein Prepaidhandy. Du darfst auf keinen Fall deins benutzen.«
Er nickte. »Mein Handy habe ich im Wagen gelassen, die SIM-Karte vorher rausgenommen und durchgebrochen.«
ZWEI
Die »Neuwerk« näherte sich der letzten Arbeitsposition, danach wäre der Einsatz beendet, und das Schiff würde an seinen Liegeplatz am Anleger des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Cuxhaven zurückkehren. Nach dem Auslaufen am Montag war das Mehrzweckschiff seit etwas mehr als zweiundsiebzig Stunden auf See, hatte diverse Fahrwassertonnen inspiziert und Reparaturen durchgeführt.
In der vergangenen Nacht hatte der Wind aufgefrischt und das Wasser der Außenelbe aufgewühlt, aber auf dem Schiff war davon kaum etwas zu spüren gewesen. Nun stand die Sonne wieder am Himmel. Vom Wind war nur eine angenehme Brise aus Südwest übrig geblieben, die über das Wasser strich und ein paar kleine Wellen entstehen ließ.
Rudi Harms, seines Zeichens Steuermann des neunundsiebzig Meter langen Schiffes, freute sich darauf, in wenigen Stunden festen Boden unter den Füßen zu haben und die Nacht in seinem eigenen Bett und vor allem neben seiner Frau verbringen zu können. Im Moment stand er auf der Brücke und suchte mit dem Fernglas die rote Fahrwassertonne Nummer 32, etwas mehr als einen Kilometer nordwestlich der Kugelbake im Elbfahrwasser. Fünfzehn Meter über der Wasseroberfläche hatte er einen phantastischen Ausblick, nicht nur über das Schiff, sondern über die Elbe hinweg bis nach Cuxhaven auf der einen und der Küste von Schleswig-Holstein auf der anderen Seite. Er sah die wie auf eine Schnur aufgereihten Schiffe, die entweder Hamburg entgegenstrebten oder sich auf die offene Nordsee zubewegten. Und natürlich benötigte er nur Sekunden, um das gesuchte Seezeichen auszumachen. Da Harms im Moment der Ranghöchste auf der Brücke war, gab er ein paar schnelle Anweisungen, die eigentlich gar nicht notwendig waren, denn das Team war eingespielt, jeder wusste genau, was er wann zu tun hatte. Die »Neuwerk« bewegte sich mit langsamer Fahrt auf ihr Ziel zu.
Das Schiff gehörte dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Die drei Schwesterschiffe »Arkona«, »Mellum« und »Scharhörn« waren in anderen Häfen an Nord- und Ostsee stationiert. Neben den Möglichkeiten, als Eisbrecher, Notschlepper und Schadstoffbekämpfer zu agieren, war die »Neuwerk« auch als Tonnenleger konzipiert und mit einem Kran ausgestattet, der Gewichte bis zu zweiundzwanzig Tonnen heben konnte.
»Kran vorbereiten«, rief Harms. Sofort wurde der Befehl über die Sprechanlage weitergegeben.
Der riesige Ausleger des Krans erhob sich nun im rückwärtigen Teil des Schiffes aus seinen Halterungen und richtete sich langsam auf. Auf dem Arbeitsdeck, das nur knapp über der Wasseroberfläche lag, hatte sich bereits ein Arbeitsteam versammelt.
»Wir liegen auf Position«, ertönte eine Stimme auf der Brücke.
Harm drehte sich zum Sprecher um. »Danke, Andreas. Position halten.« Er verließ den vorderen Fahrstand und ging in den hinteren Bereich der Brücke, um die Arbeiten an der Tonne durch die dortigen Fenster zu verfolgen. Tief unter ihm, im Bauch des Schiffes, dröhnten die schweren Maschinen, die den Antrieb mit Drehmoment versorgten, um die »Neuwerk« gegen die starke Strömung der Außenelbe auf Position zu halten.
Der Kran hatte die erforderliche Auslage erreicht, und der massive Haken senkte sich an dicken Stahlseilen langsam hinab. Auf der Steuerbordseite, genau auf Höhe des Arbeitsdecks, schwamm die Tonne 32.
Die Männer arbeiteten konzentriert und effizient, alle Handgriffe saßen. Nach wenigen Minuten fuhren die Winden des Krans wieder an, und die Seile strafften sich mit Knarzen und Ächzen. Augenblicke später hob sich die Tonne langsam aus dem Wasser.
»Langsam jetzt«, ertönte eine Stimme aus einem Lautsprecher. »Wir haben alle Zeit der Welt, keine Hektik, keinen Stress, keine Pannen.«
Niemand schenkte der Durchsage Beachtung. Alle Männer an Deck fuhren seelenruhig mit ihrer Arbeit fort, so wie sie es schon unzählige Male zuvor gemacht hatten.
Mittlerweile hatte sich die Tonne vollständig aus der Elbe gehoben. Wasser strömte am Gestänge und an der Kette zum Ankergewicht hinab und ergoss sich zurück in den Fluss. Die Motoren des Krans wechselten von einem langsamen, tiefen Surren in eine höhere, angestrengte Tonlage. Langsam begann der Ausleger, sich zu drehen, um das Seezeichen zunächst über das Arbeitsdeck zu schwenken und dann Zentimeter für Zentimeter darauf abzusenken.
Einer der Männer schrie plötzlich auf. »Ach du Scheiße!«
»Was ist los?«
Der erste Mann zeigte mit dem ausgestreckten Arm auf die noch immer einige Meter über ihnen schwankende Fahrwassertonne. »Da hängt einer dran.«
Jetzt entdeckten es auch andere Mitglieder der Arbeitscrew auf dem Deck. Auch Harms auf der Brücke sah es. Wie elektrisiert starrte er auf das mannsgroße, schleimige Etwas. Ihm schwante Böses. »Winden anhalten. Ich komm runter«, bellte er in ein Mikrofon.
Die Männer auf dem Arbeitsdeck fuhren erschrocken zusammen, als die harsche Ansage aus den Decklautsprechern ertönte.
Harms spurtete die steilen Treppen hinab, nahm immer zwei Stufen auf einmal. Augenblicke später stand er auf dem Arbeitsdeck. »Jetzt die Winden langsam wieder anfahren«, gab er Anweisungen. »Du und du«, er zeigte auf zwei der Arbeiter, »ihr zieht den – na, ihr wisst schon, also den Körper unter der Tonne weg, wenn sie langsam runterkommt. Da soll nichts zerquetscht werden.«
Einer der beiden rannte zur Reling und übergab sich. Ein anderer nahm dessen Platz ein.
Jetzt konnten sie den Körper deutlich erkennen, der an einem Seil seitlich an der Tonne herabhing.
»Eine Wasserleiche«, sagte Harms mehr zu sich selbst. »Verfluchte Sauerei.«
Einer der Männer, die die Leiche von der Tonne wegziehen sollten, hatte sich einen langen Bootshaken gegriffen und drückte damit dagegen. Nach weiteren Zentimetern konnte er diese mit den ausgestreckten Händen erreichen. Angeekelt sprang er plötzlich zur Seite, weil ihm schleimiges Wasser ins Gesicht tropfte. »Verdammt, das hat mir hier noch gefehlt.«
Keiner der Umstehenden sagte ein Wort.
»Helft ihm«, forderte Harms.
Die Männer machten sich gemeinsam an die Arbeit. Es vergingen weitere lange Minuten, bis der Tote von der Tonne losgeschnitten und in sicherem Abstand abgelegt worden war. Auch die Tonne samt Grundgewicht lag nun an Deck und wurde gesichert.
»Was machen wir jetzt?«, fragte einer der Decksmänner an Harms gewandt.
Der musste schlucken. »Wiederbelebungsversuche können wir uns sparen. Deckt den Körper mit einer Plane ab. Ich informiere die Wasserschutzpolizei.«
***
Hauptkommissar Arne Olofsen und sein Kollege Martin Greiner verließen den großen Besprechungsraum der Polizeiinspektion an der Werner-Kammann-Straße in Cuxhaven. Seit einigen Wochen fand auf Wunsch des Leiters der Inspektion einmal im Monat, immer am Donnerstag, ein Lunchseminar unter dem Motto »Fortbildung von Kollegen durch Kollegen« statt. Keine schlechte Idee, hatte Olofsen, der im Fachkommissariat eins Kapitalverbrechen wie Mord nachging, gedacht, als er zum ersten Mal davon gehört hatte.
Hinter den beiden folgten Frank Pall, Leiter der Tatortgruppe und somit Herr über alle Spuren, und Nils-Niklas Nunk, seines Zeichens Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, kurz ZKD, und Chef von Olofsen und Greiner. Heute war Pall an der Reihe gewesen und hatte über neue Vorgehensweisen bei der Sicherstellung von Tatortspuren referiert. Nun balancierte er einen Aktenstapel mit Beispielmaterial mit einer Hand wie ein Kellner ein gut bestücktes Tablett. In der anderen Hand trug er die Tasche mit dem Laptop, den er bis vor wenigen Minuten für seine Präsentation benötigt hatte.
»Brauchst du Hilfe?«, erkundigte sich Nunk mit einem besorgten Blick auf den Aktenturm.
Pall warf ihm einen schrägen Blick zu. »Quatsch, das mach ich mit links. Willst du dich obendrauf setzen?«
Bei seinen Worten kam der Stapel bedrohlich ins Schwanken. Pall versuchte, die Bewegung mit geschickten Drehungen seines Körpers auszugleichen. Aber die Schwerkraft siegte über seine Bewegungskunst. Laut krachend fielen die Ordner zu Boden, die Deckel der Aktenmappen öffneten sich, und ein Schwall von Papieren flatterte über den Fußboden. Das eine oder andere Blatt segelte einige Meter weiter, sodass das schmucklose graue PVC bald flächendeckend mit weißen Blättern übersät war.
»Verflucht«, meckerte Pall lautstark. »Wer von euch Vögeln hat mich geschubst?«
Olofsen hatte sich umgedreht und klatschte in die Hände. »Ja klar, immer sind es die anderen. Aber du hast mich erwischt – ich war’s. Kraft meiner Gedanken.«
Greiner, Nunk und noch ein paar andere Beamte, die aufgrund von Palls Gezeter aus ihren Büros herausschauten, konnten sich ein Lachen nicht verkneifen.
»Frank, ich als Chefermittler und Leiter des Zentralen Kriminaldienstes kann dir glaubhaft versichern, dass sich dieses Malheur nur aufgrund deiner eigenen Uneinsichtigkeit ereignet hat. Ich habe dir Hilfe angeboten, aber du wolltest keine«, sagte Nunk.
»Ich als Hauptkommissar und noch viel besser im Ermitteln als unser geschätzter Vorgesetzter N-Kubik – ähm – Nils kann bestätigen, dass du das selbst verbockt hast«, ergänzte Olofsen. »Sogar, ohne es mit eigenen Augen gesehen zu haben. Aber ich mache dir ein Angebot: Wir helfen dir beim Einsammeln.«
N-Kubik war der Spitzname des Leiters des ZKD. Jedes N bezog sich auf einen Teil seines Namens: Nils-Niklas Nunk. Dreimal N. N hoch drei, N-Kubik.
»Klar, machen wir«, bestätigte Greiner. »Aber in die richtige Reihenfolge sortieren musst du die Blätter selbst.«
Pall zog eine Fluppe. »Macht euch ruhig über mich lustig. Aber wartet nur ab, wenn ihr das nächste Mal vor meiner Labortür steht und ganz dringend etwas untersucht haben wollt – dann könnt ihr mich mal.«
Olofsen legte seinem Kollegen die Hand auf die Schulter. »Mach mal halblang. Wir können nichts dafür, dass du mit ein bisschen Papier überfordert bist.«
Pall wollte gerade aufbrausen und zu einem der in Polizeikreisen legendären Wortgefechte mit Olofsen ansetzen, als sich dieser an die umstehenden Kollegen wandte. »Alle Hände an Deck und anpacken, das Zeug einzusammeln. Los geht’s.«
Eine knappe Minute später waren alle Blätter aufgestapelt. Pall murmelte ein Dankeschön und marschierte ins Treppenhaus.
Olofsen zuckte mit den Schultern. »Manchmal ist er schon schräg drauf.«
»Der kriegt sich schon wieder ein«, sagte Greiner, Nunk nickte zustimmend.
»Ich brauche jetzt einen Kaffee.« Olofsen drehte sich in Richtung der kleinen Küche.
»Ich auch«, sagten Greiner und Nunk fast synchron.
»Okay, mein Büro, in einer Minute.«
Es dauerte weniger als die angekündigte Minute, bis die drei Polizisten in Olofsens Büro saßen, jeder einen Becher dampfenden Kaffee in der Hand. Olofsen hielt seinen Hartplastikpott mit beiden Händen fest umklammert. Er hatte ihn, samt Deckel und Strohhalm, vor Monaten von seinen Kollegen geschenkt bekommen, da er aufgrund ungestümer Armbewegungen, kombiniert mit einer guten Portion Ungeschicklichkeit, den hauseigenen Bestand an Porzellanbechern drastisch dezimiert hatte.
Olofsen nippte an seinem Kaffee. »Franks Vortrag war gut.«
»Einiges kannte ich tatsächlich noch nicht«, sagte Greiner. »Aber deswegen ist er ja unser Spurenspezialist.«
»Arne, ich möchte, dass du beim nächsten Termin etwas über Verhörmethoden erzählst«, sagte Nunk.
Olofsen verschluckte sich fast an seinem Heißgetränk. »Was, ich? Bist du verrückt? Außer ›guter Cop, böser Cop‹ habe ich keine Ahnung von Verhören.«
Nunk lachte. »Na, da erzählt man sich auf dem Flur aber anderes.«
Olofsen machte große Augen. Doch bevor ihm eine passende Antwort einfiel, klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch. Behutsam stellte er den Becher auf die Schreibtischplatte – bloß keinen Unfall mit Sauerei riskieren – und griff nach dem Telefonhörer. Leider hatte sich das Kabel an der Computertastatur verklemmt.
Als Olofsen zog, um es aus seiner misslichen Lage zu befreien, schoss es vor wie eine Peitsche und traf den Kaffeebecher genau in der Mitte. Dieser machte einen Satz, kippte um und ergoss seinen Inhalt auf den Schreibtisch und Nunks Hose.
Der ZKD-Leiter sprang erschrocken auf, was die Sache jedoch nicht besser machte, denn nun verschüttete er auch Kaffee aus seinem eigenen Becher – auf Greiners Hose.
Greiner blieb ganz gelassen auf seinem Stuhl sitzen und trank einen Schluck.
Nunk fluchte einmal lautstark.
»Kannst du bitte mal ruhig sein?«, schimpfte Olofsen. »Ich telefoniere.«
Nunk fiel die Kinnlade herunter.
Greiner hielt ihm ein Papiertaschentuch hin, das er irgendwoher gezaubert hatte. »Aufregen lohnt nicht«, sagte er ganz entspannt. »Das ist hier der ganz normale Wahnsinn.«
Olofsen hielt Nunk den Telefonhörer hin. »Ist für dich.«
Nunk war zu perplex und wusste nicht, was er mit dem Becher, dem Taschentuch und dem Telefonhörer machen sollte.
»Du musst Martins Taschentuch dankend ablehnen, den Becher auf den Schreibtisch stellen und als Letztes den Hörer in die frei gewordene Hand nehmen«, erklärte ihm Olofsen geduldig. »Das mit dem Kaffee ist nicht schlimm. Passiert hier öfter.«
»Ja«, sprach Nunk in den Hörer, nachdem er Olofsens Anweisungen gefolgt war. Er hörte einige Augenblicke zu, dann reichte er Olofsen den Hörer zurück. »Das war die WSP.«
Olofsen und Greiner blickten ihren Chef an.
»Okay«, sagte Olofsen gedehnt. »Und was möchten die Damen und Herren von der Wasserschutzpolizei von uns?«
»Die haben eine Leiche auf der ›Neuwerk‹.«
»Neuwerk gehört zu Hamburg. Damit sind eventuelle Leichen erst einmal nicht unser Problem«, entgegnete Olofsen altklug. »Das sollten die eigentlich wissen. Noch Kaffee?«
»Nicht die Insel Neuwerk, du Dorschkopp«, schnappte Nunk und wischte mit der Hand an seinem Fleck auf der Hose herum. »Das Schiff ›Neuwerk‹. Die sind jetzt auf dem Rückweg und sollten in einer halben Stunde hier in Cuxhaven anlegen. Und nein – keinen Kaffee mehr. Eher eine neue Hose.«
»Sorry, hab ich gerade nicht da.« Olofsen grinste.
»Was hat es mit dieser Leiche auf sich?«, fragte Greiner.
»Die Jungs von der ›Neuwerk‹ haben sie aus dem Wasser gezogen. Alles Weitere müsst ihr herausfinden.« Nunk blickte zunächst zu Olofsen und dann zu Greiner. »Die WSP bittet um unsere Unterstützung. Ein Arzt wird ebenfalls zum Anleger kommen und sich die Leiche ansehen. Nehmt Frank auch gleich mit. Zur Sicherheit, denn Leichen auf Arbeitsschiffen des Wasser- und Schifffahrtsamtes gehören nicht zur Tagesordnung. Wenn ihr einen ersten Überblick habt, meldet euch umgehend. Ich kläre dann die nächsten Schritte mit der Staatsanwaltschaft ab.«
Olofsen zog die oberste Schreibtischschublade auf, entnahm ihr ein Geschirrtuch und wischte die Kaffeepfütze von der Tischplatte. Anschließend ließ er das Tuch wieder in die Schublade fallen. »Auf geht’s, Martin, wir müssen los. Deine Hose ist übrigens nass.«
Als die beiden durch das Tor auf den Parkplatz des Maritimen Sicherheitszentrums fuhren, schob sich die »Neuwerk« langsam in den Vorhafen. Das massige Schiff mit seinen asymmetrischen Aufbauten und dem Wirrwarr dicker und dünner Lüftungsrohre, Schornsteine, Antennen und Radoms oberhalb der Brücke wirkte wie ein riesiges Insekt aus dem Weltraum.
Mit einem langen Signalton beschied es alle anderen Wasserfahrzeuge im Hafenbecken, Platz zu machen und das Anlegemanöver nicht zu stören.
Bevor Olofsen sich mit Greiner auf den Weg zum Hafen gemacht hatte, war er zu Pall ins Labor gegangen, um ihn über das Geschehene zu informieren. Pall, noch immer ein wenig verschnupft über den Vorfall im Flur, hatte nur unverständliche Laute gebrummt. Doch jetzt erkannte Olofsen, dass der Spurensicherer schneller gewesen war. Er stand bereits auf dem Pier, eine Kamera von beeindruckender Größe in der Hand, und machte Fotos von dem sich nähernden Schiff.
»Willst du sichergehen, dass dir auch nicht die kleinste Kleinigkeit entgeht?«, frotzelte Olofsen, als er neben Pall trat.
»Hmpf«, kam die Antwort. Der Auslöser klickte in schneller Folge, dann ließ Pall die Kamera sinken. »Vor einiger Zeit habe ich die Fotografie für mich entdeckt. Habe ja sowieso ständig mit Bildern und Bildbearbeitung zu tun. Vor ein paar Tagen habe ich mir dieses Wahnsinnsteil von Kamera gegönnt und mache nun die ersten Gehversuche damit. So ähnlich wie du mit deinem Boot.«
Olofsen war beeindruckt.
»Und jetzt halt die Klappe«, fuhr Pall fort. »Sonst kann ich mich nicht konzentrieren und verpasse das beste Motiv. Dann müsste ich dich deswegen ins Hafenbecken stoßen. Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, die ›Neuwerk‹ aus dieser Perspektive«, er machte mit der Kamera eine kreisende Bewegung, »beim Anlegen zu fotografieren?«
»Hab’s verstanden.« Olofsen trat einen Schritt zurück. »Vergiss nur deinen Job nicht.«
Pall feuerte einen giftigen Blick auf seinen Kollegen ab.
Greiner schüttelte den Kopf. »Könnt ihr beiden eigentlich auch normal?«
»Das war doch normal«, grinste Olofsen. »Warte mal ab, bis wir in Fahrt kommen.«
»Wir sind die besten Freunde«, nuschelte Pall und drückte den Auslöser.
In der Zwischenzeit hatte das Schiff sich quälend langsam an den Anleger geschoben. Noch drei Meter Wasser trennten die »Neuwerk« von der Kaimauer. Die ersten dünnen Leinen flogen vom Schiff an Land und wurden dort von helfenden Händen aufgefangen. Anschließend zogen sie die schweren Trossen hinüber, mit denen das Schiff vertäut werden sollte.