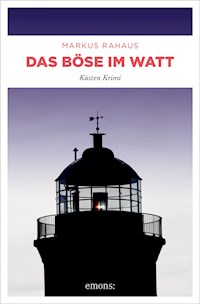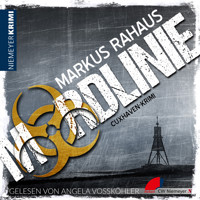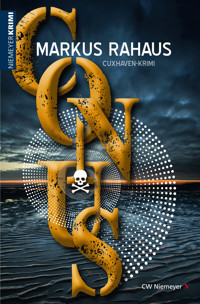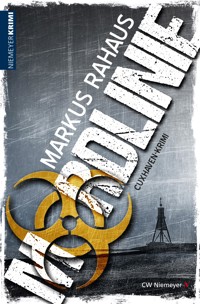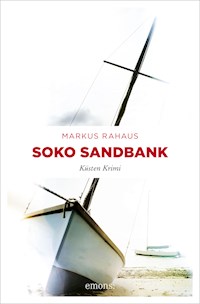
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ermittler-Duo Olofsen/Greiner
- Sprache: Deutsch
Originell, schlagfertig und sehr menschlich. Diesen Chefermittler muss man erleben. Vor Cuxhaven läuft ein Segelboot auf eine Sandbank auf, darauf zwei grausig inszenierte Leichen. Hauptkommissar Arne Olofsen und sein Team müssen bei den Ermittlungen tief in die maritime Welt des Cuxlandes eintauchen – wäre da nicht dieses mysteriöse Virus, das die Ermittler reihenweise außer Gefecht setzt. Nur Zufall oder Teil eines perfiden Plans?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Rahaus wurde 1970 im nordrhein-westfälischen Herten-Westerholt geboren. Der habilitierte Virologe lebt mit seiner Familie in Cuxhaven. In seiner Freizeit beschäftigt er sich ausgiebig mit der Fotografie, veröffentlicht regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften und zeigt seine Bilder im Rahmen von Ausstellungen und Vorträgen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: lichtsicht/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-557-2
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Prolog
Er schlug die Hecktür des kleinen dunkelblauen Transporters zu und atmete hörbar aus. Alles hatte so funktioniert wie erhofft.
Es war eine dunkle Nacht. Als er vor einer knappen Stunde angekommen war, hatten sich dichte Wolken am Himmel gedrängt und den Halbmond verdeckt, der sonst ein wenig Licht gespendet hätte. Auch das gelbliche Licht der einzigen Laterne auf dem rückwärtigen Teil des Geländes, auf dem er sich befand, konnte nicht ernsthaft für Helligkeit sorgen. Trotzdem hatte er sie gekonnt mit wenigen Handgriffen ausgeschaltet.
In der Ferne war das schwache Motorengeräusch eines Lastwagens zu hören. Aber hinter dem Gebäude würde ihn niemand sehen können. Er fragte sich, wie man hier so nachlässig hatte sein können – die Abgelegenheit und Dunkelheit kam quasi einer Einladung gleich, hier einzusteigen. Er legte die Stirn in Falten. Glänzende Fassade, gestapelte Dummheit dahinter.
Seine anfänglich größte Sorge, dass die Fenster des Gebäudes zwischenzeitlich mit einer Alarmsicherung ausgestattet worden sein könnten, hatte sich als unbegründet erwiesen. Mit dem Profiglasschneider, den es im Internet speziell für Leute mit unlauteren Absichten gab, konnte er mühelos eine Öffnung in eines der großen Fenster im Erdgeschoss schneiden. Mit angehaltenem Atem entnahm er das kreisförmige ausgeschnittene Glasstück, griff mit der Hand durch das Loch, legte den Fenstergriff um und stieß das Fenster nach innen auf. Nichts passierte, kein Alarm ertönte, gar nichts. Schnell überprüfte er den Fensterrahmen auf Drähte oder andere Sensoren, fand aber nichts. Einen stummen Alarm gab es demnach auch nicht. Er atmete erleichtert auf und stieg in das Gebäude.
Danach war alles ein Kinderspiel. Nur die inneren Zugangstüren für den Bereich, in dem er sich befand, waren alarmgesichert – aber mit denen hatte er nichts zu schaffen. Da, wo er jetzt war, gab es eine ganze Reihe hochmoderner Gerätschaften, und derentwegen war er hier.
Systematisch ging er von Raum zu Raum und stellte alle Gegenstände, die er mitnehmen wollte, auf einen Rollwagen, den er zuvor aus der Spülküche geholt hatte. Nicht alles, was er auswählte, benötigte er für sich selbst, aber er hatte ein paar Kontakte, über die er einiges davon unter der Hand würde verkaufen können.
Die vier Cycler für Polymerase-Kettenreaktionen hätte er schon gerne mitgenommen. Die Geräte waren erstklassig, da kannte er sich aus. Alle vier waren ziemlich neu und mochten einige tausend Euro wert sein. Aber nachdem er gesehen hatte, dass sie in Betrieb waren, ließ er die Finger davon. Er wusste, dass sie an einem Störmeldesystem angeschlossen waren und, sobald jemand sie vom Stromnetz trennte, bei der Bereitschaft der Haustechnik einen Alarm auslösen würden.
Nachdem er alle Geräte zusammengetragen hatte, die er selbst brauchte oder verkaufen konnte, suchte er sich einen zweiten Rollwagen. Dieses Mal führte ihn sein Weg zielstrebig in die Lagerbereiche. In deckenhohen Regalen stapelten sich Kartons und Kisten, daneben standen gleich mehrere Kühl- und Gefrierschränke. Er trat nacheinander vor jeden der Schränke und studierte konzentriert die an den Türen befestigten Listen mit dem jeweiligen Inhalt. So etwas wie Freude blitzte in seinem Gesicht auf. Dann schaute er sich suchend um und fand, wonach er Ausschau gehalten hatte. Dankenswerterweise hatte einer der Angestellten eine große Styroporbox auf einer Arbeitsbank stehen lassen – genau die brauchte er jetzt.
Er stellte die Kiste auf den Rollwagen, fuhr vor den ersten Gefrierschrank und öffnete diesen. Im obersten Fach lagen Eispacks, mit denen er die Styroporbox auslegte. Anschließend entnahm er dem Gefrierschrank ganz gezielt Kästchen und Fläschchen und legte sie ebenfalls in die Box. Am übernächsten Gefrierschrank wiederholte sich der Vorgang. Hier fand er, wonach er in erster Linie gesucht hatte: einen ungefähr dreißig mal zwanzig Zentimeter großen Kunststoffkasten. Nachdem er ihn vorsichtig geöffnet hatte, sah er, dass er fast vierzig verschlossene Glasröhrchen enthielt. Er entnahm eines der Röhrchen und betrachtete das kleine Etikett. Erneut umspielte ein Lächeln seinen Mund.
Er verschloss den Kasten wieder und packte ihn in die Styroporkiste. Die zwei weiteren Kästen, die hinter dem ersten in dem Gefrierschrankfach standen, nahm er ebenfalls mit. Danach widmete er sich den Kühlschränken. Auch hier wurde er fündig, und schon bald war die Box randvoll gefüllt.
Er fuhr mit dem Rollwagen zurück zu dem Fenster, vor dem bereits der erste Wagen mit den Geräten stand. Rasch kletterte er hinaus und verschwand in der Dunkelheit. Zwei Minuten später saß er in seinem Van und fuhr mit ausgeschalteten Scheinwerfern bis dicht an das Fenster heran. Dort begann er, seine Beute durch das Fenster nach draußen zu heben und in den Lieferwagen zu packen. Er arbeitete schnell und konzentriert, und so dauerte es nicht lange, bis alles eingeladen war.
Ein weiteres Mal ging er zurück ins Gebäude und stellte die beiden Rollwagen zurück an ihre Plätze. Nun war es Zeit, zu verschwinden. Er zog das offene Fenster von außen zu und legte durch das Loch im Glas den Griff wieder um. Mit einem Spezialkleber bestrich er die Kanten des Glaskreises, den er anfangs aus der Scheibe herausgeschnitten hatte, und setzte diesen vorsichtig ein. Selbstverständlich würde man am folgenden Morgen erst den Einbruch, dann die aufgeschnittene Scheibe entdecken, Letzteres aber nicht auf den ersten Blick, sondern erst bei genauerem Hinsehen.
Er stieg in den Wagen und startete den Motor. Es war kurz nach drei Uhr morgens. Bald würde die Dämmerung einsetzen und ein neuer Tag beginnen.
EINS
Montag, 3. September, früher Morgen
Es dämmerte. Die ersten zaghaften, goldgelben Lichtstrahlen bemühten sich, die nächtliche Dunkelheit zu verdrängen. Die See war ruhig, ein leichter Wind strich sanft über das Wasser.
Georg Magog lehnte sich in seinem Sitz zurück und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Vor einer halben Stunde hatte ihn sein Sohn Thomas geweckt und ihm das Steuer ihrer fünfundvierzig Fuß langen Motoryacht übergeben. Thomas war trotz Autopilot und Müdigkeit die ganze Nacht am Steuer geblieben, während sie das letzte Stück der Nordsee in Richtung Osten überquert hatten. Die Wettervorhersage war so gut gewesen, dass sie beschlossen hatten, die nächtliche Fahrt zu wagen und nicht noch länger auf Norderney zu verweilen.
Ihr dreiwöchiger Urlaubstörn entlang der englischen Südküste war phantastisch gewesen – malerische Buchten und Felsen, gemütliche, bisweilen quirlige Häfen und grandioses Wetter –, aber es kam, wie es kommen musste: Die schöne Zeit hatte sich unbarmherzig dem Ende zugeneigt, und sie mussten zurück nach Hause. Nach der Passage von England zur Festlandküste boten sich die Friesischen Inseln als Zwischenstopp an, zumal das Barometer gefallen und die See unruhiger geworden war. Einmal an Land war es ein Urlaub im Urlaub geworden, mit Strandspaziergängen und hervorragendem Essen. Dann war es jedoch an der Zeit gewesen, weiterzureisen. Zum Glück hatte sich das Wetter deutlich verbessert, und sie konnten die Leinen loswerfen. Bereits übermorgen musste Thomas im Büro in Cuxhaven an seinem Schreibtisch sitzen.
Bei den vorherrschenden Wetterbedingungen würden sie in gut zwei Stunden ihr Ziel, die Marina der Gemeinschaft Cuxhavener Segler, erreichen. Georg hatte bei seinen Berechnungen selbstverständlich die Tiden und Strömungen berücksichtigt. Gerade herrschte ablaufendes Wasser, und sie fuhren gegen den Strom, der auf der Außenelbe beachtlich stark war. Vor einer knappen halben Stunde hatten sie die rot-weiß gestreifte Tonne Elbe/Racon passiert und waren nun auf Höhe der grünen Tonne 1 im Fahrwasser unterwegs. Ihr Zuhause war zum Greifen nahe.
Nach einem weiteren Blick auf die Instrumententafel lehnte sich Georg gemütlich nach hinten. Es war alles in Ordnung. Ihre »Seepferdchen« schob sich mit gleichmäßig brummenden Motoren durch das Wasser. Georg schaute voraus, in Richtung der aufgehenden Sonne. Der Himmel erstrahlte in orangen und glutroten Farbtönen. Die wenigen Wolken schienen wie mit Goldlack besprüht, und die Wasseroberfläche funkelte wie flüssige Lava. Er liebte diese Momente am frühen Morgen. Auch wenn die Elbe zu den meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt gehörte, herrschte jetzt so gut wie kein Schiffsverkehr. In Gedanken versunken griff er nach dem Fernglas, um die nächste Fahrwassertonne zu suchen, an der er den Kurs ihres Schiffes orientieren wollte. Nach wenigen Sekunden hatte er sie entdeckt.
Plötzlich erwachte das Funkgerät zum Leben und schreckte Georg aus seinen Gedanken. »Motorboot ›Seepferdchen‹, Motorboot ›Seepferdchen‹, hier spricht Cuxhaven-Elbe-Traffic. Bitte kommen!«
Georg schaute verdutzt. Hatte er etwas falsch gemacht, sodass er sich jetzt – zum vergnüglichen Mithören für alle, die gerade am Funkgerät saßen – einen Rüffel einfangen konnte?
Wieder ertönte die knarrende Stimme aus dem Lautsprecher des Funkgerätes. Georg griff zum Funkhörer, drückte die Sprechtaste und meldete sich. »Cuxhaven-Elbe-Traffic, hier ist die ›Seepferdchen‹. Was gibt es?«
»›Seepferdchen‹, prima, dass ihr euch meldet«, erhielt er Antwort und atmete auf – doch kein Rüffel. »Gut acht Seemeilen elbaufwärts von eurer Position, zwischen den Tonnen 11 und 13, sehen wir auf dem Radar ein Boot ohne Fahrt, vermutlich liegt es auf den Scharhörnsandbänken. Wir konnten keinen Funkkontakt herstellen, und ihr seid im Augenblick das einzige Boot in der Nähe. Die Wasserschutzpolizei fährt gerade auf der Höhe von Brunsbüttel und bräuchte zu lange bis zur genannten Position. Schaut bitte bei der Vorbeifahrt nach, was da los ist.«
Georg schaute nachdenklich drein. Er wusste aus eigener Erfahrung, dass dieser Abschnitt des Fahrwassers bis zur Kugelbake tückisch war. In seinen frühen Tagen als Freizeitskipper hatte er selbst hier einmal fast sein kleines Boot versenkt. Damals hatte er, unerfahren, aber mit großer Klappe, bei auflaufendem Wasser ins Watt bei Döse einfahren wollen, weil es seiner Meinung nach der kürzeste Weg nach Neuwerk war. Allerdings hatte er den Leitdamm übersehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Damm aus aufgeschütteten Steinbrocken, der die Wattflächen von Döse vom Elbfahrwasser abtrennte, war bereits knapp überspült gewesen. Es hatte schrecklich geknallt, der Propeller seines Außenborders war abgerissen, auf der Backbordseite hatten die Steine des Damms den Rumpf auf ganzer Länge aufgeschlitzt, und er selbst hatte im Moment des Aufpralls einen Satz über das Steuer in den Bug des Bootes gemacht und sich dabei den rechten Arm gebrochen.
Bis zu der Position, auf der er sich jetzt mit der »Seepferdchen« befand, reichte der Leitdamm zwar nicht, aber an der dem Land zugewandten Seite des Fahrwassers gab es keinen seichten Anstieg des Meeresbodens, stattdessen ging es steil die Wattflächen des Scharhörnriffs hinauf. Wer hier eng am grünen Tonnenstrich fuhr und nicht aufpasste, konnte ganz schnell auflaufen und festsitzen.
»Cuxhaven Elbe-Traffic«, meldete er sich wieder. »›Seepferdchen‹ hat verstanden. Wir schauen nach.«
Die »Seepferdchen« fuhr weiter, bis die besagte Tonne 11 in Sichtweite kam. Noch immer waren sie allein auf dem Wasser, kein anderes Schiff weit und breit. Georg konnte sich nicht erinnern, die Elbmündung kurz vor Cuxhaven schon einmal so einsam erlebt zu haben.
Er hielt sich eine Hand über die Augen und suchte sorgsam das Wasser auf seiner Steuerbordseite ab. Bislang hatte er noch nichts Auffälliges entdecken können. Vielleicht hätte er mit dem Fernglas mehr Erfolg. Georg setzte sich das Glas an die Augen und versuchte, das gesuchte Boot aufzuspüren. Und tatsächlich entdeckte er es – ein Segler. Er stutzte. Der Segler lag quer zum Fahrwasser auf dem Sand. Einzelheiten konnte er nicht erkennen, die Entfernung war noch zu groß. Er schob den Fahrthebel auf der Steuerkonsole ein Stückchen nach vorne, um das Schiff zu beschleunigen.
Nach zwanzig Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, waren sie dicht genug herangekommen, dass er Einzelheiten erkennen konnte. Was er sah, ließ ihn blass werden.
»Thomas, komm schnell rauf«, rief er mit zittriger Stimme.
»Was ist denn los?«
»Komm einfach.«
Einen Moment später stand Thomas neben seinem Vater und blickte durch ein Fernglas auf das Boot vor ihnen. Auch er erstarrte augenblicklich.
»Ach du Schande«, stammelte er, drehte sich auf dem Absatz um und lief auf das Achterdeck.
»Was hast du vor?«, wollte sein Vater wissen.
»Bring uns möglichst nah heran. Und setze sofort einen Notruf ab. Ich mache das Schlauchboot klar.«
»Das Schlauchboot? Du willst da rüber?«
»Papa! Den Notruf! Sofort!«
Unsicher griff Georg neuerlich nach dem Funkhörer. Er zögerte. Normaler Funkverkehr war kein Problem für ihn. Es machte ihm sogar Spaß. Aber ein Notruf? Selbstverständlich hatte er gelernt, wie man ihn absetzte, damals während seines Wochenendkurses für das Short Range Certificate bei einer Sportbootschule in Bremen. Das war aber nun schon einige Jahre her. Seitdem hatte diese ominöse große rote Taste auf dem Funkgerät zwar immer eine beruhigende Wirkung auf ihn gehabt, doch benutzt hatte er sie noch nie.
Er hörte seinen Sohn auf dem Achterdeck werkeln und gab sich einen Ruck. Mit einer schnellen Fingerbewegung klappte er die Plastikabdeckung hoch und drückte auf die Taste. Fünf Sekunden, genau wie man es ihm damals beigebracht hatte. Gleichzeitig mit dem Erscheinen der ersten Schweißperlen auf seiner Stirn ließ er wieder los. Das Gerät bestätigte mit einem schrillen Signalton, dass der digitale Notruf gesendet war. Seine Finger begannen zu zittern.
Nur Augenblicke später wurde der Alarm von der Seenotleitung in Bremen quittiert. Georg räusperte sich, um sicher zu sein, dass seine Stimme ihn nicht im Stich lassen würde, drückte die Sprechtaste und begann zu sprechen: »Mayday, Mayday, Mayday. This is ›Seepferdchen‹. ›Seepferdchen‹. ›Seepferdchen‹. Call sign delta hotel – ja, Mist noch mal, was ist denn unser Rufzeichen? Verfluchtes Englisch.«
Er ließ die Sprechtaste los und sah sich hilfesuchend um. Von Thomas war nichts zu sehen. Mit dem Handrücken wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Das Funkgerät gab nur statisches Rauschen von sich.
Plötzlich ertönte eine leicht verzerrte Stimme aus dem kleinen Lautsprecher: »Mayday, ›Seepferdchen‹. This is Bremen Rescue Radio. Received Mayday. Please confirm your position and distress situation. Bitte bestätigen Sie Ihre Position und die Art des Notfalls.«
Hokki Werlops, der Vormann der »Anneliese Kramer«, lag in seiner Koje und wollte an diesem Morgen einfach noch ein wenig dösen. Der DSC-Alarmgeber in seiner Kammer war abgeschaltet, im Falle eines digitalen Notrufes würde die Seenotleitung ihn alarmieren.
Für heute waren Wartungsarbeiten an der Maschine geplant und anschließend eine Kontrollfahrt auf der Außenelbe. Bevor die Techniker eintrafen, wollte er noch die Ruhe an Bord genießen. Aus den beiden kleinen Lautsprechern in der Decke seiner Kammer, über die ununterbrochen der Funkverkehr von Kanal 16, dem Not- und Anrufkanal, und Kanal 71, dem Revierfunk für Cuxhaven und die Außenelbe, übertragen wurde, tönten wechselweise schwer verständliche Sprachfetzen und Rauschen. Das störte ihn schon lange nicht mehr. Er hatte sich so sehr daran gewöhnt, dass er trotz der ständigen Geräuschkulisse schlafen konnte wie ein Baby.
Doch kaum hatte die Silbe »May-« den Lautsprecher verlassen und durch sein Ohr das Unterbewusstsein erreicht, war er hellwach. Bei »-day« saß er bereits aufrecht. Mit einem gebrummten »Muss das jetzt sein?« sprang er aus seiner Koje, riss die Tür seiner Kammer auf und stürmte mit fliegenden Schritten, nur im Pyjama bekleidet, den Niedergang hinauf auf die Brücke. Ein Blick auf das Funkgerät am linken Fahrstand zeigte ihm, dass tatsächlich kurz vorher ein digitaler Notruf samt der Position des Havaristen eingegangen war. Mit nur einem Blick auf die Koordinaten erkannte er sofort, dass der Notruf auf Höhe des Scharhörnriffs abgesetzt worden war. Sein Revier.
Sofort stürmte er wieder den Niedergang hinunter.
»Einsatz«, brüllte er in einer Lautstärke, die man sicherlich in den umliegenden Hotels der Grimmershörner Bucht noch hörte.
Die im Cuxhavener Fährhafen stationierte, achtundzwanzig Meter lange »Anneliese Kramer« gehörte zur neuesten Generation von Seenotrettungskreuzern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Das Schiff mit seinem für die Rettungskreuzer so unverwechselbaren weißen und leuchtend roten Anstrich und den drei großen, dunkelroten Buchstaben SAR am weißen Bug – sie standen für »search and rescue«, den Auftrag der Seenotretter – war aus dem Gesamtbild des Hafens nicht wegzudenken. Tag für Tag zog es die Blicke von Touristenscharen auf sich, die hier einen Zwischenstopp einlegten, um ein Foto von »ihrem« Schiff zu machen.
Auf dem hochmodernen und mit allen erdenklichen Rettungsmitteln und technischen Finessen ausgestatteten Schiff brach sofort professionelle Betriebsamkeit aus. Mit einem tiefen Wummern sprangen die mächtigen, immer vorgewärmten Dieselaggregate an.
Zurück auf der Brücke, nahm sich Vormann Werlops den Funkhörer und rief die »Seepferdchen« an: »Mayday, ›Seepferdchen‹. Hier ist der Seenotrettungskreuzer ›Anneliese Kramer‹. Wir laufen aus und kommen Ihnen zu Hilfe. Bitte beschreiben Sie die aktuelle Situation. Over.«
Nach kurzem statischen Rauschen kam die Antwort: »Ja, Gott sei Dank, dass ihr kommt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Muss das denn sein, so kurz vor dem Ziel?«
Eine Mischung aus Angst und Panik schwang in der Stimme am anderen Funkgerät mit. Werlops kannte das. Wenn die Freizeitskipper in den Wochenendkursen ihren Funkschein machten, konnten sie die Abläufe des Funknotverkehrs vorwärts und rückwärts runterbeten, und das sogar auf Englisch. Mit der Zeit vergaßen sie aber wieder alles, und wenn es dann plötzlich darauf ankam, war das Gehirn leer geblasen und mit Brettern vernagelt. Trotz allem konnte er es nachvollziehen. Für ihn und seine Crew war ein Seenotfall das tägliche Brot, für die meisten Hobbykapitäne war es der Super-GAU.
Der Redeschwall seines Gegenübers hatte aufgehört, und so zog Werlops das Gespräch an sich, ruhig und professionell. »Mayday, ›Seepferdchen‹. Bitte beruhigen Sie sich. Beschreiben Sie uns die aktuelle Situation.«
Der Skipper der »Seepferdchen« meldete sich wieder. »Wir laufen ostwärts auf Tonne 11 zu. Kurz dahinter liegt ein Segler auf dem Sand. Ihr wisst schon, so zehn oder zwölf Meter lang. Ob er den Anker geworfen hat, kann ich noch nicht erkennen. Es steigt Rauch auf.«
»›Seepferdchen‹, können Sie Personen an Bord des Seglers erkennen?«, fragte Werlops. Mit einem Seitenblick suchte er auf dem großen Kartenplotter neben ihm die genaue Position der »Seepferdchen«. Diese befand sich etwa zwölf Seemeilen vom Liegeplatz des Rettungskreuzers entfernt. Bei ablaufendem Wasser und mit Höchstgeschwindigkeit sollten sie diese in fünfundzwanzig Minuten erreichen können.
»Nur eine Person«, kam die Antwort und holte Werlops in den aktuellen Funkverkehr zurück. »Sie liegt vorne am Bug, ziemlich weit außenbords. Wenn das Schiff wieder aufschwimmt, kippt sie über Bord. Und wie gesagt, vom Vorschiff steigt Rauch auf.«
Werlops griff zum Telefon – die Landleitungen waren noch nicht gekappt – und rief die Einsatzzentrale der Cuxhavener Feuerwehr an. Nur Augenblicke später machten sich ein Notarzt und ein Rettungsassistent mit Blaulicht und Martinshorn auf den Weg zum Fährhafen. Weil es noch früh am Morgen war, erreichten sie das Schiff in nur sechs Minuten. Kaum waren sie an Bord, wurden die Leinen gelöst, und das Schiff schob sich langsam vom Steg.
Sobald der Rettungskreuzer den Fährhafen verlassen hatte, legte der Vormann am Fahrstand die Fahrthebel auf den Tisch. Das Schiff schoss westwärts über die Elbe. Glücklicherweise kam ihnen die starke Strömung des ablaufenden Wassers zugute, sodass sie eine Geschwindigkeit von fast achtundzwanzig Knoten erreichten. Ein tiefes Brummen legte sich über das ruhige Wasser, nur gelegentlich spritzte Gischt auf und wurde durch die aufgehende Sonne in einen Vorhang aus goldglänzenden Wassertröpfchen verwandelt.
Werlops griff sich wieder den Hörer des Funkgerätes. »Wir laufen mit Höchstgeschwindigkeit auf die angegebene Position zu. Geschätzte Ankunftszeit in zwanzig Minuten«, sagte er.
Thomas legte mit dem kleinen Schlauchboot vom Heck der »Seepferdchen« ab. In zwei oder drei Minuten würde er auf der Sandbank ankommen und an Bord des Seglers gehen. Auch er hatte den Rauch und die reglose Person am Bug des Schiffes entdeckt. Der Oberkörper ragte weit über das Deck hinaus, ein Arm baumelte schlaff herunter. Etwas Rotes lief in kleinen Fäden an der Bordwand abwärts.
Thomas wurde unsicher. War das Blut? In seiner Magengegend machte sich ein mulmiges Gefühl breit. Vielleicht war es keine so gute Idee, noch näher heranzufahren. Er schob diesen Gedanken schnell zur Seite. Selbstverständlich war es richtig. Hier schien etwas Schlimmes passiert zu sein, und möglicherweise benötigte jemand dringend Hilfe. Er gab Gas.
»Hallo! Kann mich jemand hören?«, rief er, als er auf Rufweite herangekommen war. »Brauchen Sie Hilfe?«
Eigentlich eine blöde Frage. Wer so über die Bordwand hing und blutete, brauchte mit Sicherheit Hilfe. Trotzdem rief er noch einmal.
Keine Reaktion.
Thomas erreichte die Sandbank, sprang aus dem Boot und schob es ein wenig weiter auf den Sand. Vertäuen konnte er es nicht, und einen Anker gab es auch nicht. Also musste er gut auf die Tide achten, damit es mit dem bald startenden auflaufenden Wasser nicht wegschwamm. Am Heck des Seglers stieg er an Bord. Ihm fiel auf, dass der Heckspiegel, an dem normalerweise Name und Kennung eines Sportbootes angebracht waren, komplett mit einer schwarzen Brand- oder Rußschicht überzogen war. Erneut ertönte seine innere Alarmanlage, erneut schaltete er sie ab. Er blickte umher. Bis auf den Rauch und die leblose Person vorne sah sonst alles normal aus. Zumindest soweit er das Leinengewirr an Bord eines Seglers beurteilen konnte.
Mit schnellen Schritten lief er nach vorne, griff beherzt zu, zog die Person wieder an Bord und drehte sie um. Es war eine Frau. Sie hatte lange dunkle Haare, die ihr jetzt wie ein nasser Wischmopp über dem Gesicht lagen, und trug eine für die Jahreszeit typische leichte Seglermontur, aber keine Rettungsweste. Komisch, dachte Thomas, bei einem Notfall hätte er die Weste als Erstes angelegt.
Mit Entsetzen stellte er fest, dass das Rote tatsächlich Blut war. Es war aus einer klaffenden Wunde in der Brust der nun auf dem Rücken liegenden Frau gelaufen, hatte ihre Kleidung durchtränkt und war in kleinen Rinnsalen zuerst über das Deck und dann an der Bordwand entlang ins Wasser geflossen. Mittlerweile war der Blutfluss versiegt und begann rotbraun einzutrocknen. Thomas musste heftig schlucken. So etwas hatte er noch nie gesehen. Übelkeit stieg in ihm auf.
Er wandte sich ab und atmete einmal tief die frische Seeluft ein. Hier wurde keine Hilfe mehr benötigt, fasste er pragmatisch zusammen und lief zurück in den achternen Teil des Bootes, wo er den Niedergang in die Kabine vermutete. Fast hätte er sich dabei in losem Tauwerk verheddert und wäre gestürzt. Plötzlich fühlte er sein Handy in der Hosentasche vibrieren.
Kaum hatte er das Gespräch angenommen, hörte er die aufgeregte Stimme seines Vaters. »Thomas, der Rettungskreuzer ist unterwegs. Ich habe denen deine Handynummer gegeben. Was ist da bei dir los?«
»Die Frau am Bug ist tot. Ich glaube, sie wurde umgebracht.« Thomas’ Stimme begann zu zittern. »Ich schaue jetzt in die Kabine.«
»Umgebracht?« In Georgs Stimme schwang Sorge. »Komm zurück. Was, wenn der Mörder noch auf dem Schiff ist?«
Thomas lief es kalt den Rücken herunter. Dieser Gedanke war ihm bis jetzt gar nicht gekommen. Aber nun, nachdem ihn sein Vater ausgesprochen hatte, stieg Panik in ihm auf. Schließlich befand er sich mitten auf dem Wasser, auf einem Schiff, von dem man nicht mir nichts, dir nichts verschwinden konnte. Okay, genau genommen lag das Schiff auf einer Sandbank, aber das erhöhte die Fluchtoptionen nicht ernsthaft. Trotzdem, ein schneller Blick in die Kabine und dann nichts wie weg. Sollten die Seenotretter sich um den Rest kümmern.
Er blickte in Richtung der aufgehenden Sonne und hielt eine Hand über die Augen, um in dem gleißenden Licht und dem funkelnden Wasser etwas erkennen zu können. Da! Da näherte sich ein Schiff in schneller Fahrt. Das musste der Rettungskreuzer sein.
Er nahm all seinen Mut zusammen und öffnete die Tür zum Niedergang. Ein widerlicher, gleichzeitig süßer und rauchiger Gestank schlug ihm entgegen. Dennoch stieg er mutig die wenigen Stufen in die Kabine hinunter.
Hokki Werlops stand unbeweglich auf der Brücke der »Anneliese Kramer« und blickte durch sein Fernglas. Nicht mehr lange, bis sie vor Ort sein würden. Zwei Crewmitglieder waren bereits damit beschäftigt, das Tochterboot klarzumachen, sodass sie es in kürzester Zeit zu Wasser lassen konnten. Gerade eben hatte er das Funkgespräch beendet, in dem er von dem Skipper der »Seepferdchen« die Information bekommen hatte, dass die Person an Deck des Segelbootes tot war. Ohne dass weitere Worte notwendig waren, hatte sein Kollege auf der Brücke die Wasserschutzpolizei von Revier 4 in Cuxhaven alarmiert.
Jetzt hatte Werlops die Boote entdeckt. Eines von ihnen, das Segelboot, lag tatsächlich im Sand. Ein Stückchen weiter sah er ein Schlauchboot. Er vermutete, dass es dem Sohn des Skippers gehörte.
Querab zum Segler schwamm ein Motorboot. Das musste also die »Seepferdchen« sein. Sein Blick schwenkte zurück zum Segler. Dort konnte er nun einen Mann auf dem Achterschiff erkennen, der sich in die Kabine hineinbeugte und dann darin verschwand. Werlops wollte ihn umgehend anrufen und sich berichten lassen, wie es im Inneren des Segelbootes aussah. Also griff er nach dem Handy. Doch kaum hatte er die ersten Nummerntasten gedrückt, sah er aus den Augenwinkeln, wie der Mann, der gerade in die Kabine des Segelbootes gestiegen war, wie von der Tarantel gestochen wieder an Deck sprang, an die Reling stürzte und sich die Seele aus dem Leib spuckte.
ZWEI
Montag, 3. September, früher Vormittag
Hauptkommissar Arne Olofsen saß an seinem Schreibtisch im Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Cuxhaven und starrte wie gebannt auf das knapp einen Meter lange Seilstück vor ihm. Es war früher Morgen, kurz nach sieben Uhr, und er hatte das Fenster seines Büros weit geöffnet, um die frische, kühle Morgenluft hereinzulassen. Für ihn war dies die beste Zeit im Büro. Die meisten Kollegen waren noch nicht da, und er konnte sich ungestört auf wichtige oder vermeintlich wichtige Dinge konzentrieren.
Auf Armeslänge vor dem linken Ende des Seiles legte er eine kleine Schlaufe. Nein, ein Auge, korrigierte er sich. Hoch konzentriert schob er das Seilende durch dieses Auge, führte es von hinten um das Seil herum und wollte es gerade wieder von vorne durch das Auge führen, als plötzlich das Telefon auf dem Schreibtisch laut summte. Vor Schreck riss er den halb fertigen Knoten auseinander und fegte dabei mit dem Arm seinen Kaffeebecher vom Schreibtisch. Dieser schoss wie eine Rakete durch den Raum, verteilte unterwegs seinen flüssigen und fast schwarzen Inhalt in einem abstrakten, aber interessanten Muster auf dem Fußboden, schlug gegen die Wand und zerbarst in tausend Stücke. Das Telefon summte noch einmal, dann kehrte die morgendliche Ruhe zurück.
Tatsächlich war es eine von Olofsens Qualitäten, Kaffeebecher von Schreibtischen zu schießen. Das konnte er wirklich gut und tat es auch regelmäßig. Zum Glück gab es aber noch andere Dinge, die er ebenso gut konnte. Polizist sein, zum Beispiel.
»Verdammter Mist«, schimpfte er. »Der Tag fängt ja gut an.«
Dabei schlug er mit der flachen Hand auf den Schreibtisch, die Computertastatur hüpfte auf und ab, und das Seilstück fiel zu Boden.
Einen Augenblick später flog die Tür auf, und sein Kollege Martin Greiner stürmte ins Büro. Auch er hatte von seinem Kollegen die Angewohnheit übernommen, sehr früh ins Büro zu kommen. Ebenso wie Olofsen hatte er diese Tageszeit zu schätzen gelernt.
»Was war das für ein Knall? Was ist passiert?«, fragte er und suchte mit schnellem kriminalistischen Blick den Raum ab. Dann sah er die Sauerei auf dem Fußboden und an der Wand. Augenblicklich brach er in schallendes Gelächter aus. »Du solltest deine Kaffeetasse besser irgendwo auf den Boden stellen und den Rest des Tages nicht mehr in ihre Nähe kommen«, prustete er. »Dein Verbrauch an Tassen wird langsam besorgniserregend.«
»Ach, halt doch die Klappe«, schnaubte Olofsen und versuchte, das Seil unauffällig vom Boden zu angeln und unter dem Schreibtisch verschwinden zu lassen.
»Was machst du da?«, fragte Greiner.
»Nix.«
»Schon klar.«
»Wirklich.«
»Einen Tampen.« Greiner lachte noch lauter und ließ sich in Olofsens Besucherstuhl fallen. »Lass mich mal nachdenken«, begann er. »Du machst in ein paar Tagen die Prüfung für deinen Bootsführerschein.« Greiner legte die Stirn in Falten und imitierte angestrengtes Nachdenken. »Knoten. Ich hab’s: Du sitzt hier und übst die Knoten.«
Olofsen fühlte sich ertappt. Jeden anderen als Martin Greiner hätte er jetzt verbal zusammengefaltet und in einem Hauspostumschlag aus dem Raum befördert.
»Du hast recht«, bestätigte er ungewohnt kleinlaut. »Morgen. Und ich kriege diese verfluchten Knoten nicht hin. Wer sich diesen Mist ausgedacht hat, sollte an den Eiern an die Kugelbake genagelt werden.«
Jemanden mit den Eiern an die Kugelbake zu nageln war Olofsens bevorzugte Zwangsmaßnahme, die so ziemlich jedem angedroht wurde, der ihm in irgendeiner Form querkam.
Greiner grinste schelmisch und schnappte sich das Seil. »Pass auf, das machst du so und dann so und dann hierum und fertig.« Er hielt ihm einen perfekt geknoteten Palstek vor die Nase.
»Wieso kannst du das?« Olofsen war sichtlich erstaunt.
Greiner feixte noch immer. »Ich musste als Jugendlicher mal einen Segelschein machen. Mein Vater hat darauf bestanden, obwohl wir weit weg von der Küste oder einem großen See wohnten. Es war ihm wichtig. Familientradition. Ein richtiger Greiner musste segeln können, selbst wenn Geld und Wasser für ein Boot fehlten.«
Er blickte für einige Sekunden versonnen aus dem Fenster. »Meine Lehrer haben mir damals die Knoten so tief ins Hirn eingebrannt, dass ich sie wohl niemals vergessen werde.«
»Okay, das musst du mir zeigen. Und die anderen Knoten gleich auch. Doppelter Schotsteg, Stopperknoten –« Olofsen war sofort Feuer und Flamme. Weiter kam er jedoch nicht, denn trotz der frühen Morgenstunde erschien das nächste Gesicht in der Tür.
Es war Nils-Niklas Nunk, der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes. »Bist ja doch schon da. Wieso gehst du nicht ans Telefon? Ich hab dich vor ein paar Augenblicken angerufen.« Doch als Nunk zuerst Greiner im Besucherstuhl mit einem Stück Seil in der Hand erspähte und dann ebenfalls die Scherben und Kaffeeflecken auf dem Fußboden entdeckte, konnte auch er sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Er kam näher und stellte Olofsen eine neue Tasse auf den Schreibtisch. »Wollte ich dir sowieso vorbeibringen. Plastik«, sagte er und klopfte mit dem Daumen dagegen. »Garantiert bruchsicher. Superstabil, unkaputtbar. Die Kollegen haben zusammengelegt.« Mit weit ausholender Geste legte er noch einen Deckel mit Trinkhalm dazu.
»Manchmal fühle ich mich wie eine Banane«, brummte Olofsen. »Immer nur von Affen umgeben.« Aber auch er musste schmunzeln.
Nunk wurde ernst. »Ich bin gerade von den Kollegen der Wasserschutzpolizei informiert worden, dass es draußen auf der Elbe auf einem Segelboot zu einem Todesfall gekommen ist, möglicherweise liegt ein Tötungsdelikt vor. Ich will, dass ihr euch das anschaut und die WSP unterstützt.«
»Sollen wir da rausschwimmen?«, erkundigte sich Olofsen flapsig. Er war aufgestanden und wischte erfolglos mit einem Papiertaschentuch an einem Kaffeefleck an der Wand herum.
»Natürlich nicht, du Döskopp«, retournierte Nunk unbeeindruckt. Er kannte Olofsen und seine Sprüche. »Die ›Bürgermeister Brauer‹ legt in wenigen Minuten am Lenzkai zum Schichtwechsel an und macht sich danach sofort auf den Weg. Die nehmen euch mit. Ich habe schon alles mit den Kollegen der WSP geklärt. Macht euch auf die Socken.«
»Und schon ist der gemütliche Start in den Tag gelaufen«, stellte Greiner mit gespieltem Bedauern fest.
Olofsen dagegen war sofort startklar. »Auf die ›Bürgermeister Brauer‹?«, fragte er begeistert.
Vor einigen Monaten, er wusste selbst nicht, warum, war seine Kindheitsliebe zu Schiffen und allem Maritimen wiedererwacht. Vielleicht war er endlich auch mental im Norden angekommen und begann, Strand, Watt, Wind und Wasser zu genießen, ohne pausenlos über die Touristen zu schimpfen, die fast das ganze Jahr durch die Stadt fluteten. Zunächst hatte er angefangen, in seiner Hobbyholzwerkstatt kleine Modelle von Segelbooten zu bauen, bis er sich vor einigen Wochen entschloss, einen Sportbootführerschein zu machen.
Olofsen und Greiner rasten mit Blaulicht und Sirenengeheul durch die Präsident-Herwig-Straße. Sie fuhren an den alten Fischhallen vorbei, in denen sich die Dienststelle der Wasserschutzpolizei befand, überquerten die erste Brücke an der Seeschleuse zum neuen Fischereihafen und erreichten nach einer weiteren Minute den Lenzkai im Amerikahafen. Die »Bürgermeister Brauer« lag schon am Anleger, die Besatzung der vergangenen Nachtschicht hatte das Schiff verlassen, und die Kollegen der Tagschicht gingen an Bord. Kaum waren die beiden Kommissare ebenfalls über die schmale Gangway an Bord gelaufen, wurden die Festmacher losgeworfen, das Schiff schob sich von der Kaimauer weg und nahm langsam Fahrt auf.
Ein Beamter der Wasserschutzpolizei trat zu den beiden. »Moin! Da haben sie euch ja früh aus dem Bett geholt.«
Greiner nickte nur.
»Ach, Unsinn«, erklärte Olofsen, jetzt erstaunlich gut gelaunt. »Wir sind doch immer im Einsatz. Zu Land und zu Wasser.«
Der andere Beamte lachte. »Dann kommt mal mit auf die Brücke. Der Schiffsführer erklärt euch den Stand der Dinge.«
Damit wandte er sich ab und stieg die wenigen Treppenstufen hinauf, die ins Schiff und zur Brücke führten.
Innerlich freute sich Olofsen wie ein kleiner Junge, der seinem Papa ein Stückchen von dessen Lieblingsschokolade stibitzt hatte, versuchte aber, nach außen den coolen Bullen zu geben. Oben wurden sie von Bengt Petersen, dem Schiffsführer, mit einem Nicken begrüßt. Er saß entspannt im mittleren der drei Sitze am zentralen Fahrstand.
»Moin, Kollegen«, sagte er gedehnt. »Mächtig was los am frühen Morgen.«
Olofsen konnte seine Augen kaum von den vielen Anzeigen, Schaltern und Hebeln des Fahrstands lösen, wurde sich dann aber des Anlasses seines Kommens bewusst. »Okay, was genau ist los? Was müssen wir wissen?«
Der Schiffsführer winkte ab. »Wenn wir auf der Elbe sind, gibt es alle Infos. Jetzt wollen wir erst mal aus dem Hafen raus.«
In den folgenden Minuten herrschte auf der Brücke der »Bürgermeister Brauer« konzentrierte Stille. Schließlich hatten sie den Amerikahafen verlassen und mit einem westlichen Kurs in das Elbfahrwasser eingedreht. Um keine weitere Zeit zu verlieren, hatte Petersen angeordnet, auch die mittlere der drei Dieselmaschinen anzuwerfen und mit Höchstgeschwindigkeit, knapp zwanzig Knoten, zu den Seenotrettern aufzuschließen. Sie passierten das Steubenhöft, ein paar Minuten später die Alte Liebe, die zu dieser frühen Stunde einsam und verlassen dalag.
»›Anneliese Kramer‹«, rief er die Seenotretter über Funk an. »Hier ist die ›Bürgermeister Brauer‹. Wir werden an der Havarieposition in circa dreißig Minuten eintreffen. Bitte um Rückruf über Handy. Over.« Was jetzt zu besprechen war, sollte lieber nicht über die Funkkanäle laufen, die von aller Welt mitgehört werden konnten.
»›Bürgermeister Brauer‹, hier ist ›Anneliese Kramer‹. Bestätige Rückruf via Handy. Ende.«
Nur Augenblicke später klingelte das Smartphone, das Petersen vor sich auf der Steuerkonsole liegen hatte.
»Moin, Hokki«, meldete er sich ohne Umschweife. Man kannte sich. »Wir sind unterwegs zu euch. Ich stelle das Gespräch jetzt auf Lautsprecher. Wir haben die Hauptkommissare Olofsen und Greiner von der Kripo Cuxhaven an Bord. Die beiden möchten sich die Situation vor Ort anschauen.«
Olofsen und Greiner nickten bedeutsam.
»Moin, Jungs«, ertönte wieder die volle, sympathisch klingende Stimme, diesmal über den Lautsprecher, wie Petersen bereits angekündigt hatte. »Hokki Werlops, Vormann der ›Anneliese Kramer‹.« Von Anspannung oder Stress war in der Stimme des Vormanns nichts zu hören. Die Seenotretter sind schon coole Typen, Profis wie wir, ging es Olofsen durch den Kopf.
»Wie ist die Situation?«, fragte Olofsen.
»Unser Problemfall ist eine Segelyacht, zwölf Meter lang«, begann Werlops. »Die Yacht liegt jetzt, da wir Niedrigwasser haben, kurz hinter Tonne 11 im Sand neben dem Fahrwasser. Da uns eine leblose Person an Deck gemeldet wurde, haben wir den Notarzt mitgebracht. Der ist gerade mit unserem Tochterboot auf den Segler umgestiegen. Moment mal.«
Im Hintergrund war ein Stimmengewirr zu hören, das an Bord der »Bürgermeister Brauer« niemand verstehen konnte. »Okay, bin wieder da«, kehrte die Stimme des Vormanns zurück. »Der Notarzt meldet gerade, dass die Person an Deck zweifelsfrei tot ist.«
»Was genau heißt das?«, wollte Greiner wissen.
»Keine Ahnung«, erhielt er Auskunft. »Wir retten Menschen in Not. Mit den Toten kennen wir uns nicht aus.«
Olofsen zog geräuschvoll die Nase hoch.
Werlops sprach weiter: »Aber eure Probleme fangen da erst an. Es soll noch eine zweite Leiche geben. Im Schiffsinneren. Eine Riesensauerei.«
Aha. Nicht gerade eine sehr aussagekräftige Information, aber ein Anfang, dachte Olofsen. »Habt ihr auch etwas Brauchbares für uns?«, murrte er.
»Nur jede Menge Arbeit«, antwortete Werlops. »Ach ja, der Segler wurde zuerst von einer Motoryacht entdeckt, die uns dann alarmiert hat. Ein Mitglied der Motoryachtcrew ist auf den Segler übergestiegen und steht jetzt unter Schock. Wir werden ihn nach Cuxhaven bringen. Der Landrettungsdienst wird sich um ihn kümmern.«
»Okay«, schaltete sich auch Petersen in das Gespräch ein. »Was ist mit den Toten an Bord? Habt ihr die schon geborgen?«
»Nein«, antwortete Werlops.
Bevor er weitersprechen konnte, meldete sich Olofsen zu Wort: »Lasst die Leichen liegen und fasst nichts an. Ich will mir das selbst ansehen. Liegt der Segler noch so, wie ihr ihn gefunden habt?«
»Die Leichen überlassen wir euch gerne. Das ist sowieso nicht unsere Aufgabe. Das Schiff liegt so, wie wir es gefunden haben. Aber es wird vom Sand rutschen, wenn die Tide dreht.«
»Was genau bedeutet das?«, fragte Olofsen.
»Es bedeutet, dass wir den Segler rausziehen und abschleppen werden. Wenn der sich mit dem auflaufenden Wasser losreißt, wird er zu einer Gefahr für die Schifffahrt. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wie lange braucht ihr noch?«
Olofsen sah Petersen an, der angestrengt seinen Kartenplotter fixierte.
»Fünfzehn bis zwanzig Minuten«, sagte er dann.
»Das passt«, antwortete Werlops. »Sobald wir den unter Schock stehenden Patienten an Bord haben, verschwinden wir. Unser Tochterboot bleibt vor Ort und wird den Segler mit dem steigenden Wasser vom Sand ziehen.«
Damit beendete Werlops das Gespräch. Petersen gab umgehend Anweisungen an seine Kollegen, das Tochterboot der »Bürgermeister Brauer« ebenfalls klarzumachen. Es würde Olofsen und Greiner zur Sandbank und zum Segler bringen.
Olofsen betrachtete fasziniert den Fahrstand des Schiffes. Mit einem Blick auf ein kleines, nahezu unauffälliges Handrädchen ganz an der Seite fragte er: »Ist das das Steuer?«
Petersen nickte. »Ja, von den großen Steuerrädern, wie man sie von Traditionsschiffen oder aus Filmen kennt, ist nichts mehr übrig geblieben. Nur noch Minirädchen oder Joysticks.«
Olofsens Augen leuchteten.
»Kaffee?«, wechselte Petersen das Thema, bevor sein Gast noch auf die Idee kam, das Schiff selbst fahren zu wollen.
»Auf gar keinen Fall«, mischte sich Greiner augenblicklich ein.
Petersen schaute ihn überrascht an.
»Die Sauerei, die mein Kollege regelmäßig mit Kaffee veranstaltet, wollt ihr nicht an Bord haben. Eine Tasse hat er heute schon zerdeppert.«
Petersen lachte laut auf.
»Blödmann«, brummte Olofsen und starrte halb andächtig, halb beleidigt aus dem Fenster.
Eine gute Viertelstunde später erreichten sie den Segler. Unterwegs war ihnen die »Seepferdchen« entgegengekommen. Sie hatten den Skipper aufgefordert, im Alten Fischereihafen bei der Dienststelle der Wasserschutzpolizei anzulegen und für eine Befragung erreichbar zu bleiben.
Olofsen und Greiner stiegen in das Tochterboot der »Bürgermeister Brauer«. Das Boot hatte keinen Namen, sondern trug nur die Bezeichnung WS-63. Beide hatten automatische Rettungswesten angezogen und kamen sich darin einigermaßen ungelenk vor. Etwas nervös klammerten sie sich an den Haltegriffen fest und warteten darauf, dass die drei Beamten der Wasserschutzpolizei, die ebenfalls mitkommen würden, die letzten Vorbereitungen abschlossen.
Dann öffnete sich die Klappe der Heckwanne, und das Boot rutschte über die Führungsschienen ins Wasser.
»Hölle«, jaulte Greiner. »Muss das wirklich sein? Ich lass mich in die Alpen versetzen, wenn wir so etwas öfter machen sollen.«
»Schnack nicht rum«, beschied ihm Olofsen. »Alles ist gut.«
Das kleine Boot nahm Kurs auf die Sandbank. Olofsen konnte das Schlauchboot erkennen, das ein Stück weit davor auf dem Sand lag. In geringer Entfernung dümpelte die »Mathias«, das vor Ort gebliebene Tochterboot der »Anneliese Kramer«. Zwei der Seenotretter winkten ihnen zu. Olofsen sah, dass die Schleppleine bereits am Segler angebracht war.
Der Fahrer des Bootes ließ plötzlich den Motor aufheulen, das Boot machte einen Satz nach vorne und sprang förmlich auf den Sand. Zum Segler waren es noch etwas mehr als zehn Meter.
»Dichter kommen wir nicht ran«, sagte einer der beiden Beamten zu Olofsen. »Wir gehen vor, sichern unser Boot und steigen auf den Segler. Anschließend kommt ihr beide rüber.«
»Auf gar keinen Fall«, stellte Olofsen sofort klar. »Das hier ist ein Tatort und damit unsere Spielwiese. Ihr passt auf euer Boot auf und schützt uns vor Haiattacken.«
Kaum hatte er dies ausgesprochen, sprang er in bester Turnermanier über die Bordwand auf den Sand. Dann machte er einen großen, vor Autorität strotzenden Schritt vorwärts, rutschte auf dem schlickigen Untergrund aus und klatschte der Länge nach in eine vor ihm liegende Sandfurche. Zu seinem Leidwesen war diese mit Wasser gefüllt. Nur Sekundenbruchteile später kam der Kontaktgeber seiner Rettungsweste mit dem Wasser in Berührung, woraufhin sich die Weste laut zischend aufblies. Olofsen lag auf dem Bauch in der Wasserlache und zappelte wild herum. In der prall aufgeblasenen Rettungsweste sah er aus wie ein gelb leuchtendes Michelin-Männchen. Hinter sich hörte er lautes Gelächter.
»Das hier ist zwar ein Tatort, aber keine Spielwiese«, schnaubte einer der Wasserschutzbeamten. »Eher ein matschiger Sandkasten.«
Etwas vorsichtiger kletterte Greiner aus dem Boot. Mit kleinen, nach sicherem Halt tastenden Schritten gelangte er zu seinem Kollegen, der sich zwischenzeitlich immerhin auf den Rücken gedreht hatte – was die Situation aber nicht verbesserte, denn nun gab er das Bild eines gestrandeten Wals ab.
»Scheiße, verfluchte«, polterte Olofsen. Bei einem weiteren ungelenken Versuch, aufzustehen, war er erneut im Schlick ausgerutscht. Greiner reichte ihm die Hand.
Mittlerweile waren die beiden Wasserschutzbeamten aus dem Boot gestiegen und kamen auf sie zu. Olofsen, der es nun auf die Beine geschafft hatte, fluchte unflätig vor sich hin. Einer der Beamten mühte sich an der Rettungsweste, um Druck daraus abzulassen, sodass Olofsen sie ausziehen konnte.
»So, nun haben wir alle unseren Spaß gehabt«, sagte Greiner mit der Absicht, zu vermitteln. »An die Arbeit, es gibt einen ernsthaften Grund, aus dem wir hier sind. Ich gehe als Erster an Bord.«
Augenblicke später stand Greiner auf dem Deck des Seglers und ging langsam nach vorne. Er setzte seine Schritte mit Bedacht. Aufgrund der leichten Schräglage des Bootes musste er sich an der Reling abstützen, um nicht abzurutschen.
Er entdeckte die tote Frau im Bug des Schiffes, die der Notarzt bereits mit einem weißen Tuch abgedeckt hatte. Hier verwertbare Hinweise auf den Tathergang zu finden dürfte verdammt schwierig werden, so viel wurde ihm sofort klar. Der Notarzt und die Seenotretter sowie der junge Mann von der Motoryacht waren schon hier gewesen, hatten Dinge angefasst oder ungewollt verändert. Und nun würde Greiners schlammbeschmierter Kollege die Sache auch nicht besser machen.
Wie aufs Stichwort kam ein sichtbar missmutiger Olofsen auf Greiner zugestapft und zog eine nicht zu übersehende Matschspur hinter sich her.
»Und?«, wollte er wissen.
»Weiblich. Tot«, antwortete Greiner. »Zwei Einschusswunden im Brustbereich. So wie die Wunden aussehen, wurden die Schüsse aus nächster Nähe abgegeben.«
»Da muss die Gerichtsmedizin ran«, schloss Olofsen die erste Untersuchung ab.
»Lass uns einen Blick in die Kabine werfen«, sagte Greiner.
Nickend drehte Olofsen sich um und machte sich auf den Weg. Zu seiner Spur aus Matsch äußerte er sich nicht. Am Niedergang zur Kabine zog er jedoch die Schuhe aus, um keinen weiteren Schmutz zu verteilen. Überzieher aus Plastik hatte er leider nicht dabei. Wenn Frank Pall und seine Kollegen von der Tatortgruppe mit der kriminaltechnischen Untersuchung anfingen, würde es wieder ein Heidentheater um die Flusen von Olofsens Socken geben. Aber das war ihm jetzt erst einmal egal.
Er blickte in die Kabine hinein und erbleichte. »Heilige Scheiße«, entfuhr es ihm. Auch Greiner musste schlucken.
Vor ihnen eröffnete sich ein Bild des Grauens. In der wahrscheinlich vormals sehr gemütlichen Kabine waren fast alle Oberflächen schwarz oder dunkelgrau. Die Türen von sämtlichen Schränken und Verschlägen, Teile des Fußbodens, sogar die Kabinendecke sahen aus, als wären sie mit einem Schweißbrenner angebrannt und verkohlt worden. Es roch entsprechend angesengt.
In der Mitte der Kabine, direkt dort, wo die Maststütze positioniert war und sich zu ihrer Befestigung auf dem Kiel des Schiffes fortsetzte, konnten die beiden Polizisten einen Menschen erkennen. Beim Anblick des Mannes fuhr den beiden erneut ein Schauer durch die Glieder. Der Mann saß zusammengesunken und mit unbekleidetem Oberkörper am Fuß der Maststütze. Eine schwere Kette war ihm um den Bauch geschlungen worden und fixierte ihn in dieser Position. Soweit es die Polizisten sehen konnten, wies der Oberkörper zahlreiche Brandwunden auf. Wie schwer die Verbrennungen waren, ließ sich auf die Schnelle nicht erkennen. Es wirkte, als wollte der ganze Körper sich auch jetzt noch mit aller Kraft gegen die Ketten und Flammen wehren.
Mit dem grausigen Anblick der Leiche stieg Olofsen und Greiner auch der widerliche, süßliche Geruch von verbranntem Fleisch in die Nase. Olofsen musste sich abwenden und nach Luft schnappen.
»Zur Hölle«, entfuhr es ihm erneut.
Er war viel gewohnt und hatte insbesondere in seiner Berliner Zeit viele schreckliche Dinge gesehen, aber auch nach all den Dienstjahren machte ihm der erste, manchmal völlig unerwartete Anblick einer derartigen Grausamkeit zu schaffen. Er verstand nicht, wie Menschen dazu fähig sein konnten. Es war ihm schleierhaft, was diese Bestien dazu veranlasste, jede Menschlichkeit über Bord zu werfen und den dunkelsten und niedersten Instinkten freien Lauf zu lassen. Deswegen hatte er sich vor Jahren hinter einer hohen Mauer aus mit Zynismus überzogener Ironie verschanzt. Bis ihm klar geworden war, dass Zynismus ihn zwar vor den Schrecken seiner Arbeit schützte, ihn aber auch zu einem unausstehlichen Arschloch gemacht hatte, mit dem niemand mehr etwas zu tun haben wollte. Also war er von Berlin nach Cuxhaven gewechselt, in der Hoffnung, an der Nordseeküste könnte dieser Panzer Stück für Stück zerbröckeln, von Wind und Sand abgeschliffen werden. Im beschaulichen Cuxland, so seine Idee, würde es derartige Gewaltexzesse nicht geben.
»Was ist hier passiert?«, fragte Greiner und holte seinen Partner wieder in die Gegenwart zurück. In seiner Stimme schwang Entsetzen.
»Der Teufel persönlich hat hier eine Party gefeiert«, entfuhr es Olofsen leise. Er hatte seinen Zynismusgenerator angeworfen.
»Aha.«
Vorsichtig machte Olofsen einen Schritt in die Kabine hinein.
»Dir ist klar, dass Pall mit dir auch eine Party feiert, wenn du hier Spuren kontaminierst«, kommentierte Greiner mit leiser Stimme den Vormarsch seines Kollegen.
Frank Pall war der Leiter der Tatortgruppe der Cuxhavener Polizeiinspektion und damit Herr über Spuren und Beweismittel in einem Kriminalfall. Olofsen und Pall kamen gut miteinander aus – aber beide waren Alphatiere und extreme Dickköpfe. Die Wortgefechte, die sich die beiden regelmäßig lieferten, waren in Polizeikreisen bereits legendär.
»Ich denke, du hast recht«, lenkte er ein. »Frank muss das hier genauestens untersuchen.« Damit drehte er sich um und verließ die Kabine.
Greiner folgte ihm und sog die frische, kühle Nordseeluft in seine Lungen. Das Bild der an die Maststütze gebundenen und geschundenen Leiche konnte er jedoch auch damit nicht von seinem inneren Auge löschen.
An Deck trafen sie wieder auf die beiden Beamten der Wasserschutzpolizei. Sie hatten die erste äußerliche Inspektion des Schiffes beendet.
»Was gefunden?«, fragte Olofsen.
»Kommt alles in den Bericht.«
»Erstklassig«, pflaumte Olofsen ihn sofort an. »Bekomme ich eine handkolorierte Abschrift davon? Oder darf ich jetzt schon die Kurzversion hören?«
Der Beamte sah ihn verdattert an.
»Die Kurzversion. Heute noch«, blaffte Olofsen. »Und das Schiff – wie heißt es, woher kommt es, wem gehört es?«
Der andere Beamte räusperte sich. »Also, das mit dem Schiffsnamen ist zumindest hier draußen ein Problem.« Er deutete auf den Heckspiegel. »Name und Kennung sind komplett unkenntlich gemacht worden, ebenso am Bug. Hier und jetzt können wir den Eigner nicht identifizieren. Ansonsten scheint das gesamte Schiff äußerlich in Ordnung zu sein. Wir haben keine Schäden erkennen können, die das Auftreiben auf den Sand erklären würden.«
»Das Schiff ist also nicht zufällig hier aufgelaufen?«, fragte Greiner.
»Das ist unwahrscheinlich. Dazu liegt es zu hoch auf dem Sand. Außerdem wurde der Anker ausgebracht. Wahrscheinlich wurde das Schiff mit dem ablaufenden Hochwasser in voller Absicht hierhergesteuert, und anschließend ist es trockengefallen. Erstaunlich ist, dass sich der Kiel langsam in den weichen Sand gebohrt und das Schiff weitgehend aufrecht gehalten hat.«
»Und wie geht’s jetzt weiter?«, fragte Olofsen.
»Die Seenotretter müssen auf das auflaufende Wasser warten, um das Boot freischleppen zu können. In der Zwischenzeit sehen wir uns die nautischen Details an.«
»Wann wird das Wasser auflaufen?«, fragte Greiner.
Einer der beiden Beamten warf einen Blick auf seine Uhr. »Tatsächlich ist der Strom bereits gekentert«, sagte er.
»Hä?«, entfuhr es Olofsen.
»Die Ebbe hört auf, die Flut kommt«, erläuterte Greiner mit spöttischem Ton. An die beiden anderen Beamten gewandt flüsterte er: »Überfordert meinen Kollegen nicht mit Seemannslatein.«
»Klugschnacker«, kommentierte Olofsen, der die Worte seines Kollegen trotz Flüsterns gehört hatte.
Die beiden Wasserschutzpolizisten entfernten sich langsam in Richtung des Kabineneingangs.
»Wo wollt ihr denn wohl hin?«, rief Olofsen ihnen nach.
»Nach unten. Funkanlage, Karteneinträge und nautische Instrumente prüfen. Wenn wir das Logbuch oder Funkrufzeichen da unten finden, können wir damit Schiffsname und Eigner ermitteln.«
»Nix da«, beschied ihnen Olofsen. »Da unten ist Sperrgebiet, bis die Spurensicherung drin war. Und ganz ehrlich – ihr wollt da nicht runter.«
Kurze Zeit später waren alle Polizisten zurück auf der »Bürgermeister Brauer«. Das Tochterboot lag längsseits vertäut. Auf der kurzen Rückfahrt fiel Olofsen auf, dass das Wasser merklich angestiegen war und die Strömung nun in die andere Richtung, elbaufwärts, zog.
Auf der Brücke des Polizeischiffes bat Olofsen darum, eine Verbindung zur Polizeiinspektion herzustellen, um die Kollegen dort ins Bild zu setzen und die nächsten Schritte abzusprechen. Petersen legte das Gespräch auf den Lautsprecher, sodass alle mithören konnten. Er schlug vor, auch das Maritime Sicherheitszentrum in Cuxhaven sowie die Kollegen der Wasserschutzpolizei an Land in das Gespräch einzubinden.
Olofsen fasste die Situation für alle in wenigen Sätzen zusammen.
»Was passiert als Nächstes?«, fragte Nunk aus der Polizeiinspektion.
»Die ›Anneliese Kramer‹ ist auf dem Weg zurück, um den unter Schock stehenden Motorbootfahrer an den Landrettungsdienst zu übergeben«, sagte Petersen. »Wir bleiben vor Ort und begleiten den Schleppverband.«
»Wohin schleppen wir den Segler?« Greiner sah fragend in die Runde.
»Die Anleger am Wasser- und Schifffahrtsamt und am MSZ sind momentan alle frei.« Die Stimme gehörte dem Kollegen vom Maritimen Sicherheitszentrum. »Da können wir das Schiff weitgehend abgeschirmt festmachen und untersuchen. Unbefugte kommen da nicht hin.«
»Einverstanden«, sagte Olofsen. »Und Frank soll sofort rauskommen und den Segler unter die Lupe nehmen. Wir müssen schnellstens herausfinden, was hier passiert ist.«
»Er ist schon informiert«, antwortete Nunk.
»Wir gehen von Mord aus«, sagte Greiner. »Die Staatsanwaltschaft muss ebenfalls eingeschaltet werden.«
»Auch das ist bereits geschehen«, antwortete Nunk. »Sowohl in Bremerhaven als auch in Stade wissen sie Bescheid. Da es sich wohl um Mord handelt, übernimmt die Staatsanwaltschaft Stade. Die Bremerhavener haben nichts dagegen, da sie lieber bei ihren maritim gelagerten Fällen ohne Tote bleiben wollen. Arne, Martin, setzt euch nach eurer Rückkehr umgehend mit dem Staatsanwalt in Verbindung.«
»Geht klar«, sagte Olofsen.
Petersen sprang von seinem Sitz auf. »Okay, Leute. Es geht los. Die ›Mathias‹ beginnt jetzt mit dem Schleppmanöver.«
Das Segelboot war vollständig von Wasser umspült. Die Leine zum Boot der Seenotretter straffte sich, dann begann das Wasser hinter der »Mathias« zu brodeln, als der Motor seine geballte Kraft an den Propeller weitergab. Trotzdem bewegte sich der Segler nicht von der Stelle. Den Seenotrettern blieb nichts anderes übrig, als ein wenig zu warten und es erneut zu versuchen. Nach einigen zäh dahinfließenden Minuten heulte der Motor abermals auf. Es ruckte, und dann glitt das Segelboot langsam und schwerfällig vom Sand ins freie Wasser.
»Mächtig Kraft in dem Bötchen.« Olofsen war beeindruckt.
»Das hat ja besser geklappt als gedacht«, sagte Petersen, als Olofsen und Greiner wieder bei ihm waren. »Wir werden jetzt querab den Schleppzug nach Cuxhaven begleiten«, erklärte er und zeigte mit einer Hand nach hinten.
Olofsen drehte sich um und konnte durch das kleine Fenster ein riesiges Containerschiff erkennen.
»Mit dem auflaufenden Wasser kommen auch die dicken Pötte, die nach Hamburg wollen. Die müssen hier in der Elbmündung zwar die Geschwindigkeit reduzieren, aber da sie jetzt mit dem Strom fahren, geht das nur eingeschränkt, wenn sie nicht die Steuerfähigkeit verlieren wollen. Wollen wir hoffen, dass die Heckwellen uns nicht zu sehr durchschaukeln.«