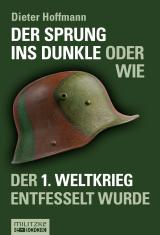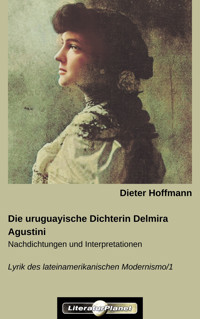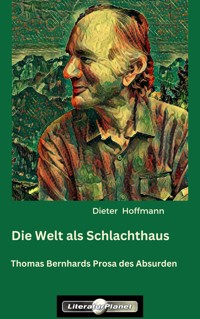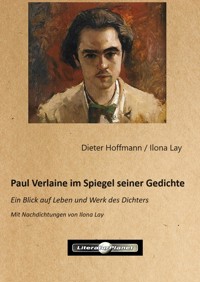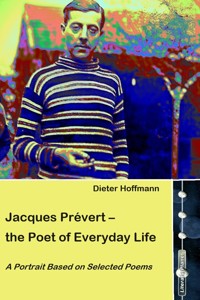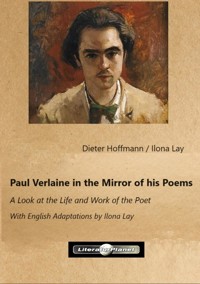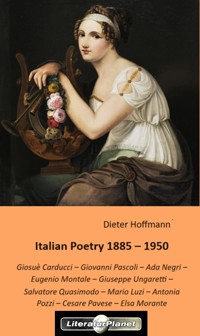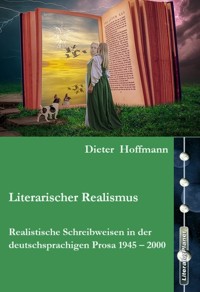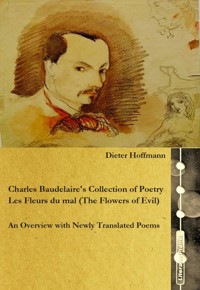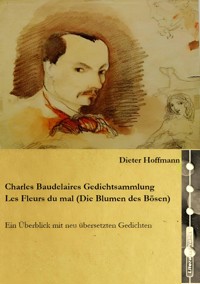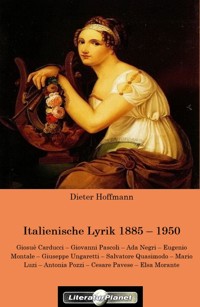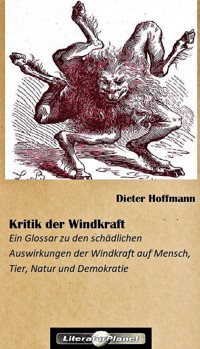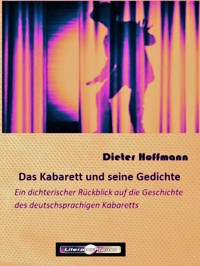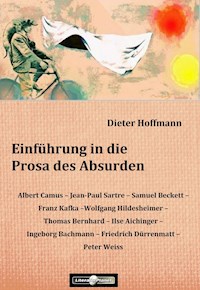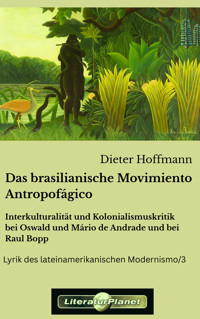
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: LiteraturPlanet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die brasilianische anthropophagische ("Menschenfresser-")Bewegung nutzte Ende der 1920er Jahre das Menschenfresserbild, um dem "Aufgefressenwer¬den" des Landes in der Kolonialzeit einen eigenständigen kulturellen "Appetit" gegenüberzustellen. An die Stelle des Dominanzanspruchs einer einzigen Kultur setzte sie das Ideal einer gegenseitigen Befruchtung der Kulturen. Der Band beleuchtet das Schaffen von Oswald und Mário de Andrade und von Raul Bopp
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dieter Hoffmann
Das brasilianische Movimiento Antropofágico
Interkulturalität und Kolonialismuskritik
bei Oswald und Mário de Andrade und bei Raul Bopp
Lyrik des lateinamerikanischen Modernismo/3
Literaturplanet
Impressum
© LiteraturPlanet, 2025
Wilhelmstr. 58, 66589 Wemmetsweiler
http://www.literaturplanet.de
Band 3 der Reihe Lyrik des lateinamerikanischen Modernismo
Band 1:Die uruguayische Dichterin Delmira Agustini. Nachdichtungen und Interpretationen (PDF und Ebook).
Band 2: Rebellische Poetin und poetische Rebellin. Die brasilianische Dichterin Patricia Galvão (Pagu); PDF
Über dieses Buch:
Die brasilianische anthropophagische ("Menschenfresser-")Bewegung nutzte Ende der 1920er Jahre das Menschenfresserbild, um dem "Aufgefressenwerden" des Landes in der Kolonialzeit einen eigenständigen kulturellen "Appetit" gegenüberzustellen. An die Stelle des Dominanzanspruchs einer einzigen Kultur setzte sie das Ideal einer gegenseitigen Befruchtung der Kulturen.
Auf Literaturplanet zum Hören gibt es auch einen Podcast zur anthropophagischen Bewegung.
Informationen über den Autor finden sich auf seinem Blog (rotherbaron.com) oder auf Wikipedia.
Cover-Bild: Henri Rousseau (1844 – 1910): Die Schlangenbeschwörerin (1907); Paris, Musée d'Orsay (Wikimedia commons)
Vorwort
"Movimiento Antropofágico" – wörtlich übersetzt bedeutet das "Menschenfresserbewegung". Das klingt nicht gerade nach einer humanen Thematik.
Allerdings handelt es sich bei dem Begriff lediglich um eines jener bewusst provokanten Labels, wie sie für die Manifeste-Literatur aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts typisch waren. Gemeint ist damit, kurz gesagt, eine kulturelle Praxis, bei der eine Kultur sich Elemente einer anderen Kultur "einverleibt" bzw. anverwandelt und auf diese Weise in einen lebendigen interkulturellen Dialog mit dieser eintritt.
Das Label ist demnach als Abwehr hegemonialer Kulturpraktiken gedacht, bei der die dominante Kultur die Minderheitenkulturen überwölbt und in diesem Sinne "kannibalisiert". Diesem destruktiven kulturellen Kannibalismus wird eine kulturelle Praxis gegenübergestellt, bei der die Kulturen gleichberechtigt neben- und miteinander existieren und sich gegenseitig befruchten.
Dieser Ansatz scheint gerade in der heutigen Zeit, wo die Berührung mit fremden Kulturen vielfach wie eine ansteckende Krankheit wahrgenommen und entsprechend abgewehrt wird, von besonderem Interesse. Deshalb wird ihm hiermit eine eigene kleine Studie gewidmet, natürlich ohne dabei den spezifisch brasilianischen Kontext aus den Augen zu verlieren, in dem er entstanden ist.
Der Veranschaulichung von Hintergründen, kunsttheoretischer Fundierung und literarischer Praxis der "anthropophagischen Bewegung" dient das Werk von Oswald de Andrade, dem – nicht mit ihm verwandten – Mário de Andrade sowie von Raul Bopp (dessen Nachname auf seine deutschen Vorfahren verweist).
Alle drei Autoren haben die Bewegung in besonderer Weise geprägt: Oswald de Andrade ist mit seinem Manifesto da Poesia Pau-Brasil und seinem Manifesto Antropófago der wichtigste Theoretiker der Bewegung. Mário de Andrade hat – auch wenn er sich nicht als aktives Mitglied daran beteiligt hat – mit Macunaíma den bedeutendsten Roman der Bewegung geschrieben, Raul Bopp mit Cobra Norato und Urucungo ihre Ideen am konsequentesten in Lyrik umgesetzt.
Da dieser Band als Teil der Reihe "Lyrik des lateinamerikanischen Modernismo" erscheint, gilt das besondere Augenmerk natürlich dem dichterischen Werk der drei Autoren, aus dem exemplarisch ausgewählte Gedichte in deutschen Nachdichtungen präsentiert werden. Dabei wird das Werk von Raul Bopp den größten Raum einnehmen, da es am deutlichsten lyrisch geprägt ist.
Andererseits lässt sich gerade das Werk von Oswald und Mário de Andrade nicht angemessen würdigen, ohne dass auch auf ihr übriges literarisches Werk eingegangen wird. Dies kann zudem einen Eindruck von dem Dialog zwischen den einzelnen Genres und Künsten vermitteln, der im Fall der anthropophagischen Bewegung besonders intensiv war.
Einführung: Anthropophagische Bewegung und brasilianische Identitätssuche
Erstveröffentlichung von Oswald de Andrades Manifesto antropófago in der Zeitschrift Revista de Antropofagia; in der Mitte eine Zeichnung mit den äußeren Konturen des Gemäldes Abaporu (Menschenfresser) von de Andrades damaliger Gattin Tarsila do Amaral (1886 – 1973); Wikimedia commons
Der Weg Brasiliens in die Unabhängigkeit
1807, 300 Jahre nach dem Beginn der Kolonisierung durch Portugal, setzte der Unabhängigkeitsprozess Brasiliens ein. Eingeleitet wurde er durch den Einmarsch französischer Revolutionstruppen nach Portugal. Der portugiesische König João VI. floh daraufhin nach Brasilien und machte Rio de Janeiro zur Hauptstadt des portugiesischen Weltreichs. Auf dem Wiener Kongress, wo über die Neuordnung der europäischen Staaten und ihrer Kolonien nach den Kriegen gegen das revolutionäre Frankreich beraten wurde, erhielt Brasilien schließlich den Status einer gleichberechtigten Entität im Rahmen des Vereinigten Königreichs von Portugal, Brasilien und der Algarve.
Als João VI. 1821 nach Portugal zurückkehrte, setzte er seinen Sohn, Pedro I., als Statthalter ein. Dieser erklärte sich ein Jahr später zum Kaiser von Brasilien und rief die Unabhängigkeit des Landes aus, um einen gegen das Königshaus gerichteten Militärputsch abzuwenden und das Land dem Einfluss der Cortes, der portugiesischen Ständeversammlung, zu entziehen. Aufgrund von Thronwirren nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1826 und fortgesetzten Protesten gegen seine Herrschaft in Brasilien kehrte er schließlich 1831 nach Portugal zurück.
1840 übernahm der Sohn von Pedro I. als Pedro II. die Macht in Brasilien, nachdem für den Minderjährigen zuvor ein Regentschaftsrat die Geschicke des Landes bestimmt hatte. Seine Herrschaft dauerte bis 1889, als es nach Protesten von Großgrundbesitzern gegen die Abschaffung der Sklaverei zu einem Militärputsch kam. Die daraufhin vom Militär ausgerufene Republik war de facto eine Oligarchie, die auf der Herrschaft der großen Kaffee- und Kautschukbarone beruhte.
Diese so genannte "República Velha" (Alte Republik) geriet Ende der 1920er Jahre ins Wanken, als der bereits seit Längerem andauernde Verfall der Kautschuk- und Kaffeepreise durch die Weltwirtschaftskrise verschärft wurde. In der Folge kam es 1930 zu einem erneuten Militärputsch, der den unterlegenen Kandidaten der Präsidentschaftswahlen, Getúlio Vargas, an die Macht brachte.
Vargas leitete zunächst einige Neuerungen ein, die zur Stabilisierung der Wirtschaft beitrugen und auch Sozialreformen beinhalteten. Nachdem er seine Herrschaft 1934 durch Wahlen hatte legitimieren lassen, rief er jedoch 1937 nach Vorbild der portugiesischen Salazar-Diktatur den "Estado Novo" ins Leben und regierte das Land spätestens ab diesem Zeitpunkt diktatorisch. Dabei stützte er sich auf die alten oligarchischen Strukturen.
Vargas blieb jedoch abhängig von der Macht des Militärs, das ihn 1945 zum Rücktritt zwang. Nachdem er 1950 noch einmal zum Präsidenten gewählt worden war, ließ das Militär ihn 1954 endgültig fallen, als er in ein Attentat auf einen Oppositionspolitiker verwickelt war – woraufhin Vargas seinem Leben selbst ein Ende setzte.
Auf der Suche nach einer brasilianischen Identität
Der kurze Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass die politische Unabhängigkeit Brasiliens keineswegs mit einer kulturellen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit einherging. Durch die enge, auch personelle Verbindung mit dem portugiesischen Königshaus blieb das ehemalige Mutterland auch danach noch jahrzehntelang der zentrale Bezugspunkt.
Dies änderte sich auch durch die Abdankung des Königs vorerst nicht. Der brasilianischen Oberschicht ging es nicht um kulturelle Selbstbestimmung, sondern vor allem darum, ihren Geschäften ungestört nachgehen zu können. Bezeichnenderweise war die Auslösung für das Ende der Monarchie denn auch das sozialreformerische Engagement des Königs.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Intellektuellenkreisen daher immer häufiger die Frage diskutiert, ob und wie die brasilianische sich von der portugiesischen Kultur unterscheide und ob es überhaupt so etwas wie eine spezifisch brasilianische Identität gebe. Diese Diskussionen intensivierten sich im Umfeld der Feierlichkeiten zum einhundertsten Jahrestag der Unabhängigkeit im Jahr 1922.
Besondere Bedeutung erlangte dabei die so genannte "Grupo dos Cinco" (Fünfergruppe), die aus den Malerinnen Anita Malfatti und Tarsila do Amaral, den – nicht miteinander verwandten – Schriftstellern Oswald und Mário de Andrade sowie dem sowohl schriftstellerisch als auch in der bildenden Kunst aktiven Paulo Menotti Del Picchia bestand. Ausgangspunkt ihrer Zusammenarbeit war eine Ausstellung von Anita Malfatti, auf der diese zum Jahreswechsel 1917/18 ihre von Kubismus und Expressionismus beeinflussten Werke vorstellte.
Die heftigen Gegenreaktionen, welche die Ausstellung im konservativen brasilianischen Kulturbetrieb auslöste, führten dazu, dass die an der künstlerischen Moderne orientierten Intellektuellen sich enger zusammenschlossen und sich gegenseitig in ihrer Arbeit unterstützten. Ein erster Höhepunkt dieser Zusammenarbeit war die maßgeblich von Mitgliedern der Grupo dos Cinco vorangetriebene Semana de Arte Moderna (Woche der Modernen Kunst), ein Kulturfestival, das im Februar 1922 in São Paulo stattfand. Ziel des Festivals war es, durch Ausstellungen und Veranstaltungen zu moderner Kunst und Literatur Impulse für eine Erneuerung der brasilianischen Kultur zu geben.
Die Geburt der anthropophagischen Bewegung
Die anthropophagische Bewegung hat ihren Ursprung ebenfalls in der Grupo dos Cinco. Deren kreativ-kritischer Geist prägte auch die Diskurse, aus denen die Bewegung sich schließlich 1928 als eigenständige Erscheinungsform in der brasilianischen Kunstszene herausschälte.
In diesem Jahr entstand das berühmte Gemälde Abaporu von Tarsila do Amaral. Außerdem veröffentlichte Oswald de Andrade, der von 1926 bis 1929 mit der Künstlerin verheiratet war, in dem Jahr das Manifesto antropófago ("Anthropophagische Manifest"), das in seiner Erstveröffentlichung in der Revista de Antropofagia auch eine Zeichnung mit den äußeren Konturen des Gemäldes enthielt.
"Abaporu" bedeutet in der Sprache der Tupi, der neben den Guaraní wichtigsten indigenen Volksgruppe auf dem Boden des heutigen Brasiliens, "Anthropophage", also Menschenfresser. Tarsila do Amaral kreierte demnach das ikonische Gemälde der Bewegung, ihr damaliger Ehemann Oswald de Andrade lieferte die kunsttheoretischen Begründungen.
Sigmund Freuds Totem-Theorie als theoretischer Referenzpunkt
Referenzpunkt für die Überlegungen de Andrades ist Sigmund Freuds 1913 erschienene Schrift Totem und Tabu, auf die er in seinem Manifest an mehreren Stellen Bezug nimmt. Darin stellt Freud die These auf, dass in der Urhorde der Vater von seinen Söhnen getötet und anschließend verspeist worden sei [1].
Grund für den Vatermord war laut Freud das Inzestverbot. Als eine Art Sühne für diese Ursünde sei nachfolgend in dem Totemtier der ermordete Ahne verehrt worden, was nachträglich zu einer umfassenden Durchsetzung des Inzestverbots geführt habe. Dieses habe sich danach auf alle dem Totem zugeordneten Personen, also nicht nur auf den Familienclan im engeren Sinn, bezogen.
De Andrade bezieht sich in seinem Anthropophagischen Manifest insbesondere auf die identitätsstiftende Bedeutung des urtümlichen kannibalistischen Aktes. Demnach ist die Einverleibung des Urvaters durch seine Söhne als symbolische Handlung zu verstehen. Diese stellt sicher, dass das geistige Erbe des Vaters in seinen Nachkommen weiterlebt, ohne dass es sie jedoch in ihrer kreativen Entfaltung hemmt.
Als Teil ihres eigenen geistigen Potenzials können die Nachkommen das geistige Erbe der Vorfahren frei verwenden und an ihre jeweiligen Bedürfnisse und die äußeren Gegebenheiten anpassen. In diesem Sinne spricht de Andrade von der Notwendigkeit einer "permanenten Verwandlung von Tabu in Totem" (MA 4).
Übertragen auf die Beziehung zum ehemaligen Mutterland Portugal und auf die europäische Geistesgeschichte im Allgemeinen bedeutet dies, dass die brasilianische Kultur diesen gegenüber mit einem größeren Selbstbewusstsein auftreten sollte: Sie soll sich lediglich das "einverleiben", was ihr für ihre eigene Entfaltung von Nutzen ist, anstatt sich wie bisher sklavisch an Entwicklungen anzupassen, die auf ihre eigene Realität gar nicht oder nur bedingt zu übertragen sind.
Emanzipatorischer Kern der anthropophagischen Bewegung
Die anthropophagische Bewegung war demnach in erster Linie ein Ausdruck für geistige Emanzipationsbestrebungen innerhalb der brasilianischen Intellektuellenszene. Die Abgrenzung zur europäischen Leitkultur erfolgte dabei auf zwei Ebenen:
Zum einen wurden Praktiken und Theoreme der modernen Kunst rezipiert, die als antitraditionalistisch und damit den eigenen Autonomiebestrebungen analog wahrgenommen wurden.
Zum anderen wurde auf Elemente der indigenen Kulturen Brasiliens Bezug genommen, die als Antithese zur europäischen Kultur und Geistesgeschichte herausgestellt wurden.
Beide Aspekte ließen sich insofern gut miteinander verbinden, als die moderne Kunst in der Malerei maßgeblich von der Unterströmung des Primitivismus beeinflusst war. Gemeint war damit eine Rückkehr zu den als urtümlich empfundenen Lebens- und Kunstformen indigener Völker.
Einen unmittelbaren Ausdruck fand diese Haltung etwa im Werk Paul Gauguins. Indirekt ist hiervon aber auch der Kubismus beeinflusst, insbesondere im Werk Pablo Picassos.
Die drei Phasen der anthropophagischen Bewegung
1977 veröffentlichte Raul Bopp einen Essay, in dem er rückblickend Entstehung und Entwicklung der anthropophagischen Bewegung skizzierte. Die Arbeit ist deshalb von besonderem Interesse, weil hier aus einer Innensicht auf Geschichte und Entwicklungsdynamik der Bewegung zurückgeschaut wird.
Bopp unterscheidet drei Phasen bei der Entwicklung der anthropophagischen Bewegung. Außerdem geht er ausführlich auf deren Vorgeschichte ein.
Vorgeschichte
Bopp verweist zunächst auf die lange Prägung der brasilianischen Geschichte durch die Kolonialherren. Diese hätten die Sprache in ein enges Korsett gezwängt, um das Geistesleben an die Entwicklung im Mutterland zu binden. In der Literatur seien dieselben Motive verwendet worden wie in der Heimat der Eroberer.
Auf diese Weise habe "kein direkter Dialog mit der Umgebung" entstehen können. Die sozialen Verhältnisse hätten sich nicht in der Literatur widergespiegelt. Arbeiteraufstände und politische Unterdrückung seien schlicht ignoriert worden. Stattdessen habe man nach arkadisch-bukolischem Vorbild die "liebliche Schäferin" besungen (VMA 25).
Nach der Unabhängigkeit habe es zwar "einige zögerliche Versuche" gegeben, "Begriffe aus der Umgangssprache" des brasilianischen Alltags in die Literatur zu integrieren. Insgesamt sei es aber bei einer Konzentration auf klassische Themen und antike Stoffen geblieben, die nichts mit der brasilianischen Realität zu tun gehabt hätten (ebd.).
Dagegen wandte sich laut Bopp einhundert Jahre nach der Unabhängigkeit "die modernistische Reaktion von 1922", mit ihrem Kristallisationspunkt der Semana de Arte Moderna. In der Literatur habe dies inhaltlich zu einer Annäherung an volkstümliche Motive und formal zu freieren Ausdrucksformen geführt. In der Lyrik sei hierdurch eine Lösung vom Reimzwang und eine Hinwendung zu freirhythmischen Versen bewirkt worden.
Vielfach seien dabei allerdings auch die alten Themen aufgegriffen und lediglich mit einem "modernistischen Anstrich" versehen worden. Zudem hätten sich die Auswirkungen der modernistischen Revolte auf die urbanen Zentren des Landes beschränkt (VMA 25 f.).
Erste Phase: Spontaneistischer Selbstfindungsprozess
So hat sich die brasilianische Kunstszene durch die Diskussionen im Umfeld der Semana de Arte Moderna Bopp zufolge zwar "aus ihrer Erstarrung" gelöst. Einen grundlegenden Wandel habe sie jedoch zunächst nicht zur Folge gehabt. Das Verdienst der anthropophagischen Bewegung sieht Bopp eben darin, hierfür der Katalysator gewesen zu sein.
Bopp beschreibt die Bewegung in ihren Anfängen als Ausdruck einer geistigen "Unruhe", die in der damaligen Intellektuellenszene geherrscht habe. Mit ihrem "jungen, unabhängigen, spöttischen und kritischen Geist" und ihren "gewagten Satiren" habe sie die bestehenden Machtverhältnisse erschüttert und einen "Umsturz" der alten, leblosen Werte bewirkt (VMA 26).