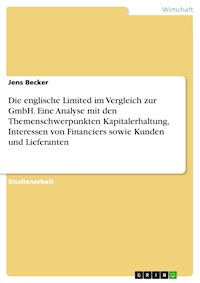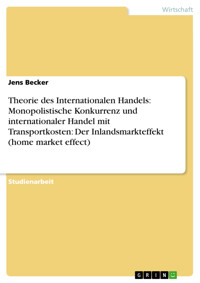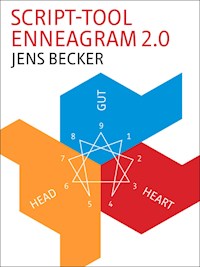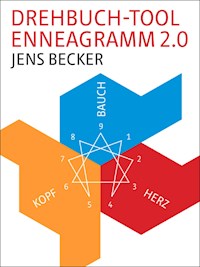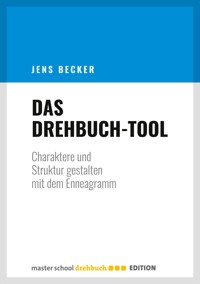
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Master School Drehbuch E.K.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Enneagramm beschreibt neun verschiedene Charakterprofile und leitet daraus eine Vielzahl von Beziehungskonstellationen und Persönlichkeiten ab. Jens Becker erschließt die legendäre Typenlehre aus der Antike für die Drehbuchschreibenden von heute. Er entdeckt sie neu als Instrument zur Entwicklung dynamischer Stoffe und Figuren. In seine Überlegungen zum Enneagramm fließen Erkenntnisse aus Psychologie und Soziologie mit ein. Jens Beckers Drehbuch-Tool hilft, glaubhafte Charaktere und Ensembles zu entwerfen. Darüber hinaus enthält es ein eigenes Strukturmodell, mit dem fesselnde und bewegende Handlungsstränge entwickelt werden können. Wenn Sie den nächsten Schritt Ihrer Figuren nicht kennen, wenn Ihr Plot zu spannungsarm ist, wenn es Ihren Charakteren noch an Tiefe mangelt, wird Ihnen dieses Buch den Weg weisen. Jens Becker bereitet das Enneagramm für alle auf, die Drehbücher schreiben oder die an einem Roman, einer Erzählung oder einem Theaterstück arbeiten. Im Buch finden Sie außerdem den Zugang zu einer Website mit zahlreichen Vertiefungen und einigen szenischen Beispielen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: Dominik Kollang
Jens Becker wurde 1963 in Berlin geboren. Er lebt in Mecklenburg-Vorpommern.
Von 1984–1992 studierte er Filmregie an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg. Seitdem drehte und schrieb er über 70 Spielfilme, Dokumentarfilme, Dokudramen, Drehbücher und Sachbücher, unter anderem ADAMSKI, TATORT, HENKER – DER TOD HAT EIN GESICHT, KRIEG IN DER ARKTIS, NELLYS ABENTEUER, ERICH MIELKE –
MEISTER DER ANGST und 1918. AUFSTAND DER MATROSEN. Außerdem arbeitet er als Dramaturg und Script Consultant für Filme und Serien.
Wichtige Auszeichnungen: Preis der Jury beim Max-Ophüls-Preis 1994, Förderpreis Kunstpreis Berlin der Akademie der Künste 1994, Journalistenpreis Thüringen 2003, Grimme-Preis 2011, Gryphon Award Giffoni 2016.
Er ist Mitglied im Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) und im Verband für Film- und Fernsehdramaturgie (VeDRA). 1993–1994 war er Meisterschüler an der Akademie der Künste Berlin bei Wim Wenders. Von 2004 bis heute unterrichtet er als Professor für Drehbuch an der Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ (früher „Hochschule für Film und Fernsehen“).
Bitte besuchen Sie auch diese Websites:
www.drehbuch-tool.de
www.jensbecker.info
AUS FREUDE AM DENKEN!
Schriften zu dramaturgischen und filmwissenschaftlichen Aspekten
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine gelungene Stoffentwicklung maßgeblich für gute Filme und Serien ist und dass man nie genug darüber wissen kann.
Die Master School Drehbuch bietet seit 1995 Seminare und Lehrgänge in den Bereichen Drehbuchschreiben und Dramaturgie an. Der stets angeregte Austausch im Kolleg:innenkreis und unter den Freund:innen der Schule war unsere Motivation, im Jahr 2015 die Master School Drehbuch EDITION zu gründen.
Es macht uns Freude, tiefer in dramaturgische und filmwissenschaftliche Themen einzusteigen. Wir finden es wichtig, unser Know-how anderen zugänglich zu machen.
INHALT
VORWORT
VORFILM
1. Mensch und Figur
2. Individualität und Gruppenverhalten
2.1 Freiheit und Norm
2.2 Geschlechtsunterschiede und Geschlechterrollen
2.3 Erziehung
3. Selbsterkenntnis und Wahrnehmungslücken
3.1 Stereotyp und Vorurteil
3.2 Dreiteilung der Seele: Kognition, Emotion, Motivation
3.3 Die Faszination des Bösen und der Macht
4. Zögern und Handeln
HAUPTFILM
5. 1. AKT: CHARAKTERMODELL
5.1 Vom Problem der Glaubwürdigkeit
5.2 Wissenschaftliche und esoterische Ansätze
5.3 Das Enneagramm als empirisches Erkenntnismodell
5.4 Das Enneagramm-Charaktermodell in der Übersicht
5.5 Das Enneagramm-Charaktermodell im Detail
Charakter 1 – Perfektionisten / Idealisten / Dogmatiker
Charakter 2 – Helfer / Fürsorgliche / Besitzergreifende
Charakter 3 – Macher / Dynamiker / Blender
Charakter 4 – Seismografen / Individualisten / Melancholiker
Charakter 5 – Beobachter / Denker / Geizige
Charakter 6 – Loyale / Skeptiker / Ängstliche
Charakter 7 – Hedonisten / Optimisten / Maßlose
Charakter 8 – Bosse / Kämpfer / Triebhafte
Charakter 9 – Vermittler / Friedliebende / Unentschlossene
5.6 Praktisches Anwendungsbeispiel
6. 2. AKT: STRUKTURMODELL
6.1 Das Enneagramm-Strukturmodell in der Übersicht
6.2 Das Enneagramm-Strukturmodell im Detail
Step 1 – Anfang
Step 2 – Störung
Impuls 3 – Herausforderung
Step 4 – Widerstand
Step 5 – Optimieren
Impuls 6 – Höhepunkt
Step 7 – Erwachen
Step 8 – Energie
Impuls 9 – Entscheidung
Step 1 – Ende
7. 3. AKT: ANALYSEMODELL
7.1 Analyse Billy ELLIOT
7.2 Analyse ZIEMLICH BESTE FREUNDE
7.3 Analyse ANTICHRIST
7.4 Analyse LOST IN TRANSLATION
7.5 Analyse BABEL
7.6 Analyse TRIANGLE OF SADNESS
7.7 Analyse BRIDGERTON (Staffel 1)
ABSPANN
Danksagung
Literatur
Übersicht: Enneagramm-Charaktermodell
Übersicht: Enneagramm-Strukturmodell
VORWORT
Sagen lassen sich die Menschen nichts; aber erzählen lassen sie sich alles.Bernard von Brentano
Die Welt ist voller Geschichten, die erzählt werden wollen. Komische, tragische, absurde, aufregende, provokante, lustvolle, authentische und versponnene. Immer wieder dieselben Geschichten. Und doch immer wieder neu.
Wenn ich erzähle, bin ich dicht bei anderen Menschen und dicht bei mir. Ich erfinde mir die Welt neu und erkenne mich darin selbst. Was kann schöner sein?! Über meinem Schreibtisch hängt ein Spruch:
A pencil and a dream can take you anywhere.
Ich schreibe über alles, was mich beschäftigt. Manche Geschichten entstehen so über Nacht, andere brauchen viele Jahre. Ich kann es mir als Autor nicht aussuchen, was die Geschichten mit mir vorhaben. Ich lasse es einfach zu, was bleibt mir übrig. Vom Schreiben zu leben, heißt auch, über das Schreiben nachzudenken.
Wie kann man die Geschichte pointierter erzählen, welche Eigenschaft braucht diese Protagonistin zwingend und welche dunkle Seite hat jene Nebenfigur?
Wer regelmäßig schreibt, wird daher mit der Zeit auch zum professionellen Leser1. Das lässt sich nicht vermeiden. Man wächst zugleich an den eigenen Fehlern und lernt aus 2500 Jahren Narrationsgeschichte.
Das Regelwerk des Erzählens heißt Dramaturgie. Was ich an der Dramaturgie liebe? Dass sie mir zugleich einen Halt gibt und Bewegungsfreiheit. Ich kann mich an die Regeln halten und wenn ich sie kenne, tragen sie mich durch Schreibkrisen. Aber wie lustvoll ist es auch, sie gekonnt zu verletzen. Und das geht, denn der Horizont narrativer Möglichkeiten will ständig erweitert werden, die Regeln wollen übertreten werden. Und Wege entstehen beim Gehen!
Einer dieser Wege hat mich vor fast zwanzig Jahren zum Enneagramm geführt. Durch eine Empfehlung las ich DAS ENNEAGRAMM: DIE 9 GESICHTER DER SEELE von Richard Rohr und Andreas Ebert. In diesem Typenmodell erkannte ich sofort ein sinnvolles Tool, nach dem ich schon lange gesucht hatte. Ich war überzeugt, dass es mir helfen könnte, komplexe und glaubhafte Charaktere zu entwickeln. Allerdings kam es aus einem christlichen Kontext und nicht aus einem dramaturgischen. Also begann ich selbst, es für die Drehbucharbeit zu adaptieren.
Zur Berlinale 2011 erschien im VISTAS Verlag meine Lehr-DVD FIGUREN UND CHARAKTERE, ein Werkzeug für Drehbuchautoren. Es war die erste Veröffentlichung in Deutschland, bei der das Enneagramm auf dem Gebiet der Dramaturgie zielgerichtet für die Filmstoffentwicklung angewandt wurde. Sie erschien nicht als klassisches Lehrbuch, sondern als Lehr-DVD mit einem ausführlichen Booklet, um das Enneagramm-Schema interaktiv und mit Filmbeispielen anschaulich zu präsentieren.
Seitdem sind mehr als zehn Jahre vergangen, in denen das Enneagramm von vielen Autoren und Dramaturgen beachtet, diskutiert und als Arbeitsinstrument angewandt wurde. Ich freue mich sehr, dass es sich als Werkzeug für die dramaturgische Arbeit so gut bewährt hat. Unterdessen habe ich mir oft die Frage gestellt, ob sich das Enneagramm wohl auch für ein Strukturmodell eignen würde. Es wäre doch wunderbar, wenn man Figuren und Strukturen in einem Modell analysieren und gestalten könnte. Ein solches Enneagramm-Strukturmodell aber hätte nur Sinn, wenn es gegenüber den bereits bekannten Strukturmodellen auch einen Mehrwert böte.
Im Jahr 2013 fand ich heraus, wie dieses Strukturmodell beschaffen sein müsste und veröffentlichte das Ergebnis 2014 bei epubli im E-Book DREHBUCH-TOOL ENNEAGRAMM 2.0. Darin habe ich außerdem die Hauptcharaktere und die Erzählstruktur einiger bekannter Filme analysiert, um die Anwendung des Enneagramms in der dramaturgischen Praxis exemplarisch zu demonstrieren.
Viele Diskussionen in der Filmbranche, im Verband für Film- und Fernsehdramaturgie VeDRA, im Verband der Drehbuchautoren VDD und an der Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ inspirierten mich auch nach der zweiten Veröffentlichung, und meine dramaturgische Praxis mit Enneagramm-Analysen schärfte meinen Umgang mit dem Modell weiter, zum Beispiel bei den TV-Serien SoKo MÜNCHEN, SOKO LEIPZIG, IN ALLER FREUNDSCHAFT oder auch bei WISHLIST / Staffel 2 für Radio Bremen und Funk.
Über die Jahre sammelten sich auf meinem Schreibtisch weitere zahlreiche Ideen, Zeitungsartikel und Exzerpte – neue Puzzleteile aus der Dramaturgie, der Psychologie und Soziologie. Sie bereichern nun auch diese überarbeitete Ausgabe, die im Vergleich zu den vorherigen Fassungen noch einmal ausführlicher und um einige komplett neue Analysebeispiele erweitert worden ist. Für das bewährte interaktive Enneagramm-Schema und die Beispielfilme gibt es eine Website, zu der Sie mit dem Kauf dieses Buches einen exklusiven Zugang bekommen.
Website: https://enneagramm.masterschool.de/
Passwort: MSDdbt21
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und klicken Sie sich auf der Website durch die Charaktere. Schauen Sie auch die drei Beispielfilme und die Interviews mit den Figuren an. Nichts vermittelt die Sichtweise der neun Grundcharaktere des Enneagramms so anschaulich wie diese Interviews im Kontext mit den Beispielfilmen!
Ich wünsche Ihnen nun mit diesem Buch viele erhellende Erkenntnisse, gern auch neue, daraus entstehende Fragen und gutes Gelingen beim Erproben und Anwenden des Enneagramms in Ihrer eigenen Arbeit.
Jens Becker
1 Wegen der besseren Lesbarkeit verzichtet dieses Buch auf Gendersternchen, Unterstriche oder das Binnen-I. Wenn bei personenbezogenen Substantiven die männliche Sprachform gewählt wird, ist dies natürlich geschlechtsneutral zu verstehen.
VORFILM
Dieses Kapitel erzählt nichts über Figuren, aber viel über die Natur des Menschen. Wenn Sie zu ungeduldig sind, können Sie den Vorfilm auch überspringen. Sie werden den Hauptfilm trotzdem verstehen. Aber vielleicht verpassen Sie etwas!
Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Sie kennen diese alte Weisheit vielleicht. Auf unser Thema bezogen bedeutet sie, bevor wir uns tiefer mit Figuren befassen können, sollten wir uns mit der Natur des Menschen beschäftigen. Denn Figuren bilden doch Menschen ab, oder?
1. MENSCH UND FIGUR
Wir müssen immer klar unterscheiden zwischen Menschen und Figuren. Während Menschen von unendlich vielen Einflüssen geprägt sind, sehr vielfältig handeln können und kompliziert strukturiert sind, verhält sich das bei Figuren völlig anders. Sie können niemals so komplex wie Menschen sein, sondern täuschen das nur vor. Wir erliegen nur zu gern der Illusion, dass die Figuren auf der Leinwand oder dem Bildschirm echte Menschen seien, denn diese Verabredung zwischen Filmschöpfern und Zuschauern ist ein wesentlicher Aspekt des Mediums.
Wenn wir das nicht genau wüssten, dann könnten wir die Filme vielleicht nicht ertragen, wenn sie besonders grausam sind oder wenn die Figuren an ihre Grenzen geführt werden. Wir sehen ihnen beim Stolpern, beim Scheitern und wieder Aufstehen zu. Wir leiden und freuen uns mit ihnen, weil wir anhand unserer eigenen Lebenserfahrungen ermessen, welche Intensität, Fallhöhe und Konsequenzen der Konflikt hat, den wir in der Story gerade miterleben dürfen.
Für diesen spezifischen Moment der Identifikation zwischen Zuschauer und Figur hat Aristoteles in seinem Grundlagenwerk POETIK den Begriff Katharsis geprägt. Die Katharsis möge der seelischen Reinigung dienen, so Aristoteles, indem wir auf ungefährliche Weise Jammer und Schmerz durchleben. Gotthold Ephraim Lessing hat in seiner HAMBURGISCHEN DRAMATURGIE von Mitleid und Furcht gesprochen, die den Zuschauer moralisch bessern solle. Warum funktioniert dieses System so gut, jahrtausendelang? Weil wir im Theater, im Spielfilm, in der Serie im weitesten Sinne immer über uns erzählen, über uns Menschen.
Wir durchleben unsere Ängste, unsere Abgründe, unsere Hoffnungen wie in einem Spiegel.
Ein moderner Erneuerer der Dramaturgie jedoch, Bertolt Brecht, hielt nicht viel von Einfühlung. Er verachtete die Katharsis und wollte stärker das Denken der Zuschauer herausfordern. Dafür fand er ein radikales Mittel – das Heraustreten des Schauspielers aus seiner Rolle mittels Durchbrechen der vierten Wand, der zum Zuschauer. Diesen Effekt nannte Brecht Verfremdung. Indem die Darsteller das Publikum direkt ansprechen, verlassen sie das Stück und die Spielverabredung. Hinter der Figur X wird plötzlich der Schauspieler Y sichtbar.
Diese Brechtsche Entzauberung findet im Film nur selten statt. Warum eigentlich? Vielleicht weil die Kunst des Films stärker noch als das Theater eine Abbildung der Realität suggeriert und genau daraus ihre Wirkungskraft gewinnt. Diese Kraft zu schwächen, hält das Medium nur in besonderen Augenblicken oder Konstellationen aus. Ein solcher Ausnahmemoment war zum Beispiel im Jahr 1940 das Heraustreten von Charlie Chaplin aus seiner Rolle am Ende des Films DER GROSSE DIKTATOR. Charlie, der sich als Filmfigur bis dahin auch standhaft geweigert hat zu sprechen, hält plötzlich eine minutenlange Rede an die Menschheit. Indem Chaplin direkt in die Kamera blickt, also seine Zuschauer anschaut, wird hinter seiner Maske der Schauspieler Charlie Chaplin sichtbar. Er hält eine so grundlegende, ergreifende Rede, dass es nicht verwundert, wenn diese Szene zugleich die letzte für diese außergewöhnliche Filmfigur wird. Als der Mensch Chaplin sichtbar wurde, musste die Filmfigur verschwinden.
Über 70 Jahre später schaut Kevin Spacey als Francis Underwood in der Serie HOUSE OF CARDS in die Kamera. Er tut dies recht oft und es zeigt sich, dass die Verfremdung nicht mehr so extrem wirkt, wie noch zu Chaplins Zeiten. Der Mensch gewöhnt sich eben an alles, auch an postmoderne Erzählweisen.
Dafür entsteht heute mit dem Aufkommen von interaktiven Games und der Verbreitung von Virtual Reality ein ganz neues Level für audiovisuelle Erzählungen: Die Zuschauer werden zu Usern und damit selbst zum Teil der Handlung. Unser Publikum verlässt die Sitze und betritt die Bühne. Es verschmilzt in Rollenspielen interaktiv mit den Figuren. Die User suchen sich ihre Rollen nicht nur aus, sie gestalten sie sogar, im Charakter und im Handeln. Was für ein großer Schritt, was für spannende Chancen und Herausforderungen für die Kunst der Narration!
Gerade weil das Verhältnis zwischen Mensch und Figur in der Postmoderne also offensichtlich immer komplexer wird, fangen wir unsere Überlegungen ganz von vorn an – beim Menschen.
2. INDIVIDUALITÄT UND GRUPPENVERHALTEN
Alles ist Schwingung. Ständig ziehen Menschen einander an oder stoßen einander ab. Wir sind immer Teil einer Gruppe, sogar gleichzeitig Teil von vielen Gruppen. Ich gehöre zum Beispiel zu den Europäern, zu den Deutschen, zu den Männern, zu den Vätern, zu den Künstlern, zu den Kaffeeliebhabern, zu den Autofahrern, zu den Fans von Tim und Struppi, zu den ... na und so weiter. Und dabei lege ich großen Wert auf meine Individualität!
Die Frage ist: Können wir überhaupt individuell sein, wenn wir zugleich immer auch Gruppenmitglieder sind? Ich saß einmal vor einer Seminargruppe an der Filmuniversität Babelsberg, ein Ort, an dem individuelle Selbstverwirklichung ein hohes Gut ist. Während die Gruppe an einer Aufgabe schrieb, fiel mir auf, dass alle diese Individualisten schwarz gekleidet waren und silberne Notebooks vor sich hatten mit einem leuchtenden Apfel darauf. Wirklich alle.
Wie ist das einzuordnen?
Wir haben ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Menschseins. Wir sind Teil von Gruppen, weil wir Bestätigung suchen für ganz wesentliche Schwingungen in uns, man könnte sagen: für unser Weltbild. Wir definieren uns durch diese Gruppenzugehörigkeit und reduzieren dadurch unsere Unsicherheit. Eine Gruppe kann unserem Leben einen Sinn geben, einen Halt. Sie verschafft uns Bindung an andere Menschen, denn wir sind soziale Wesen. Und was ist mit den Einsamen, könnte man kritisch einwerfen. Nun, die gehören eben zur Gruppe der Einsamen. Warum wir uns Gruppen suchen, dazu gibt es verschiedene Theorien. Es ist wie immer, drei Wissenschaftler – vier Meinungen. Die sich vielleicht nicht mal widersprechen, sondern ergänzen.
Die Evolutionstheoretiker sind überzeugt, dass Gruppen uns elementare Vorteile verschaffen beim Kampf gegen Feinde, bei der Beschaffung von Nahrung und beim Hüten der Kinder. Die Erfahrung, dass wir in Zusammenarbeit und damit in Gruppen besser überleben, habe sich inzwischen genetisch manifestiert in einem tief verankerten Bedürfnis nach Zugehörigkeit.
Der Sozialpsychologe Leon Festinger entwickelte 1954 eine Theorie des sozialen Vergleichs. Sie besagt, dass wir uns Gruppen aussuchen, zu denen wir gehören wollen, weil wir hier Bestätigung für unsere Meinung finden. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das können virtuelle Filterblasen bei Facebook sein oder politische Parteien, Fußballfangruppen oder der Imkerverein. Das Gefühl, mit seinen Auffassungen nicht allein zu sein, ein Verständnis für die Welt mit anderen zu teilen, verstärkt das Selbstbewusstsein und gibt unserem Leben mehr Sinn.
Und dann gibt es noch die utilitaristische Austauschtheorie von John Thibaut und Harold Kelley aus dem Jahr 1959. Sie sehen den Sinn von Gruppen etwas nüchterner. In der Gemeinschaft würde man sich einfach Vorteile verschaffen durch den Austausch von Gütern – und zwar psychologischen (Zuneigung), materiellen (Dinge) und sozialen (Unterstützung). Das sei eine Kosten-Nutzen-Rechnung und man bleibe solange in einer Gruppe, wie der Nutzen die Kosten übersteigt. Wenn jedoch die Kosten den Nutzen übersteigen, dann würden wir aus der Gruppe austreten und nach Alternativen suchen. Halten wir also einen Gedanken fest, der später noch wichtig sein wird, wenn wir uns mit Figuren beschäftigen:
Zwar sind wir Menschen alle Individuen, aber aus vielerlei Gründen sind wir stets auch Mitglieder von vielen Gruppen, deren Merkmale wir gern teilen, um dazuzugehören.
2.1 FREIHEIT UND NORM
Wenn wir Mitglieder in bestimmten Gruppen sein wollen, dann müssen wir uns den Normen dieser Gruppen natürlich möglichst unterordnen. Moslems sollten kein Schweinefleisch essen, Bayern-München-Fans keine St.-Pauli-Trikots tragen, katholische Priester nach dem Zölibat leben und Polizisten gesetzestreu handeln.
Wir sollen also angepasst sein, möglichst durchschnittlich nach den Normen der Gruppe. Und dazu sind wir auch bereit, weil wir dazugehören möchten. Dieser Gruppenzwang wird Normalität genannt. Und er ist das Gegenteil von Individualität. Wir geben also freiwillig unsere Freiheit auf, denn Freiheit heißt ja Individualität ...
Ist das nicht widersinnig? Ja und nein. Erich Fromm nennt das die Pathologie der Normalität des heutigen Menschen. Er sagt, man könne gesund und frei sein, aber nicht gesund, frei und normal.
Nun gibt es eine Tendenz in der Gesellschaft, auch in jeder Gruppe, das Abweichen von der Norm, also die Andersartigkeit, als psychische Störung zu definieren. Alle, die sich dem System nicht oder nicht ganz unterwerfen, die also ihre Freiheit ausleben wollen und unangepasst bleiben, werden schnell als gestört betrachtet. So empfindet man in schwulenfeindlichen Gruppen mitunter Homosexualität als krank, Veganer können keine Jäger dulden und in traditionellen arabischen Familien hält man feministische Ideen für ganz abwegig. Alles nur eine Frage der Perspektive, eine Frage der jeweiligen Gruppennorm.
Natürlich verändern sich Gruppennormen auch, zum Beispiel durch den Wechsel von Generationen oder durch neue Mitglieder, die von außen kommen. Wenn eine Gruppe nicht untergehen will, muss sie sich auch den Veränderungen der Welt bzw. der Umwelt anpassen. Sobald Systeme zu starr und dogmatisch werden, gehen sie unter. Das sehen wir anschaulich am Beispiel des Sozialismus sowjetischer Prägung um 1990 herum.
Lebendigkeit bedeutet eben auch Schwingung, bedeutet das Zulassen von Entwicklung. Alles, was sich der Entwicklung verweigert, stirbt letztlich ab.
Was passiert aber mit den Normen, wenn eine Gesellschaft in die Barbarei abdriftet, zum Beispiel in eine faschistische Gesellschaft oder eine Sekte? Hans-Joachim Maaz beschreibt in seinem Buch DAS FALSCHE LEBEN, wie Denk- und Verhaltensweisen, sobald sie ein Großteil der Bevölkerung teilt, zum Mainstream werden, selbst dann, wenn sie amoralisch sind und als pathologisch bezeichnet werden können. Als Stichworte führe ich hier so unterschiedliche Beispiele wie den Völkermord der Europäer an den Indianern, den Holocaust und den Massenselbstmord der Peoples-Temple-Sekte 1978 in Jonestown an.
Der Psychoanalytiker Maaz untersucht, wie der Normalitätsbegriff völlig gestört sein kann, ohne dass es den Menschen überhaupt auffällt. Sukzessive nehmen die meisten Menschen die Verhaltensmuster einer Mainstream-Gruppe an. Und wenn das, wie in Deutschland nach 1933, der Faschismus ist, dann hinterfragen sie nicht mehr das Ausgrenzen und Verschwinden von Andersdenkenden und Juden. Die gehören nach der vorherrschenden Logik ja nun nicht mehr dazu, sind nicht mehr Teil der Gruppe. So ist vieles, was normal scheint, nach Maaz an sich höchst pathologisch.
Wenn das Anpassen in eine Gruppe also unsere Freiheit beschränkt, uns der Möglichkeit des Andersseins beraubt, dann muss es sehr starke Vorteile geben, damit wir uns trotzdem dieser Normalität unterwerfen. Diese Vorteile, die uns vom Sinn einer Gruppenzugehörigkeit überzeugen, sind die kulturellen Werte. Es sind spezifische Sitten und Codes, die sehr identitätsbildend wirken und die uns von anderen Gruppen unterscheiden, etwa mit Regeln für erwartetes Verhalten, in der Art unserer Kleidung, in der Sprache, der Musik, den Tischsitten, der Erotik, der Erziehung von Kindern, den Begräbnisritualen und so weiter.
Wie stark wir alle von kulturellen Werten geprägt sind, merken wir auf Reisen. In der Konfrontation mit anderen Kulturen spüren wir den Rucksack, den wir mit uns herumschleppen. Ich werde zum Beispiel nervös, wenn Busse unpünktlich sind, wenn ich auf Märkten um einen Preis feilschen soll oder wenn eine Verabredung nicht eine Verabredung ist. Dann weist mich meine Frau fürsorglich darauf hin, dass ich bitte nicht so deutsch sein soll.
Andererseits können wir richtig tief ins Fettnäpfchen treten, wenn wir fremde kulturelle Normen verletzen. Vor japanischen Türen sollte man unbedingt die Schuhe ausziehen, in der arabischen Welt sitzen Frauen und Männer getrennt, auf amerikanischen Straßen trinkt man nicht offen Alkohol. Alle diese landestypischen Normen haben auch Sinn, wenn man sich mit den regionalen Spezifika auseinandersetzt.
Normen schreiben uns also vor, was die Gruppe für angemessen hält. Dieser Rahmen beschränkt zwar unsere Freiheit, aber er gibt uns zugleich Sicherheit. Wenn wir uns entsprechend verhalten, gehören wir dazu. Wenn wir Teil einer Gruppe sein dürfen, wenn wir deren Normen zu unseren machen, befreit uns das auch von dem Problem, dass wir uns ständig selbst organisieren müssen; im Alltag ist vieles ja durch die Gruppennormen gut und klar geregelt.
2.2 GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE UND GESCHLECHTERROLLEN
Es lohnt sich, noch einen genaueren Blick auf zwei besondere Gruppen zu werfen: auf Frauen und Männer. Aber kann man sie überhaupt als Gruppen betrachten, und gibt es überhaupt männliches und weibliches Gruppenverhalten? Nun, das ist ein weites Feld. Und ein sehr spannendes dazu, weil wir gegenwärtig sehr intensiv Genderdiskussionen führen. Wir sollten zunächst berücksichtigen, dass es ein biologisches Geschlecht gibt, ein soziologisches und ein psychologisches.
Das biologische Geschlecht baut auf dem winzigen Unterschied von einem einzigen Chromosom auf. Von 46 Chromosomen sind 45 bei Frau und Mann gleich – es gibt also weit mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und doch spielt dieses eine Chromosom eine gewaltige Rolle: Es bestimmt die Aufgabe bei der Fortpflanzung. Nur biologische Frauen können Kinder bekommen, und das verändert vieles.
Es gibt auch Äußerlichkeiten, die gut statistisch erfassbar sind: Männer sind meist größer und haben eine höhere Muskelmasse. Frauen dagegen haben tendenziell einen größeren Fettanteil und werden älter als Männer. Und Mädchen kommen früher in die Pubertät. Wenn ich das biologische Geschlecht einer Person kenne, dann verrät mir das aber noch nichts über ihren Charakter, ihre Intelligenz, Emotionalität, Interessen und Ansichten. Deshalb sind die biologischen Geschlechtsmerkmale für unsere Betrachtungen nicht so relevant.
Viel interessanter ist das soziologische Geschlecht. Hier kann man beobachten, wie die Kultur vertieft, was die Biologie initiiert hat. Babys und Kleinkinder lernen schon in der nonverbalen Phase, Gesichter und Stimmen in männliche und weibliche zu unterscheiden. Carol Lynn Martin und Diane Ruble untersuchten 2004 in ihrer Studie CHILDREN’S SEARCH FOR GENDER CUES, wie Kinder von Anfang an nach Hinweisreizen suchen, um Menschen Geschlechtern zuzuordnen. Sie finden diese Hinweise in der Kleidung, im sozialen Verhalten, in Frisuren, im Spielzeug und so weiter. Im Alter von zwei bis drei Jahren entwickeln Kinder das Bedürfnis, zu der einen oder der anderen Gruppe zu gehören. Nun passiert, was ich im vorigen Kapitel beschrieben habe – die Anpassung an die Normen einer Gruppe.
Diese Normen – und das ist wichtig – finden sich weltweit wieder, durch alle Kulturen hinweg: Jungen spielen tendenziell in größeren Gruppen, messen sich dabei in ihren Fähigkeiten, sind lauter und aggressiver. Mädchen spielen tendenziell eher in kleineren Gruppen, machen soziale Rollenspiele und gehen stärker aufeinander ein. Diese Gruppen mischen sich wenig. So entstehen Jungen- und Mädchenwelten. Hierbei werden Geschlechterrollen durch Beobachtung und Nachahmung geformt.
Die Theorie des sozialen Lernens untersucht, wie Lob („Du bist so ein tolles Mädchen!“) und Kritik („So was machen Jungs nicht!“) das geschlechtstypische Verhalten beeinflussen. Jungen und Mädchen passen sich durch diese Rückmeldung den sozialen Erwartungen mehr oder weniger an.
Und damit geben sie sich mehr oder weniger auch ein psychologisches Geschlecht, das heißt, sie lassen in sich selbst – bewusst und unbewusst – weibliche und männliche Persönlichkeitsanteile zu. Eigenschaften wie Aggression und soziale Dominanz werden dabei eher als männlich angesehen und Eigenschaften wie soziale Bindungsfähigkeit und Rücksicht eher als weiblich. Dies lässt sich durch viele soziologische Forschungen und öffentlich zugängliche Statistiken belegen.
In der Pubertät und im frühen Erwachsensein werden die Geschlechterrollen einerseits so stark ausgelebt, wie sonst nie wieder im Leben, andererseits entwickelt sich für die meisten das Bedürfnis, Beziehungen zum anderen Geschlecht aufzubauen. Wenn viele Jugendliche das tun, führt es wiederum zu einem sozialen Druck in der Gruppe, auch einen Freund bzw. eine Freundin zu haben. Das eigene Geschlechterrollenverhalten hat sich in der Adoleszenz so manifestiert, dass es prägend wird für die ganze Zeit des Erwachsenseins. Erst in der zweiten Lebenshälfte, mit über 50 Jahren, bekommen viele Männer mehr „weibliche“ Züge und verhalten sich sozial zugewandter. Umgekehrt finden Frauen oft erst in der zweiten Lebenshälfte die Kraft, ihre Interessen deutlicher durchzusetzen, also „männlicher“ zu agieren, wo sie bisher zu nachgiebig waren.
Man kann also sagen, dass die Gene uns vorprägen, aber auch, dass sie nicht allmächtig sind. Wir sind offene und komplexe Systeme, stark beeinflusst von der Kultur der Gruppen, denen wir angehören, aber durchaus auch mit der Option ausgestattet, auf unserer Individualität zu bestehen. Das gilt so auch für Menschen, die sich als homosexuell, non-binär oder queer einordnen.
Sheri Berenbaum und Melissa Hines stellten 1992 in ihrer Studie EARLY ANDROGENS ARE RELATED TO CHILDHOOD SEX-TYPED TOY PREFERENCES fest, dass weibliche Embryos mit einer übermäßigen Testosteronkonzentration später männlicher aussehen, sich aggressiver und jungenhafter verhalten. Trotzdem sehen sie sich als Mädchen, nicht als Jungen. Einige davon entwickeln sich zu lesbischen Frauen, aber durchaus nicht alle. Mädchen, die jungenhafter aussehen und sich auch so verhalten, werden von der Umwelt aber anders wahrgenommen und behandelt. Gleiches gilt für Jungen, die sich nicht geschlechtertypisch verhalten.
Generell kann man sagen, Kinder, die sich anders verhalten, machen in ihren Gruppen (Familie, Schulklasse, Freunde) zweifellos spezifische Erfahrungen. Diese können sehr unterschiedlich sein, von besonderer Unterstützung über die Akzeptanz als Außenseiter bis hin zu Mobbing und Ausgrenzung. Und diese Erfahrungen prägen natürlich den Charakter. Sie führen dazu, das Anderssein zu unterdrücken oder sogar zu verstärken. In welche Richtung der Charakter sich entwickelt, wird ganz wesentlich beeinflusst von einem Faktor, den wir nun näher beleuchten wollen: die Erziehung.
2.3 ERZIEHUNG
Es gibt den allgemeinen Konsens, dass die Erziehung, besonders in der frühen Kindheit, unseren Charakter entscheidend prägt. Dem widerspricht der Verhaltensgenetiker Robert Plomin in seinem 2018 erschienenen Buch BLUEPRINT: HOW DNA MAKES US WHO WE ARE vehement. Er behauptet, dass die Gene für 50 Prozent der psychologischen Unterschiede zwischen Menschen verantwortlich sind. Nach seinen Forschungen ist es Eltern kaum möglich, die Intelligenz, Motivationsfähigkeit und Selbstkontrolle ihrer Kinder zu formen. Dies ist natürlich eine provokante These. Aber selbst wenn wir als Eltern nur auf die Hälfte der Charaktereigenschaften unserer Kinder Einfluss hätten, wäre das noch sehr viel. Es wäre dann die gestaltungsfähige Variable, während die Genetik eine Konstante vorgibt.
Seit geraumer Zeit wird die geschlechtstypische Erziehung (Jungs sind wild und weinen nicht, Mädchen sind brav und toben nicht rum) stark infrage gestellt. Das ist auch gut so, denn die letzten 100 Jahre haben unser Selbstverständnis als Menschen sehr verändert. Die Gegenwart in der westlichen Welt ist wesentlich geprägt von der erfolgreichen Emanzipationsbewegung der Frauen. Inzwischen kämpft eine selbstbewusste Queer-Community um die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen, die sich nicht mehr heteronormativ einordnen lassen wollen.
Historisch gesehen entwickelte sich dieser Prozess der Selbstbestimmung rasant. Zugleich entsprechen viele Erziehungsmethoden und -ansichten noch den Idealen voriger Generationen, die wir heute gar nicht mehr teilen oder teilen wollen. Bei dem nachvollziehbaren Wunsch, diese alten Geschlechterstereotypen aufzulösen, werden jedoch oft zwei wichtige Aspekte übersehen.
Erstens haben wir Menschen einen sehr starken Drang, die Welt zu kategorisieren. Dies geschieht, weil wir im Alltag einen Menschen schnell geschlechtlich einordnen wollen, um weitergehende Fragen zu stellen, wie: Ist diese Person mir gut gesonnen? Stehen wir in bestimmten Fragen auf der gleichen Seite? Wie können wir kommunizieren? Wenn wir also die alten Geschlechterbilder auflösen wollen, brauchen wir zugleich eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür, was denn an ihre Stelle treten soll.
Zweitens gibt es die Erziehung