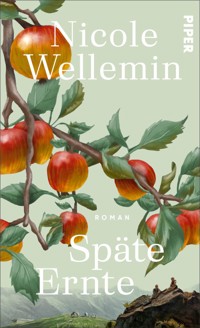18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Nicole Wellemins Texte sind so klar wie ein Bergsee und so präzise wie ein Scherenschnitt. Was für ein Lesevergnügen!« Martina Bogdahn Von der Suche nach Versöhnung Nach vielen Jahren der Abwesenheit zieht Theresa aus der Stadt zurück in ihr kleines Heimatdorf im Bayerischen Wald. Der Umzug ist sowohl Neuanfang als auch Kapitulation, ein letzter Versuch, ihre Doktorarbeit über die Moore erfolgreich zu Ende zu bringen. Aber in der Umgebung ihrer Kindheit reißen alte Wunden wieder auf: Hier sind die schmerzlichen Erinnerungen an den Bruch mit ihrer Zwillingsschwester allgegenwärtig. Außerdem hadert Theresa nach wie vor mit einer schwerwiegenden Entscheidung, die sie nach dem frühen Tod ihres Bruders getroffen hat. In den unwirtlichen Mooren ihrer Heimat sucht sie Zuflucht und findet in der zaghaften Freundschaft mit ihrem jugendlichen Neffen neuen Mut. Doch die Konfrontation mit dem Unausgesprochenen hat längst etwas in Theresa losgetreten … Eine Schwesterngeschichte über die vielen Schattierungen von Wahrheit, so eindringlich wie Jarka Kubsova und so ergreifend wie Ewald Arenz. ⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ Die Autorin Nicole Wellemin über ihre lebenslange Faszination für einen im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtigen Ort, der in den letzten Jahren einen regelrechten Imagewandel hingelegt hat: »Moore sind seit jeher Schauplätze gruseliger Geschichten. Als Kind liebte ich diese, heute faszinieren Moore mich noch aus einem anderen Grund: Sie sind unverzichtbar für Klimaschutz und Artenvielfalt. Damit sind sie gleichzeitig lebensfeindlich und lebensbejahend, schön und unheimlich. Und sie konservieren die Vergangenheit, wie die 13.500 Jahre alten Torfschichten im Bayerischen Wald, wo mein Roman spielt. ›Das Echo der Moore‹ vereint diese Gegensätze und zeigt, wie das Vergangene unsere Gegenwart prägt.« ⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ »Ganz große Erzählkunst, warmherzig, einfühlsam und klug. Eine Geschichte, die zu Herzen geht und eins der besten Bücher, die ich gelesen habe!« Susanne Lieder über »Späte Ernte« »Ein spannender, einfühlsamer und tiefgründiger Roman über Schuld und Vergebung. Sanft, wütend und ungemein ehrlich.« Julia Fischer über »Späte Ernte«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Das Echo der Moore« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Redaktion: Dr. Clarissa Czöppan
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Oskar Ulvur / Trevillion Images; mauritius images / Blume Bild und Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1997 – Helen
Heute – Theresa
Heute – Theresa
Heute – Theresa
2007 – Chrissi
1997 – Helen
Heute – Theresa
2008 – Chrissi
Heute – Theresa
2002 – Helen
Heute – Theresa
2008 – Chrissi
Heute – Theresa
2008 – Chrissi
Heute – Theresa
2005 – Helen
Heute – Theresa
2008 – Chrissi
Heute – Theresa
2008 – Chrissi
2007 – Helen
Heute – Theresa
Heute – Theresa
Heute – Theresa
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1997 – Helen
Beim ersten Ruf der Singdrossel hält Helen nichts mehr im Bett. Der Bauch rebelliert. Das tut er seit ein paar Wochen regelmäßig. Übungswehen, hat die Ärztin gesagt, doch diesmal ist es anders. Seit Stunden schon gewinnt das Drängen in ihrem Leib stetig an Kraft. Basti liegt neben ihr. Er dreht ihr den Rücken zu und schnarcht leise. Sie will ihn nicht wecken. Erst gestern ist er von Montage zurückgekommen. Sie haben sich gestritten. In zischendem Flüsterton, damit die Mädchen nichts hören. Warum sie sich aufrege, hatte er gefragt. Bis das Kind da sei, bleibe er doch zu Hause. Ob ein einziger Abend Ruhe wirklich zu viel verlangt sei? Er wolle ja helfen, aber bevor er irgendwas tun könne, müsse er sich ausruhen.
Sie schlägt die Decke zurück, hievt sich aus dem Bett. Eine neue Welle Schmerz erfasst sie, brennt sich einen Weg durch ihr Rückgrat. Sie drückt sich mit der linken Hand aufs Kreuzbein, die rechte schiebt sie sich zwischen die Zähne, um keinen Laut von sich zu geben. Ausruhen kommt von Ruhe, und wenn der kleine Mann in ihrem Bauch schon keine Rücksicht auf die Bedürfnisse seines Vaters nimmt, dann kann sie Basti den Gefallen wenigstens tun.
Als der Schmerz nachlässt, steht sie auf. Der Bauch drängt nach unten. Es fühlt sich an, als würde dieser Leib, dieser Bauch, nicht mehr ihr gehören, sondern nur noch dem Kind. Diesem Leben, das achtunddreißig Wochen und drei Tage lang unter ihrem Herzen gewachsen und gediehen ist. Es ist ein seltsames, berauschendes Gefühl. Dass ihr Körper das kann. Dass sie das kann. Neues Leben schaffen. Empfangen, gebären, geleiten – Mutter sein, mit Haut und Haar und Schmerz und Freude. Die Mädchen sind per Kaiserschnitt gekommen. Helen hatte sich eine natürliche Geburt gewünscht. Sehr sogar. Was immer sie an Tipps gehört oder gelesen hatte, wie man ein Kind im Bauch dazu bringen könnte, die Lage zu verändern, hat sie ausprobiert. Sie hat ihre Zehenballen mit Räucherkerzen traktiert, mit einer Taschenlampe in ihre Vagina geleuchtet und so lange eine Brücke gemacht, wie es die geschwollenen Gelenke zuließen. Damals hatte sie noch geglaubt, es liege in ihrer Hand. Dass sie die Lenkerin ihres eigenen Schicksals sei. Geholfen hat es nichts. Die kleine Resi saß mit dem Hintern in Helens Becken fest und bewegte sich kein Stück. Damit hat sie ihrer Mutter eine wichtige Lektion erteilt.
Die Mädchen sind jetzt vier. Vier Jahre für Helen, um zu lernen, was die Alten schon immer wussten, wenn sie sagen: Es werd wern, wia’s werd.
Auf blanken Sohlen tappt sie aus dem Schlafzimmer. In der Küche stapelt sich das Geschirr vom Abendessen. Abgestandener Tomatensoßengeruch verätzt ihre Nase. Sie braucht Luft. Braucht Weite. Braucht Platz.
Sie stößt die Glastür auf, die von der Küche auf die Terrasse führt, und tritt ins Freie. Dämmerung hängt wie ein Schleier über der Wiese vor dem Haus. Über den Wipfeln der Bäume verraten Streifen aus Gelb und Orange, dass der Tag im Werden ist. Wieder ruft die Singdrossel. Nicht einmal eine Stunde bis Sonnenaufgang. Helen ist eine Waidlerin – eine, die im Bayerischen Wald geboren, hier aufgewachsen ist. Sie kennt die Natur und versteht, was sie ihr sagen will. Nicht jeder Vogel singt zur selben Zeit. Helens Großmutter konnte anhand des Vogelkonzerts auf die Minute genau voraussagen, wann die Sonne aufging. Etwas von diesem Wissen hat sie an Helens Mutter weitergegeben und die an sie. Jetzt, im März, ist es für die meisten Zugvögel noch zu früh. Aber die Singdrossel ist schon da. Ihr freches Zipp-zipp-zipp ruft Helen einen Morgengruß zu.
Ihr Haus ist das letzte vor dem Wald. Helen verlässt die Terrasse. Nachtkaltes Gras kitzelt ihre Fußsohlen. Spazierengehen hilft, hat die Hebamme gesagt. Wenn die Wehen dann aufhören, waren es nur Übungswehen, wenn sie stärker werden, weißt du Bescheid. Sie guckt auf die Uhr, merkt sich die Position des Minutenzeigers. Über den Bäumen erklimmt die Sonne den Horizont, schickt Streifen flüssigen Goldes über die Wiese bis zu ihrem Haus. Wo das Licht den Hang berührt, entfaltet sich das pralle Leben. Es ist Frühling. Nicht nur Helens Leib birst von der Kraft des Werdens. Überall um sie herum drängt Neues in die Welt. Zartgrüne Halme warten unter dem toten Wintergras. Hier und da bricht die Erde auf, strecken erste Frühlingsblüher die Köpfe aus dem Boden. Krokusse malen bunte Tupfen auf die Wiese. Im lauen Wind des anbrechenden Morgens wiegen sich die Zweige einer nahen Birke, wispern Helen Mut zu. Du kannst das, flüstern sie, wenn eine neue Wehe sie überrollt. Dafür ist dein Körper gemacht. Du bist ein Teil des ewigen Kreislaufs.
Zehn Minuten Abstand zwischen den Wehen. Dann acht. Kuckuck, ruft der Freund der Singdrossel und Helen guckt hin. Sie sieht all das Leben, das im Begriff ist zu sein, sieht all die Kraft um sich herum. Wenn jetzt eine Wehe kommt, krallt sie die Zehen in den feuchten Boden, krümmt ihren Rücken nach hinten, pumpt kalte Morgenluft in ihre Lungen.
Mhhhhh-mhhhh, fällt sie in das Lied der Vögel ein, als die Schmerzen zu stark werden. Mhhhh-mhhhh-mhhhh.
Fünf Minuten Abstand. Zeit, ins Krankenhaus zu fahren.
Sie geht zurück ins Haus, ruft Rosi an, die versprochen hat, auf die Mädchen aufzupassen, wenn Basti und sie ins Krankenhaus müssen. Es klingelt kaum, da meldet sich die Stimme ihrer Schwiegermutter. »Ist es so weit?«
»Ich glaube schon.« Plötzlich ist Helen unsicher. Ist es so weit? Kann sie wirklich vertrauen? Auf sich? Auf ihren Körper? Auf das, was das Drängen und Reißen in ihrem Inneren ihr sagt?
»Ich komme«, meint Rosi knapp, und Helen ist froh, als sie den Hörer auflegen kann.
Die Kliniktasche steht gepackt im Flur. Darin sind nicht nur das T-Shirt für die Geburt, Wechselkleidung für hinterher und die Babyausstattung für ihren Sohn, sondern auch Rätselhefte und Energydrinks für Basti. Das war ein Vorschlag von Rosi. Falls Basti langweilig werden sollte während der Geburt.
Im Bad spritzt sich Helen eine Handvoll Wasser ins Gesicht, dann kann sie es nicht mehr aufschieben und weckt ihren Mann.
Er brummt etwas Unverständliches, zieht sich die Decke über den Kopf.
»Wir müssen«, drängt sie. »Die Wehen kommen alle fünf Minuten.« Und dann, als selbst das nicht hilft: »Der Kleine will raus. Dein Sohn will dich kennenlernen.«
Das endlich dringt zu ihm durch. Er schlägt die Decke zurück, blinzelt sie an. Von den Stoppeln seines Barts sehen seine Wangen dreckig aus. »Mein Sohn, hm?« Stolz erhellt seine Miene, springt über von ihm auf sie. Sie grinst. Dass sie nach den Zwillingen ein drittes Kind wollten, hat niemanden gewundert. A Bua muaß sei, heißt es nicht umsonst. Helen hätte keinen Sohn gebraucht. Was sie wollte, war eine Schwangerschaft zum Genießen. Einmal guter Hoffnung sein, kein Liegen wegen Blutungen in der Frühschwangerschaft, kein doppeltes Bangen, keine Komplikationen und zweifache Belastung, wenn zwei Neugeborene zu unterschiedlichen Zeiten schliefen, Hunger hatten, gewickelt werden mussten. Sie wollte das wachsende Leben in ihrem Bauch und die Vorfreude auf alles, was kommen würde, in vollen Zügen auskosten. Deshalb haben Basti und sie gewartet, bis die Zwillinge vier sind. Jetzt gehen die beiden in den Kindergarten. Sie sind alt genug, um zu verstehen, wenn sie einmal warten müssen, haben eigene Freunde, erobern die Welt manchmal schon ohne sie.
»Ich bin gleich so weit«, verspricht Basti.
»In Ordnung.«
Sie veratmet eine weitere Wehe, überlässt ihren Mann sich selbst und geht in das Zimmer der Mädchen.
Da schlafen sie. Obwohl sie zwei Betten haben, liegen sie meistens in einem, Chrissi mit dem Gesicht an Theresas Schulter gekuschelt, Resis Arm um den Bauch ihrer Schwester gelegt. Die Bettdecke haben sie im Lauf der Nacht weggestrampelt. Die Wärme der anderen ist ihnen genug. Sie sehen so klein aus im Schlaf, so verletzlich und schutzbedürftig. Die Feenwesen auf der Bettwäsche, die rosa Frotteepyjamas, das Schnuffeltuch in Chrissis Hand. Mahnmale ihrer Kindlichkeit.
Eine gewaltige Welle Zärtlichkeit überspült Helen, reißt sie mit, die Kraft vergleichbar mit der Urgewalt der Wehen. Sacht rüttelt sie die Mädchen wach. Chrissi wacht zuerst auf, von jetzt auf gleich und mit einem Lachen auf der Miene, das ihr ganzes Gesicht erhellt. Bei Resi dauert es länger. Vorsichtig blinzelt sie in den Morgen, die Augen groß und prüfend. So war es schon bei der Geburt der Mädchen. Kaum aus dem Bauch heraus, hat Chrissi gebrüllt wie eine Löwin. Der kleine Körper hat gezittert vor Wut, im Rachen sah man das Zäpfchen vibrieren. Der ganzen Welt hat sie verkündet: Hier bin ich. Da wusste Helen, dass ihre Mädchen sich eine Fruchtblase geteilt hatten, aber doch jede für sich war. Denn Resi war so anders, zwei Minuten vorher, als die Ärzte sie Helen aus dem Bauch geschnitten hatten: still und prüfend und den unfokussierten Blick der Neugeborenen vor abschätzender Neugier geweitet.
Helen setzt sich zu den Mädchen auf die Bettkante und zieht jede ihrer Töchter an eine Seite des Bauchs. Abwechselnd vergräbt sie ihre Nase im Haar der beiden.
»Kommt das Baby?«, will Resi wissen.
»Der Anselm?«, bohrt Chrissi nach und benutzt den Namen, auf den Helen und Basti sich geeinigt haben.
Helen nickt. »Ganz bald schon. Papa und ich fahren jetzt ins Krankenhaus. Aber gleich kommt Oma, ihr seid nicht lange allein. Macht bis dahin einfach noch mal ein bisschen die Augen zu.«
»Wir schaffen das schon, Mama. Mach dir keine Sorgen.« Beruhigend tätschelt Resi Helens Bauch, der sich gerade unter einer Wehe verkrampft. Chrissi kichert, als sie die Beulen sieht, zu denen sich die dicke Kugel verformt.
»Ich weiß, dass ihr das schafft.« Ganz eng drückt sie ihre Mädchen an sich. So nah, wie es nur geht, denn plötzlich fühlt sich all das an wie ein Abschied. Einmal noch, dieses letzte Mal, will sie ihre beiden Kleinen im Arm halten, sie herzen und lieben und ihren Duft nach schlafwarmem Kleinkind atmen. Denn eines weiß sie, spürt es instinktiv, ohne darüber nachdenken zu müssen: Es ist der Lauf der Dinge, die Natur der Sache. Wie auf jeden Winter ein Frühling folgt und auf die Nacht der Tag, so werden Theresa und Chrissi nicht mehr ihre Kleinen sein, wenn Helen mit dem Baby im Arm und einem Rucksack voller neuer Pflichten aus dem Krankenhaus kommt, sondern die Großen.
Heute – Theresa
Vier Kartons.
Zu viel Platz.
Fremde Möbel.
Theresa zieht sich die Decke bis zum Hals, dreht sich auf die Seite. Bei jeder Bewegung sticht ihr eine Springfeder in die Hüfte. Morgen um acht wird sie an ihrer neuen Arbeitsstelle erwartet. Sie sollte schlafen, die Chance für einen guten ersten Eindruck bekommt man nur einmal. Aber sie kann nicht. Im Dunkeln zeichnen sich die Konturen der Umzugskartons ab. Vier lächerliche Kartons. Zwei mit Ausrüstung, einer mit Büchern und einer mit Kleidung und ein paar persönlichen Dingen. Mehr hat sie nicht mitgenommen aus ihrem alten Leben in das neue. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, wächst der Druck auf ihrer Brust und macht Schlaf unmöglicher.
Besser, sie kapituliert und versucht es später noch einmal. Sie schwingt die Beine aus dem Bett, tastet mit den Zehen auf dem Boden nach ihren Hausschuhen, da sieht sie aus dem Augenwinkel einen Schatten am Fenster. War das ein Gesicht? Ihr Kopf ruckt herum, sie nimmt eine Bewegung wahr. Aber da ist nichts. Nur die Äste einer Birke, die sich im Wind wiegen.
»Gott, was bist du für eine Stadtpflanze geworden.« Sie schüttelt über sich selbst den Kopf. Als Kind hat sie sich nicht mal vor Gewittern gefürchtet. Ganz oft hat sie Chrissi früher in den Arm genommen, wenn Mama und Anselm im Krankenhaus waren und es gewittert hat.
»Musst keine Angst haben«, hat sie dann gesagt. »Siehst du den Mond? Der ist unser Freund. Der passt auf uns auf.«
Auch jetzt sucht sie nach dem Mond im Fenster, als sie vom Schlafzimmer in die Küche tappt, aber der Winkel ist nicht richtig. Von ihrer neuen Erdgeschosswohnung aus sieht sie nur auf den Parkplatz vor dem Museum, die kleine Baumgruppe dort in der Mitte und eine Bank. Etwas stimmt da nicht. Wieder glaubt sie zuerst an ein Spiel der Schatten, aber das ist es nicht. Da steht wer, halb verborgen von dem Stamm einer Kastanie, und sieht genau zu ihr herüber.
Ihr Herz macht einen Satz, sie springt vom Fenster weg. Wer um alles in der Welt drückt sich um kurz nach elf am Abend auf dem Parkplatz des verlassenen Moorerlebniszentrums herum und starrt zu ihr in die Wohnung? Das hier ist nicht die Stadt, wo vierundzwanzig-sieben immer jemand unterwegs ist, sondern Moosbrunn, wo pünktlich um sechs die Bürgersteige hochgeklappt werden und es spätestens nach dem Fernsehhauptprogramm heißt: Gute Nacht. Sie muss sich getäuscht haben. Wie schon vorhin, als sie geglaubt hat, ein Gesicht am Fenster zu sehen. Nur langsam beruhigt sich ihr Puls, zurück bleibt eine bebende Nervosität. Das Glas Wasser wird eine immer bessere Idee.
Beim Aufdrehen gurgelt die Leitung. Der Hahn spuckt hustend ein paar Tropfen aus, ehe er einen gleichmäßigen Strahl zustande bringt. Theresa bereut, noch nicht einkaufen gewesen zu sein, bevor sie die Wohnung bezogen hat. Wasser aus einer sterilen PET-Flasche wäre ihr jetzt lieber, aber es ist, wie es ist, und sie muss halt nehmen, was es gibt.
Wie immer, wenn ihr etwas nicht geheuer ist, macht ihr Hirn Purzelbäume. Ihr fallen Dinge ein, die vollkommen überflüssig sind. Dass das Leitungswasser ganz anders schmeckt als in München zum Beispiel. Irgendwie salziger, mit einem leicht metallischen Nachgeschmack. War das früher auch so? Sie kann sich nicht erinnern. Dabei wüsste sie schon gerne, ob der seltsame Geschmack mit dem Unterschied im Grundwasser zu tun hat oder an den alten Leitungen in diesem Haus liegt. Wenn es sich irgendwie vermeiden ließe, würde sie auf eine Bleivergiftung gerne verzichten. Gerade will sie das Glas wegstellen, da huscht eine Gestalt am Küchenfenster vorbei.
Also doch! Diesmal lässt ihr Puls sich nicht so leicht beruhigen. Ihr Herz hämmert gegen die Rippen. Ihre Finger krampfen sich um das Glas. Damit sie eine Waffe hat, wenn es drauf ankommt. Wenn das dort draußen wirklich ein Einbrecher ist. Oder ein Stalker. Zwei Schritte geht sie in Richtung Fenster, dann stoppt sie.
Was soll der Blödsinn? Sehr bewusst zwingt sie sich, zu atmen. Einatmen. Halten. Ausatmen. Immer länger aus als ein. Das ist wichtig, hat ihr eine Kollegin vom Institut mal erzählt, die regelmäßig zum Yoga geht. Weil mit dem Ausatmen alles Schlechte Körper und Geist verlassen kann. Als sie das Prozedere dreimal wiederholt hat, geht es ihr besser. Wer sollte denn bitte in eine Wohnung einbrechen, die jahrelang leer gestanden hat? Und der Gedanke mit dem Stalker ist noch lächerlicher. Außer ihrer Doktormutter und dem Typen vom Museum, mit dem sie im Laufe des kommenden Jahres zusammenarbeiten wird, weiß niemand von ihrer heutigen Ankunft. Das war ihr wichtig. Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist, dass ihre Ankunft im Bayerischen Wald wie die Rückkehr der verlorenen Tochter gefeiert wird. Noch unangenehmer ist nur die Vorstellung, dass niemand sie begrüßt und sie alle wie eine Aussätzige behandeln. Das draußen vor der Tür müssen also Schatten sein. Geister aus der Vergangenheit wie die, von denen sie sich als Schulkinder erzählt haben, um sich gegenseitig Angst zu machen.
Gerade hat sie sich so weit zu glauben, dass sie sich alles nur eingebildet hat, da scheppert es vor der Haustür. Es klingt, als wäre etwas zu Bruch gegangen. Einer der leeren Blumenkübel vielleicht, die noch von den Leuten stammen, die früher in dem Haus gewohnt haben, das jetzt zum Museum gehört.
Okay, Schluss. Es ist genug. Geister aus der Vergangenheit zertreten keine Blumenkübel. Wenn sie heute irgendwann noch mal ein Auge zumachen will, muss sie nachsehen, wer oder was da vor dem Haus rumschleicht. Die Angst macht ihre Gedanken ganz flattrig. Vielleicht war das da draußen ja nur ein Waschbär. Weil Waschbären keine natürlichen Feinde haben und wahre Anpassungskünstler sind, kommen sie sowohl in ländlichen Gebieten als auch in der Stadt gut zurecht. Ursprünglich stammen die Kleinbären aus Nordamerika, aber über den Pelzhandel sind sie nach Europa gekommen. Aus anderen Regionen Deutschlands sind sie heute schon nicht mehr wegzudenken, aber letztens hat sie gelesen, dass auch in Bayern immer häufiger Waschbären gesichtet werden. Mit ihren schwarz umrandeten Augen könnte man ihr Gesicht im Dunkeln durchaus für menschlich halten, oder nicht? Ihr Gesicht vielleicht schon, ihre Gestalt eher weniger. Sie schließt kurz die Augen, atmet zittrig ein und aus. Ist ja nett, dass ihr Hirn Zufallsfakten ausspuckt, um sie zu beruhigen, aber könnte es sich dabei nicht etwas mehr anstrengen? Das war ganz sicher kein Waschbär dort draußen. Das vorhin zwischen den Bäumen war ein erwachsener Mann, und wenn das kein Grund ist, um Angst zu haben, was dann? Wenn sie nicht bald herausfindet, wer oder was um ihr Haus schleicht, wird sie heute Nacht keine Ruhe mehr finden.
In dem kleinen Flur, der zu ihrer neuen Wohnung gehört, sieht sie sich nach einer Waffe um. Nicht nach einer richtigen Waffe natürlich. Nur nach etwas, womit sie sich zur Not gegen ein Wildtier verteidigen könnte. Ihr Blick fällt auf einen alten Teppichklopfer im Schirmständer. Der tut’s.
Sie schnappt sich das Teil und schleicht aus dem Haus. Tatsächlich ist einer der beiden Blumenkübel, die auf der zweistufigen Treppe standen, die zur Haustür führen, zerbrochen. Die Scherben liegen über die Stufen verteilt. Von dem Verursacher des Malheurs ist weit und breit keine Spur. Sie verstärkt den Griff um den Teppichklopfer, geht der Länge nach das Erdgeschoss des Hauses ab, alle Fenster, an denen sie geglaubt hat, jemanden zu sehen. Doch da ist nichts. Nur Gras und Unkraut und Löwenzahn, der sich zwischen Schotter und Steinplatten einen Weg sucht.
Obwohl es tagsüber recht warm war, kriecht ihr nun Kälte unter den Stoff des Pyjamas. Gänsehaut rieselt ihr Rückgrat entlang, lässt sie schaudern. All ihre Sinne sind aufs Äußerste gereizt. Irgendwo hier draußen schleicht ein Räuber ums Haus. Die Frage lautet: Wer schnappt wen zuerst?
Sie erreicht die Hausecke. Im ersten Stock brennt Licht. Ihr neuer Kollege ist zu Hause, er kann es also nicht gewesen sein, der heimlich um das Haus geschlichen ist und in ihre Fenster geschaut hat. Soll sie ihn um Hilfe bitte? Kurz erwägt sie den Gedanken, dann schüttelt sie innerlich den Kopf. Jungfer in Nöten ist nicht die Rolle, in der sie sich ihrem neuen Kollegen vorstellen möchte. Als Biologin hat sie oft genug mit Männern zu tun, die sie nicht ernst nehmen, nur weil sie eine Frau ist. Im Museum werden sie autarke Einsatzbereiche haben. Sie kümmert sich um die fachliche Beratung beim weiteren Ausbau des Moorerlebniszentrums und ihre Forschungsarbeit, er ist als Museumspädagoge für die Öffentlichkeits- und Besucherarbeit zuständig. Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist, dass er sie nicht für voll nimmt, weil sie Angst vor Gespenstern hat.
Immer noch wachsam, schiebt sie sich im Schutz der Mauer vorwärts, während sie mit dem Kopf um die Ecke schielt. Da! Eine Gestalt. Dunkel gekleidet. Sie steht direkt am Fenster, die Hände ans Glas gepresst, um besser hineinschauen zu können.
Theresa handelt, ohne zu denken. Sie macht einen Satz nach vorne, reißt den Teppichklopfer in die Höhe, lässt ihn auf den Spanner niedersausen.
»Au! Was …?« Der andere fährt herum, hält die Hände schützend vors Gesicht, doch Theresa kann sich nicht mehr stoppen. Immer wieder lässt sie den Teppichklopfer niedersausen.
»Es tut mir leid«, jammert der Spanner, »das wollte ich nicht. Ich wollt dich nicht erschrecken. Ich wollt doch nur …« Ihre Hiebe unterbrechen sein Gestammel. Selbst als der Teppichklopfer sich in seine Einzelteile auflöst, weil die Rattanstäbe ungefähr genauso alt sein müssen wie der Rest der Möblierung ihrer neuen Wohnung, kann sie nicht aufhören.
»Was soll das?«, brüllt sie zurück. »Niemand schleicht zufällig nachts um ein Haus! Verzieh dich, du Scheißkerl! Wenn du dich noch mal hier blicken lässt, ruf ich die Polizei.«
Ein Teil von ihrem Gehirn registriert, dass er nicht versucht zu fliehen. Er verteidigt sich nicht einmal. Er duckt sich nur, so gut es geht, unter den Schlägen weg und schützt mit den Armen sein Gesicht. Doch dieser Teil von ihrem Hirn hat gerade nicht das Sagen. Zu dicht sitzt die Angst unter der Oberfläche. Fight or Flight, heißt es in der Biologie, und sie hat sich für Kämpfen entschieden.
»Hallo? Hey!« Erst als sich eine dritte Stimme über das Chaos erhebt, wird sie wieder Herrin über Nebennierenrinde, Nebennierenmark und Hypophyse. Auch wenn die weiterhin jede Menge Stresshormone durch ihren Körper pumpen, gelingt es Theresa endlich, den Teppichklopfer zu senken. Beziehungsweise das, was von ihm übrig geblieben ist. Ihre unmittelbare Umgebung hat sich in ein Schlachtfeld verwandelt. Überall liegen Rattanbrösel. Sie stützt die Hände auf die Oberschenkel, atmet schwer. Sie kann sich vorstellen, wie sie aussehen muss. Im Pyjama, mit Hausschlappen an den Füßen und einem Teppichklopferskelett in der Hand. Dazu die verwuschelten Haare und der wirre Blick. Angst und Stress weiten die Pupillen, dagegen kann sie nichts machen.
»Will mir mal jemand erklären, was hier los ist?« Der Neuankömmling stellt die Frage, deren Antwort auch sie gerne wüsste. Doch ihr Opfer scheint ebenso wenig gewillt, Licht ins Dunkel der Situation zu bringen wie sie.
Der andere seufzt. »Okay. Warum gehen wir nicht erst mal rein zu mir und klären das? Muss ja nicht das ganze Dorf mitbekommen, was hier vor sich geht. Ich heiße übrigens David.«
O nein.
»David Oswald.«
Oooooooh nein!
Er streckt ihr die Hand hin, und weil ihr Körper weiß, was die angemessene Reaktion darauf ist, schlägt sie ein.
Der Typ, den sie mit dem Teppichklopfer verdroschen hat, murmelt etwas, das man mit gutem Willen als Zustimmung werten könnte. Jetzt, wo ihr Parasympathikus dafür sorgt, dass ihr Stoffwechsel sich wieder normalisiert, erkennt sie auch, dass der Spanner kein Mann ist, sondern ein halbes Kind. Vierzehn, vielleicht fünfzehn Jahre alt. Seine Körpergröße muss sie zunächst getäuscht haben, denn er ist locker einen Kopf größer als sie. Doch seine Schultern sind die eines Kindes, und er hat die überlangen Gliedmaßen, die so typisch für Jugendliche in diesem Alter sind. Immer noch schüttelt sie David Oswalds Hand. Sie spürt die Berührung nicht, Schock macht ihre Finger ganz taub. Sie hat ein Kind geschlagen! Sie hat ein Kind geschlagen, und David Oswald hat es gesehen. Ihr neuer Kollege! Wo bitte ist ein Loch im Boden, wenn man es gerade gebrauchen kann? So hat sie sich das Kennenlernen mit dem Mann, mit dem sie in den kommenden zwölf Monaten Hand in Hand zusammenarbeiten muss, ganz sicher nicht vorgestellt.
David führt sie und den Jungen hoch in den ersten Stock. Ihre Wohnungen haben den gleichen Grundriss. Da hören die Ähnlichkeiten allerdings auch schon auf. Direkt nach dem Eintreten finden sie sich in einer Art Hippie-Wohlfühloase wieder. Sicher hat das Institut auch Davids Wohnung möbliert, doch er muss den Großteil der alten Teile rausgeschmissen haben. Statt eines abgeschabten Echtledersofas in Anthrazit liegt bei ihm eine bunt bezogene Matratze mit jeder Menge Kissen auf gestapelten Europaletten. Der Sofatisch war früher vermutlich eine Weinkiste, vielleicht sogar die, aus der die Flaschen kamen, die jetzt als Kerzenständer dienen. Über die Auslegware auf dem Fußboden hat er PVC gelegt, das vom Muster her marokkanische Fliesen imitiert. Auf einem Wandregal steht eine Shisha. Außerdem ziert die Wände jede Menge abgefahrene Kunst. Afrikanische Holzmasken, ein Baumscheibenmobile, ein zweites, an dem Knochenfragmente und Zähne an Fäden von einem Querholz hängen. Bilder, die eher von Enthusiasmus als von der Fertigkeit der Schaffenden zeugen. Vor einem Fenster hängt ein höchstwahrscheinlich selbst gemachter Vorhang aus verschiedenen Muschelschalen. An lange Schnüre geheftete Polaroidfotos zeigen fröhliche Menschen auf Dachterrassen, am Strand, im Dschungel.
Der Junge kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Dass er nicht allzu viel von persönlichen Grenzen hält, hat er am heutigen Abend bereits bewiesen. Auch jetzt macht er sich nichts daraus. Mit offenem Mund streift er durch das Wohnzimmer, saugt alle Eindrücke in sich auf. Theresa kann ihn verstehen. Sie hat die letzten fünfzehn Jahre in der Großstadt gewohnt, aber selbst für sie ist das hier ganz schön viel.
David schiebt sich an ihnen vorbei. »Setzen wir uns doch erst einmal.« Er deutet auf das Palettensofa. »Wollt ihr was trinken? Ich hab Fassbrause.« Er guckt zu dem Jungen, dann richtet er die Aufmerksamkeit auf sie. »Oder vielleicht einen Schnaps auf den Schreck?«
Der Junge grinst. »Ich nehm ’nen Schnaps.«
»Ganz sicher nicht!«, protestieren David und sie wie aus einem Mund.
»Warum? Ich bin schon achtzehn.«
David zieht eine Augenbraue hoch.
»Okay, siebzehn.«
Die zweite Augenbraue gesellt sich zur ersten. »Zwölf, allerhöchstens.«
»He! Ich seh nicht aus wie zwölf. In echt bin ich sogar ziemlich groß für mein Alter.«
»Und welches Alter ist das?«
Er sackt in sich zusammen. »Vierzehn. Aber ich werde bald fünfzehn. Nicht mal mehr sechs Wochen.«
»Also im besten Fassbrausenalter«, meint David fröhlich und wendet dann ihr fragend den Blick zu.
»Für mich auch eine«, sagt sie.
David nickt. »Zwei Fassbrausen kommen gleich.« Er verschwindet in Richtung Küche, und sofort legt sich Verlegenheit zwischen sie und den Jungen. Er lässt den Kopf hängen, schaut aber immer wieder verstohlen zu ihr hoch. So, als könnte er gar nicht anders. Wahrscheinlich sollte sie sich bei ihm entschuldigen, aber immerhin war er es, der nachts um ihr Haus geschlichen ist und ihr eine Heidenangst eingejagt hat.
Zwei Erdzeitalter später kommt David endlich mit den Limoflaschen zurück. Er reicht erst ihr eine, dann dem Jungen. Das Glas ist kühlschrankkalt. Bevor sie einen Schluck trinkt, presst sie es gegen ihre Schläfe. Dorthin, wo sich die Anspannung der vergangenen Viertelstunde zu einem pochenden Knoten verdichtet hat.
Der Junge leert die Hälfte der Flasche in einem Zug, unterdrückt einen Rülpser und sieht sich wieder im Wohnzimmer um. »Echt krass, was Sie aus der Wohnung gemacht haben. Dabei sah die Bude hier oben doch anfangs sicher genauso aus wie die unten.«
»Und wie es da aussieht, weißt du so genau, weil du mir nachts ins Schlafzimmer gespannt hast. Schon mal überlegt, dass das illegal ist?«
»Hey, ich hab nicht gespannt. Ich wollte nur gucken, ob du schon da bist. Ich war neugierig, okay?«
»Neugierig worauf? Welche Farbe mein Schlafanzug hat? Gibt es nicht für genau solche Kicks das Internet?«
»Ich bin doch kein Perverser, Mann! Ich …«
»Okay, okay, können wir mal einen Gang zurückschalten?« Wieder ist David die Stimme der Vernunft. »Vielleicht stellen wir uns erst mal gegenseitig vor. Wie ich heiße, wisst ihr ja schon. Und du musst Theresa sein, oder? Wir arbeiten ab morgen zusammen im Museum.«
Sie nickt. Der Zug, vorzugeben, sie sei eine andere, ist längst abgefahren.
»Bleibst nur noch du.« Auffordernd sieht David den Jungen an.
»Wenn ich euch jetzt sage, wer ich bin, ruft ihr sicher meine Eltern an, und die flippen dann total aus.«
»Zu Recht.« Jedes Mal, wenn Theresa den Mund aufmacht, kommen Gift und Galle raus. Diese ganze Situation ist ihr schrecklich peinlich. Hier sitzt sie im Schlafanzug im Wohnzimmer ihres zukünftigen Kollegen und muss erklären, warum sie einen Minderjährigen verprügelt hat. Aus den Unterlagen, die sie zur Vorbereitung auf diesen Job bekommen hat, weiß sie, dass David Oswald Sozialpädagoge ist. Die Zusatzqualifikation in Museumspädagogik hat er in einem postgradualen Studium erlangt. Kein Wunder, dass er ganz Verständnis und Deeskalation ist, während die Anwesenheit eines Kindes in ihrer Gegenwart sie fast noch mehr stresst als die Vermutung, ein Stalker würde um ihr Haus schleichen. »Gehören Kinder in deinem Alter zu der Zeit nicht ins Bett?«
»Nee, das ist kein Problem. Meine Eltern merken gar nicht, wenn ich nachts aussteige, die sind viel zu sehr mit den Kleinen beschäftigt. Aber zu dir zu gehen, hat mir meine Mutter ausdrücklich verboten.«
»Zu mir?« Theresa versteht nicht. »Warum sollte dir irgendwer verbieten, mich kennenzulernen? Es weiß doch niemand, dass ich ankomme.«
»Hä? Das wissen alle! Die Frau Berndl hat es der Frau Emlinger erzählt, weil sie doch die Wohnung hier unten fertig gemacht hat und deshalb allen möglichen Kram im Supermarkt gekauft hat, den sie sonst nie kauft. Und die Frau Emlinger hat es dann allen anderen erzählt. Dass die Resi Radinger wieder zurückkommt und dass vor allem meine Mam sich bestimmt freuen muss, weil ihr euch ja schon so lange nicht mehr gesehen habt und so.«
Frau Berndl ist die Besitzerin des Hauses, das an das Moorerlebniszentrum anschließt, und damit so was wie Theresas neue Vermieterin, und den Emlingers hat schon früher der einzige Supermarkt im Umkreis von zwanzig Kilometern gehört. Das hat sich offenbar in den vergangenen fünfzehn Jahren nicht geändert, aber darum geht es im Moment nicht.
»Wie alt bist du noch mal, sagtest du?«
»Vierzehn.«
»Und deine Mutter …«
»… will nicht, dass ich dich kennenlerne. Sie sagt, ich habe bei dir nichts zu suchen. Dabei habe ich echt schon oft noch dir gefragt. Ich wollte dich schon total lang mal kennenlernen, und da dachte ich, das könnte jetzt endlich meine Chance sein.«
Sie schluckt trocken. Selbst die Fassbrause hilft nicht gegen das plötzliche Kratzen im Hals. »Du bist …« Noch einmal schluckt sie. Es auszusprechen, würde es wahr machen. Würde bedeuten, dass Worte, die vor fünfzehn Jahren in Wut ausgesprochen wurden, noch immer gelten.
Noch einmal atmet sie durch, dann gibt sie sich einen Ruck. »Du bist Korbinian. Korbinian Bachmair.«
»Eigentlich nennen mich alle Korbi.« Er grinst. Auf einmal ist es so offensichtlich. Die Farbe seiner Haare, die Form seines Kinns. »Du bist meine Tante. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe«, schiebt er nach, da kämpft sie immer noch mit der Titulierung. Tante. Natürlich weiß sie, dass Chrissi Kinder hat. Drei Stück an der Zahl, und doch hat sie nie darüber nachgedacht, dass das auch für sie eine Bedeutung hat. Dass Chrissis Mutterschaft sie zu einer Tante macht.
»Schon vergessen«, sagt sie, und das stimmt. Im Vergleich zu dem, was Korbi ihr gerade eröffnet hat, war der Schreck, eine fremde Gestalt vor dem Fenster zu sehen, gar nichts.
Zum Glück übernimmt von da an wieder David das Ruder. Er lässt Korbi schwören, nie wieder durch die Fenster fremder Leute zu gucken. Außerdem legt er ihm nahe, demnächst offen auf andere zuzugehen, wenn er sie kennenlernen will, und dass es ratsam wäre, sich mit seinen Eltern auszusprechen, statt hinter ihrem Rücken durch die Nacht zu schleichen. Zuletzt besteht er darauf, Korbi mit dem Auto nach Hause zu fahren. Weil es zu spät für einen Vierzehnjährigen ist, um noch allein unterwegs zu sein.
Theresa verabschiedet die beiden an ihrer Wohnungstür im Erdgeschoss.
»Bis morgen dann«, meint David. »Wir sehen uns ja in ein paar Stunden drüben im Museum.«
»Gute Nacht, Tante Resi«, sagt Korbi, und obwohl sie es nicht will und es total absurd ist, weil sie nichts mehr mit dieser Gegend hier verbindet, außer ein Job, den sie eigentlich gar nicht annehmen wollte, und sie gerade erst erfahren hat, dass Chrissi sie wirklich und wahrhaftig nicht wiedersehen will, fühlt es sich zum ersten Mal ein bisschen an wie Nach-Hause-Kommen.
Heute – Theresa
Es riecht nach Farbe und Lösungsmitteln. Die Böden glänzen, auf den Treppengeländern und Glasscheiben gibt es keine Fingerabdrücke. Erst vor wenigen Tagen hat das Moorerlebniszentrum seine Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die Ausstellung hat eine gemischte Arbeitsgruppe aus Biologinnen, Museumspädagogen, Vertreterinnen des Tourismusverbands, Geologen und Ökologinnen kuratiert. Kein Wunder, dass Theresa ein bisschen das Gefühl hat, sich in ein gemachtes Nest zu setzen. Aber so ist es nun einmal in der wissenschaftlichen Welt. Man geht dorthin, wo die Jobs sind. Hätte sie es sich aussuchen können, hätte sie bestimmt nicht den Bayerischen Wald gewählt. Das Chaos vom Vorabend ist der beste Beweis dafür, wie richtig ihr Bauchgefühl in dieser Sache lag.
Als sie eintritt, schaut David von hinter dem Empfangstisch auf. Sein Lächeln wirkt ehrlich, nicht, als würde er sich an die Irre mit dem Teppichklopfer erinnern und sich innerlich über sie lustig machen.
»Da bist du ja.« Er wirft einen Blick zu der Wanduhr über dem Haupteingang. »Pünktlich auf die Minute.«
»Irgendwie muss ich den Eindruck von gestern Abend ja wiedergutmachen. Oder es zumindest versuchen.«
»Ach, so schlimm war das nicht. Um ehrlich zu sein, fand ich es ziemlich amüsant. So viel Action erlebt man auf diesem Fleckchen Erde sonst ja eher nicht.«
Sie denkt an seine Wohnungseinrichtung mit den Fotos von überall auf der Welt, seine hippen Freunde und die exotischen Reisemitbringsel. In seiner Vita hat sie gelesen, dass er nicht nur in Berlin studiert, sondern nach dem Abitur ein internationales Freiwilliges Soziales Jahr in Mexiko-Stadt verbracht hat, wo er Kindern auf den Müllkippen Lesen beigebracht hat, und zum ersten Mal sieht sie ihn sich richtig an.
Er muss ungefähr in ihrem Alter sein. Anfang, höchstens Mitte dreißig. Statt wie gestern in Jogginghose und ausgeleiertem T-Shirt steht er heute in cognacfarbener Cordchino, mit bis zu den Ellenbogen hochgekrempeltem eierschalenfarbenem Leinenhemd und karierter Wollweste vor ihr. Was bei anderen bieder aussehen würde, wirkt bei ihm hip. Das mag an dem Septum-Piercing liegen oder an dem Schal mit Paisley-Muster, den er sich kunstvoll um den Hals geschlungen hat. Doch am auffälligsten sind seine Augen. Warm ist das erste Wort, das ihr zu ihnen einfällt, und so dunkel wie frisch gestochener Torf. Kontur verleihen seinem Gesicht der Dreitagebart und die kräftigen Augenbrauen. Überhaupt ist er ziemlich haarig. Die wilden schwarzen Locken und die feinen Härchen auf den Unterarmen siedeln ihn optisch irgendwo zwischen französischem Liebhaber und Brennpunktlehrer in Köln-Finkenberg an. Natürlich ist Moosbrunn für ihn ein Synonym für Hinterwäldlerhausen, und irgendwie tut es gut zu wissen, dass es wahrscheinlich nicht nur sie nicht ganz freiwillig in den Bayerischen Wald verschlagen hat.
Sie muss zu lange gestarrt haben, denn wieder ist er es, der den Gesprächsfaden aufnimmt.
»Wie starten wir? Soll ich dich erst mal herumführen? Oder möchtest du zuerst dein Büro sehen?«
»Lass mich am besten meine Tasche ablegen, dann kann es losgehen.«
Wie erwartet, macht das Büro nicht viel her. Es ist ein Raum unter dem Besucherbereich im Kellergeschoss mit zwei Schreibtischen, einer Reihe Metallregalen und diversen Messinstrumenten. Natürliches Licht kommt nur durch einen länglichen Lichtschacht, den Rest erledigen Leuchtröhren.
»Die anderen Büros sind oben hinter dem Empfang«, erklärt David. »Du kannst dich hier also ausbreiten, wie du willst. Das Labor ist nebenan, aber da kenne ich mich nicht aus. Ich soll dir nur den Schlüssel überreichen. Außer mir und dir arbeiten die meisten hauptsächlich remote von zu Hause aus und kommen nur ein- oder zweimal pro Woche ins Museum, um am Empfang auszuhelfen und so.« Mit großer Geste fördert er einen Schlüsselbund aus seiner Hosentasche zutage und legt ihn neben die Computertastatur auf den Schreibtisch. »Mit dem Rest kennst du dich aus, hat man mir gesagt.«
Sie nickt und stellt ihre Tasche unter einen der beiden Schreibtische. Dann richtet sie ihren Blick wieder auf David. »Dann also los. Zeig mir dein Reich.«
Im Großen und Ganzen teilt sich der Besucherbereich des Moorerlebniszentrums in zwei grobe Abschnitte: Im Erdgeschoss wird die erdhistorische Entwicklung der Gegend beleuchtet. Auf Knopfdruck erzählen Fichten, Eiben und Buchen ihre Geschichte. In einem wimmelbildartigen Mural kann man mit einer Fernrohrattrappe nach typischen Bewohnern des Moorwalds suchen. Trifft man mit dem Fernrohr die richtige Stelle an der Wand, leuchtet das entsprechende Tier auf. Ein Rothirsch guckt aus dichtem Dickicht auf die Betrachtenden, am Ufer eines Baches versteckt sich eine Wasserspitzmaus, ins Visier genommen von einem Uhu auf der Jagd.
Schaubilder erklären die Unterschiede zwischen Hochmooren, Niedermooren und Zwischenmooren, ein durchsichtiger Tank zeigt die verschiedenen Erdschichten eines Moores.
In den oberen Besucherbereich geht es durch einen lang gezogenen Tunnel, an dessen Wände Videoeinspieler projiziert werden. Er verdeutlicht die jahrmillionenlange Entwicklung der verschiedenen Landschaften dieser Gegend. Jahrtausende sind die Sekunden unserer Erde, hat einer ihrer Professoren an der Uni gesagt, und dem Museumsteam ist es gelungen, das einzufangen. Während Theresa und David den Tunnel entlanggehen, verändert sich die Landschaft auf den Tunnelwänden. Sie laufen durch einen Hain von Moorbirken, die es bereits vor 13 000 Jahren im Bayerischen Wald gab, umringt von Sanddorn und Wacholderbüschen. 12 500, blinkt auf der Leinwand auf, und aus der Ferne läuft eine Gruppe steinzeitlicher Jäger auf sie zu. Mit der Wärmezeit vor 10 500 Jahren erblüht die Vegetation. Es kommen Heidelbeersträucher, Ahornbäume und zahlreiche Kleintierarten dazu. Vor 8000 Jahren sieht es beinah schon aus wie heute: Fichten besiedeln den Boden, immer öfter treffen sie Menschen auf der Reise durch die Zeit. Hirten und Jäger in richtiger Kleidung. Sie ernähren sich von den Früchten der Haselsträucher, mahlen Mehl aus Bucheckern und suchen Schutz im Schatten mächtiger Buchen. Der Boden ist über und über bewachsen mit Farnen und Gräsern. Vor rund 1100 Jahren dann beginnt die späte Warmzeit, in der wir uns auch heute noch befinden. Es ist das Mittelalter. Durch den Wald und über das Moor kommen Reisende von überall aus Europa und der Welt. In den Glashütten der Gegend werden kostbare Kelche, Gläser und Vasen hergestellt. Die Menschen sind gläubig und arbeitsam.
Mit eingezogenem Kopf schlüpft Theresa auf der anderen Seite aus dem Tunnel. Ihr Mund steht vor Begeisterung offen.
»Das ist …«, sie sucht nach den richtigen Worten, »… echt eindrucksvoll.«
David lächelt. »Ja, zum Glück hat man mittlerweile begriffen, dass Lernen Spaß machen muss. Wir können Kindern Schreiben, Rechnen und Lesen beibringen, soviel wir wollen; wenn wir ihnen nicht mitgeben, dass sich damit mehr machen lässt, als gute Noten in der Schule zu bekommen, können wir uns die Mühe eigentlich gleich sparen.«
Eine Erinnerung flackert in ihrem Gedächtnis auf. Frau Loibl, ihre Klassenlehrerin von der sechsten bis zur neunten Klasse, die mit Gummistiefeln in einem Bachlauf steht. Mit der einen Hand rafft sie ihr knielanges Blümchenkleid, mit der anderen hält sie einen Kescher, um im Wasser nach Wasserasseln, Steinfliegenlarven und Wasserläufern zu fischen. Theresa hat sie die große Ehre anvertraut, nach jedem erfolgreichen Fang die Beute aus dem Kescher in ein Glasgefäß zu geben. Noch heute spürt Theresa das Pochen ihres Herzens in der Brust, als sie zum ersten Mal begreift, dass der Mensch nur eine Art von vielen ist. Dass es, auch verborgen vor den Augen der Menschen, kreucht und fleucht und vor Leben pulsiert. Hätte es Frau Loibl nicht gegeben, stünde sie heute nicht hier. Wie vieles wäre dann anders.
»Und hier oben ist der Ausstellungsteil, in dem es um das Leben der Menschen in der Gegend geht, nicht wahr?« Als brave zukünftige Mitarbeiterin hat sie sich natürlich über das Zentrum informiert.
»Genau. Es gibt Informationen zu Waldwirtschaft, zu Migration und Integration. Zum Leben im Schatten des Eisernen Vorhangs und den Aussichten, die junge Menschen aus der Region heute haben.«
»Jetzt sind wir also schon museumswürdig. Wer hätte das gedacht?« Sie weiß, dass es im Grunde eine gute Sache ist. Dass Ausstellungen wie die im ersten Stock ihres neuen Arbeitsplatzes Brücken bauen und Vorurteile verringern sollen. Wir sind wie ihr, sagen die Schaubilder zu den Touristen. Seid stolz auf eure Herkunft, ermutigen sie die Jugendlichen aus der Gegend, die künftig schulklassenweise durch das Moorerlebniszentrum geschleift werden. Ihr flüstern sie alle nur eines zu, und das ist das Wort »Verräterin«.
Im Foyer des Museums klingelt die Türglocke und kündigt Besucher an.
»Ich muss dann mal«, sagt David. »Du findest dich zurecht?«
Theresa nickt. Er wendet sich ab und sprintet die Treppe hinunter, die neben dem Tunnel zurück ins Erdgeschoss führt. Unbeobachtet jetzt, geht sie erneut die Exponate ab, sieht in die Gesichter auf den alten Fotos. Nicht wenige der Nachnamen sind ihr vertraut: Schreil, Sendbühler, Zeitlköfler. Heute sind die wenigsten von ihnen noch Bauern, aber Waidler sind sie geblieben. Die Kinder ihrer Kindeskinder sind mit Theresa zur Schule gegangen. Ein Name bedeutet hier etwas. Er ist ein ewiges Erbe, das aus Erde erwachsen ist, auf der der Bayernwald sich erhebt.
Ein Kind, dem sie einen Namen geben wird, wird es niemals geben. Dafür hat sie gesorgt.
Der Schmerz trifft sie unvermittelt und so heftig, dass er ihr den Atem nimmt. Sie presst beide Hände auf den Bauch, wo die Leere sich zu einem eisigen Knoten verkrampft.
Sie hat kein Recht auf diesen Schmerz, hat ihn sich selbst ausgesucht. Ihre Gründe waren gut, und sie gelten noch immer.
»Theresa?« Davids Stimme reißt sie aus den Gedanken. »Besuch für dich.«
Mit dem Handrücken wischt sie sich Feuchtigkeit von den Wangen. »Gleich.« Sie hat eine Ahnung, wer im Foyer auf sie wartet, und ihre Intuition liegt richtig.
Korbi lehnt mit dem Hintern am Empfangstresen, ein Skateboard lässig unter einen Arm geklemmt. Als er sie kommen sieht, grinst er unter dem Schirm seines Käppis hervor.
»Der junge Mann hier hat gefragt, ob wir nicht einen Job für ihn haben.« Auch David kann sich das Grinsen nicht verkneifen. Dass es zwischen ihr und Korbinian eine Geschichte geben muss, ist offensichtlich, und ihr neuer Kollege ist niemand, der sich für seine Neugier schämt. Er zwinkert ihr zu und fährt fort: »Zur Not auch ehrenamtlich. Ein unbezahltes Praktikum als Wiedergutmachung für seine Vergehen.«
Theresa verdreht die Augen. »Hast du keine Schule?«
»Habt ihr nicht auch am Nachmittag geöffnet?«
Genau so hätte auch Chrissi reagiert, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Theresa verschränkt die Arme vor der Brust und schiebt sich an Korbi vorbei in Richtung Personalausgang, von wo es nach unten zu ihrem Büro geht. Ihm ins Gesicht zu sehen, bringt sie nicht fertig.
»Sorry, Kleiner, aber Personalentscheidungen liegen nicht in meinem Zuständigkeitsbereich.«
»In wessen Zuständigkeitsbereich dann? Ich kann auch eine richtige Bewerbung schreiben, wenn ihr wollt. Sagt mir nur, an wen ich mich wenden soll.«
Den letzten Satz hört sie nur noch gedämpft. Hinter ihr fällt die Feuerschutztür zu.
»Theresa, warte!« Auf halbem Weg in den Keller holt David sie ein.
Theresa bleibt stehen, dreht sich aber nicht zu ihm um.
»Ihm ist es wirklich ernst«, meint er. »Willst du ihm echt keine Chance geben?«
»Du bist der Pädagoge von uns beiden. Wäre es da nicht dein Job, gelangweilte Kinder zu bespaßen?«
Ausgesprochen klingt die Frage viel patziger als in ihrem Kopf. Sie saugt die Unterlippe zwischen die Zähne, kaut darauf herum, so hatte sie das nicht gemeint. Doch David lässt sich von ihrer Kratzbürstigkeit nicht abschrecken. Im Gegenteil. Sie könnte wetten, dass sie in seinen Augen Herausforderung funkeln sieht.
Korbi kommt wieder. Jeden Tag um kurz vor zwei am Nachmittag betritt er das Museum. David macht es ihm nicht leicht. Er lässt ihn die Glasscheiben der Schaukästen putzen, Unmengen an Infobroschüren sortieren und mehrmals täglich Kaffee kochen, doch das hält Korbi nicht auf. Auch die kleine Kaffeeküche sauber und ordentlich zu halten, wird zu Korbis Aufgabe, und nicht einmal das entlockt ihm ein Murren. Alle ihm übertragenen Pflichten erledigt er sorgfältig und verlässlich. Am Anfang zeigt sie ihm die kalte Schulter. Chrissi hat ihrem Sohn nicht umsonst verboten, Kontakt zu ihr zu suchen, aber Korbi ist stur, und am dritten Tag bröckelt Theresas Schutzmauer. Wenn Korbi ihr jetzt einen Kaffee ins Büro bringt, lächelt sie ihn an. Wenn sie sich irgendwo im Haus begegnen, werfen sie sich einen Gruß zu. Er hat schnell herausgefunden, dass er sie ärgern kann, indem er sie »Tante Resi« nennt. Jedes Mal korrigiert sie ihn dann, sagt »Theresa«, aber er lässt sich nicht davon abbringen, und die Sache mit dem Namen wird zu einem Spiel zwischen ihnen.
Wenn Neugierige ins Moorerlebniszentrum kommen, versorgt sie David von hinter dem Empfangstresen mit Informationsmaterial. Er hat ein gutes Gespür dafür, wer durch die Ausstellung geführt werden will und wer die Exponate lieber allein erkundet. Wenn keine Gäste da sind, hört sie David und Korbinian immer wieder zusammen lachen, und eine Sehnsucht ergreift sie, die so ursprünglich ist wie Hunger.
Am Freitag dann hat sie genug. In ihrem unterirdischen Kabuff fällt ihr die Decke auf den Kopf. Sie ist nicht Biologin geworden, um tagein, tagaus im Keller zu sitzen. Sie packt ihre Ausrüstung in einen Rucksack und macht sich auf die Suche nach Korbinian. Sie findet ihn in der Ausstellung mit den Waldbewohnern. Er sitzt mit einem Zeichenblock auf den Knien auf einer der Besucherbänke und hat den Blick auf seine Arbeit gerichtet. Sein Bleistift tanzt über das Papier. So konzentriert ist er, dass er sie nicht kommen hört.
»Hey.« Mit zwei Schritten Abstand bleibt sie stehen.
Er zuckt zusammen, lässt den Block ungeschickt hinter seinem Rücken verschwinden.
»Tante Resi.« Das Grinsen, das ihr mittlerweile so vertraut ist, erscheint auf seinem Gesicht, doch diesmal wirkt es ein wenig gezwungen. »What’s up?«
»Theresa.« Sie verdreht die Augen. »Und eigentlich wollte ich dich das fragen. Bist du gerade schwer beschäftigt, oder hättest du ein, zwei Stündchen Zeit für mich?«
»Für meine Tante Resi habe ich immer Zeit.«
»Weißt du was, vergiss es einfach.« Sie winkt ab und macht Anstalten, auf dem Absatz kehrtzumachen, aber das lässt Korbi nicht so einfach geschehen. Er schnappt sich den Zeichenblock und hetzt ihr nach.
»Warte, okay? Tut mir leid. Ich dachte, das wäre mittlerweile ein Spaß zwischen uns. Warum magst du es eigentlich nicht, wenn ich dich so nenne? Du bist doch meine Tante.«
»Warum magst du es nicht, wenn jemand deine Arbeiten sieht?« Sie nickt zu dem Block unter seinem Arm, und unter dem Bartflaum kriecht Röte auf sein Gesicht.
»Das ist doch nichts. Nur ein paar Kritzeleien von mir.«
»Zeigst du sie mir trotzdem?« Sie bleibt stehen.