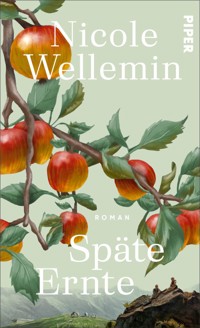
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer sind wir noch, wenn uns alles genommen wird? Im Jahr 1943 träumt die junge Südtirolerin Lene von einer glücklichen Zukunft auf dem Hof ihrer großen Liebe Elias. Wie hart das Schicksal ist, das in der rauen Bergwelt auf sie wartet, ahnt sie nicht. Viele Jahrzehnte später baut ihre Enkelin Anna in ebendieser kargen Landschaft mit viel Hingabe alte Apfelsorten an. Als sie die Mittfünfzigerin Lis kennenlernt, die eine schwere Schuld trägt, gewährt Anna ihr Unterschlupf auf dem Hof. Ein ganzes Jahr verbringen die Frauen gemeinsam im Einklang mit der Natur. Mit ihrer behutsamen Art ermöglicht Anna Lis, sich zu öffnen und zu heilen. Denn auch sie kennt die Last von fremder Schuld und den Schaden, den das Schweigen anrichten kann. Ein einfühlsamer Roman über die heilende Kraft der Natur und die Befreiung von einer vererbten Schuld Die Autorin Nicole Wellemin erzählt, was hat Sie dazu inspiriert hat, diesen besonderen Roman zu schreiben: »Vor fünf Jahren las ich zum ersten Mal von einem Südtiroler, der auf über 1.000 Höhenmetern gegen alle Widerstände sortenreine Apfelsäfte für die Hochgastronomie keltert, und war sofort fasziniert. Die Landschaft kenne ich noch aus dem Familienurlaub als Kind. Schon damals wirkten die Dolomiten auf mich wie die Grenze zwischen einem unsichtbaren Hier und Dort. Aus all den Bruchstücken in meinem Kopf setzte sich dann nach und nach eine Geschichte zusammen. Über Dinge, die nicht gesagt werden können, die aber doch die Macht haben, Menschen für immer zu entzweien, über den Anbau besonderer Äpfel und eine Schuld, der jede Generation etwas hinzufügt.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Späte Ernte« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Dr. Clarissa Czöppan
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bridgeman Images und Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Ritten, 1952
Kapitel 1
Elisabeth
heute
Anna
Elisabeth
heute
Kapitel 2
Anna
Elisabeth
zwei Jahre zuvor
Elisabeth
heute
Kapitel 3
Anna
Ritten, 1943
Kapitel 4
Elisabeth
heute
Elisabeth
fünf Jahre zuvor
Elisabeth
heute
Kapitel 5
Anna
Ritten, 1943
Anna
Kapitel 6
Anna
Elisabeth
heute
Kapitel 7
Elisabeth
heute
Elisabeth
vier Jahre alt
Elisabeth
heute
Kapitel 8
Ritten, 1944
Anna
Kapitel 9
Elisabeth
heute
Anna
Kapitel 10
Elisabeth
neunzehn Jahre alt
Elisabeth
heute
Ritten, Oktober 1944
Elisabeth
heute
Kapitel 11
Elisabeth
heute
Anna
Kapitel 12
Ritten, 1945
Elisabeth
heute
Kapitel 13
Elisabeth
heute
Ritten, 1945
Anna
Elisabeth
heute
Kapitel 14
Ritten, 1946
Elisabeth
heute
Kapitel 15
Elisabeth
heute
Anna
Elisabeth
heute
Landgericht München I
sechs Monate zuvor
Kapitel 16
Ritten, 1946
Elisabeth
heute
Kapitel 17
Elisabeth
heute
Ritten, 1952
Elisabeth
heute
Kapitel 18
Anna
Elisabeth
heute
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Ritten, 1952
Manche Dinge sind so schlimm, da kann man nicht drüber reden. Das heißt nicht, dass man sie vergisst, das meine ich nicht. Im Gegenteil. Sie bleiben für immer da und begleiten dich bei jedem Schritt an jedem Tag. Sie vergiften dich von innen heraus, bis du selbst zu dem Monster wirst, das dich im Schlaf verfolgt. Hässlich von innen und von außen, kein Mensch mehr, eine Bestie.
Die Tür zur Stube fliegt auf, und die Kleine stolpert herein. Ihre Fußsohlen sind dreckig. Zwischen den Zehen hängen ein paar Halme Stroh. Sie hat die Hände zu einer Schale geformt, und die hält sie mir so dicht vors Gesicht, dass ich nicht sehen kann, was darin ist.
»Geh, Gisela, lass mich in Frieden, siehst du nicht, dass ich am Buttern bin?« Ich nicke mit dem Kinn zur Seite. Meine Hände hören nicht auf zu arbeiten, nur die Fingerknöchel treten ein wenig weißer hervor. Das schmatzende Stampfen des Stößers erfüllt die Stube. Die malzige Süße der Sahne liegt klebrig auf meiner Zunge.
»Aber schau, Mama, was ich gefunden habe. Er ist krank.«
Nun sehe ich doch hin. Einen Zitronenzeisig hat sie aufgestöbert. Das heißt, sie hat sich wieder im Wald rumgetrieben, denn dort nisten die kleinen Viecher. Der hier hat sich den Flügel gebrochen. Ganz verdreht hängt er vom Körper runter. Das Schnäbelchen des winzigen Vogels steht offen, er japst nach Luft. Die Brust unter den flaumigen Federn hebt und senkt sich viel zu schnell.
»Der wird nimma«, sage ich zu der Kleinen. Ich lass den Butterstößer los und wische mir die Hände an der Schürze ab. »Am besten, du zertrittst ihn.«
»Ich will ihn behalten«, jammert sie. Noch ist es kein Heulen. Aber fast. Sie schaut mich an, mit diesem Ernst in den Augen, den ein Kind in ihrem Alter nicht haben sollte.
Es gibt Dinge, die sind so schlimm, da kann man nicht drüber reden. Sie will den Vogel behalten. Sie will zugucken, wie er leidet und stirbt. Die Leut sagen immer, sie sei ganz der Vater. Aber ihre Haare sind falsch. Die vom Elias sind zwar auch blond, aber ein bisschen dunkler und nicht ganz so lockig. Die Leut haben keine Ahnung, wie recht sie haben.
Ehe die Kleine ahnen kann, was ich mache, hole ich mit der Rechten aus und hau ihr den Vogel aus der Hand. Ein gezielter Tritt mit dem Fuß, und er ist hin.
Das Pendel der Uhr an der Wand schlägt genau einmal hin und her, dann fängt das Geheule an. Zuerst bebt die Unterlippe des Mädels, dann gräbt sich eine Falte zwischen ihre Augenbrauen. Ein markerschütternder Schrei hallt durch die Stube. Der Vogel war ganz leis, als er gelitten hat. Sie nicht.
»Ich wollt ihm helfen«, presst sie zwischen zwei Schluchzern hervor. »Ich wollt, dass er gesund wird, und ihn pflegen und ihm zeigen, dass ich ihn lieb hab.«
»Hol Schaufel und Besen und mach den Dreck weg.« Ich nicke zu dem zerquetschten Leib, dem Haufen aus Federn und Knochen am Stubenboden, der mal ein Vogel war.
Sie will protestieren. Ich seh es in ihren Augen, aber ich geb nicht nach. Mein Blick bleibt hart. Ich sag kein Wort. Ich fang auch nicht wieder an zu buttern, sondern schau sie nur an. Irgendwann kommen keine Tränen mehr. Der Rotz und das Wasser vom Heulen kleben auf ihren Wangen.
»Putz dir das Gesicht«, verlange ich. Ich schrei nicht, und sie tut, was ich sage. Sie schnieft und wischt sich mit dem Ärmel über die Nase und die Wangen. Jetzt klebt der Rotz an ihrem Hemd. Auch damit werd ich sie nicht davonkommen lassen. Sie muss lernen, dass alles, was man tut im Leben, Folgen hat. Die guten Sachen und auch die schlechten. Vor allem die schlechten. Wenn sie ihr Leiberl waschen muss, draußen an der Tränke, mit den Fingern im eiskalten Wasser, dann wird sie es sich merken.
»Und jetzt den Dreck.« Mit der Schuhspitze tippe ich neben den Kadaver von dem Vogel, den ich erlöst hab. Von ihrer Neugier. Von ihrer Liebe. Von dem Bösen in ihr.
Sie tut auch das. Ungeschickt mit ihren dicken Kinderfingern, aber am Ende ist der Boden sauber und der Rest vom Vogel auf dem Mist.
Beim Abendessen fragt Elias die Kleine, was sie erlebt hat und ob sie einen schönen Tag hatte. Es gibt die Butter, die ich nachher natürlich noch fertig gemacht hab, und Brot. Einen Käse und Speck ham wir auch noch in der Speise, aber ich hab sie nicht aufgetan. Ein Gefühl hat mir gesagt, dass es kein guter Abend wird, und für einen schlechten wollt ich den Kas und den Speck nicht verschwenden.
Der Blick von der Kleinen ruckt zu mir. Wie am Nachmittag fängt ihre Unterlippe das Zittern an. Ich denk schon, dass sie von dem Vogel anfangen wird, und wie ich ihn zertreten hab. Dass ich für das Tier nur das Beste getan hab, wird sie nicht sagen. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Das Beste zu wollen und das Richtige zu tun, das ist ganz oft nicht dasselbe. Elias wird das verstehen. Vielleicht.
Ich halte die Luft an, warte auf die Vorwürfe und die Tränen. Sie kommen nicht. Sie sieht ihren Vater noch nicht einmal an, spielt nur mit dem Brot auf ihrem Teller rum, zerbröselt ein Stückchen zwischen den Fingern.
Elias fährt ihr lachend durch die Locken. »Willst nicht drüber reden, was? Macht nichts, Gisela, dann bleibt’s halt dein Geheimnis.« Verschwörerisch zwinkert er ihr zu, und das Zittern von ihrer Unterlippe hört auf. Dass er lachen kann und sie lieben, wenn er sie anfasst, mit ihr isst oder spielt, das verübel ich ihm am meisten. Mehr noch als alles andere. Mehr noch, als dass es seine Idee war und deshalb auch seine Schuld.
Er nimmt die Hand von ihrem Kopf, und ich glaub, er wartet, ob sie nicht doch noch anfängt zu sprechen, jetzt, wo sie seine Erlaubnis hat zu schweigen. Aber sie tut es nicht. Sie presst die Lippen aufeinander und zerbröselt weiter ihr Brot.
Manche Dinge sind so schlimm, da kann man nicht drüber reden. Das heißt aber nicht, dass man sie vergisst, und ich frag mich, ob sie sich an den Zitronenzeisig erinnern wird. Irgendwann, wenn sie selbst Mutter ist und ein Kind hat. Ich frag mich, ob sie dem Kind dann davon erzählen wird oder ob ihr Schweigen genauso unendlich sein wird wie meins.
Kapitel 1
Elisabeth
heute
Nun habe ich also mein Ziel erreicht. Bolzano. Bozen, begrüßt mich das Schild am Bahnhof. Nicht nur der Ortsname ist in zwei Sprachen angeschrieben. Auch jede andere Information. Da steht Bin. tronco und Stumpfgleis direkt nebeneinander. Binario und Gleis, oder Sud und Süd. Ich habe keine Ahnung, was ein Stumpfgleis ist. Hinter mir seufzt die Hydraulik des Zuges, als würde er unter der schwindenden Last aufatmen. Immer mehr Reisende steigen aus. Die meisten tragen dicke Rucksäcke auf den Schultern, einige haben Wanderstöcke dabei. Ich habe meinen letzten Rucksack in der Grundschule besessen. An Wandertagen hat meine Mutter mir eine Brotzeitdose dort hineingepackt und meistens auch noch eine Süßigkeit. Als Belohnung, wenn ich gut durchgehalten habe. Heute belohnt mich niemand mehr für irgendwas, aber das ist okay, denn ich selbst würde mich ja auch für nichts belohnen. Heute ziehe ich den kleinen Bric’s Trolley hinter mir her. Die Rollen laufen wie auf Schienen und sind damit momentan wohl das Einzige in meinem Leben, das läuft, ohne zu ruckeln.
Über dem Gewirr an Oberleitungskabeln blicken die Berge auf mich hinab. In der Nähe des Bahnhofs sind die Hänge grün vom sprießenden Frühling. In der Ferne, wo sie mit der Unendlichkeit des Himmels verschmelzen, grau und blau. Berge sind Grenzen und Verbindungsglieder zugleich, habe ich mal gelesen, und Gipfel die Orte des Übergangs. Ich mochte das Bild – vielleicht ein klein wenig zu sehr.
Ich setze einen Fuß vor den anderen. Warum ich hier bin, weiß ich nicht wirklich. Ich habe keinen Plan, nur eine vage Idee. Es ist angenehm mild hier, die Luft klar und rein. Sie schmeckt wie saure Äpfel. Auf dem Bahnhofsvorplatz studiere ich eine Karte hinter Glas. Dort sind Wanderwege eingezeichnet, jede Menge Hotels und die Namen einiger berühmter Gipfel. Die Linien und Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen. Die Namen sagen mir nichts. Sie könnten in dreißig Sprachen da stehen statt nur in zwei, und trotzdem wären sie mir fremd. Mir ist alles fremd mittlerweile. Auch ich. Ich am allermeisten, und wenn man bedenkt, wie sicher ich mir bis vor Kurzem darüber war, wer ich bin und wie ich mein Leben leben will, ist das fast zum Lachen. Das, oder zum Heulen. Ersteres habe ich verlernt, glaube ich, und die Tränen sind mir ausgegangen.
»Kann ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie denn hin?« Eine Männerstimme reißt mich aus meinen Grübeleien. Ich schrecke auf. Halb hinter, halb neben mir steht ein junger Mann, Mitte zwanzig, schätze ich. Sein Gesicht ist braun gebrannt, nur die Partie über den Augen ist weiß. Von einer Sonnenbrille, nehme ich an. Der, die auf seinem Kopf in die aschblonden Haare geschoben ist. Ein hässliches Teil, wenn man mich fragen würde, neongrün und mit verspiegelten Gläsern, aber mich fragt ja niemand. Was wahrscheinlich gut ist, denn in seinen Augen bin mit Sicherheit ich es, die hässlich und fehl am Platz wirkt. Eine Frau in den Fünfzigern mit Falten im Twinset und Falten im Gesicht. Die im Twinset kommen vom langen Sitzen im Zug. Die im Gesicht hat das Leben gefurcht. Allein schon ihre Namen sind hässlich. Zornesfalte heißt die Kerbe zwischen den Augenbrauen. Nasolabialfalte die Rinne zwischen Nasenflügeln und Mundwinkeln, die mich mit jedem sich vertiefenden Millimeter verhärmter und bitterer aussehen lässt. Meine Haare habe ich mir nicht allzu ordentlich zu einem Pferdeschwanz gebunden. Dass ich aufgehört habe, sie zu färben, und zu meinen grauen Strähnen stehe, ist weniger ein Statement als das Akzeptieren einer Veränderung. Über dreißig Jahre lang waren sie dunkelbraun. Anfangs noch ganz ökomäßig mit Henna gefärbt, später kam die Chemie, sorgfältig angerührt im Salon, um den exakt richtigen Look zu erzielen. Alles, was anders ist als früher, ist gut. Aus diesem Grund habe ich mir auch den Pony geschnitten. Eigenhändig mit der Haushaltsschere vor dem Gästeklospiegel. Damit ich mich hinter den Fransen verstecken kann, müssen sie nicht gerade sein.
Eine Bewegung im Augenwinkel zerrt mich aus der Trance. Immer öfter passiert mir das, dieses Abtauchen in düstere Gedanken. Ich blinzle ein paarmal und räuspere mich. »Entschuldigung. Ich war ganz weggetreten. Was haben Sie gesagt?«
Der Typ mit der Sonnenbrille grinst. »Ich hab gefragt, ob ich Ihnen helfen kann. Sie sehen aus, als wüssten Sie nicht recht, wohin, und diese Fahrpläne sind einfach vollkommen verwirrend.« Er lacht ein wenig und sieht mich an, freundlich, offen. Trotzdem halte ich die Luft an, warte auf den Moment des Erkennens. Er kommt nicht. Sonnenbrillenmann bleibt freundlich und offen.
»Ich … ähm …« Ich räuspere mich. Meine Stimme kratzt im Hals. »Ich will die Berge sehen.«
Vielsagend lässt er den Blick schweifen und hebt eine Augenbraue. Berge sind hier überall.
»Als Kind habe ich mit meinen Eltern einmal Ferien in den Dolomiten gemacht«, setze ich zu einer Erklärung an. Warum ich den Drang verspüre, mich diesem Fremden in Funktionskleidung und mit der hässlichen Sonnenbrille zu erklären, bleibt ein Rätsel. Womöglich weil er der Erste seit Jahren ist, der mich ansieht, als wäre ich ein unbeschriebenes Blatt und als hätte er absolut keine Meinung zu mir. »Mein Vater hat mir diese Geschichte erzählt. Von Rübezahl und seinen Rosen.«
»König Laurin, meinen Sie. Dem Zwergenkönig. Dann wollen Sie also den Rosengarten sehen?«
»Ja. Und …« Wieder gehen mir die Worte aus. »… einfach alles.«
Mein selbst ernannter Fremdenführer lacht. »Wenn das so ist, fahren Sie zum Rittner Horn. Oben an der Schwarzseespitze steht ein runder Tisch. Von dort können Sie wirklich alles sehen, die ganze Pracht der Dolomiten. Von den Gipfeln des Peitlerkofel über die Geislerspitzen bis hin zum Schlern, weiter zum Rosengarten, zum Latemar bis zum Schwarz- und Weißhorn.« Mit dem Zeigefinger deutet er auf die entsprechenden Stellen auf der Karte. Wieder verschwimmen die Linien und Buchstaben auf der Karte vor meinen Augen. Zu viele Informationen. Meine Therapeutin hat mir Tabletten dafür verschrieben. Angeblich sollen sie mir helfen, mich zu konzentrieren, statt mich in endlosen Gedankenspiralen zu verlieren. Ich nehme sie nicht. Mein eigener Kopf ist mein einziger Rückzugsort geworden.
»Klingt gut«, sage ich, hoffend, so meinen Helfer loszuwerden. Mir ist nicht mehr zu helfen, und seine nette Art strengt mich an.
»Prima. Dann nehmen Sie am besten von hier aus die Rittner Seilbahn nach Oberbozen. Dann mit der Tram nach Klobenstein und weiter mit dem Bus nach Pemmern. Da ist dann die Talstation von der Seilbahn, die hoch zum Rittner Horn fährt. Ich hab das schon ganz oft gemacht. Ist nicht so schwer zu finden, und oben gibt es Wanderwege in wirklich jedem Schwierigkeitsgrad.« Jetzt mustert er mich doch, und ich kann mir denken, was er ungesagt lässt. Dass ich die ganz leichten Wanderwege brauchen werde in meinem Aufzug. Ohne richtige Wanderschuhe, nur mit Kalbsleder-Sneakern an den Füßen, einer Escada-Jeans statt atmungsaktiven Trekkinghosen und einem Fünfhundert-Euro-Trolley im Schlepp. Vielleicht liegt ihm eine Predigt auf der Zunge, wie wichtig die Sicherheit in den Bergen ist, aber er schluckt sie runter, und ich bin ihm dankbar dafür. Wie hätte ich ihm auch sagen können, dass meine Sicherheit wirklich das Letzte ist, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, als ich heute Morgen am Münchner Hauptbahnhof in den Zug gestiegen bin?
»Danke.« Ich wende mich ab.
»Schöne Ferien!«, ruft er mir nach, und weil ich nicht weiß, was ich sonst machen sollte, folge ich seinem Ratschlag und suche nach der Seilbahn nach Oberbozen. Den Trolley lasse ich stehen, wo er ist. Nichts aus meinem alten Leben kann mir jetzt noch helfen. Nur das Handy stecke ich in die Jeanstasche. Als ich ein paar Schritte gegangen bin, drehe ich mich noch einmal zu ihm um.
»Ein schönes Leben«, wünsche ich ihm. Ich weiß nicht, ob er mich hört.
Anna
Mit dem Klemmbrett im Arm sieht Anna dem jungen Azubi nach. Die Beine, die unter der weißen Kochschürze hervorstechen, sind so dünn, dass sie fürchtet, der arme Junge könnte jeden Augenblick unter seiner Last zusammenbrechen. Er schwankt ein wenig beim Gehen. Statt den direkten Weg vom Parkplatz zum Personaleingang zu nehmen, läuft er eine leichte Schlangenlinie. Na, wenn das mal gut geht.
Valentin folgt ihrem Blick und lacht. »Ich bin mir nicht sicher, ob du Angst um meinen Azubi hast oder um deine Lieferung. Aber sei dir versichert: Der Flo schafft das schon. Der ist nur noch ein bisschen verkatert von letzter Nacht. Aber wie heißt es so schön? Wer feiern kann, kann auch arbeiten.«
Sie hakt die letzte Zeile auf ihrer Liste ab und reicht den Lieferschein Valentin. Was auch immer dieser Flo angestellt hat, es fällt jetzt nicht mehr in ihren Zuständigkeitsbereich. Zwölf Kisten à sechs Flaschen hat sie Valentin diesmal ausgeliefert. Ein neuer Rekord, wenn man bedenkt, dass sie vor nicht einmal vierzehn Tagen zum letzten Mal hier war. Sie beide lehnen mit dem Hinterteil an der Ladekante ihres Mercedes Sprinter. Vor ihnen plätschert ein Springbrunnen. Aus dem Spa-Bereich des Hotels steigt Dampf über den Sichtschutz, der die Wellness-Suchenden vor neugierigen Blicken abschirmt. Das Spa-Resort Egger Alm gilt als eine der besten Erholungsadressen in Südtirol. Alles hier ist luxuriös und ganz auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt. Genau das macht die Egger Alm zum perfekten Testmarkt für ihre Säfte. Spielerisch stupst sie Valentin in die Seite.
»Mach dich nur lustig über mich, aber wenn ich mit meiner Ware nicht so vorsichtig umgehen würde, wären deine Gäste sicher nicht so begeistert davon. Wenn das so weitergeht, muss ich demnächst wöchentlich liefern und nicht mehr nur alle zwei Wochen.«
»Apropos begeistert.« Er zwinkert ihr zu. Mit etwas Fantasie wäre Valentin alt genug, ihr Vater zu sein. Dennoch zählt sie den Hotelier aus dem Eggental zu ihren engsten Freunden. Er hat zu den Ersten gehört, der ihr Vorhaben nicht für verrückt erklärt, sondern sie von Anfang an unterstützt hat. »Ich sehe da noch ein Kistchen in der hintersten Ecke des Lieferwagens. Hast du das vergessen? Oder ist das eine Speziallieferung, die du vor dem gemeinen Volk versteckst?« Vielsagend wackelt er mit den Augenbrauen. Anna lässt sich von seinem Lachen anstecken.
»Durchschaut!«, gibt sie zu. »Es ist ein Versuch, und ich wollte hören, was du davon hältst.« Mit dem Knie stützt sie sich auf der Ladefläche des Sprinter ab und kriecht halb in den dusteren Laderaum. Unglaublich, dass Valentin die Kiste tatsächlich erspäht hat. Sie hat sie extra weit nach hinten gepackt. Beim Wegfahren von zu Hause war sie sich noch nicht sicher, ob sie wirklich bereit sein würde, Valentin in ihr neustes Vorhaben einzuweihen. Nun, jetzt hat er die Entscheidung für sie getroffen. Auch gut.
»Brauchen wir Gläser? Sollen wir reingehen?«, fragt er.
Sie schüttelt den Kopf und klappt die Kiste auf. »Ich hab an alles gedacht.« Vorsichtig holt sie die beiden Gläser aus der Holzwolle, mit der sie ihre kostbare Ware geschützt hat. Eines reicht sie Valentin, das andere stellt sie zwischen ihn und sich auf die Ladefläche. Einmal durchatmen für Mut, dann greift sie nach dem Hals der ersten Flasche, holt sie aber noch nicht hervor. »Du weißt ja, dass einer meiner Grundsätze ist, meine Säfte nur sortenrein zu keltern.«
Er nickt. »Das ist die Geschäftsidee hinter den Hofer-Premium-Säften. Hundert Prozent Frucht, hundert Prozent Qualität. Du wolltest Verbrauchern zeigen, dass Apfelsaft all das kann, was Wein auch kann.«
»Genau.« Aufregung kribbelt in ihrem Magen. Das ist der Grund, warum sie mit neuen Ideen immer zu allererst zu Valentin kommt. Er begreift, was in ihrem Kopf vorgeht. »Und das habe ich jetzt auch wieder gemacht, ich habe mich vom Weinmarkt inspirieren lassen. Gerade bei den hochwertigen Schaumweinen gibt es eine riesige Nachfrage für Cuvées. Vor allem in Frankreich und Spanien. Liegt vielleicht daran, dass Cuvée hübscher klingt als ›Verschnitt‹, aber das Prinzip dahinter ist ja dasselbe. Es geht darum, die Vorzüge verschiedener Rebsorten so zu kombinieren, dass sie sich gegenseitig verstärken.«
»Und das willst du jetzt auch mit Saft machen?«
»So ungefähr.«
»Aber wenn du nun doch anfängst, unterschiedliche Apfelsorten zu mischen, verwässerst du deine gesamte Geschäftsidee.« Valentin scheint mit Recht skeptisch, aber natürlich hat Anna das auch bedacht.
»Deshalb habe ich nicht verschiedene Apfelsorten gemischt«, setzt sie zu einer Erklärung an. »Meine Cuvées kombinieren sortenreine Apfelsäfte mit anderen Früchten, Kräutern oder Blüten. Hier, schau mal.« Sie holt die erste Flasche aus der Kiste. »Das ist zum Beispiel ein Gravensteinerapfelsaft mit Hopfen. Siehst du die Farbe?« Sie hält die Flasche so, dass sich das Sonnenlicht in ihr bricht und die Flüssigkeit zum Leuchten bringt. »Dieses intensive Strohgelb? Man muss noch nicht einmal kosten und hat schon eine Fülle am Gaumen, oder? Und warte erst einmal, bis du ihn probiert hast. Der Saft hat eine unglaublich feine Säurestruktur. Dadurch bleibt das Aroma lange am Gaumen. Der herbe Hopfen kontrastiert mit der Süße der Äpfel. Ich kann mir das perfekt zu würzigen, scharfen Gerichten vorstellen. Oder auch zu Pizza oder kräftigen Käsesorten. Und weil man Hopfen eher mit Bier verbindet als mit Saft, wirkt ein ›Bergapfel-Hopfen-Cuvée‹ auch gleich viel maskuliner. Ein Hopfencuvée ist kein Kindergetränk. Das ist etwas für echte Genießer.«
Valentin stößt einen anerkennenden Pfiff aus. »Auf jeden Fall weißt du, wie du deine Ideen verkaufen musst. Nach dieser kleinen Ansprache kann ich es gar nicht abwarten, deine Kreation zu probieren.«
Sie dreht die Flasche auf. Wie all ihre Säfte gleicht die Aufmachung eher einem hochwertigen Wein statt einem Apfelsaft. Das gehört zum Konzept. Hofer Bergapfelsäfte sind Premium-Apfelsäfte. Keine Flasche kostet unter sechs Euro. Dafür bekommt der Kunde ausgewählte Bioqualität aus handverlesenen Früchten. Niemand kommt auf die Idee, ihre Säfte mit Wasser zu verpanschen oder als puren Durstlöscher hinunterzustürzen. Genau das spiegeln auch die Flaschen und Etiketten wider. Angefangen vom schlanken Flaschenhals über den von einer Kappe geschützten Drehverschluss bis hin zum leicht gebogenen Flaschenboden, setzt das gesamte Produktdesign auf Eleganz und Exklusivität. Sie wiegt die Flasche kurz in den Händen, dann schenkt sie erst Valentin ein und schließlich sich selbst.
Wie sie erwartet hat, lässt Valentin die goldene Flüssigkeit zunächst kreisen, ehe er die Nase in die Öffnung des Glases steckt und intensiv schnuppert. Gedankenverloren wiegt er den Kopf hin und her. »Du hast recht. Schon im Bukett kommt der Hopfen schön raus.« Er erhebt sich von der Ladeflächenkante, tritt einen Schritt nach vorne und hält das Glas prüfend ins Sonnenlicht. Auf diese Weise kann er sehen, ob Partikel im Saft schwimmen oder die Textur auch beim genauen Hinsehen so seidig ist, wie Anna versprochen hat. Er legt den Kopf schief, kneift die Augen zusammen und stockt mitten in der Bewegung. »Au weia.« Zwischen den Zähnen saugt er zischend Luft ein. »Das sieht aber gar nicht gut aus.«
Annas Herz rutscht in die Magengrube. Ihr ist doch nicht etwa der Saft gekippt? Mit ganz viel Pech kann das passieren, wenn die Flaschen nicht hundert Prozent sauber sind beim Abfüllen. Im Leben nicht würde sie sich einen derart blöden Fehler verzeihen. Sie braucht Valentin. Wenn sie nicht einmal ihn auf ihre Seite ziehen kann, dann hat sie niemanden mehr. Das ist nämlich der Nachteil daran, eine Einzelkämpferin zu sein. Mit jeder Idee, mit jedem neuen Unternehmen ist sie vollkommen auf sich gestellt. Als sie den Hof von ihren Eltern übernommen und sie davon überzeugt hat, Anna einfach machen zu lassen, hat sie genau das gewollt. Sie liebt die Freiheit dabei. Kompromisse einzugehen, war noch nie ihre Stärke. Doch manchmal ist es ebendiese Freiheit, die sie ausbremst. Wie viel mehr wäre möglich, wenn sie jemanden an ihrer Seite hätte, der ihre Visionen mit ihr teilt? Mit dem sie Strategien besprechen oder einfach nur ihre Gedanken diskutieren könnte. Valentin tut, was in seiner Macht steht. Aber am Ende des Tages ist er ihr Kunde. Ein Resort wie die Egger Alm führt sich nicht von selbst. Apfelanbau ist nicht sein Metier, sondern ihres.
Sie verscheucht den Gedanken und tritt eilig an seine Seite. »Ist etwas mit dem Saft?«
»Nein, gar nicht.« Sein Blick bleibt weiter gen Himmel gerichtet. »Aber siehst du die Wolken da oben über dem Latemar? Das sieht mir gefährlich nach einem Gewitter aus. Und zwar nach einem, das sich gewaschen hat.«
Anna stößt einen Fluch aus. Wie alle Kinder der Berge hat sie früh gelernt, die Gefahren eines Gewitters zu fürchten. Vor allem an Tagen wie heute, wenn den ganzen Vormittag über die Sonne mit voller Kraft auf die Erde scheint und nichts auf einen Wetterumschwung hinweist. Doch genau das macht die Gefahr aus. Insbesondere die gefürchteten Frontgewitter kommen nicht selten aus heiterem Himmel. Im einen Moment noch eitel Sonnenschein, im nächsten meint man, die Welt ginge unter. Oft genug bringen sie auch einen Wetterumschwung mit sich. Wer dann in den Bergen feststeckt und nicht die richtige Ausrüstung dabeihat, für den kann es böse enden. »Hoffentlich sind deine Gäste alle in Sicherheit.«
»Ich werd auf jeden Fall an der Rezeption Bescheid sagen, dass sie ein Auge drauf haben, wer unterwegs ist und wer nicht zurückkommt.« Ihren Apfel-Hopfen-Cuvée stürzt er in einem Zug hinunter. Das leere Glas reicht er ihr. »Schmeckt ganz okay. Ich weiß, dass du mehr hören wolltest, aber ich muss los, gucken, dass alles gewitterfest gemacht wird. Letztens haben meine Leut vergessen, die Sonnensegel im Garten vom Wellnessbereich einzuholen, und als dann der Wind kam, hat er mir die ganze Verankerung rausgerissen. Wir setzen uns einfach die Tage noch mal zusammen, ja?«
»Gerne.« Okay? Das ist alles, was er dazu zu sagen hat? Enttäuschung macht sich in ihr breit, aber sie drängt sie zurück. Das hier ist wirklich nicht die richtige Gelegenheit. Sie nimmt das Glas von ihm entgegen. »Aber willst du nicht wenigstens die Kiste mitnehmen? Da sind auch noch meine anderen Experimente drinnen. Rouge-Preiselbeere und Pinova-Marille.«
»Klingt super.« Er hievt sich die Kiste auf den Arm und beugt sich zu ihr herab, um ihr zum Abschied Küsse auf beide Wangen zu drücken. »Aber weißt du was? Warum lädst du nicht außer mir noch ein paar andere zu dir auf den Hof ein und machst ein richtiges Tasting draus? Geschmäcker sind unterschiedlich, und je mehr Meinungen du sammeln kannst, umso besser. Und bis dahin: Pass auf dich auf, wenn du zurückfährst, ja? Nimm lieber nicht die Abkürzung übers Joch, wo die Wege so schmal sind. Wenn da wirklich was runterkommt, wüsste ich dich lieber auf gescheiten Straßen.«
»Ja, Papa.« Sie verdreht die Augen. »Ich pass schon auf. Schließlich fahr ich die Strecke nicht zum ersten Mal.« Schwungvoll lässt sie die Heckklappe des Sprinter ins Schloss fallen. Beinah gleichzeitig frischt der Wind auf. Eine Böe saust über den Hotelparkplatz, fährt in die Ärmel von Annas T-Shirt und lässt sie schaudern. Wie es aussieht, ist es wirklich Zeit für sie, nach Hause zu fahren. Anna mag weit gereist sein und beinah die ganze Welt gesehen haben, doch aufgewachsen ist sie im Schatten der Dolomiten. Die Legenden und Mythen ihrer Welt hat sie mit der Muttermilch aufgesogen. Sie sitzen ihr im Mark, ganz tief, wo weder Vernunft noch Verstand hinkommen. Und diese Legenden besagen, dass, wenn ein Windsturm aufkommt, sich einer erhängt hat und es dem Teufel gefällt, ihn hin und her zu beuteln. Sie will nicht glauben, dass es wirklich so ist. Dass irgendwo, nicht weit entfernt, ein Mensch so verzweifelt gewesen sein soll, dem Leben selbst ein Ende zu machen. Doch das Gefühl von Unbehagen bleibt.
Elisabeth
heute
Ich bin vom Weg abgekommen. Irgendwann habe ich mich verlaufen. Schon wieder. Wahrscheinlich hätte ich mir die Ausführungen des Sonnenbrillenmanns aufschreiben sollen. Mein Gedächtnis ist nicht das beste zurzeit. Die Seilbahn nach Oberbozen habe ich noch genommen und auch die Tram. Danach muss ich in den falschen Bus gestiegen sein, doch statt den Fahrer zu fragen, wie ich zum Rittner Horn komme, bin ich einfach ausgestiegen. Die Haltestelle hatte mir gefallen. Ein Schild mitten im Nichts. Kein Dorf weit und breit. Ein paar Wegweiser deuten in verschiedene Richtungen. Schmale Holzpfeile mit roten Spitzen an langen Stecken. Außer mir sehe ich keine Wanderer. Ich folge meinem Instinkt, nehme einen Pfad, der rechts von der Straße abgeht. Schon bald komme ich ins Schwitzen, so steil führt der Weg bergan. All meine Gedanken beziehen sich aufs Atmen. Zwei Schritte ein, zwei Schritte aus. Früher bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Pilates und Spinning waren meine Favoriten. Das hier ist anders. Unmittelbarer. Unweit des Weges rauscht ein Bach in die Tiefe, moosbewachsene Felsen erheben sich rechts und links des Pfades aus dem Wiesengrün. Überall sprießt der Frühling. Butterblümchen und Alpen-Vergissmeinnicht sprenkeln den Wegrand in Gelb und Grün. Die Berge sind so viel näher hier als in Bozen. Wie Scherbensplitter ragen ihre Zacken in den Himmel, mit schneebedeckten Hängen und Gipfeln. Noch bin ich weit entfernt von den Gipfeln. Mal geht es durch tiefen Mischwald, mal über Wiesen oder Weiden, die durch Viehgatter abgesperrt sind.
Wenn ich nicht mehr kann, halte ich an. Dann beuge ich mich vornüber, stütze die Hände auf die Oberschenkel und atme. Ein. Aus. Ein. Aus. Irgendwann geht es wieder, und ich kann weitergehen. In der Ferne sehe ich Gehöfte. Aus Holz gebaute Anwesen, die sich wie Schwalbennester an die Berghänge schmiegen. Gegen Mittag wünsche ich mir, ich hätte einen Sonnenschutz dabei. Ich schwitze in meinem Twinset und den Jeans. Feuchtigkeit klebt mir im Nacken, läuft mir in Bächen von unter den Armen über die Seiten. Vielleicht bemerke ich deshalb den Sturm zunächst nicht. Im ersten Moment genieße ich die flüsternde Kälte von auffrischendem Wind auf meiner überhitzten Haut. Ich lege den Kopf in den Nacken, sehe in den Himmel. Erst da fällt mir auf, wie schnell die Wolken mit einem Mal ziehen. Sie rasen förmlich, bauschen sich turmhoch um die Bergspitzen, schlucken das Sonnenlicht, tauchen die Welt in monochromes Grau. Ich fröstle. Als würde ein Geist mich berühren, stellen sich die feinen Härchen in meinem Nacken auf. Da! Ein Leuchten zerteilt die plötzliche Dunkelheit. Wie ein gezackter Blitz fährt es in eine der Felswände am Horizont, doch es ist kein Blitz, denn dem Leuchten folgt kein Donner.
Ich ziehe die Schultern zu den Ohren, versuche, mich in mir selbst zu verstecken. Es hilft nicht. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Aus den Wolken fällt dicker Regen auf mich herab. Er haut auf mich ein. Ich spüre die Einschläge auf meiner Kopfhaut, meinen Armen und dem Gesicht. Ich renne. Eben noch schien doch die Sonne. Wo um alles in der Welt kommt plötzlich dieses Gewitter her? Oder ist es womöglich wirklich der Weltuntergang? Hat irgendeine hohe Macht dort oben auf den Gipfeln, auf dem Übergang zwischen hier und dort beschlossen, dass es noch nicht meine Zeit ist, und vertreibt mich jetzt mit all seiner Macht?
Der Gedanke ist so absurd, dass ich lache. Eigentlich ist es eher ein Keuchen. Ich kann nicht mehr. Klappernd schlagen meine Zähne aufeinander. Weiden sollst du meiden, Buchen sollst du suchen – heißt so nicht die alte Binsenweisheit, die Polli mir als Kind mitgegeben hat? Doch ich bin eine Stadtpflanze. Ich kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob ich eine Weide von einer Buche unterscheiden könnte, wenn sie direkt vor mir stünden. Aber das da am Hang neben dem Weg sind ziemlich sicher weder das eine noch das andere. Es sind Nadelbäume. Ihre Äste peitschen im Wind. Der ganze Wald jault und heult, und dennoch ist mir bewusst, dass das Dickicht zwischen den Bäumen meine einzige Rettung ist.
Ich verlasse den Weg. Zuerst noch ein Stück über die Wiese und dann hinein in den Wald. Der Hang ist stark abschüssig, aber der Regen ist so kalt, und die Wolken zerquetschen meinen Verstand.
Schon beim ersten Schritt zwischen die Bäume gibt der Boden unter mir nach. Die Sohlen meiner Kalbsleder-Sneaker bieten keinen Halt. Auf dem glitschigen Untergrund aus nassen Blättern und Nadeln rutsche ich aus, falle, falle, falle. Ich reiße Äste mit mir und kleine Steine, mein Körper kugelt den Abhang hinunter. Immer wieder sticht mir etwas Hartes in den Rücken, die Rippen, den Bauch. Ich knalle mit der Stirn gegen einen Baumstamm, auf der Suche nach Halt krallen sich meine Hände in Dornenranken und fassen ins Leere. Schwärze verwirbelt vor meinen Augen, kriecht immer weiter auf mich zu, bis sie mich schließlich komplett umschließt, und das Letzte, was ich denke, ist: So hat es nicht sein sollen. Ich hab mir das Ende so oft ausgemalt, aber so hat es nicht sein sollen. Am Ende wollte ich fliegen, nicht fallen.
Kapitel 2
Anna
Anna ist noch keine Viertelstunde unterwegs, da setzt der Regen ein. Als würde sie eine unsichtbare Macht mit Steinen bewerfen, trommelt er auf das Autodach. Sie schaltet das Licht ein, verlangsamt das Fahrtempo. Durch die graue Suppe vor der Windschutzscheibe erkennt sie kaum, wohin sie fährt. Selbst auf der höchsten Stufe kommen die Scheibenwischer nicht damit nach, die Himmelssturzbäche vom Glas zu schieben. Zefix, sie hätte auf Valentin hören und lieber den Umweg über Bozen nehmen, aber dafür auf den besser ausgebauten Straßen bleiben sollen. Aber so ist es immer mit ihr. Nichts kann sie erfolgreicher davon abhalten, einen bestimmten Weg einzuschlagen, als ein wohlmeinender Rat. Ihr Vater sagt: Studier was Vernünftiges, und Anna packt ihren Rucksack und macht sich auf, die Welt zu erkunden. Ihre Mutter sagt: Hauptsache, du findest einen netten Mann, mit dem du eine Familie gründen kannst, und Anna stürzt sich in das Verhältnis mit einem Kerl, der seine Freiheit noch mehr liebt als sie. Die Leute sagen: Auf tausend Metern Höhe wachsen keine gescheiten Äpfel, und Anna beschließt, die elterliche Landwirtschaft auf Apfelanbau umzustellen. Marco liebt das an ihr. Ihren Eigenwillen und die Bereitschaft, unkonventionelle Wege einzuschlagen. Mitunter ist diese verfluchte Dickköpfigkeit aber auch ein echtes Ärgernis.
Sie klammert die Hände fester ums Lenkrad und rutscht auf dem Fahrersitz so weit nach vorne, dass ihre Nase beinah die Windschutzscheibe berührt. Obwohl sie mittlerweile nur noch in Schrittgeschwindigkeit dahinkriecht, fürchtet sie, etwas zu übersehen. Auf diesem Wegabschnitt führt die kleine Straße mitten durch den Wald. Rechts von ihr ragt steil der Hang auf, links geht es metertief hinab. Zwar würden die Bäume sie auffangen, wenn sie vom Weg abkäme, aber angenehm wäre ein solcher Sturz nicht. Die viel größere Gefahr geht von Steinschlägen aus. Schon jetzt reißt das Wasser jede Menge loses Geröll, Blätter und Erdreich vom Hang und spült es auf die Straße. Wenn es hier schon so schlimm ist, will sie sich gar nicht ausmalen, wie fürchterlich es erst weiter oben sein muss, wo es keine Bäume mehr gibt, nur noch Wiesen und Weiden.
Meter für Meter schleicht sie vorwärts. In ihren Ohren pocht der Puls, so sehr konzentriert sie sich auf den Weg. Sind das Schneeflocken, die sich da in den Regen mischen? Himmel Herrgott, das hat ihr gerade noch gefehlt. Seit fast zwei Wochen ist die Temperatur stetig gestiegen. Das hat den Bäumen gefallen, und sie haben ausgeschlagen. Wenn dieses Gewitter jetzt Frost mit sich bringt, kann das im schlimmsten Fall die ganze Ernte gefährden. Als ob ihre pure Anwesenheit die Apfelblüten schützen könnte, tritt sie ein wenig aufs Gaspedal. Und wird prompt bestraft, indem der Sprinter unsanft über eine Wurzel oder einen Stein rumpelt, den sie nicht gesehen hat.
»Verdammt!« Sie tritt auf die Bremse, versucht gegenzulenken, und übersteuert. Einen kurzen, fürchterlichen Augenblick lang meint sie, direkt auf den schmalen Straßengraben zuzuschlittern, der den Hang vom Weg trennt. Gerade so gelingt es ihr, den Wagen wieder nach vorne zu richten, aber der winzige Moment des Schlingerns hat genügt, damit das Licht ihrer Scheinwerfer auf etwas am Hang fällt, was dort nicht hingehört.
Instinktiv bringt sie den Sprinter zum Halten und legt den Rückwärtsgang ein. Da! Sie hat sich nicht getäuscht. Da ist etwas! Zwischen den Stämmen zweier junger Kiefern. Es war die Farbe, die sie hat aufsehen lassen. Nichts in der Natur ist von einem so leuchtenden Magenta. Sie lehnt sich über den Beifahrersitz, rutscht so nah an das dem Hang zugewandte Fenster, wie es nur geht. Vor Schreck gefriert ihr das Blut in den Adern. Das Unbehagen ist zurück. Die lächerliche Vorahnung, die sie gehabt hat, als der plötzliche Wind aufgezogen ist. Das ist nicht etwas, was sich zwischen den Bäumen verhakt hat, sondern jemand. Anna kann Beine ausmachen, die in Jeans stecken, und einen Schopf schulterlanger Haare. Nur der Herrgott kann ahnen, wie weit die Wanderin den Hang abgestürzt ist, ehe ihr Sturz zwischen den Bäumen zu einem unsanften Stopp gekommen ist. Wenn Anna sich nicht täuscht, führt der nächste Wanderweg erst oben an der Wiese entlang in Richtung Gipfel. Von dort trennen sie gut und gerne fünfzig Meter.
Sie lässt sich zurück auf den Sitz fallen und stößt die Fahrertür auf. Um ein Haar reißt ihr der Wind die Tür aus der Hand. Es ist ihr egal. Sie springt aus dem Wagen. Sofort peitscht Regen gegen sie, und ihre Hosenbeine sind nass bis zum Knie. Für ihren Besuch bei Valentin hat sie weder Wanderschuhe noch Funktionshosen getragen. So gut es geht, schirmt sie ihr Gesicht mit der Hand vor dem Regen ab und schlägt sich über den schmalen Straßengraben hinein in den Hang. Getrieben vom Wind, schwanken die Bäume. Ein unheimliches Jaulen liegt in der Luft, als würden die Geister der Hölle Hochzeit feiern. Je näher sie kommt, desto mehr Details erkennt sie. Die Frau hat eine Platzwunde an der Stirn. Dreckschlieren verunzieren ihre Jeans und das Wolltwinset, das sie trägt. Hat Anna sich gerade noch geärgert, dass sie die falsche Kleidung für eine Rettungsaktion trägt? Die Verunglückte setzt dem Ganzen die Krone auf. Wer, bitte schön, geht in Kaschmirtwinset und Designerjeans in die Berge? Von einem Rucksack ist weit und breit keine Spur. Wenn Anna es nicht besser wüsste, würde sie glauben, irgendeine höhere Macht hätte die Frau direkt aus der Stadt hierher gebeamt.
Neben dem Oberkörper der Verunglückten geht sie in die Hocke. Sie streicht ihr die Haare aus der Stirn. »Hallo? Hören Sie mich? Wie heißen Sie? Sie hatten einen Unfall.«
Eine Sekunde, zwei, dann heben sich flatternd die Augenlider der Fremden. Selbst im Sturmdunkel erkennt Anna die geweiteten Pupillen und die pure Angst in den Augen der anderen. »Wo … was …? Ich … E…«, ein Seufzen, »…lis.«
»Sie sind gestürzt, Lis.« Sie glaubt nicht, dass Lis ihr echter Name ist. Das Unwetterfauchen hat die gehauchten Laute der Frau verschluckt und verzerrt. Selbst Anna muss schreien, um dagegen anzukommen. »Können Sie aufstehen? Sie müssen mitkommen, hören Sie? Hier ist es nicht sicher. Warten Sie, ich helfe Ihnen, Ihre Beine zu befreien.« Im Grunde ist es ganz leicht. Die beiden Stämme, zwischen denen Lis’ Bein feststeckt, sind jung und lassen sich ohne viel Kraftaufwand auseinanderschieben.
»Jetzt!« Anna feuert Lis an, und zu ihrer großen Erleichterung begreift diese sofort und befreit mit einem Ruck ihr Bein.
»Ich glaube … ich glaube, den Rest schaffe ich allein.«
»Das ist nicht nötig. Ich helfe Ihnen. Warten Sie!« Sie schiebt eine Schulter unter Lis’ Arm, hält sich an dem Baum fest, gegen den Lis’ Oberkörper geprallt ist, und richtet die andere, so langsam und vorsichtig sie kann, auf.
Zwar stöhnt Lis, aber sie scheint keine allzu großen Schwierigkeiten damit zu haben aufzustehen.
»Mein Wagen ist direkt dort drüben. Nur ein paar Schritte. Schaffen Sie das? Dann fahre ich Sie ins Krankenhaus, okay?«
»Kein Krankenhaus.« Millimeter für Millimeter kämpfen sie sich vorwärts. Lis’ Gewicht halb auf Anna gestützt und Anna, die sich an jedem Baum festhält, damit sie nicht wieder abrutschen. Sie haben noch nicht einmal den halben Weg hinter sich gebracht, da kleben ihre Hände bereits vom Harz, und in den Regen auf ihrem Nacken und der Stirn mischt sich Schweiß.
Das größte Hindernis ist der Straßengraben. Im Dreibeinlauf werden sie ihn niemals überwinden. Sie lässt Lis los, mustert sie von der Seite her. »Meinst du, du schaffst das allein?« Das Sie vergisst sie ganz schnell. Sie findet, ein Abenteuer wie das, welches sie gerade gemeinsam durchstehen, verlangt nach dem Du.
Lis befreit sich aus Annas Umarmung, testet erst vorsichtig, dann mit mehr Sicherheit ihren Stand. »Das geht schon. Ich glaube nicht, dass ich mich verletzt habe. Es sind nur ein paar Kratzer.«
»Das sollten wirklich lieber die Ärzte im Krankenhaus …«
»Nein!« Das kommt so resolut, wie Anna es niemals im Leben von einer Frau erwartet hätte, die eben noch halb bewusstlos zwischen zwei Kiefernstämmen festklemmte. Aber die Sache ist die: Mit Dickköpfigkeit kennt Anna sich aus. Deshalb weiß sie ganz genau, dass in Lis’ Fall momentan kein Reden und Diskutieren helfen werden.
Sie seufzt. »In Ordnung. Aber dann komm wenigstens mit zu mir. Im Wagen kann ich die Heizung aufdrehen, und wenn wir bei mir zu Hause sind, überlegen wir weiter.«
Lis antwortet nicht, aber die Art, wie etwas von der Spannung aus ihrem Körper weicht, verrät Anna, dass sie das Richtige gesagt hat. Nur beim Einsteigen ächzt Lis noch einmal. Ansonsten wirkt sie beinah unwirklich gefasst. Obwohl sie Schmerzen haben muss, hält sie den Rücken gerade und den Kopf aufrecht. Ihre Lippen verschwinden beinah, so fest presst sie sie zusammen. Irgendwas an Lis’ Haltung, an der Verbissenheit um ihren Mund und dem Ausdruck in den Augen erinnert Anna an ihre Oma Lene. Seltsam, dass sie ausgerechnet jetzt an Lene denken muss. Ihre Großeltern mütterlicherseits und vor allem ihre Oma sind der große schwarze Fleck in ihrer Familiengeschichte. Die, deren Namen nicht genannt werden dürfen. Ohne Witz. Es ist exakt so wie bei Harry Potter. Sie selbst hat das nie verstanden. Selbst dann nicht, als sie Lene kurz vor deren Tod im Heim besucht und alles erfahren hat. Aber vielleicht hat sie auch leicht reden. Immerhin ist sie kurz darauf in die Welt aufgebrochen. Dorthin, wo niemand sie gekannt hat. Wo sie ein unbeschriebenes Blatt war statt eine ewige Erinnerung. Und seit sie zurückgekehrt ist, sorgt sie selbst für genug Furore, damit die alten Geschichten an Bedeutung verlieren.
Erst als Anna den Motor des Sprinter wieder anlässt, fällt ihr auf, dass der Regen nachgelassen hat. Die Scheibenwischer müssen nicht mehr so heftig arbeiten, trotzdem hat sie relativ freie Sicht auf die Straße.
»Dann wollen wir mal«, sagt sie und reibt sich die Hände. Von Lis bekommt sie keine Antwort.
Elisabeth
zwei Jahre zuvor
Die Ritzen der Jalousien filtern das Morgenlicht. Tanzende Lichtflecken sind das Erste, was ich sehe, als ich die Augen aufschlage. Sie fallen auf Mannies Waden, in ihrem Glanz schimmern die feinen Haare dort wie gesponnenes Gold. Ich strecke den Rücken durch, rolle die Schultern und lasse die Nackenwirbel knacken, dann rutsche ich ein wenig näher zu meinem Mann. Ins Gesicht sehe ich ihm nur flüchtig. Weil er mit chronisch verstopften Nebenhöhlen kämpft, schläft er mit leicht offenem Mund. Ein Speichelfaden rinnt ihm aus dem Mundwinkel und verfängt sich in den kurzen Stoppeln, die über Nacht an seinem Kinn gesprossen sind. Die Hand unter seiner Wange schiebt die Haut seines Gesichts ineinander, verstärkt die Falten zwischen seinen Brauen und knautscht ihm ein Doppelkinn, das er in wachem Zustand nicht hat.
Wir sind nicht mehr jung, Mannie und ich. Aber wenn ich mir den Schwung seiner Waden ansehe, die langen, eleganten Muskeln dort, die er mit so viel Mühe und Ausdauer pflegt, wenn ich auf das V seiner Schultern unter der Bettdecke gucke oder auf die Rundung seines Pos, begehre ich ihn noch immer so intensiv wie vor über dreißig Jahren.
Unter der Bettdecke kuschele ich mich an ihn. Der Wecker hat noch nicht geklingelt. Das heißt, es ist noch nicht einmal halb sieben. Mit der Hand taste ich nach dem schmalen Streifen Haut zwischen dem Bund der Boxershorts und dem Saum seines T-Shirts. Er ist warm dort und weich, und er gibt ein wohliges Stöhnen von sich, als er aufwacht.
»Morgen«, nuschle ich und drücke ihm einen Kuss auf das Schulterblatt. Er rutscht mir entgegen, sucht mit seinem Hintern meine Nähe und stößt ein tiefes Brummen aus. Wie wahrscheinlich jeder Mann mag er es, wenn ich ihm mein Begehren zeige. Er ist eitel. Manchmal erwische ich ihn dabei, wie er sich im Badezimmerspiegel von allen Seiten betrachtet und sich mit Daumen und Zeigefinger in die Haut an seiner Hüfte kneift. Wenn das Ergebnis nicht zu seiner Zufriedenheit ausfällt, verzichtet er ein paar Tage lang abends auf unser Gläschen Wein und isst kein Brot zum Abendessen oder Frühstück. Meine Freundinnen machen sich darüber lustig, wenn ich es ihnen erzähle, aber ich mag Mannies Eitelkeit. Ihm ist wichtig, wie er auf andere wirkt, und das ist auch ein Zeichen von Respekt. Er ist beruflich viel unterwegs, aber er denkt an mich. Auch nach siebenundzwanzig Jahren Ehe macht er mir noch Geschenke, wenn er zurückkommt. Kann eine Frau sich mehr wünschen?
Ich lasse meine Hand weiterwandern, über seine Flanke, nach vorne zu seinem Bauch. Die Härchen um seinen Bauchnabel herum kitzeln meine Fingerspitzen, jagen winzige Impulse durch meinen Leib. Mein Körper erwacht, prickelt unter den Funken unsichtbarer Wunderkerzen auf meiner Haut. Das sind die Momente, in denen ich mich ganz als Frau fühle.
»Hmm«, brummt er und rollt sich auf den Rücken. Er legt eine Hand in meinen Nacken, führt meinen Kopf nach unten. Ich küsse seinen Hals, direkt über dem Pulspunkt, die Kuhle unter seinem Adamsapfel, die zarte Haut über den Schlüsselbeinen. Nur auf den Mund küsse ich ihn nicht. Aus dem Alter, in dem ich Morgenatem ignorieren konnte, bin ich raus.
Bähm! Ein heftiger Schlag lässt das ganze Haus erzittern. Die Jalousie rattert gegen das Fensterglas. Ruckhaft hebe ich das Gesicht. Bähm, bähm, bähm. Noch mal und noch mal. Die Hände in die Bettdecke gekrallt, setze ich mich auf. Schwere Stiefelschritte poltern die Treppe herauf. Mein Herz rast. Es will mir den Brustkorb sprengen. Auch Mannie hat sich aufgesetzt. Ich will etwas sagen. Irgendwas. Doch meine Zunge ist wie gelähmt, und schon fliegt die Tür auf, und ins Zimmer stürmen mehrere Männer. Menschen. Vielleicht sind auch Frauen dabei. Ich weiß es nicht. Sie tragen Schwarz, von Kopf bis Fuß. Helme mit Visier, dicke Westen, Schulterholster, breite Gürtel. Sie haben Waffen dabei, Gewehre und Pistolen, und der Lauf eines dieser Gewehre richtet sich jetzt auf mich.
»Nicht bewegen! Polizei!«, schreit einer der Männer. Seine Stimme ist verzerrt von der Sturmhaube, als wäre gar kein Mensch hinter all der Schutzausrüstung, sondern ein Monster aus einem bösen Traum. Alles geht jetzt ganz schnell. Einer zerrt Mannie die Bettdecke weg. Ein Handgriff, zwei, dann liegt mein Mann auf dem Bauch, die Hände auf dem Rücken, Handschellen klicken. Ein Wimmern droht mir aus der Kehle zu steigen. Ich schlucke es hinunter. Furcht drückt mir auf die Blase. Ich habe solche Angst. Todesangst.
»Sie sind vorläufig festgenommen«, informiert einer Mannie. »Ihnen wird gleich erklärt, worum es geht.«
Ein anderer brüllt: »Sicher«, und schon kommen noch mehr Beamte ins Schlafzimmer. Dass das goldene Morgenlicht auch auf ihren Uniformen funkelt und tanzt, genau so, wie es vorhin auf Mannies Waden getanzt hat, kommt mir in diesem Moment vor wie die größte Ungerechtigkeit von allen. Gerade eben war noch alles gut. Gerade eben noch dachte ich, ich sei glücklich.
Elisabeth
heute
Jemand packt mich an der Schulter, rüttelt. Instinktiv reiße ich die Hände nach oben, schütze mein Gesicht, spüre die Feuchtigkeit auf den Wangen.
»Nein.« Meine Stimme zittert. Ich bin noch nicht richtig wach. »Nein, wirklich. Ich … glauben Sie mir … ich …« Mit dem Bewusstsein kommt die Scham. Ich presse die Lippen aufeinander, stoppe die Worte, die mir aus dem Mund brechen. Oder eigentlich aus dem Herzen. Gegen die Tränen, die ich im Schlaf vergossen habe, kann ich nichts mehr tun. Dabei dachte ich, ich hätte keine Tränen mehr. In Wahrheit waren sie nur versteckt. Verborgen in meinen Träumen, wo sie lauernd warten. Auf den richtigen Moment. Auf den einen unaufmerksamen Augenblick, in dem ich schwach genug bin, das Gestern an mich heranzulassen.
»Wir sind da«, sagt eine Frauenstimme.
Das Rütteln an der Schulter hört auf. Ich öffne die Augen, ganz langsam. Von irgendwoher bläst mir warme Luft ins Gesicht. In mir drinnen ist alles aus Eis.
Als Erstes sehe ich ihre Augen. Blau und klar wie das Wasser am Strand von Paradise Island, wo Mannie und ich unsere Silberhochzeit gefeiert haben. Ihr Gesicht ist zu nah, um Details auszumachen, aber in ihrem Blick liegen Wärme und Verständnis. Ich rücke von ihr ab, und sie versteht den Wink, lässt sich ihrerseits auf den Fahrersitz zurückfallen.
Es gibt Hunderte Arten zu lügen, das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Nur die wenigsten brauchen Worte. Auch Liebe kann eine Lüge sein. Freundlichkeit, Wärme, Hilfsbereitschaft, Offenheit. Früher habe ich nur an Gott nicht geglaubt. Heute glaube ich an gar nichts mehr.
Um nicht meine Retterin ansehen zu müssen, richte ich den Blick aus dem Fenster. Wälder und Wiesen, Bäume und Weiden. So, so viele Töne von Grün, trotz des Regens. Wie ein Fluss aus Schotter mäandert eine Straße in Schlangenlinien den Berg hinauf. Himmelsleiter nennen manche solche Straßen. An ein Paradies glaube ich ebenso wenig wie an Gott oder das Gute im Menschen. Allerdings kommt es mir vor, als hätten mich die Serpentinen in eine andere Zeit geführt. Dort, auf der anderen Seite des Nebels, der dick und weiß zwischen den Tannen hängt, meine Welt: Gerichtssäle, Verhörzimmer. Sendewagen mit Satellitenschüsseln auf dem Dach. Lauernde Reporter. Falsche Freunde.
Hier: Windschiefe Holzzäune, ein Haus wie aus einem anderen Jahrhundert. Dicke Mauern, fleckig wie ein abgenutztes Schaffell. Darüber Wände und Giebel aus Holz, dunkel von Alter und Wetter. Die obere Etage wird von Holzstützen getragen. Fenster, klein wie Schießscharten. Wer in diesem Haus wohnt, erträgt den Blick in die Welt wohl genauso wenig wie ich. An einer Mauer stapelt sich Feuerholz. Holzschindeln schmiegen sich schuppig wie die Haut eines Wesens aus der Urzeit ans Dach. Und außen herum die Berge, die Grenze zwischen hier und dort.
»Kommst du?«, fragt die Frau neben mir. Sie öffnet die Fahrertür, springt behände aus dem Kastenwagen.
Ich folge ihr langsamer. Jetzt merke ich sie doch. Die zahlreichen Blessuren von meinem Sturz. Hier ein Zerren, dort ein Reißen. Selbst meine Kiefer tun weh. Ein dumpfes Ziehen, das von unter meinen Ohren über den Hinterkopf bis in den Nacken, das Rückgrat entlang in meine Hüften fließt. Ich ignoriere den Schmerz, strecke das Rückgrat. Darin bin ich gut geworden in den letzten Jahren.
Bei jedem Schritt knirscht der Kies unter meinen Sohlen.
Meine Retterin stößt die Haustür des Bauernhofs auf. Einen Schlüssel benutzt sie nicht. Wenn sie etwas Böses fürchtet, dann nicht die Art von Übel, die sich von einem Schloss aussperren lässt. Obwohl der Türsturz nicht sonderlich niedrig ist, ziehe ich den Kopf ein, als ich ihr ins Hausinnere folge.
Im Flur ist es duster. Unverputzte Mauern scheinen auf mich zuzurücken. Eine große Truhe steht an die Wand geschoben. Garderobenhaken halten mehrere Jacken. Darunter ein paar Gummistiefel.
»In ein paar Minuten wird es warm«, verspricht mir die Fremde. Gleich die erste Tür in dem Flur führt in die Küche. »Ich mach uns ein Feuer. Setz du dich so lange doch schon mal hin.« Sie deutet auf die Eckbank vor dem Fenster. Der Tisch, zu dem die Bank gehört, bietet gut und gerne Platz für ein Dutzend Leute, aber ein Gefühl sagt mir, dass wir allein im Haus sind. Sie und ich. Da ist diese Stille um uns herum, die mehr ist als nur die Abwesenheit von Worten.
Ich rutsche in eine Ecke der Bank. Meine Hände verschränke ich im Schoß.
Mit ihrer jugendlichen Energie und zupackenden Freundlichkeit passt meine Retterin nicht in diese Küche. An der Wand hängt ein Kruzifix, flankiert von gerahmten Glasbildern der Muttergottes und dem Mensch gewordenen Christus. Fliesen, die wahrscheinlich älter sind als meine Retterin, zieren die Wände. Cremefarbene Keramik, dekoriert mit Blüten in Orange und Oliv. Auch die Möbel wirken alt. Nicht im Sinne von antik und wertvoll, sondern eher wie gebraucht und benutzt. Da ist ein riesiger Schrank. Eiche, schätze ich, mit Glastüren oben und ein paar Schubladen und Fächern unten. Eine Truhe. Die Unter- und Oberschränke in der Kochzeile sind windschief gezimmert. An den Ecken blättert das Furnier ab. Gegenüber von dem Kruzifix hängt eine Uhr. Hübsch, mit einem Gehäuse aus geschlagenem Kupfer und Zeigern und Ziffern aus dunklerem Metall. Sie passt zum Rest der Küche. Das leise Ticken füllt den Raum.
Aus der Truhe im Flur holt Anna ein Handtuch und reicht es mir.
»Fürs Gröbste«, sagt meine Retterin, dann schürt sie mit Handgriffen, die verraten, wie oft sie es tut, den Ofen an. Es gibt auch einen Elektroherd, mit Cerankochfeld und Backofen, aber der alte Holzofen ist schöner, genau so, wie man sich einen alten Bauernherd vorstellt. Mit einem silbrig glänzenden Handlauf, der einmal rund um die Herdplatte führt, abgegriffenen Henkeln an den Fächern und Laden und einem rötlich glänzenden Kupferkessel auf einer der Platten. Ein in Alufolie eingewickeltes dickes Ofenrohr führt über den Oberschränken in die Wand und nimmt dem Ganzen ein bisschen von der Schönheit.
Ich rubble mir mit dem Handtuch die Haare trocken, lege es mir wie eine Decke um die Schultern. Bald knistert ein Feuer. Lächelnd richtet die Fremde sich auf, und wieder trifft es mich, wie wenig sie in diese Küche, auf diesen Hof zu passen scheint. Sie ist jünger als ich, aber nicht blutjung. Um die dreißig, schätze ich. Schlank. Und hübsch mit ihren tief liegenden Augen, die ein wenig zu weit auseinanderstehen und ihrem Blick etwas Durchdringendes verleihen. Sie ist groß gewachsen, hat ein bisschen Po, ein bisschen Busen, ein bisschen Hüfte. Von allem nicht zu viel und nicht zu wenig. Sie ist die Art von Frau, die vielen Männern gefällt. Vor allem solchen, die mehr wollen als ein Aushängeschild an ihrem Arm. Ihre Schönheit wirkt natürlich, strahlt mehr von innen heraus, als von außen aufgesetzt zu sein. Nur ein paar dünne schwarze Schlieren unter den Augen verraten, dass sie geschminkt gewesen war, bevor sie angehalten hat, mitten im Wald in einem Sturm, um eine verirrte Wanderin aufzusammeln. Mit dem Handrücken wischt sie sich die Schlieren aus dem Gesicht und lacht ein bisschen.
Ende der Leseprobe





























