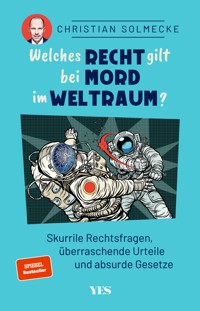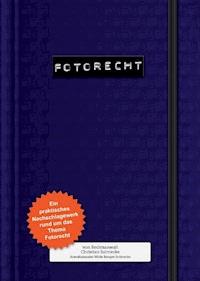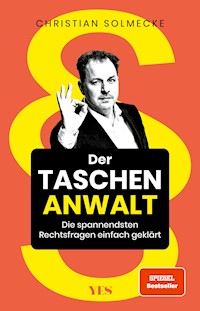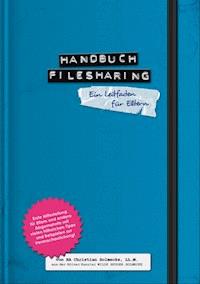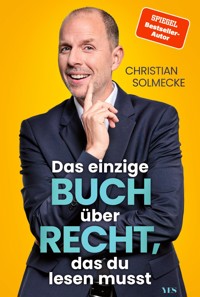
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Yes Publishing
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wann darf ich im Bewerbungsgespräch lügen? Wie kann ich mich gegen einen Strafzettel wehren? Und muss ich meine Mietwohnung jetzt doch renovieren, wenn ich ausziehe? Rechtsfragen begegnen uns tagtäglich: im Beruf, beim Wohnen, im Straßenverkehr, in der Familie oder im Internet. In diesem unentbehrlichen Handbuch erklärt dir der bekannte Rechtsanwalt Christian Solmecke, dessen YouTube-Kanal WBS.LEGAL über eine Million Abonnenten begeistert, kompakt und verständlich, welche Rechte und Ansprüche du im Alltag hast, welche Fristen du kennen musst und über welche weit verbreiteten Irrtümer du Bescheid wissen solltest. Ob Arbeitsrecht, Mietrecht, Erbrecht, Datenschutz, Familienrecht oder Versicherungsfragen: Dieses Buch verschafft dir schnell einen Überblick über alle wichtigen Rechtsbereiche des Alltags – ganz ohne Juristendeutsch. So verschenkst du keine rechtmäßigen Ansprüche oder Forderungen mehr, sparst bares Geld und bist bestens auf die Herausforderungen vorbereitet, die das Leben heute so mit sich bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Christian Solmecke
Das einzige Buch über Recht, das du lesen musst
Titelseite
Christian Solmecke
mit Daniel Wiechmann, Sonja Kurth und Anne Herr
Das einzige
Buch
über
Recht,
das du
lesen musst
Impressum
Originalausgabe
1. Auflage 2025
© 2025 by Yes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbR
Türkenstraße 89, 80799 München
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Stephanie Kaiser-Dauer
Umschlaggestaltung: Marija Džafo
Umschlagabbildung: Tim Hufnagl
Layout und Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN druck 978-3-96905-349-2
ISBN ebook 978-3-96905-350-8
Inhalt
Warum dieses Buch wichtig für dich ist und wie du es benutzt
Grundlagen des Rechts
Was ist eigentlich Recht?
Unser Rechtssystem
Lexikon: Wichtige juristische Begriffe
Vertragsrecht
Allgemeine Vertragsgrundlagen: Wie entsteht ein Vertrag?
AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen): Keine Angst vorm Kleingedruckten
Widerruf, Anfechtung, Rücktritt und Kündigung: Wie komme ich aus einem Vertrag wieder raus?
Vertragsbruch: Welche Rechte hast du?
Kaufrecht und Online-Verträge
Verträge mit Handwerkern und Dienstleistern
Mahnungen und Schulden
Internetrecht
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Urheberrecht
Recht am eigenen Bild
Welche Äußerungen im Internet sind (un)zulässig?
Social-Media-Plattformen und ihre Regeln
Was tun bei Abmahnungen?
Mietrecht
Mieterselbstauskunft: Was dein Vermieter dich fragen darf
Mietvertrag: Was muss in einem Mietvertrag stehen?
Arbeitsrecht
Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
Der Bewerbungsprozess und dein »Recht auf Lüge«
Arbeitsvertrag: Typische Regelungen und ihre Bedeutung
Regelungen zur Arbeitszeit und Überstunden
Vergütung
Urlaub: Anspruch, Berechnung und Übertragbarkeit
Mutterschutz und Elternzeit
Rechte bei Teilzeit oder im Minijob
Arbeitssicherheit
Mobbing
Kündigungsschutz: Alles, was du über Kündigungen wissen musst
Arbeitszeugnis: Was darf drinstehen?
Eherecht
Rechte und Pflichten in der Ehe
Ehevertrag – Ja oder Nein?
Scheidung: Voraussetzungen, Ablauf und Folgen
Erbrecht
Deine Rechte und Pflichten als Erbe
Testament und Erbvertrag: Unterschiede und Formvorschriften
Wie können sich Erben gegen ein fehlerhaftes Testament wehren?
Gesetzliche Erbfolge: Wer erbt, wenn es kein Testament gibt?
Gesetzlicher Pflichtteil
Erbengemeinschaft: Rechte und Pflichten der Erben
Erbschaftssteuer: Was ist zu beachten?
Umgehung des Erbrechts: Schenkung zu Lebzeiten
Was tun, wenn man ein Erbe ausschlagen möchte?
Erbrecht innerhalb der Familie: Wie regelt man sein Erbe richtig?
Verkehrsrecht
Unfall
Unfallflucht
Haftung bei Verkehrsunfällen: Wer zahlt den Schaden?
Bußgelder
Strafrecht
Strafverfahren
Was tun als Beschuldigter?
Was tun als Opfer?
Was tun als Zeuge?
Häufige Straftaten
Versuchte und vollendete Straftaten
Beteiligung an einer fremden Tat
Verwaltungsrecht
Ämter und Behörden: Wer kümmert sich um was?
Verwaltungsakt: Was steckt dahinter?
Ordnungswidrigkeiten: Rechte bei kleinen Vergehen
Was dürfen Polizisten?
Versicherungsrecht
Arten von Versicherungen: Was ist Pflicht, was ist sinnvoll?
Schadensmeldung: Wie gehst du vor und was musst du beachten?
Ablehnung von Leistungen: Was kannst du tun?
Versicherungsbetrug: Welche Konsequenzen drohen?
Kündigung und Wechsel von Versicherungen: Wann darf wer?
Sozialrecht
Krankenversicherung: Ansprüche und Leistungen
Arbeitslosengeld (ALG I): Was tun, wenn der Job weg ist?
Bürgergeld: Das Grundnetz für alle Fälle
Rente: Lohn für ein langes Arbeitsleben?
Recht haben und recht bekommen
Wann lohnt sich der Gang zum Gericht?
Wie läuft ein Zivilgerichtsverfahren ab?
Wann brauchst du einen Anwalt?
Wie teuer ist ein Gerichtsverfahren?
Wie verhältst du dich als Kläger vor Gericht?
Was tun, wenn du als Zeuge geladen wirst?
Was, wenn du einen Prozess verloren hast?
Was passiert nach dem Urteil? Zwangsvollstreckung
Alternative Konfliktlösungsmethoden
Mein Schlussplädoyer
Warum dieses Buch wichtig für dich ist und wie du es benutzt
Recht haben und recht bekommen gehen nicht immer Hand in Hand. Und das, obwohl wir – zum großen Glück – in einem Rechtsstaat leben. Jeder Rechtsanwalt kennt es: Sobald Menschen erfahren, dass man Anwalt ist, reagieren die meisten für fünf Sekunden mit ehrfürchtiger Neugier und einem leichten Herumdrucksen. Sind die fünf Anstandssekunden vorbei, stellen sie in der Regel eine Rechtsfrage, die ihnen offensichtlich seit Wochen, Monaten oder gar Jahren auf dem Herzen liegt. »Sagen Sie mal, Herr Solmecke, wie ist das eigentlich, wenn …« Willkommen in meiner Welt.
Ich kann diese Neugier gut nachvollziehen, schließlich wird unser Leben rund um die Uhr von Rechtsfragen und Gesetzen beeinflusst. Wie dein Tag im Job abläuft, wird maßgeblich vom Arbeitsrecht mitbestimmt. Wie viel von deinem Gehalt netto am Monatsende auf deinem Konto übrigbleibt, regelt das Steuerrecht. Und dass du deine Mietwohnung während eines Sabbaticals womöglich doch unterviermieten kannst, obwohl dein Vermieter die Untervermietung in deinem Mietvertrag eigentlich ausgeschlossen hat, wird im Mietrecht festgelegt. Die Kakerlake im Hotelzimmer neulich im Urlaub? Ist Teil des Reiserechts. Solltest du verheiratet und sehr unglücklich in deiner Beziehung sein, wirst du dich bald mit dem Thema Scheidungsrecht befassen müssen und dich über kurz oder lang vielleicht fragen, ob es nicht doch besser gewesen wäre, bei der Eheschließung einen Ehevertrag aufzusetzen. Und ob es heute Morgen eine gute Idee war, auf dem Weg zur Arbeit dem nervigen Autofahrer neben dir den Mittelfinger zu zeigen, kann dir das Strafrecht verraten. Das Recht ist einfach überall.
Gesetze regeln die Art, wie wir miteinander arbeiten, Handel betreiben, wie wir zusammenleben oder wie wir uns voneinander trennen. In Deutschland sind das (Stand: 24.5.2024) immerhin 1797 Bundesgesetze mit 52 401 Einzelnormen sowie 2866 Bundesrechtsverordnungen mit 44 272 Einzelnormen. Hinzu kommen die jeweiligen Gesetze und Rechtsverordnungen in jedem der 16 Bundesländer, die gewisse Rechtsbereiche unabhängig vom Bund regeln dürfen. Klar ist es nicht leicht, bei dieser Vielzahl an Vorschriften durchzublicken. Und nicht umsonst dauert ein Jurastudium ein bisschen länger als die meisten anderen Studiengänge.
Dennoch werbe ich dafür, dass sich jeder mit dem Thema Recht auch persönlich intensiver auseinandersetzt. Recht und Gesetz existieren ja nicht zum Spaß, sondern um jedem von uns ein Leben in maximaler Freiheit zu ermöglichen. Um diese Freiheit auch leben zu können, muss ich meine Rechte kennen. Denn wie soll ich einen Anspruch geltend machen, von dem ich nichts weiß? Wie kann ich mich gegen einen übergriffigen Chef, einen unredlichen Vermieter oder einen lügenden Ladenbesitzer zur Wehr setzen, wenn ich mit der Rechtslage nicht wenigstens grundlegend vertraut bin? Wie kann ich verhindern, dass ein privates Video im Internet von mir verbreitet wird, wenn ich nicht über die Vorgehensweisen, Personen und Institutionen Bescheid weiß, die mir helfen können, mein Recht durchzusetzen?
Für dieses juristische Nichtwissen gibt es Gründe. Die Art und Weise, wie in der Politik Gesetze auf den Weg gebracht werden, wie über Gesetze debattiert und gestritten wird, macht nur selten Lust, sich mit dem Thema Recht auseinanderzusetzen. In der Schule – immerhin kommt das Thema Recht dort schon vor – fehlt es in meinen Augen vor allem an der praktischen Vermittlung, welchen konkreten Einfluss Recht und Gesetz in unserem Alltag haben. Diese Lücke möchte ich mit meinem neuen Buch schließen.
Das einzige Buch über Recht, das du lesen musst ist dein persönlicher Jura-Crashkurs. Du erfährst alle notwendigen Basics, mit denen du ein solides Grundverständnis in allen für dich relevanten Rechtsfragen erhältst, und vor allem das damit verbundene Prozedere besser nachvollziehen kannst. Wie läuft ein Prozess ab? Wie verhältst du dich als Beklagter? Welche Pflichten hast du als Zeuge?
Damit das gelingt, erklärt dieses Buch kurz, wie unser Rechtssystem aufgebaut ist. Es führt dich in die wichtigsten Begriffe und Rechtsprinzipien ein, damit du in Zukunft besser verstehst, wovon Anwälte oder Politiker reden, wenn sie über Recht und Gesetz sprechen. Nach dem Grundlagenteil tauchen wir in die für dich wichtigsten Rechtsgebiete ein und behandeln typische Rechtsfragen, mit denen jeder irgendwann in seinem Leben konfrontiert wird. Der besondere Schwerpunkt liegt dabei auf Arbeitsrecht, Mietrecht, Vertragsrecht, aber auch auf Familien- und Eherecht, Strafrecht und dem Recht der Ordnungswidrigkeiten. Ich zeige dir in all diesen Rechtsgebieten deine Möglichkeiten auf, an dein Recht zu kommen und von anderen nicht ausgenutzt oder übervorteilt zu werden.
Aus Rechten leiten sich aber mitunter auch Pflichten ab. Welche Pflichten das sind und welche du auf keinen Fall ignorieren solltest, erfährst du ebenfalls überall dort, wo es für dich relevant ist. Ab wann begehst du eigentlich eine Unfallflucht? Wo beginnt ein Hausfriedensbruch? Wann verfallen meine Urlaubstage? Wer zahlt was bei einem Arbeitsunfall?
Das ganze Recht in einem Buch abbilden? Unmöglich! Und für juristische Laien auch nicht zielführend. Ich habe die Inhalte in jedem Rechtsgebiet so verkürzt, dass sie verständlich und dennoch korrekt sind. Und mich auf die Themen beschränkt, die für die meisten im Alltag besonders relevant sind. Unter der Überschrift »RECHT BEKOMMEN« findest du zudem immer wieder praktische Vorgehensweisen und Hinweise auf die wichtigsten Paragrafen, auf die du dich im Falle eines Falles berufen kannst.
Dieses Buch kann natürlich keinen Anwalt ersetzen. Es hilft dir jedoch, deine Rechtsansprüche in dem einen oder anderen Fall womöglich auch ohne Anwalt durchzusetzen, in dem du einem Streitpartner mit dem Verweis auf den einen oder anderen Paragrafen oder ein wichtiges Urteil signalisierst, dass du kein leichtes und vollkommen ahnungsloses Opfer bist. Und es sensibilisiert dich dafür, wann du in Zukunft unbedingt eine Rechtsvertretung an deiner Seite haben solltest. Dieses Buch wird sich auf jeden Fall für dich lohnen.
Ein letzter Hinweis: Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf gegenderte Bezeichnungen und in vielen Fällen auch auf Doppelnennungen wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
Grundlagen des Rechts
Was ist eigentlich Recht?
Auf diese einfache Frage gibt es nicht die eine richtige Antwort. Das zeigt sich schon daran, dass in anderen Ländern die Rechtsprechung in Teilen auf anderen Grundsätzen aufgebaut ist als bei uns. In den USA beispielsweise spielen sogenannte Präzedenzfälle und das ungeschriebene Gewohnheitsrecht – Common Law – eine viel größere Rolle als hierzulande. Doch trotz dieser Unterschiede, die Rechtsordnungen in sich tragen können, gibt es wichtige Gemeinsamkeiten, die uns dabei helfen, zu verstehen, was Recht ist und warum wir es brauchen.
Recht ist immer der Wille zur Gerechtigkeit. Recht hilft uns, Konflikte zu vermeiden oder im Konfliktfall einen fairen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen der Konfliktparteien herzustellen. Wenn man so will, dann ist Gerechtigkeit das Produkt, das unsere Gerichte tagtäglich produzieren (sollten). Dazu braucht es unter anderem Gesetze und einen Plan, eine Prozessordnung, wer wann wofür zuständig ist, um für Gerechtigkeit im Verfahren zu sorgen.
Eine ideale oder gar absolute Gerechtigkeit kann es jedoch nicht geben. Zu einer Demokratie gehört, dass wir nicht alle dieselben Moral- und Gerechtigkeitsvorstellungen teilen müssen. Recht und Gerechtigkeit entstehen im demokratischen Prozess daher immer aus den Vorstellungen der Mehrheit heraus. Dazu gehört auch, dass das Recht sich verändern kann, etwa indem neue Gesetze geschaffen werden, um auf gesellschaftliche Entwicklungen (wie z. B. die Digitalisierung) zu reagieren oder weil sich Moralvorstellungen geändert haben (Ehe für alle).
Das Recht dreht sich jedoch nicht ausschließlich um Gerechtigkeit. Unsere Rechtsordnung dient auch wichtigen Werten wie Frieden und Freiheit. Gesetze sind schließlich nicht nur dazu da, um uns einzuschränken, sondern auch, um uns zu schützen und um jedem Individuum unserer Gesellschaft ein Maximum an Freiheit und Entfaltung zu ermöglichen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Freiheit möglicherweise mit der Freiheit eines anderen kollidiert und sich die Konfliktparteien vor Gericht sehen, um eine Lösung zu erwirken. In unserer Rechtsordnung stehen Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit in einer Art Dreiecksbeziehung zueinander. Die Freiheit von einzelnen Individuen wird im Zivilrecht sowie besonders im Grundgesetz verhandelt. Frieden ist primär Gegenstand des Strafrechts. Und das Verwaltungsrecht zielt unter anderem auf die soziale Gerechtigkeit ab. In einer Demokratie, in der die widerstreitenden Bedürfnisse zwischen den Menschen, aber auch unterschiedliche Positionen zu Themen wie Freiheit, Gleichheit und Frieden zeit- und kontextabhängig ständig neu verhandelt werden, ist der Versuch, die gerechteste Lösung zu finden, immer das Ergebnis von vielen Kompromissen und eine nie endende Aufgabe.
Doch woher kommt das Recht eigentlich? Wo hat es seinen Ursprung? Aus welchen Quellen wird es gespeist? Woher wissen wir, was richtig und was falsch ist? Seit Jahrhunderten beschäftigt sich die Rechtsphilosophie mit der Frage, ob es eine Art universell geltendes Recht gibt, das unserer Gemeinschaft und allen Dingen innewohnt und aus dem wir einfach unsere Gesetze ableiten können. Dieses universelle Recht wird als »Naturrecht« bezeichnet. Die Idee dahinter ist, dass um uns herum eine ewige moralische Ordnung existiert, auf der die Natur des Menschen und der Welt beruht. Moral und Recht werden im Naturrecht zusammengedacht. Das von Natur aus gegebene Recht wird als unveränderlich angesehen. Es ist zu allen Zeiten gleich und gilt für jeden, egal welchen Geschlechts oder Alters, egal wo man lebt oder herkommt. Der 1. Artikel des Grundgesetzes, in dem die Unantastbarkeit der Menschenwürde als höchster Rechtswert festgeschrieben ist, nimmt zum Beispiel Bezug zur Idee des Naturrechts. Ebenfalls angelehnt an das Naturecht sind übrigens die Menschenrechte. Dabei handelt es sich um unveräußerliche Rechte, die jedem Menschen von Geburt an zustehen. Dazu gehören unter anderen das Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit und auf persönliche Freiheit.
Neben dem Naturrecht steht die Idee des positiven oder gesetzten Rechts. Dabei handelt es sich um eine Rechtsquelle, die eindeutig von Menschen geschaffen wurde, eben durch niedergeschriebene Gesetze, wie zum Beispiel im Bürgerlichen Gesetzbuch. Das positive Recht ist veränderbar. Es gilt zu bestimmen Zeiten und an bestimmten Orten. Moral spielt dabei erst einmal keine Rolle: Recht ist, was der Gesetzgeber als solches verabschiedet hat. Diese Gesetze müssen entsprechend befolgt und durchgesetzt werden, auch wenn sie der Einzelne vielleicht als ungerecht empfindet. Das hat den Vorteil, dass sich so die moralische Pluralität einer modernen demokratischen Gesellschaften abbilden lässt. Dieser sogenannte Rechtspositivismus stößt allerdings auch an Grenzen, wie beispielweise die Prozesse um Verbrecher des Nationalsozialismus oder um Mauerschützen der DDR gezeigt haben: Nüchtern betrachtet handelten die Angeklagten in der jeweiligen Zeit nach geltendem Recht. Sie befolgten lediglich die Gesetze. Durften sie für ihre offensichtlich unrechten Taten dennoch nachträglich rechtlich belangt werden? Zu den wichtigsten Prinzipien eines Rechtsstaates gehört schließlich die Rechtssicherheit. Bürger haben einen Anspruch darauf, dass Rechtsnormen sowie die daran gebundenen Pflichten und Berechtigungen klar, beständig und vorhersehbar sind. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen keine Nachteile entstehen, wenn sie sich an die geltenden Gesetze halten.
In unserer Rechtsordnung begegnet man diesem Konflikt, indem positives Recht und Naturrecht nicht als unversöhnlicher Gegensatz begriffen werden. Grundlage dafür ist die sogenannte Radbruchsche Formel, die der deutsche Rechtswissenschaftler Gustav Radbruch 1946 entwickelt hat:
»Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als ›unrichtiges Recht‹ der Gerechtigkeit zu weichen hat.«
In unserem Grundgesetz wird dieser Formel in Artikel 20 Absatz 3 Rechnung getragen. Dort heißt es, dass Verwaltung und Rechtsprechung »an Gesetz und Recht« gebunden sind, also nicht nur an das niedergeschriebene Gesetz. Im Ringen um Gerechtigkeit sind wir als Menschen eben nicht nur den Gesetzesparagrafen, sondern stets auch unserem Gewissen verpflichtet.
Unser Rechtssystem
Nun, wo du eine Vorstellung davon hast, was Recht eigentlich ist, stellt sich die Frage, wie man das Recht in einem Staat am besten organisiert, um Willkür zu verhindern und einen fairen Zugang für alle zu ermöglichen. Um zu verstehen, wie unsere Rechtsordnung aufgebaut ist, schauen wir auf das Prinzip der Gewaltenteilung, auf den Rechtsweg, die Gerichtsbarkeiten, die Instanzen und darauf, wie Gesetze eigentlich entstehen.
Gewaltenteilung
Für Vertrauen in das Recht und einen Rechtsstaat, der frei von Willkür ist, soll unter anderem die Gewaltenteilung sorgen. Sie ermöglicht die Unabhängigkeit der Justiz und einen geordneten Gesetzgebungsprozess. Die Gewaltenteilung entstand unter anderem, weil sich spätestens Ende des 20. Jahrhunderts das Verhältnis von Staat und Bürger grundlegend verändert hat. Früher wurde der Staat als eine Macht gesehen, der seine Bürger unterwirft und der durch das Recht gebändigt werden muss.
Der Staat galt als Obrigkeit, dem Bürger übergeordnet. Der Bürger wiederum schuldete dem Staat Gehorsam. Obwohl dieses Unterordnungsverhältnis längst überholt ist, existiert es in den Köpfen mancher Menschen noch immer. Sie schimpfen dann gerne auf »die da oben«, die ohnehin nur machen würden, was sie wollen.
Die Gewaltenteilung ist in Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetztes verankert. Sie dient der Machtbegrenzung staatlicher Akteure und basiert auf dem System der sogenannten checks and balances, also der Überprüfung und des Ausgleichs der drei Staatsgewalten: Legislative (gesetzgebende Gewalt), Exekutive (vollziehende Gewalt) und Judikative(rechtssprechende Gewalt).
Legislative
Die gesetzgebenden Organe in Deutschland sind zunächst der Bundestag sowie die Landtage. Nur sie können Bundes- oder eben Landesgesetze erlassen. Über den Bundesrat können die Länder zudem an Bundesgesetzen mitwirken und diese unter bestimmten Bedingungen sogar verhindern. Sowohl Bundestag als auch Landtag sind durch freie und geheime Wahlen legitimiert.
Exekutive
Zur Exekutive gehören Regierungen, Ministerien sowie Verwaltungs- und Vollzugsorgane wie die Polizei, die Staatsanwaltschaft, Behörden und Ämter wie zum Beispiel das Finanzamt und weitere staatliche Organisationen wie die Justizvollzugsanstalten. Diese Organe tragen die Verantwortung dafür, dass geltende Gesetze – mitunter unter Zwang – auch durchgesetzt werden.
Judikative
Die Rechtsprechung durch die Judikative erfolgt durch unabhängige Richter – obwohl vom Staat finanziert. Richter sind wie alle anderen staatlichen Organe auch selbstverständlich an Gesetz und Recht gebunden, können also nicht willkürlich entscheiden. Da viele unserer Gesetze jedoch abstrakt formuliert sind und nicht bezogen auf einen Einzelfall entstanden sind, müssen Richter prüfen, wie sie die geltenden Gesetze auf den konkreten Fall möglichst passgenau anwenden. Da auch Richter letztlich nur Menschen sind und sich irren können, besteht für die am Verfahren beteiligten Parteien in der Regel die Möglichkeit, Rechtsmittel – Berufung und Revision – bei einem Gericht in einer höheren Instanz einzulegen, also das Urteil überprüfen zu lassen. Die Gesamtheit aller Gerichte und Instanzen wird als Gerichtsbarkeit bezeichnet.
Die Gewaltenteilung sorgt letztlich dafür, dass das Recht nicht mehr Herrschafts- oder Machtinstrument des Staates ist. Im Gegenteil: Recht, Staat und Bürger stehen in einem gleichgeordneten Dreiecksverhältnis. In einem Konflikt zwischen Staat und Bürger entscheidet das Recht unabhängig darüber, ob und wie beide Parteien Rechte gegeneinander geltend machen können.
Wichtige Rechtsnormen: Gesetze und Verordnungen
Was Recht ist, steht im Gesetz. Zum Beispiel im Grundgesetz oder im Bürgerlichen Gesetzbuch. Doch wie entstehen Gesetze eigentlich? Und wie können Bürger, also du und ich, auf Gesetze einwirken?
Was gilt als Gesetz?
Formelle, also »richtige« Gesetze sind Rechtsnormen, erlassen von den gesetzgebenden Organen eines Staates. In Deutschland sind das vor allem der Bundestag und der Bundesrat, außerdem die Landtage. Bundesgesetze entstehen dabei durch ein sogenanntes förmliches Gesetzgebungsverfahren, das in der Regel mehrere Stufen durchläuft: Erst bringt jemand – häufig die Regierung – einen Gesetzesvorschlag ein, dann wird darüber im Bundestag beraten, auch der Bundesrat wird damit befasst, wobei er in ein paar Fällen auch zustimmen muss, und am Ende beschließt der Bundestag das Gesetz. Dann muss der Bundespräsident es noch unterschreiben, bevor es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird. Geht alles glatt und halten sich alle beteiligten Institutionen an die vorgegebenen Fristen, kann ein Bundesgesetz frühestens 23 Wochen nach Einbringung im Parlament in Kraft treten.
Was ist eine Verordnung?
Neben diesen formellen Gesetzen gibt es auch noch Verordnungen. Ein Beispiel hierfür wäre die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). Für sie braucht es kein förmliches Gesetzgebungsverfahren im Parlament. Aber auch nur, weil das Parlament zuvor durch das Straßenverkehrsgesetz die Exekutive dazu ermächtig hat, das Thema Straßenverkehr durch eine Verordnung zu regulieren. Zuständige Behörde der Exekutive ist in diesem Fall das Bundesverkehrsministerium. Verordnungen geben quasi den vorgeschalteten Gesetzen, die frei sind von technischen Details und fallspezifischen Anordnungen, den nötigen Feinschliff.
Was ist eine Satzung?
Unterhalb der Rechtsverordnungen gibt es noch Satzungen. In diesen können zum Beispiel lokale Bauvorschriften festgehalten sein oder bestimmte kommunale Abgaben wie etwa Müll- oder Friedhofsgebühren. Auch hier gilt: Satzungen müssen im Einklang mit höherrangigem Recht, insbesondere Bundes- und Landesgesetzen, stehen.
Normenhierarchie
Gesetze stehen immer über Verordnungen und natürlich auch über Satzungen. Gerichte können aber auch die »normalen« Gesetze unterschiedlich bewerten. Und zwar gemäß der sogenannten Normenhierarchie. Formuliert ein Satiriker zum Beispiel ein Gedicht voller Beleidigungen über einen aktuellen Politiker, muss ein Gericht abwägen, ob in diesem Fall die Kunstfreiheit höher wiegt oder doch eher der Tatbestand der Beleidigung erfüllt ist. Die höchste Stufe innerhalb dieser Hierarchie hat das Grundgesetz (GG), unsere Verfassung. Die Regelungen dort sind daher auch besonders schwer zu ändern. Für Änderungen bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. Bestimmte Grundsätze des GG können sogar gar nicht geändert werden. Sie sind durch die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 des GG geschützt.
Die Ewigkeitsklausel
Die Ewigkeitsklausel besagt, dass bestimmte grundlegende Prinzipien des Grundgesetzes nicht durch eine Grundgesetzänderung angetastet werden dürfen. Dazu gehören:
die Gliederung des Bundes in Länder (Föderalismus)die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebungdie in Artikel 1 GG niedergelegten Grundsätze (insbesondere die Menschenwürde und die Grundrechte)die in Artikel 20 GG niedergelegten Grundsätze (Demokratie-, Rechtsstaats-, Sozialstaats- und Bundesstaatsprinzip)Artikel 79 Absatz 3 GG selbst kann nicht geändert oder aufgehoben werden. Die Ewigkeitsklausel ließe sich nur durch eine neue Verfassung aushebeln.
Jedes untergeordnete Gesetz muss sich in der Folge daran messen lassen, ob es im Einklang mit dem Grundgesetz (GG) steht. Ob das GG eingehalten wird, überprüft das Bundesverfassungsgericht (BVerfG, siehe Gerichtsbarkeit, Seite 23). Das BVerfG kann sowohl Gesetze, Urteile anderer Gerichte, den Bundeskanzler als auch den Bundestag stoppen, wenn sie etwas tun oder beschließen, was gegen die Verfassung verstößt.
Grundsätzlich gilt: Je niedriger eine Rechtsnorm in der Normenhierarchie steht, desto leichter kann sie verändert werden. Für die Rechtssicherheit ist es jedoch wichtig, dass Bürger sich auf die Gesetze verlassen können. Es wäre nicht gut, wenn Gesetze ständig geändert werden könnten.
Alle Rechtsnormen müssen aber nicht nur in der Theorie rechtmäßig sein, sondern auch in der Praxis rechtmäßig angewendet und durchgesetzt werden. Das übernimmt die Exekutive des Staates, also meist Behörden und Ämter von Ländern und Gemeinden, wie etwa die Polizei oder das Bürgeramt. Wer dann eine Rechtsnorm nicht befolgt, muss mit den angedrohten Konsequenzen rechnen. Das können Bußgelder sein, aber auch physischer Zwang, zum Beispiel in Form einer Haftstrafe.
Wie können Bürger die Gesetzgebung beeinflussen?
Wahlen
Bürger haben verschiedene Möglichkeiten, auf Gesetze einzuwirken. Zunächst einmal klassisch durch Wahlen. Durch sie werden die Politiker ausgewählt, die später auf Bundes- oder Landesebene über Gesetze entscheiden. Politik machen heißt gute Gesetze machen. Kein Wunder, dass sich in deutschen Parlamenten besonders viele Menschen mit Erfahrung in der Verwaltung oder mit juristischem Hintergrund finden.
Petitionen
Artikel 17 des Grundgesetzes ermöglicht es Bürgern zudem, sich mit Petitionen an den Gesetzgeber zu wenden, also zum Beispiel an den Bundestag oder den Landtag. Das Petitionsrecht ist unverbindlich, der Empfänger muss es jedoch zur Kenntnis nehmen, sachlich prüfen und Petenten – wie die Urheber einer Petition genannt werden – eine Antwort geben, wie er mit der Petition verfährt. Durch Petitionen kann in wichtigen Fällen öffentlicher Druck aufgebaut werden, denn nicht immer hält der Gesetzgeber Schritt mit den Entwicklungen in einer Gesellschaft.
So führte die Verbreitung von Smartphones mit überall präsenter Kamera in den zurückliegenden Jahren auch zu einer Verstärkung des sogenannten Upskirtings. Dabei werden bei Frauen heimlich Video- oder Bildaufnahmen ihres Intimbereichs gemacht, indem ihnen unter den Rock oder das Kleid gefilmt wird. Dass es seit Januar 2021 nun den neuen § 184k »Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen« im Strafgesetzbuch gibt, verdanken wir unter anderem der erfolgreichen Online-Petition zweier Frauen. Mehr als 100000 Menschen unterstützten die Forderung, die in diesem Bereich vorhandene Gesetzeslücke zu schließen.
Verfassungsbeschwerde
Glaubt ein Bürger, dass er von einer Maßnahme betroffen ist, die auf einem verfassungswidrigen Gesetz beruht, und hat er sich deswegen bereits durch die Instanzen geklagt, hat er die Möglichkeit, mittels Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Das prüft dann, ob die Maßnahme – und letztlich auch das ihr zugrunde liegende Gesetz – mit dem Grundgesetz im Einklang waren oder nicht. Ein Gericht, das einen konkreten Fall verhandeln muss, kann das BVerfG sogar direkt fragen, ob ein Gesetz, das es eigentlich anwenden müsste, verfassungsgemäß ist. Dieses Vorgehen nennt sich konkrete Normenkontrolle. Von der abstrakten Normenkontrolle wird gesprochen, wenn Organe des Bundes ein Gesetz vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen, weil sie der Meinung sind, dass ein Gesetz nicht mit dem Grundgesetz im Einklang steht.
Der Rechtsweg
Die Ordnung unseres Rechtssystems spiegelt sich auch im sogenannten Rechtsweg. Mit diesem Begriff wird der verfahrensrechtlichen Weg, den eine Partei – so werden sowohl Kläger als auch Beklagter im Verfahren bezeichnet – beschreiten muss, um einen Anspruch gerichtlich durchzusetzen oder um sich gegen einen Anspruch zu verteidigen. Er umfasst die Gesamtheit der rechtlichen und institutionellen Schritte, die eine Person oder Organisation hierfür durchlaufen muss. Wenn man so will, stellt der Rechtsweg sicher, dass Streitigkeiten in geordneten Bahnen und nach festgelegten, für alle Parteien fairen Verfahrensregeln geklärt werden. Er sorgt also für Verfahrensgerechtigkeit und dafür, dass nicht jeder mit seiner Kündigung gleich zum Bundesverfassungsgericht, dem höchsten Gericht in unserem Land, rennen kann. Die Regelungen zum Rechtsweg sind in verschiedenen Gesetzen niedergeschrieben. Das beginnt beim Grundgesetz (GG), geht weiter mit dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), der Zivilprozessordnung (ZPO), dem Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG), der Strafprozessordnung (StPO) oder auch der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).
Je nachdem, in welchem Rechtsgebiet wir uns bewegen, können sich die Verfahrensregeln unterscheiden. So herrscht beispielweise vor dem Familiengericht mit Ausnahme von Umgangs- und Sorgerechtsverfahren bereits in der ersten Instanz die Pflicht zur anwaltlichen Vertretung. Vor dem Arbeitsgericht hingegen könntest du in der ersten Instanz theoretisch auch ohne Anwalt erscheinen.
Welche Rechtsgebiete gibt es?
Die Aufteilung der Rechtsgebiete erfolgt zunächst in das öffentliche Recht und in das Zivilrecht. Diese beiden Rechtsgebiete werden dann noch einmal differenzierter unterteilt.
Öffentliches Recht
Stehen sich vor Gericht Staat und Bürger oder zwei staatliche Institutionen gegenüber, spricht man vom öffentlichen Recht. Unter das öffentliche Recht fallen alle Rechtsgebiete, welche die Verwaltung betreffen, zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung oder das Steuerrecht. Auch das Strafrecht mit seinen Strafgesetzen zählt zum öffentlichen Recht, da bei Straftaten allein die Staatsanwaltschaft als staatliche Institution mögliche Bösewichte anklagen darf. Gesetze, die das Verhältnis der Staaten untereinander regeln, wie das Europarecht und das Völkerrecht, zählen ebenfalls zum öffentlichen Recht.
Zivilrecht (Privatrecht)
Der zweite große Rechtsbereich ist das Zivilrecht, auch Privatrecht genannt. Es beschäftigt sich mit den Konflikten, die zwischen Bürgern untereinander geregelt werden müssen (wir behandeln diesen Themenbereich vertieft ab Seite 44). Zum Beispiel Mieter und Vermieter, die uneins über eine Schönheitsreparatur in der vermieteten Wohnung sind. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die sich über eine Kündigung in die Haare kriegen. Käufer, die sich vom Verkäufer hinters Licht geführt sehen. Auch Nachbarschafts- oder Erbstreitigkeiten zählen zum Zivilrecht.
Übersicht über die Rechtsgebiete
Gerichtsbarkeit und Instanzen
Die Unterteilung der Rechtsgebiete ist auch deswegen notwendig, um die Gerichtsbarkeit in unserem Land unabhängig, fair und sinnvoll zu organisieren und zu klären, welches Gericht für welche Fälle zuständig ist. Mit dem Begriff Gerichtsbarkeit wird zum einem die Gesamtheit der Gerichte bezeichnet. Zum anderen werden bestimmte Gerichtszweige einzelnen Gerichtsbarkeiten zugeordnet. Innerhalb der verschiedenen Gerichtsbarkeiten ist auch der Instanzenzug geregelt, um Urteile überprüfen zu können.
Damit du ein Gefühl dafür bekommst, mit welchem Fall du bei welchem Gericht landest, solltest du von den folgenden fünf sogenannten Hauptgerichtsbarkeiten wenigstens einmal gehört haben. Sie decken die meisten Rechtsthemen ab, die in deinem Leben eine Rolle spielen können.
Ordentliche Gerichtsbarkeit
Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist für Zivil- und Strafsachen zuständig. Wenn du dich mit deinem Nachbarn streitest, dich scheiden lässt oder ein Testament anfechten möchtest, landest du hier. Wirst du bei einem Diebstahl erwischt, handelt es sich um eine Strafsache und damit ebenfalls um einen Fall für die ordentliche Gerichtsbarkeit. Ihr sind die folgenden Gerichte zugeordnet:
Amtsgerichte (AG):
zuständig für erstinstanzliche Zivil- und Strafsachen, kleinere Streitigkeiten, Familien- und Nachlasssachen
Landgerichte (LG):
zuständig für erstinstanzliche Zivil- und Strafsachen von größerer Bedeutung, Berufungsinstanz für Entscheidungen der Amtsgerichte
Oberlandesgerichte (OLG):
Berufungs- und Beschwerdeinstanz für Entscheidungen der Landgerichte, teilweise auch erstinstanzliche Zuständigkeit für bestimmte Streitigkeiten
Bundesgerichtshof (BGH):
höchste Instanz für Zivil- und Strafsachen, entscheidet über Revisionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte
Arbeitsgerichtsbarkeit
Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist für arbeitsrechtliche Streitigkeiten zuständig. Solltest du gegen deine Kündigung gerichtlich vorgehen, wird der Fall hier verhandelt.
Arbeitsgerichte (ArbG):
zuständig für erstinstanzliche arbeitsrechtliche Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
Landesarbeitsgerichte (LAG):
Berufungsinstanz für Entscheidungen der Arbeitsgerichte
Bundesarbeitsgericht (BAG):
höchste Instanz für arbeitsrechtliche Streitigkeiten, entscheidet über Revisionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landesarbeitsgerichte
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist für Streitigkeiten zuständig, die unter das öffentliche Recht fallen. Du willst ein Haus bauen und hast Ärger mit der Baubehörde? Du möchtest dagegen klagen, wenn dich eine Hochschule nicht zum Studium oder zur Prüfung zulässt? Um solche Themen kümmert sich das Verwaltungsgericht. Zu dieser Gerichtsbarkeit gehören:
Verwaltungsgerichte (VG):
zuständig für erstinstanzliche öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, insbesondere zwischen Bürgern und staatlichen Behörden, Beamten und ihren Dienstherren oder zwischen staatlichen Behörden selbst
Oberverwaltungsgerichte (OVG) / Verwaltungsgerichtshöfe (VGH):
Berufungsinstanz für Entscheidungen der Verwaltungsgerichte
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG):
höchste Instanz für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, entscheidet über Revisionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte beziehungsweise Verwaltungsgerichtshöfe
Sozialgerichtsbarkeit
Du hast Probleme mit deiner Krankenkasse oder staatlichen Sozialleistungen? Du möchtest einen fehlerhaften Rentenbescheid anfechten? Oder einen Arbeitsunfall anerkannt bekommen? Dann ist die Sozialgerichtsbarkeit mit den folgenden Gerichten für dich zuständig:
Sozialgerichte (SG):
zuständig für erstinstanzliche sozialrechtliche Streitigkeiten, zum Beispiel im Bereich der Sozialversicherung und Sozialhilfe
Landessozialgerichte (LSG):
Berufungsinstanz für Entscheidungen der Sozialgerichte
Bundessozialgericht (BSG):
höchste Instanz für sozialrechtliche Streitigkeiten, entscheidet über Revisionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landessozialgerichte
Finanzgerichtsbarkeit
Das Finanzamt ist der Meinung, dass deine Reise nach Spanien in Wirklichkeit ein privater Urlaub und keine Weiterbildungsmaßnahme war, obwohl du in der Zeit auch einen Sprachkurs gemacht hast? Sollte dieser Fall vor Gericht landen, ist die Finanzgerichtsbarkeit zuständig. Verhandelt werden die Fälle an den folgenden Gerichten:
Finanzgerichte (FG):
Zuständig für erstinstanzliche steuerrechtliche Streitigkeiten zwischen Bürgern oder Unternehmen und Finanzbehörden.
Bundesfinanzhof (BFH):
Höchste Instanz für steuerrechtliche Streitigkeiten, entscheidet über Revisionen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Finanzgerichte.
Es gibt darüber hinaus noch einige Sondergerichte, wie etwa die Verfassungsgerichte, zu denen das bereits angesprochene Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sowie die Landesverfassungsgerichte zählen. Auch das Bundespatentgericht (BPatG), das die Patentgerichtsbarkeit verantwortet und für Streitigkeiten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere natürlich des Patentrechts, zuständig ist, zählt zu den Sondergerichten.
Es kann auch vorkommen, dass ein Fall zwei Rechtsgebiete tangiert: Ein Diebstahl am Arbeitsplatz streift zum Beispiel das Strafrecht und das Arbeitsrecht. Eine Kündigungsschutzklage würde in diesem Fall am Arbeitsgericht verhandelt werden.
Berufung und Revision: Was ist der Instanzenzug?
Teil eines jeden Urteils ist die Belehrung der Verfahrensbeteiligten über die sogenannten Rechtsmittel: Ist eine der beiden Parteien mit dem Ausgang eines Verfahrens unzufrieden, kann sie in Berufung gehen oder Revision einlegen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Rechtsmitteln?
Berufung
Bei der Berufung kommt es im Grunde noch einmal zu einem Verfahren. Es werden sowohl die im Prozess zuvor präsentierten Tatsachen als auch die Rechtsgrundlagen für das Urteil überprüft. Und dem Gericht können neue Beweismittel und neue Tatsachen vorgelegt werden. Mit einer Berufung befasst sich die nächsthöhere gerichtliche Instanz. Dort kann das erstinstanzliche Urteil bestätigt, abgeändert, aufgehoben oder zurückverwiesen werden. Bei einer Zurückverweisung muss die Erstinstanz das Urteil noch einmal überprüfen. In Berufungsverfahren ist die Zurückweisung jedoch eine Ausnahme, da das Berufungsgericht selbst in der Sache entscheiden kann. Zurückverweisungen kommen daher eher in Revisionsverfahren vor, weil aus rechtlichen Gründen plötzlich eine Tatsache relevant wird, über welche die Vorinstanz noch nicht Beweis erhoben hatte.
Revision
Bei der Revision wird nicht noch einmal der gesamte Fall aufgerollt. Es wird lediglich überprüft, ob das Urteil in rechtlicher Hinsicht korrekt ist, also ob es wirklich auf Grundlage der geltenden Gesetze getroffen wurde. Revision wird daher gleich bei der jeweils höchsten Instanz eingelegt. In der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist das in der Regel der BGH. Das Revisionsgericht kann Urteile aufheben und zur erneuten Verhandlung an die vorherige Instanz zurückverweisen, oder es kann die Revision verwerfen und das angefochtene Urteil bestätigen.
Sowohl für die Berufung als auch für die Revision gelten bestimmte Fristen. Verfahren sollen sich nicht ewig in die Länge ziehen, sondern abgeschlossen werden. Die Frist für Berufung oder Revision beginnt mit Zustellung des schriftlichen Urteils.
Dank der Gewaltenteilung, der Gesetzgebung und der Gerichtsbarkeit ist die Rechtsprechung in Deutschland kein in Stein gemeißeltes Werk, sondern ein System, in dem sich die verschiedene Akteure immer wieder gegenseitig auf die Finger schauen und in dem – ganz wichtig – keiner allein bestimmen kann. Auf diese Weise herrscht einerseits Ordnung (Rechtssicherheit), auf die sich jeder verlassen kann. Andererseits kann sich unser Rechtssystem notwendigerweise immer auch bewegen, um auf neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen reagieren zu können. Und wir Anwälte? Haben auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Den richtigen Anwalt finden
Neben Politikern und Richtern sind auch wir Anwälte wichtiger Teil des Rechtssystems. 2024 waren in Deutschland 165 776 Rechtsanwälte zugelassen. Und in vielen Fällen darfst du auch nicht ohne Anwalt vor Gericht erscheinen. Nur: Wie findet man unter all diesen den für sich richtigen? Wie in jeder anderen Berufsgruppe auch, gibt es Anwälte, die ihren Job besonders gut erledigen und einige, die sich keine große Mühe geben.
Fachanwaltstitel
Ein erster Hinweis auf die Qualität eines Anwalts im Hinblick auf ein bestimmtes Rechtsproblem ist der Fachanwaltstitel. So wie man für eine gute Pizza zum Italiener um die Ecke und nicht zum nächsten Asiaten gehen sollte, macht es Sinn, bei einem Sorgerechtsstreit einen Experten für Familienrecht aufzusuchen und nicht etwa einen Arbeitsrechtler. Zwingend ist der Fachanwaltstitel für Rechtsanwälte nicht. Grundsätzlich kann jeder zugelassene Anwalt in jedem Rechtsgebiet tätig werden. Ich selbst habe kurz nach meiner Zulassung auch als sogenannter »Wald- und Wiesen-Anwalt« gearbeitet, also alles an Fällen übernommen, was möglich war. Vormittags einen Arbeitsrechtsfall verhandeln, nachmittags eine Erbstreitigkeit erledigen und am Abend noch schnell eine Mietrechtssache bearbeiten. Ein hartes Brot.
Fachanwälte sind in der Regel echte Experten. Sie haben eine zusätzliche Ausbildung in ihrem Fachgebiet gemacht und entsprechende Praxisnachweise gegenüber der zuständigen Rechtsanwaltskammer erbracht. Außerdem müssen sich Fachanwälte regelmäßig fortbilden. Tun sie das nicht, sind sie nicht mehr berechtigt, den Titel Fachanwalt zu tragen.
Professionalität
Doch Fachwissen allein macht einen noch nicht zu einem guten Anwalt. Es ist ähnlich wie bei einem Lehrer. Der wird auch erst durch seine menschlichen und didaktischen Qualitäten sowie das gewisse Fingerspitzengefühl im Umgang mit seinen Schülern zu einem richtig guten und geschätzten Pädagogen. In meinen Augen sind menschliche und vor allem kommunikative Qualitäten wichtig für einen guten Anwalt. Wir Anwälte arbeiten für unsere Mandanten. Da Verfahren sich mitunter über Monate und Jahre hinziehen können, finde ich es wichtig, dass ein Anwalt stets einen guten Kontakt zu seinem Mandanten pflegt. Dazu gehört, ihn auf dem Laufenden zu halten und die nächsten Prozessschritte zu erklären. Dabei sollten Anwälte auch proaktiv auf ihre Mandanten zugehen und sie regelmäßig kontaktieren, statt erst zu reagieren, wenn sie vom Mandanten angerufen werden.
Anwälte müssen im Interesse ihrer Mandanten handeln. Dazu gehört auch, objektiv entscheiden zu können, welche Strategie für den Mandanten die beste wäre. Ein guter Anwalt wird seinem Mandanten also nie zu einem Verfahren raten, bei dem er weiß, dass dieser verlieren wird – nur damit er selbst abkassiert. Ein guter Anwalt sollte den Mandanten immer objektiv über alle Szenarien aufklären und wenn der Mandant dann auf eigenes Risiko trotzdem ein Gerichtsverfahren anstreben möchte, ist das seine Sache. Wenn ich als Anwalt weiß, dass die Erfolgsaussichten schlecht sind, muss ich das dem Mandanten mitteilen. Ich darf ihm nicht einfach so zu einem Prozess raten, weil ich gerade Arbeit brauche und es mir – theoretisch – egal sein könnte. Bezahlt werde ich schließlich immer, egal ob ich den Prozess gewinne oder verliere. Kann ein Mandant nachweisen, dass sein Anwalt ihn in den Prozess gedrängt hat, ohne ausreichend auf die Risiken hinzuweisen, können Schadensersatzansprüche entstehen. Von einem Anwalt, der sich bezüglich deiner Chancen vor Gericht nicht transparent äußert, würde ich dir dringend abraten. Solltest du aber trotz Aufklärung über das Risiko in den Prozess gehen wollen, ist das selbstverständlich dein gutes Recht.
Als Anwälte stehen wir nicht über dem Recht. Natürlich dürfen auch wir nicht einfach machen, was wir wollen. Daher haften wir in bestimmten Fällen auch für unsere Arbeit. Wir müssen zum Beispiel Fristen sehr streng einhalten. Verpassen wir eine, kann zum Beispiel ein Versäumnisurteil gegen unseren Mandanten ergehen. Sollte das Versäumen der Frist tatsächlich Schuld des Anwalts gewesen sein, kann der Mandant den Anwalt auffordern, die entstandenen Schäden zu tragen. Deshalb sind wir Anwälte auch verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen.
Was tun bei Problemen mit dem Anwalt?
Solltest du Probleme mit einem Anwalt haben, kannst du Beschwerde bei der Rechtsanwaltskammer einreichen. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn dein Anwalt wirklich gegen seine in der Bundesrechtsanwaltsordnung und in der Berufsordnung für Rechtsanwälte festgelegten Pflichten verstoßen hat. Etwa die Pflicht zur Einhaltung von Fristen oder die Pflicht, transparent über die Risiken und Kosten des Verfahren aufzuklären. Hat er einfach nur seinen Job nicht sonderlich gut gemacht, darf die Kammer nicht tätig werden. Was nicht heißt, dass du nicht wegen einer sonstigen Pflichtverletzung vor Gericht gehen und auf Schadensersatz klagen kannst.
Wenn du berechtigte Zweifel an der Qualität deines Anwalts hast, kannst du den Fall und die Arbeit deines Anwalts auch einem anderen Anwalt präsentieren und – ganz ähnlich wie bei einem Arzt – eine Zweitmeinung einholen. Entweder ist diese Ersteinschätzung kostenlos oder du investiert lediglich die maximalen Kosten für eine erneute Erstberatung. Achtung: Sprich mit dem zweiten Anwalt zuvor unbedingt über die Gebühren der Beratung. Denn legst du viele Dokumente vor und hast viele Fragen, geht der Gebührenanspruch von der relativ günstigen Erstberatung direkt in den Bereich der Geschäftsgebühr über – und dann kann die Zweitmeinung ziemlich teuer werden.
Das Mandatsverhältnis zu einem Anwalt gilt laut BGB übrigens als Dienstverhältnis höherer Art, das jederzeit gekündigt werden kann. Das bedeutet, dass du nur die Kosten tragen musst, die bis zu diesem Zeitpunkt angefallen sind.
Praktische Tipps
In diesen Rechtsgebieten gibt es Fachanwälte:
VerwaltungsrechtSteuerrechtArbeitsrechtSozialrechtFamilienrechtStrafrechtInsolvenz- und SanierungsrechtVersicherungsrechtMedizinrechtMiet- und WohnungseigentumsrechtVerkehrsrechtBau- und ArchitektenrechtErbrechtTransport- und SpeditionsrechtGewerblicher RechtsschutzHandels- und GesellschaftsrechtUrheber- und MedienrechtInformationstechnologierechtBank- und KapitalmarktrechtAgrarrechtInternationales WirtschaftsrechtVergaberechtMigrationsrechtSportrechtSelbst für dein Recht einstehen
Verfahren ohne Anwaltspflicht und außergerichtliche Beilegung
Es gibt Verfahren, für die keine Anwaltspflicht besteht. Theoretisch könntest du zum Beispiel vor dem Arbeitsgericht in erster Instanz selbst Klage führen oder dich verteidigen. Auch bei Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsverfahren in erster Instanz musst du dir in den meisten Fällen nicht zwingend einen Anwalt nehmen. Und selbst in einem Zivilprozess vor dem Amtsgericht kannst du selbst klagen oder dich selbst verteidigen – vorausgesetzt der Streitwert des Zivilverfahrens liegt nicht über 5000 Euro. Streitwert nennt man den Wert dessen, worum gestritten wird. Wenn es um Geld geht, ist das natürlich einfach zu bemessen. Geht es um eine Sache oder einen Vertrag, legen die Gerichte den Streitwert hingegen durch Schätzung fest. In Strafprozessen besteht ebenfalls erst ab einer Straftat, die eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug vorsieht, die Pflicht, sich von einem Anwalt vertreten zu lassen. Ab dann reden wir nämlich von einem Verbrechen und nicht mehr von einem Vergehen. Mitunter musst du dich daher gar nicht erst auf die Suche nach einem Anwalt begeben.
Außerdem führen glücklicherweise nicht alle alltäglichen Streitigkeiten – etwa im Miet- oder Kaufrecht – tatsächlich zu einem Prozess. Häufig lassen sie sich außergerichtlich und ohne Anwalt klären. Vorausgesetzt du weißt, wie du das Recht selbst in die Hand nehmen kannst. Zum Beispiel, indem du eine juristisch fundierte Stellungnahme verfasst, in der du Bezug auf die einschlägigen Gesetze und – falls vorhanden – einen ähnlich gelagerten Fall der aktuellen Rechtsprechung nimmst und deinem Gegenüber damit signalisierst, dass du kein leichtes Opfer bist. Heutzutage gibt es – neben diesem sehr hilfreichen Buch – gute Möglichkeiten, sich in Sachen Recht zu informieren.
Wichtige Informationsquellen zu juristischen Fragen
KI-Tools wie ChatGPT können dir zum Beispiel eine erste Zusammenfassung der Rechtslage geben. Mittlerweile gibt es sogar mehrere speziell auf das deutsche Recht spezialisierte Anwalt-GPTs. Doch Achtung: Es ist wichtig, die Anhaltspunkte, die dir die künstliche Intelligenz (KI) liefert, immer noch einmal zu überprüfen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die KI Rechtsfälle oft noch sehr vage und vereinfacht darstellt. Im Detail ist manches dann doch komplexer. Am besten fragst du die KI – beim KI-Copiloten von Microsoft passiert das in der Regel automatisch – nach ihren Quellen und nach den Urteilen, auf die sie ihre Einschätzung bezieht. Anhand ihres Aktenzeichens kannst du die präsentierten Urteile dann googeln und überprüfen, ob sie von anderen vertrauenswürdigen Quellen zitiert und erläutert werden. Diese Überprüfung von KI-Urteilen ist wichtig, da es dir passieren kann, dass die KI Urteile einfach erfindet, sogar inklusive fiktiver Aktenzeichen.
Eine gute Quelle für den Gegencheck von Urteilen ist die offizielle Website des Bundesjustizministeriums www.gesetze-im-internet.de. Juristische Plattformen wie Dejure.org verlinken außerdem nicht nur die Volltextveröffentlichungen von Urteilen, sondern – sofern vorhanden – auch Kurzfassungen in der Presse sowie Besprechungen auf den Websites von Kanzleien oder juristischen Informationsportalen, die das Urteil einordnen und kommentieren. Wenn du Glück hast, haben die LTO oder beck-aktuell – zwei wichtige juristische Online-Magazine – sich mit dem Urteil befasst.
Daneben gibt es auch juristische Repetitorien wie Jurafuchs.de, die Infos für Studenten aufarbeiten. Auch die Verbraucherzentrale oder Rechtsschutzversicherer bieten gute Aufbereitungen zu bestimmten rechtlichen Themen an. Werden Beiträge bei Google weit oben angezeigt, heißt das, dass jemand die Suchmaschinenoptimierung für seinen Text gut betrieben hat. Google bewertet hier verschiedene Kriterien, die in der Regel für eine gute Qualität des Beitrags sprechen: Aktualität, Umfang, klare Sprache und gute Struktur. Wichtig ist jedoch, dich umfassend zu informieren. Arbeite dich am besten durch zwei oder drei Kommentare zum Urteil, um zu sehen, wie Juristen die Rechtsprechung einschätzen. Und manchmal findet man den entscheidenden Hinweis zu einem sehr speziellen Rechtsproblem auch erst auf Seite 3 der Google-Suche.
Bei der Auswahl der Urteile solltest du unbedingt darauf achten, möglichst aktuelle Urteile zu verwenden. Je höher die Instanz, die das Urteil gesprochen hat, desto besser. Im Zivilrecht etwa der Bundesgerichtshof, im Arbeitsrecht das Bundesarbeitsgericht (siehe Gerichtsbarkeit, Seite 23). Bei Urteilen eines Amtsgerichts kann es sein, dass nach der Verkündung des Urteils noch Rechtsmittel eingelegt wurden und das Urteil vielleicht noch abgeändert wurde. In der Regel findest du bei Dejure.org – teilweise auch bei aktuellen Berichten über Urteile – einen Hinweis darauf, ob das Urteil »rechtskräftig« (nicht mehr anfechtbar) oder »noch nicht rechtskräftig« (Rechtsmittel können noch eingelegt werden) ist. Wenn du das Urteil über das Aktenzeichen bei Dejure öffnest, wird dir dort in der Regel angezeigt, ob die Sache in einer höheren Instanz anhängig ist beziehungsweise von dieser vielleicht schon entschieden wurde.
In den Urteilen findest du dann auch die Gesetzesparagrafen, auf deren Grundlage die Richter ihre Entscheidung getroffen haben. Auch diese kannst du googeln und sie dir bei Dejure oder gesetze-im-internet.de genauer anschauen und anschließend in deine Stellungnahme einbauen.
Sollte die Partei am Ende doch auf ihren Forderungen bestehen oder keine Einigung möglich sein, kannst du hinterher immer noch einen Anwalt zu Rate ziehen. Doch wie gesagt: Viele Fälle lassen sich bereits im Vorfeld gütlich klären, wenn man seinem Gegenüber etwa juristische Kompetenz signalisiert.
Recht bekommen
Sobald deine Stellungnahme fertig ist, lasse sie noch von einer juristischen KI überprüfen. Weise dafür der KI eine Anwaltsrolle zu – oder arbeite mit AnwaltGPT – und bitte um Feedback, ob die KI noch Fehler in deiner Stellungnahme entdecken kann. Checke anschließend die Punkte, die die KI angemerkt hat, noch einmal gegen und bessere wo nötig nach. Noch mal: KI ist kein Tool, dem du blindlings folgen solltest, aber ein guter Sparring-Partner, um schneller und besser ans Ziel zu gelangen.
Lexikon: Wichtige juristische Begriffe
In der juristischen Kommunikation tauchen bestimmte Begriffe immer wieder auf. In Verfahren wird zum Beispiel über eine Leistung gestritten – doch was ist das eigentlich? Was heißt Fahrlässigkeit? Wo beginnt eigentlich ein Vorsatz? Warum unterscheiden Juristen zwischen Besitz und Eigentum oder zwischen Einwilligung und Zustimmung? Und mit welchen Kriterien bewertet man die Verhältnismäßigkeit, die in Gesetzen immer wieder enthalten ist? Viele dieser Begriffe werden auch auf den folgenden Seiten an verschiedenen Stellen auftauchen. Da sie wichtig für (d)ein juristisches Grundverständnis sind, schauen wir uns die wichtigsten davon genauer an.
Verhältnismäßigkeit
Der Begriff der Verhältnismäßigkeit gehört zu den grundlegenden Prinzipien im deutschen Recht und leitet sich aus dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes ab, auch wenn das da so explizit nicht steht. Durch diesen Grundsatz soll sichergestellt werden, dass alle Gesetze und staatlichen Eingriffe in deine Rechte immer gerechtfertigt und angemessen sind (siehe dazu auch Seite 15). Um zu einer möglichst objektiven Bewertung zu kommen, werden die Maßnahme und der Zweck in der Regel anhand von drei Kriterien auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft.
Die Maßnahme muss:
geeignet,
erforderlich und
angemessen sein.
Als geeignet gilt eine Maßnahme, wenn durch sie das angestrebte legitime Ziel objektiv erreicht werden kann. Erforderlich ist eine Maßnahme, wenn kein milderes, ebenso effektives Mittel zur Verfügung steht, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Das heißt auch, der Eingriff darf nicht stärker sein, als es zur Erreichung des Zwecks notwendig ist, um den Betroffenen nicht unnötig zu belasten. Bei der Betrachtung der Angemessenheit erfolgt eine Abwägung zwischen dem Zweck der Maßnahme und den Nachteilen, die der Betroffene dadurch erleidet. Die Maßnahme muss im Verhältnis zur Schwere des Eingriffs stehen, also nicht unverhältnismäßig belastend sein.
Gehen wir das Prinzip einmal an einem praktischen Beispiel durch: Stell dir vor, du fehlst bei deiner Arbeit krankheitsbedingt für lange Zeit. Deinem Arbeitgeber verursacht deine Krankheit erhebliche betriebliche Störungen sowie finanzielle Belastungen, weshalb er erwägt, dir zu kündigen. Aber darf er das? Wäre eine solche Kündigung wegen Krankheit verhältnismäßig? Genau diese Frage müsste womöglich vor Gericht anhand der zuvor genannten Kriterien beantwortet werden.
Ist die Kündigung geeignet, um das Ziel des Arbeitgebers – betriebliche Störungen vermeiden – zu erreichen? Objektiv ja.
Ist die Kündigung aber auch erforderlich? Oder kann der Arbeitgeber seine Belastung durch andere Maßnahmen minimieren? Er könnte dich ja zum Beispiel auch auf eine weniger belastende Stelle versetzen oder deine Arbeitszeiten anpassen. Erst wenn solche milderen Maßnahmen in Betracht gezogen wurden, erfolglos geblieben sind oder von vornherein als nicht ausreichend erscheinen, könnte die Kündigung auch das Kriterium der Erforderlichkeit erfüllen.
Allerdings muss die Kündigung nun aber auch noch angemessen sein. Dabei wird zum Beispiel abgewogen, ob die Kündigung im Verhältnis zur Schwere des Eingriffs steht, also ob die Belastung für den Arbeitgeber wirklich so hoch ist, wie er behauptet. Hier spielen die Dauer des Arbeitsverhältnisses, die Art der Erkrankung und die Prognose für die Zukunft eine Rolle. Ist beispielsweise absehbar, dass die Krankheit dauerhaft zu erheblichen Fehlzeiten führen wird, könnte die Kündigung als angemessen betrachtet werden. Ist jedoch eine Besserung in Sicht oder waren die bisherigen Fehlzeiten unvorhersehbar und nur von kurzer Dauer, könnte eine Kündigung als unverhältnismäßig angesehen werden.
Wichtiger Teilaspekt der Angemessenheit ist die Zumutbarkeit. Dabei steht im Vordergrund, ob es dem Betroffenen – unabhängig von einer objektiven Betrachtung – in seiner spezifischen Situation zugemutet werden kann, die Maßnahme zu ertragen. Im Fall der vom Arbeitgeber angestrebten Kündigung könnte diese als unzumutbar gelten, wenn der kranke Arbeitnehmer kurz vor der Rente steht und somit als besonders schutzbedürftig gilt.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit führt also in diesem Fall zu einer differenzierten, im Grundsatz objektiv ausgerichteten Bewertung, bei der die Interessen des Arbeitgebers sowie die Rechte und die subjektive Belastung des Arbeitnehmers sorgfältig abgewogen werden.
Vertrag
Ein Vertrag ist eine rechtlich verbindliche Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Personen, bei der sich mindestens eine Seite zu etwas verpflichtet – zum Beispiel zur Zahlung, zur Lieferung einer Sache oder zur Erbringung einer Dienstleistung. Die andere Seite erhält im Gegenzug ebenfalls ein Recht oder eine Leistung.
Juristisch gesehen kommt ein Vertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande: ein Angebot und eine Annahme. Ein solcher Vertrag ist viel schneller geschlossen, als viele denken. Es braucht dafür nicht zwingend ein langes Schriftstück mit Unterschrift – auch ein mündliches »Ja« oder ein Handschlag reicht aus, wenn sich beide Seiten über die wesentlichen Punkte einig sind. Und manchmal kommt ein Vertrag sogar ganz stillschweigend zustande, zum Beispiel wenn du in den Bus steigst oder im Supermarkt an der Kasse zahlst. Juristisch nennt man das »konkludentes Handeln«. Mehr dazu erfährst du im Abschnitt »Vertragsrecht« (Seite 44).
Schuld
Im Alltag sprechen wir von »Schulden«, wenn es um Geld geht – also zum Beispiel bei Krediten. Im juristischen Sinne ist »Schuld« aber viel mehr: Es geht um jede Verpflichtung, die jemand gegenüber einem anderen hat. Das kann eine Zahlungspflicht sein, aber auch die Pflicht, etwas zu liefern, eine Leistung zu erbringen oder etwas zu unterlassen. Wer eine Schuld hat, ist verpflichtet und wird im Juristendeutsch häufig auch »Schuldner« genannt. Geldschulden sind also nur ein Spezialfall von juristischen Schulden.
Eine Schuld kann – ebenso wie ein Anspruch – aus ganz verschiedenen Quellen entstehen: am häufigsten aus einem Vertrag – also wenn zwei (oder mehr) sich rechtlich bindend auf etwas geeinigt haben. Aber auch aus dem Gesetz, zum Beispiel beim Schadensersatz oder bei Unterhaltspflichten. Und manchmal auch aus anderen Regelwerken, etwa einer Satzung, Hausordnung oder Betriebsvereinbarung.
Anspruch
Im Alltag sagt man oft: »Ich habe ein Recht auf …!« In der Juristensprache heißt das ganz konkret: Du hast einen Anspruch. Ein Anspruch bedeutet, dass du von jemand anderem etwas verlangen darfst – zum Beispiel Geld, eine Leistung oder ein Verhalten. Oder dass jemand etwas unterlassen muss, weil du es fordern kannst. Die offizielle Definition steht in § 194 BGB: »Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen.« Wer berechtigt ist, von einer anderen Person etwas zu verlangen, wird häufig auch Gläubiger genannt.
Wenn du zum Beispiel jemandem Geld geliehen hast, hast du einen Anspruch auf Rückzahlung. Kaufst du ein Fahrrad, hast du einen Anspruch auf Übergabe und Eigentum – und der Händler wiederum hat einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises. Wenn dir jemand einen Kratzer ins Auto macht, hast du unter Umständen einen Schadensersatzanspruch.
Klingt trocken, ist aber eigentlich ganz logisch: Ein Anspruch ist immer dann wichtig, wenn es ums Durchsetzen von Rechten geht. Ein Anspruch kann – ebenso wie die Schuld – aus unterschiedlichen Quellen entstehen.
Leistung
Ein Begriff, der in rechtlichen Auseinandersetzungen häufig auftaucht, ist der der Leistung. Als Leistung bezeichnen wir Juristen allgemein eine Handlung oder ein Verhalten, das zur Erfüllung einer vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung erfolgt. Das kann zum Beispiel eine Dienstleistung wie eine Rechtsberatung durch einen Anwalt sein. Oder aber eine Sachleistung, worunter zum Beispiel die Lieferung deines neues Smartphones fällt, welches du in einem Online-Shop gekauft hast. Und mit der Überweisung deiner Miete an deinen Vermieter erbringst du jeden Monat eine Geldleistung.
Neben anderen Rechtsgebieten ist Leistung ein Kernelement des Schuldrechts. Leistungen werden geschuldet. Die Vertragsparteien werden daher auch als Schuldner und Gläubiger bezeichnet. Leistung ist dabei nicht als One-Way-Ticket zu verstehen. So schuldet der Verkäufer einem Käufer die Übergabe und Übereignung der Ware wie vereinbart, der Käufer wiederum muss die Zahlung des Kaufpreises leisten.
Beim Erbringen einer Leistung kann einiges schiefgehen. Auch darauf nimmt das Recht Rücksicht. Wird eine Leistung nicht wie vereinbart erbracht, liegt eine sogenannte Leistungsstörung vor, die unterschiedliche Rechtsfolgen haben kann. Dem Schuldner kann es zum Beispiel unmöglich sein, eine Leistung zu erbringen. Etwa, wenn ein Musiker krank wird und ein Konzert nicht wie vereinbart spielen kann. Oder einem Händler brennt eine Lagerhalle mit Waren ab und er kann nicht mehr zum vereinbarten Datum liefern. Er gerät dann mit seiner Leistung in Verzug. Wird eine Leistung nur mangelhaft erbracht, etwa wenn an deinem neuem Smartphone der Bildschirm oder die Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, handelt es sich um eine Schlechtleistung.
Zu den möglichen Rechtsfolgen gehört die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. Das ist vor allem bei erheblichen Leistungsstörungen wie der Nichterfüllung eines Vertrags oder bei erheblicher Schlechtleistung der Fall. Eine mangelhafte Leistung kann eine Minderung des Preises nach sich ziehen. Und je nach Sachlage können Leistungsstörungen zu Schadensersatzansprüchen führen.
Sorgfaltspflicht
Diesen Begriff hast du sicherlich schon einmal gehört. Aber was genau verbirgt sich dahinter?
Grundsätzlich geht es bei der Sorgfaltspflicht darum, dass Menschen in bestimmten sozialen und beruflichen Situationen mit Vorsicht und Aufmerksamkeit handeln müssen, um Schäden an anderen Personen, an deren Eigentum oder Rechten zu vermeiden. Tun sie das nicht, können sie hinterher dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Zu den Sanktionen, die Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht nach sich ziehen können, gehören beispielsweise Schadensersatzpflichten sowie arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen. Wie sorgfältig du dich in einer bestimmten Situation verhalten musst, wird dabei durch den Maßstab eines »vernünftigen Dritten« bestimmt: Es wird also gefragt, wie eine durchschnittlich sorgfältige Person in der gleichen Situation gehandelt hätte.
Ein Beispiel: Der Fahrer eines Rettungswagens quert mit eingeschaltetem Blaulicht eine Kreuzung bei Rot, ohne sich davon zu überzeugen, dass er von allen anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wurde. Infolgedessen verursacht er dabei einen Unfall mit einem bei Grün querenden Fahrzeug, dessen Fahrer den Rettungswagen nicht bemerkt hat. Der Rettungswagenfahrer hat in diesem Fall eine Teilschuld am Unfall, da er sorgfaltswidrig gehandelt hat. Er hätte sich beim Einfahren in die Kreuzung davon überzeugen müssen, dass die anderen Fahrer ihn wahrgenommen haben (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 20.11.2023 – 17 U 121/23).
Fahrlässigkeit
Sorgfaltspflicht sowie Fahrlässigkeit und Vorsatz (siehe unten) hängen eng zusammen. Im deutschen Recht kann nur jemand bestraft oder haftbar gemacht werden kann, wenn er schuldhaft gehandelt hat (Schuldprinzip). Dabei unterscheidet das Recht, ob jemand einen Schaden ungewollt verursacht hat – beispielsweise durch Außerachtlassen der gebotenen Sorgfalt –, also fahrlässig gehandelt hat, oder ob er den Schaden bewusst oder gewollt herbeigeführt hat, also vorsätzlich gehandelt hat.
Fahrlässigkeit wird vor allem im Zivilrecht, im Strafrecht und bei Ordnungswidrigkeiten bewertet. Um dem Grad der Sorgfaltspflichtverletzung und die Schwere des Fehlverhaltens gerecht zu werden, gibt es verschiedene Stufen der Fahrlässigkeit. Diese Unterscheidung ist wichtig, da der Grad der Fahrlässigkeit Auswirkungen auf die rechtlichen Konsequenzen, insbesondere auf die Haftung im Zivilrecht oder die Höhe einer Strafe haben kann.
Im Zivilrecht wird im Allgemeinem zwischen der einfachen Fahrlässigkeit und der groben Fahrlässigkeit unterschieden. Eine einfache Fahrlässigkeit könnte zum Beispiel vorliegen, wenn ein Autofahrer bei leichtem Regen mit normaler Geschwindigkeit unterwegs ist, jedoch ein Schlagloch übersieht, schnell umlenkt, wegen der rutschigen Fahrbahn kurz die Kontrolle über sein Auto verliert und dadurch das Auto eines anderen beschädigt. Da er seine Geschwindigkeit nicht der Witterung angepasst hat, könnte hier einfache Fahrlässigkeit vorliegen, und die Versicherung könnte dem Fahrer eine Teilschuld aufbürden. Fährt ein Autofahrer dagegen über eine rote Ampel, ist das eine grobe Fahrlässigkeit. Der Fahrer hat ganz offensichtlich seine Sorgfaltspflicht verletzt, da Ampeln in der Regel gut sichtbare und unmissverständliche Signale im Straßenverkehr sind. Hinzu kommt die hohe Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch das Verhalten.
Im Arbeitsrecht wird die einfache Fahrlässigkeit zusätzlich in mittlere Fahrlässigkeit und leichteste Fahrlässigkeit unterteilt, um Haftungsfragen zu klären. Bei leichtester Fahrlässigkeit haften Arbeitnehmer nämlich nicht. Dabei handelt es sich um kleine Unaufmerksamkeiten, bei denen zwar ein Schaden entsteht, die aber im Arbeitsalltag vorkommen können. Etwa, wenn du aus Versehen eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser über der Tastatur deines Arbeits-PC verschüttest. Mittlere Fahrlässigkeit kann dagegen vorliegen, wenn du vergisst, die Fenster zu schließen, und es nachts ins Büro hereinregnet, wodurch womöglich Telefone oder Rechner beschädigt werden. In diesem Fall könntest du anteilig am Schaden haften, der mit normaler Sorgfalt hätte verhindert werden können.
Im Strafrecht unterscheidet man zwischen bewusster Fahrlässigkeit und unbewusster Fahrlässigkeit. Eine bewusste Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Person eine Handlung begeht und sich dabei der Gefahr bewusst ist, dass eine rechtswidrige Folge eintreten könnte– jedoch darauf vertraut, dass dies nicht passiert. Nehmen wir zum Beispiel einen Autofahrer, der auf einer engen, kurvenreichen Straße deutlich schneller fährt als erlaubt. Er weiß, dass die hohe Geschwindigkeit gefährlich ist und möglicherweise zu einem Unfall führen könnte, geht aber davon aus, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug behalten wird und nichts passiert. Passiert dann dennoch ein Unfall, handelt der Fahrer bewusst fahrlässig, da er sich der Gefahr bewusst war, sie aber ignoriert hat. Bei einer unbewussten Fahrlässigkeit begeht eine Person eine Handlung, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, obwohl sie die Risiken aufgrund ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und der Umstände hätte erkennen können und in der Lage gewesen wäre, die Gefahr zu vermeiden. Stell dir vor, du streust im Winter den Gehweg vor deinem Haus nicht, weil du der Meinung bist, dass der Gehweg nicht glatt genug ist, um gefährlich zu sein. Tatsächlich rutscht jedoch ein Passant vor deinem Haus aus und verletzt sich. In diesem Fall war deine Handlung unbewusst fahrlässig. Die Pflicht zum Streuen oder zur Schneeräumung lag eindeutig bei dir. Wärst du aufmerksamer gewesen, hättest du die Gefahr erkennen und verhindern können.
Vorsatz
Vorsatz grenzt sich von Fahrlässigkeit durch die innere Einstellung des Täters ab. Bei der Fahrlässigkeit handelt eine Person, wie gesagt, ohne Absicht oder Bewusstsein; sie vertraut darauf, dass kein Schaden eintritt. Beim Vorsatz hingegen ist sich der Täter der Rechtswidrigkeit seiner Handlung bewusst oder nimmt die Tatsache, dass seine Handlung Schaden anrichten kann, zumindest billigend in Kauf. Wie bei der Fahrlässigkeit wird auch beim Vorsatz differenziert. Es gibt
die Absicht,
den direkten Vorsatz und
den bedingten Vorsatz.
Bei der Absicht(Dolus directus1. Grades) handelt ein Täter zielgerichtet und beabsichtigt den Erfolg seiner Handlung. Das Eintreten des Erfolgs ist der Hauptzweck seines Handelns. Beispiel: Ein Täter sticht gezielt auf eine Person ein, weil er beabsichtigt, sie zu töten. Es klingt merkwürdig, in diesem Fall vom »Erfolg« einer Handlung zu sprechen, aber es handelt sich eben um keine ethische, sondern um eine juristische Bewertung. Und in dieser ergibt diese Umschreibung Sinn.
Von einem direkten Vorsatz (Dolus directus 2. Grades) sprechen wir, wenn ein Täter sicher weiß, dass sein Handeln zum Erfolg führen wird, auch wenn dies nicht der Hauptzweck ist. Beispiel: Ein Bankräuber feuert einen Schuss in eine Menge, um zu entkommen. Er weiß, dass er dadurch jemanden verletzen wird, auch wenn dies nicht sein Hauptziel ist – das ist in diesem Fall die Flucht.
Bedingter Vorsatz (Dolus eventualis) liegt dann vor, wenn ein Täter es für möglich hält, dass sein Handeln zum Erfolg führen kann. Diesen Erfolg nimmt er billigend in Kauf. Hier ist keine feste Absicht erforderlich, sondern lediglich das Bewusstsein und die Inkaufnahme des Risikos. Beispiel: Ein paar Jugendliche werfen als Mutprobe Steine von einer Brücke auf eine stark befahrene Autobahn. Obwohl sie es nicht darauf anlegen, ein Fahrzeug zu treffen, muss ihnen klar sein, dass der Stein einen Wagen treffen und einen Unfall verursachen könnte. Indem sie die Steine werfen, nehmen sie diese Gefahr bewusst in Kauf.
Vorsätzlich begangene Taten werden regelmäßig härter bestraft als fahrlässige. Einige Straftatbestände im Strafgesetzbuch sind ausschließlich bei vorsätzlichem Handeln strafbar, während fahrlässiges Verhalten nur in speziellen Ausnahmefällen strafbar ist (beispielsweise fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung). Im Zivilrecht führt der Vorsatz häufig dazu, dass man für einen Schaden voll haftet. Außerdem können bei vorsätzlichem Handeln zusätzlich Schadensersatzforderungen für immaterielle Schäden (z. B. Schmerzensgeld) geltend gemacht werden, die bei einfacher Fahrlässigkeit möglicherweise entfallen. Viele Versicherungen schließen zudem die Leistung bei vorsätzlichem Handeln aus. Und selbst im Arbeitsrecht kann ein Vorsatz – etwa, wenn ein Mitarbeiter bewusst sensible Firmendaten an die Konkurrenz weitergibt – nicht nur eine fristlose Kündigung, sondern auch die Pflicht zum Schadensersatz gegenüber dem Arbeitgeber nach sich ziehen.
Einwilligung versus Zustimmung
Diese beiden Begriffe werden im Alltag oft durcheinandergebracht, bedeuten aber rechtlich etwas Unterschiedliches. Juristisch macht der Zeitpunkt den Unterschied.
Eine Einwilligung ist immer etwas, das du im Voraus gibst, zum Beispiel wenn du der Nutzung deiner Daten zustimmst oder eine medizinischen Behandlung vorher erlaubst.
Eine Zustimmung kann auch nachträglich erfolgen, etwa wenn ein Minderjähriger etwas gekauft hat und die Eltern später sagen: »Das passt, wir erlauben das im Nachhinein.« In solchen Fällen wird der Vertrag erst mit der Zustimmung wirksam.
Besitz versus Eigentum
»Meins ist meins« – so einfach ist das im Recht leider nicht. Besitz bedeutet, dass du eine Sache tatsächlich in der Hand oder unter Kontrolle hast – zum Beispiel wenn du ein Auto mietest. Eigentum dagegen ist das umfassende rechtliche Herrschaftsrecht: Du darfst mit der Sache grundsätzlich machen, was du willst – verkaufen, verschenken oder vernichten.
Das bedeutet: Man kann Besitzer sein, ohne Eigentümer zu sein (etwa als Mieter), und umgekehrt Eigentümer sein, ohne selbst im Besitz der Sache zu sein (z. B. wenn du dein Fahrrad verliehen hast).
Frist
Im Alltag sind Fristen oft unverbindlich (»Meld dich mal in zwei Wochen«). Im Recht aber sind Fristen ernst gemeint und genau geregelt. Ob es um eine Kündigung, einen Widerruf oder einen Widerspruch gegen einen Bescheid geht: Wenn du eine Frist verpasst, kann dein Anspruch oder dein Recht verfallen – selbst wenn du eigentlich im Recht wärst. Juristische Fristen beginnen und enden oft zu ganz bestimmten Zeitpunkten, und auch Wochenenden oder Feiertage können eine Rolle spielen. Deshalb lohnt es sich, Fristen immer genau zu notieren – und lieber zu früh als zu spät zu reagieren.
Verjährung
Viele glauben: »Ein Recht ist ein Recht – das hab ich für immer.« Aber das stimmt nicht ganz. Rechte können verjähren. Das heißt: Der Anspruch besteht zwar noch auf dem Papier, aber du kannst ihn nicht mehr vor Gericht durchsetzen, wenn sich die andere Seite ausdrücklich auf die Verjährung beruft.
Im Zivilrecht beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre, und sie beginnt meist am Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Es gibt aber auch kürzere und längere Fristen – je nach Art des Anspruchs. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig zu kümmern, wenn man glaubt, etwas fordern zu können.
Abmahnung
Liegt eine Abmahnung