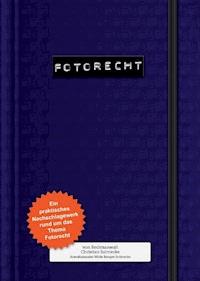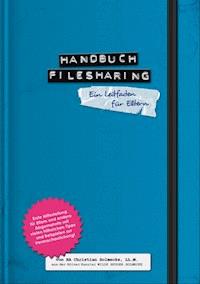Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zum Buchinhalt: Wissen Sie, wie oft Ihre Kinder im Internet unterwegs sind? Wissen Sie, was sie dort treiben? Wissen Sie, was die (rechtlichen) Folgen eines von Ihnen als unbedenklich angesehenen Handelns ihres Nachwuchses sein können? Das Netz ist kein "rechtsfreier Raum", in dem die Gesetze der normalen Welt nicht gelten. Dieses Buch soll Eltern daher auf verschiedene problembehaftete Fallkreise aufmerksam machen. Der nachfolgende Leitfaden ist dabei keineswegs als unbedingter Appell zu verstehen, den Nachwuchs heimlich zu kontrollieren, exzessive Überwachungsmaßnahmen einzurichten oder die Internetnutzung der eigenen Kinder gänzlich zu verbieten. Auch wenn dies durch entsprechende Systemeinstellungen oder spezielle Programme technisch möglich ist, geht es uns mit diesem Ratgeber vielmehr darum, zu einer angemessenen Aufklärung und Medienkompetenz beizutragen, um die endlosen Vorteile des Internets rechtssicher in Anspruch nehmen zu können. Das Handbuch ist damit gleichsam an interessierte Eltern und an den Nachwuchs selbst gerichtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LIZENZ:
Dieses Buch wird unter der Creative Commons Namensnennungslizenz verbreitet.
Internetrecht für Eltern, CC-Lizenz (BY 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
Impressum:
Copyright © 2012 Christian Solmecke
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN: 978-3-8442-4387-1
Verfasser:
Rechtsanwalt Christian Solmecke, LL.M., Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln, www.wbs-law.de und Philipp Armbrüster, Student der Rechtswissenschaften an der Universität Münster
Die nachfolgenden Bedingungen stellen die wesentlichen Elemente der CC-BY-3.0 Lizenz heraus.
Der volle Lizenztext ist hier zu finden: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
Creative Commons License
Es ist gestattet, das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen
Abwandlungen bzw. Bearbeitungen des Inhaltes anzufertigen
Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen den Zeitpunkt ihrer Bearbeitung (Stand) sowie die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen voll ausgeschriebenen Link auf diese Seite einzubinden.
Sämtliche vorherige Bearbeiter sind in der Reihenfolge der Bearbeitung und (sofern vorhanden) mit Link auf deren jeweilige Webseite, anzugeben.
Vorschlag:
Internetrecht für Eltern, CC-Lizenz (BY 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
Quelle(n): „Rechtsanwalt Christian Solmecke, LL.M., Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln, www.wbs-law.de; Phillipp Armbrüster“
Weitere Informationen zur Creative Commons-Lizenz finden Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
Layout und Illustrationen: Marisa J. Schulze - www.illustres-gestalten.de
Vorwort
Wissen Sie, wie oft Ihre Kinder im Internet unterwegs sind? Wissen Sie, was sie dort treiben? Wissen Sie, was die (rechtlichen) Folgen eines von Ihnen als unbedenklich angesehenen Handelns ihres Nachwuchses sein können?
Das World Wide Web verschafft sich aufgrund seiner immer größer werdenden Popularität auch in den Kinder- und Jugendzimmern immer öfter einen festen Platz. Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 benutzten im Jahr 2010 100% der 14- bis 19-jährigen zumindest gelegentlich das Internet; 1997 waren nur 6,3% dieser Altersgruppe im Netz unterwegs (siehe van Eimeren/Frees, Media Perspektiven 7-8/2010, S. 336). Aufgrund dieser Kennzahlen treten beim Umgang der Kinder mit dem Internet allerdings auch immer wieder rechtliche Konflikte auf.
Dieses Handbuch soll Eltern daher auf verschiedene problembehaftete Fallkreise aufmerksam machen. Das Netz ist kein “rechtsfreier Raum“, in dem die Gesetze der normalen Welt nicht gelten. Gerade durch die Eigenart des Internets, weltweit verfügbar und durchsuchbar zu sein, lassen sich mögliche Rechtsverstöße oftmals leichter feststellen und in kürzerer Zeit verfolgen, als dies im realen Leben möglich wäre. Auf der anderen Seite bietet es etwa Betrügern - beispielsweise durch die in gewissem Maße vorhandene Anonymität - eine Plattform, um allzu unbedachte Nutzer in eine ihrer vielen (Kosten-)Fallen laufen zu lassen. Speziell Minderjährige sind für die kriminellen Maschen vieler Internet-Abzocker oftmals besonders anfällig. Ferner sind im Internet quasi jederzeit Inhalte verfügbar, an die Minderjährige im normalen Geschäftsverkehr nicht in Kontakt kommen (können).
Der nachfolgende Leitfaden ist dabei keineswegs als unbedingter Appell zu verstehen, den Nachwuchs heimlich zu kontrollieren, exzessive Überwachungsmaßnahmen einzurichten oder die Internetnutzung der eigenen Kinder gänzlich zu verbieten. Auch wenn dies durch entsprechende Systemeinstellungen oder spezielle Programme technisch möglich ist, geht es uns mit diesem Ratgeber vielmehr darum, zu einer angemessenen Aufklärung und Medienkompetenz beizutragen, um die endlosen Vorteile des Internets rechtssicher in Anspruch nehmen zu können. Das Handbuch ist damit gleichsam an interessierte Eltern und an den Nachwuchs selbst gerichtet.
Ein Ratschlag umspannt daher den gesamten Text: Reden Sie mit Ihren Kindern!
In den drei Kapiteln dieses Handbuchs erläutern wir zunächst die wichtigsten Begriffe und das grundsätzliche Problem der unterschiedlichen Fallkreise - das Wissen, das Ihre Kinder Ihnen möglicherweise voraushaben -, um danach die juristischen Probleme zu beschreiben und schließlich mögliche Lösungen aufzeigen zu können.
Die in unserer täglichen Praxis am häufigsten Fälle der rechtswidrigen Tauschbörsennutzung haben wir bereits in unserem überaus erfolgreichen „Handbuch Filesharing - Ein Leitfaden für Eltern“ verarbeitet. Dieses ist neben anderen aktuellen Beiträgen zu medienrechtlichen Themen ebenfalls auf unserer Website unter www.wbs-law.de verfügbar.
Kapitel 1
1.1 Abofallen
Der in der medialen Berichterstattung (neben dem Filesharing) wohl am breitesten diskutierte Problemkreis ist der der “Abofallen“. Dieser Begriff hat sich mittlerweile auch im juristischen Alltag etabliert. Er beschreibt ein vom Nutzer nicht bewusst (als solches) abgeschlossenes entgeltliches Dauerschuldverhältnis mit dem Anbieter einer Internetseite.
Was heißt das? Der Nutzer eines (Internet-)Angebots geht ein Vertragsverhältnis mit dem Anbieter ein, da jener davon ausgeht, dass die auf der Internetseite angebotenen Leistungen kostenlos sind. In der Regel handelt es sich nämlich um Informationen, die auf anderen Seiten tatsächlich kostenlos verfügbar sind (Gratissoftware, Routenplaner, Ahnenforschung, Intelligenztests sind klassische Beispiele). Teilweise werden jedoch auch die Leistungen selbst als besonderer Köder verwendet - so werden dann etwa Sofortgewinne oder Gratis-SMS versprochen. Schließlich werden zum Teil auch Dinge angeboten, die gerade bei der Jugend besonders “hip“ sind und daher einen hohen “Kundenstrom“ erwarten lassen; hier ist beispielsweise an Klingeltöne oder Handy-Apps zu denken. Der Masche der Seitenbetreiber fallen aber nicht nur Minderjährige zum Opfer, sondern auch durchschnittliche Verbraucher - nach einer Studie des Infas-Instituts „binnen zwei Jahren 5,4 Millionen Deutsche“ (Bericht auf spiegel.de). Im Einzelfall können Jugendliche und Kinder aber ein besonders leicht zu manipulierendes Ziel darstellen.
Vor der Möglichkeit der Nutzung des Angebots wird der Nutzer gebeten, sich unter Angabe seiner persönlichen Daten auf der Seite anzumelden. Dass der Nutzer mit dieser Handlung in die Kostenfalle des Seitenbetreibers tritt, ist ihm nicht bewusst. Er glaubt vielmehr immer noch an die Unentgeltlichkeit der Seite.
Tatsächlich sind die Leistungen der Abofallen-Betreiber jedoch alles andere als das. Der Nutzer kann dies unter normalen Umständen nicht erahnen, da die Gebühren des konkreten Angebots eben nicht transparent und deutlich gestaltet auf der Seite angegeben werden (so schreibt es geltendes Recht etwa in der Preisangabenverordnung vor, siehe auch OLG Frankfurt, Urteil vom 04.12.2008, Az. 6 U 187/07). Die Kostenpflichtigkeit wird lediglich an versteckter Stelle in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Seitenbetreibers, die der Nutzer bei Vertragsschluss akzeptiert bzw. akzeptieren muss, festgehalten. Hier wird sodann fixiert, dass der Nutzer sich verpflichtet, über einen festgelegten Zeitraum (oftmals zwei Jahre) einen festgelegten Betrag (in schöner Regelmäßigkeit 96 Euro pro Jahr) an den Anbieter zu zahlen habe - über die gesamte Vertragslaufzeit wären in unserem Beispiel also Kosten in Höhe von 192 Euro fällig.
Weigern sich die Opfer diese Beträge zu begleichen, bauen die Seitenbetreiber in der Regel eine heftige Drohkulisse zu Lasten der Opfer auf: Sie schalten Anwälte und/oder Inkassounternehmen ein, die mit Mahnungen, SCHUFA-Einträgen oder schließlich einem Prozess vor Gericht drohen und die offenen Rechnungsbeträge eintreiben sollen. Die beteiligten Parteien gehen dabei oftmals organisiert vor und sind untereinander bestens vernetzt - so haben sich in den letzten Jahren richtige Abofallen-Banden zusammengeschlossen, die systematisch gegen die Opfer vorgehen.
Abofallen-Betreiber haben’s (rechtlich) schwer
Allgemein können wir sagen: In rechtlicher Hinsicht haben die Abofallen-Betreiber einen sehr schweren Stand. Sie müssen (mittlerweile) insbesondere auch strafrechtliche Sanktionen fürchten. Nach einer wegweisenden Entscheidung des OLG Frankfurt (Beschluss vom 17.12.2010, Az. 1 Ws 29/09; siehe auch AG Marburg, Urteil vom 08.02.2010, Az. 91 C 981/09) können Abofallen nämlich auch den Tatbestand des (gewerblichen) Betrugs nach dem Strafgesetzbuch erfüllen.
Diese Entscheidung wird jedoch nicht jeden Einzelnen davon abhalten können, es weiter mit dieser “Geschäftstaktik“ zu versuchen. Es ist daher geboten, einen grundsätzlichen Blick, insbesondere auf die vertragsrechtliche Seite des Abofallen- Modells, zu werfen.
Es ist nämlich schon mehr als zweifelhaft, ob überhaupt ein wirksamer Vertrag zwischen Nutzer und Seitenbetreiber zustande kommt. Da der Nutzer gerade von der Unentgeltlichkeit des Angebots ausgeht, der Abofallen-Betreiber aber Geld sehen will, haben sich die Vertragsparteien in einem wesentlichen Vertragspunkt (juristisch: „essentialia negotii“) nicht geeinigt. Somit kann auch kein Vertrag zustande kommen. Nach Ansicht des LG Mannheim kann in solchen Fällen auch ein sogenannter Dissens nach § 155 BGB vorliegen (Urteil vom 14.01.2010, Az. 10 S 53/09).
Die Seitenbetreiber argumentieren sodann aber, dass sehr wohl vereinbart wurde (nämlich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen), dass das Angebot etwas kosten würde. Der Nutzer habe die AGB akzeptiert - sie seien somit Vertragsbestandteil geworden. Unabhängig von der Frage, ob im konkreten Fall überhaupt ein Vertrag geschlossen wurde, haben die Seitenbetreiber mit dieser Ansicht gar nicht so Unrecht. Denn tatsächlich können Vertragsinhalte auch in AGB geregelt werden. Allerdings gelten für derartige Vertragsklauseln, die in AGB gefasst werden, vielfältige Einschränkungen. So muss etwa die typische AGB-Klausel, die den Hinweis auf die Kostenpflichtigkeit enthält, in der Regel als überraschend klassifiziert werden. Überraschend bedeutet nach dem Wortlaut des Gesetztes (§ 305c Abs. 1 BGB), dass die Bestimmung so ungewöhnlich ist, dass der Vertragspartner des Abofallen-Betreibers mit ihr nicht zu rechnen braucht (siehe etwa AG München, Urteil vom 16.01.2007, Az. 161 C 23695/06; AG Hamm, Urteil vom 26.03.2008, Az. 17 C 62/08). In der Regel verstößt diese Klausel auch gegen das sogenannte Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 BGB. Nach dieser Regelung dürfen Bestimmungen in AGB den Vertragspartner nicht unangemessen benachteiligen; dabei müssen sie insbesondere „klar und verständlich“ sein. Beispielsweise das AG Gummersbach (Urteil vom 30.03.2009, Az. 10 C 221/08) hat daher einen Verstoß gegen dieses Transparenzgebot bejaht. Die oben genannte Klausel („das Angebot kostet etwas“) wird daher nicht Vertragsbestandteil - falls also überhaupt ein Vertrag geschlossen wurde, dann ist er zumindest unentgeltlicher Natur. In Einzelfällen haben die Abo- fallen-Betreiber auch versucht, die Klauseln, die die Kostenpflichtigkeit beinhalten, erst nach Vertragsschluss in Form von Newslettern den Betroffenen unterzujubeln. Die rechtliche Beurteilung stellt sich in diesem Fall jedoch nicht wesentlich anders dar, die Klauseln können schlichtweg nicht wirksam einbezogen werden (vergleiche § 305 Abs. 1 S. 1 BGB: „bei Abschluss eines Vertrages“).
Weil zwischen der angebotenen Leistung und dem nach Meinung der Seitenbetreiber zu entrichtenden Entgelt in der Regel auch ein offensichtliches und gravierendes Missverhältnis vorliegt, kann der Vertrag zusätzlich auch nach § 138 BGB sittenwidrig sein (siehe etwa LG Saarbrücken, Urteil vom 22.06.2011, Az. 10 S 60/10). Der Vertrag ist damit von Rechts wegen unwirksam - eine zusätzliche Erklärung des Vertragspartners ist hier nicht notwendig.
Bei dem abgeschlossenen Abofallen-Vertrag (wiederum: wenn er überhaupt geschlossen wurde) handelt es sich in der Regel um einen sogenannten Dienstvertrag. Der Seitenbetreiber schuldet nach dem Grundverständnis des BGB daher die „Leistung der versprochenen Dienste“, der andere Teil die „Gewährung der vereinbarten Vergütung“, § 611 BGB. Werden von diesem Grundverständnis eines Dienstvertrages in AGB Abweichungen getroffen, sind diese in der Regel gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB ebenfalls unwirksam. Die Seitenbetreiber versuchen etwa in schöner Regelmäßigkeit, ihrem Vertragspartner eine Vorleistungspflicht aufzuerlegen. Das bedeutet, dass die Abofallen-Opfer dazu verpflichtet werden, direkt nach Vertragsabschluss die fälligen Beträge zu entrichten. Im Rahmen eines Dienstvertrages ist die Vergütung nach dem Gesetzeswortlaut jedoch erst nach Leistung der Dienste zu entrichten, § 614 BGB.
Besonderheiten für Minderjährige
Für die “Taten“ Ihrer Kinder stellt sich der Fall ohnehin noch einmal anders dar: Diese dürfen, soweit sie noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, selbst noch gar keine Verträge abschließen. Sie sind gemäß § 104 BGB geschäftsunfähig, Willenserklärungen sind nach § 105 Abs. 1 BGB nichtig, also unwirksam. Diese Regelungen sind gänzlich dem Schutz Minderjähriger verschrieben - daher können die Seitenbetreiber grundsätzlich überhaupt keine Rechte geltend machen; ein Vertrag mit einem solchen Minderjährigen ist schlichtweg nicht möglich. Besonders problematisch kann der Fall aber dann sein, wenn sich Ihre Kinder nicht unter dem eigenen Namen, sondern mit den Daten eines Elternteils auf der Seite angemeldet haben. Für die rechtliche Bewertung eines derartigen Sachverhalts möchten wir auf die nachfolgenden (Unter-)Kapitel verweisen, da dieser Problemkreis (Stichwort: Handel unter fremdem Namen) eine gesonderte juristische Betrachtung erfordert.
Ist Ihr Kind zwischen 7 und 17 Jahren alt, ist es ist nach dem Wortlaut des BGB „in der Geschäftsfähigkeit beschränkt“, § 106 BGB. Wird es dann Opfer einer Abofalle und meldet sich auf einer entsprechenden Seite an, ist möglicherweise tatsächlich ein Vertrag geschlossen worden. Da es sich bei einer Abofalle jedoch klassischerweise um ein entgeltliches Dauerschuldverhältnis handelt, kann der Minderjährige auch hier nicht alleine “tätig“ werden. Das mögliche Vertragsverhältnis bietet dem Minderjährigen nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil, § 107 BGB, und ist daher vielmehr „schwebend unwirksam“, §§ 107, 108 BGB; das bedeutet, dass die Wirksamkeit des Vertrages von Ihrer (vorherigen oder nachträglichen) Zustimmung - also von der Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters - abhängt. Genau so wenig wie Ihr Kind ohne Ihre Zustimmung einen Mobilfunkvertrag oder ein Pay-TV-Abon- nement abschließen darf, darf es sich hier verpflichten, dem Abofallen-Betreiber eine monatliche Gebühr zu entrichten. Der Vertrag mit dem Minderjährigen wäre nur dann möglich, wenn das Verhältnis tatsächlich unentgeltlicher Natur wäre; dann wäre das Vertragsverhältnis nämlich tatsächlich „lediglich rechtlich vorteilhaft“. Verweigern Sie also ihre Zustimmung, kommt der Vertrag nicht zustande, § 108 Abs. 1 BGB. Äußern Sie sich zu diesem Geschäft überhaupt nicht, liegt es am Abofallen- Betreiber, Ihre Genehmigung einzuholen. Schweigen Sie sodann weiterhin, gilt die Genehmigung nach zwei Wochen als verweigert, § 108 Abs. 2 BGB. Trotz alledem gilt auch hier das Vorgesagte: In den klassischen Fällen ist es fraglich, ob überhaupt ein Vertrag geschlossen wurde; zudem sind die häufig verwendeten AGB-Klauseln (wie oben dargestellt) in der Regel unwirksam.
Im Zweifel steht den Vertragspartnern aber auf jeden Fall auch ein Widerrufsrecht nach § 312d BGB zu, da der (von den Betreibern behauptete) Vertragsschluss unter Einsatz von Fernabsatzmitteln (hier mittels Internet) erfolgt ist. Opfer einer Abofalle können sich so - ohne für sie nachteilige Folgen und ohne Angabe von Gründen - von dem Vertrag lösen, indem sie dem Seitenbetreiber den Widerruf in Textform (also etwa per E-Mail oder Briefpost) mitteilen. Dieses Recht steht Verbrauchern grundsätzlich zwei Wochen zu, § 355 Abs. 2 BGB. Da die Abofallen-Betreiber aber die zwingenden Formvorschriften des gesetzlich verankerten Widerrufsrechts jedoch nur selten einhalten, kann die Widerrufsfrist im Einzelfall auch länger ausfallen.
Natürlich wollen sich die Seitenbetreiber auch dieser verbraucherfreundlichen Regelung entledigen. Oftmals schließen sie daher das Widerrufsrecht in ihren AGB aus. Dies ist jedoch nach § 312g BGB ausdrücklich nicht zulässig, sodass es Verbrauchern also trotz einer derartigen Klausel zusteht.
Schließlich steht den Opfern einer Abofalle auch das Rechtsinstitut der Anfechtung offen. Im Einzelfall sind Anfechtungen wegen arglistiger Täuschung (§ 123 BGB) - der Seitenbetreiber wollte Sie bewusst in eine Kostenfalle laufen lassen - oder wegen eines sogenannten Inhaltsirrtums (§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB) - Sie waren sich der Kostenpflichtigkeit nicht bewusst - denkbar. Gerade im letztgenannten Fall können Sie sich gegenüber dem Seitenbetreiber jedoch schadensersatzpflichtig machen (§ 122 Abs. 1 BGB). Um Ihr Anfechtungsrecht (oder gegebenenfalls das ihrer Kinder) wirksam ausüben zu können, ist es notwendig, die ursprüngliche Anmeldung „unverzüglich“ gegenüber dem Seitenbetreiber zu beanstanden. Unverzüglich bedeutet nach § 121 BGB „ohne schuldhaftes Zögern“, was im Regelfall lediglich eine Frist von nur ein bis zwei Wochen zulässt. Die juristischen Details einer Anfechtung können sich im konkreten Fall (spätestens im Prozess) jedoch als schwierig gestalten, sodass vor der Geltendmachung dieses Rechtsbehelfs die Hinzuziehung eines Anwalts mehr als sinnvoll erscheint. Insbesondere die Anfechtung durch Minderjährige ist ein umstrittenes akademisches Problem, das qualifizierten Rechtsbeirat erfordert.
Drohkulisse der Abzocker: SCHUFA, Mahnbescheid und Strafanzeige
Viele Seitenbetreiber lassen sich von der Ausschöpfung der oben aufgezeigten rechtlichen Möglichkeiten allerdings nicht beeindrucken und versuchen dennoch, eine Drohkulisse durch die Ankündigung von Mahnungen oder SCHUFA-Einträgen zu erzeugen und die Abofallen-Opfer zur Zahlung der fälligen Beträge zu bewegen. Nach einem Urteil des AG Leipzig (Urteil vom 03.02.2010, Az. 118 C 10105/09) kann aber auch diese Taktik rechtswidrig sein: In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall war die 12-jährige Tochter der Beklagten Opfer einer Abofalle geworden - mit entsprechenden finanziellen Folgen für die Mutter. Diese weigerte sich, die vom Seitenbetreiber geforderten Beträge zu bezahlen. Sie war (zutreffend) der Meinung, dass nicht sie, sondern ihre minderjährige Tochter den Vertrag geschlossen habe und daher gar keine Zahlungspflicht bestehe. Der Abofallen-Betreiber schaltete daher ein Inkassounternehmen ein, das der Mutter schließlich bei Nichtzahlung mit einem negativen SCHUFA-Eintrag drohte. Das Gericht bestärkte die Ansicht der Mutter, indem es davon ausging, dass, wenn überhaupt ein Vertrag geschlossen wurde, dieser zumindest durch Ausübung des ihr zustehenden Widerrufsrechts aufgehoben wurde. Zudem sei die Datenübermittlung an die SCHUFA im konkreten Fall aus Datenschutzgründen nicht zulässig gewesen. Ferner müsse nach Ansicht des Gerichts klar sein, dass Sinn und Zweck der SCHUFA
„der Schutz der Wirtschaftsteilnehmer vor zahlungsunfähigen oder zahlungsunwilligen Schuldnern, nicht aber die Durchsetzung möglicherweise unberechtigter Forderungen”
sei. Den Gläubigern solle keine „allgemeine Drohkulisse zur Verfügung gestellt werden, bei der das SCHUFA-Sys- tem zu reinen Inkassozwecken missbraucht werden würde”.
Oftmals versuchen die Fallensteller auch, ihre Opfer einzuschüchtern, indem sie diesen mitteilen, dass sie bei Anmeldung auf der Seite deren IP-Adresse gespeichert hätten. Damit sei auch im Prozess beweisbar, dass in der Tat ein Vertrag geschlossen wurde. Diese Behauptung entbehrt in der Regel jedoch jeglicher juristischer Grundlage. Eine IP-Adresse ordnet lediglich einen konkreten Internetanschluss einem bestimmten Anschlussinhaber zu; sie ist quasi die “Hausnummer“ Ihres Internetanschlusses. Tatsächlich ist über die IP-Adresse also, sofern diese vom Seitenbetreiber gespeichert wird und er von Ihrem Internet-Provider eine Auskunft über Ihre Daten erhält, ein Rückschluss auf Ihre Person möglich. Im Prozess könnte er damit also beweisen, dass sich - eventuell sogar tatsächlich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses - eine Person, die Zugang zu Ihrem Internetanschluss hatte, auf der betreffenden Seite des Seitenbetreibers aufgehalten hat. Dass diese Person jedoch tatsächlich eine wirksame Vertragserklärung abgegeben hat, ist durch die bloße IP-Speicherung nicht nachweisbar. Genau so wenig kann er feststellen, welche konkrete Person die Seite besucht hat. Möchte er den Vertragsschluss einer bestimmten Person aus Ihrem Haushalt “anlasten“, kann er dies nur durch die IP- Adresse als solche nicht nachweisen.