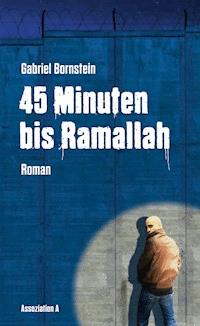14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: KrönerEditionKlöpfer
- Sprache: Deutsch
Ironisch, tiefgründig, voller Sprachfreude und Witz, zuweilen mit einer Spur Magie, erzählt Gabriel Bornstein die Geschichte des jungen David Dubnow, Waise, Sohn einer Holocaust-Überlebenden, den es auf der Suche nach dem Vermächtnis seines einzigen Angehörigen in die Sowjetunion des Kalten Krieges, nach Riga, verschlägt. Dort begegnet er den Absurditäten des autoritären Systems, der Frage, wem er trauen kann und wer was warum verbirgt – und der schönen, geheimnisvollen Judica. Zusammen mit ihr und einer Handvoll jüdischer Überlebender macht er sich auf eine Suche in den Katakomben der Stadt, die bald zur Obsession wird. Eine ganz andere Erzählung über das israelische Trauma, die Geschichte der Judenverfolgung, autoritäre Systeme, die, gerade weil sie mit einem ordentlichen Augenzwinkern erfolgt, ganz tief blicken lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gabriel Bornstein
Das Elfte Gebot
ROMAN
krönereditionklöpfer
Inhaltsverzeichnis
Das Elfte Gebot
Erstes Leben
Zweites Leben
Drittes Leben
Epilog
Glossar
Gibt es einen Gott? Diese Frage beschäftigt die Menschheit, seit Kain seinen jüngeren Bruder Abel erschlug. Velvale Kuzik glaubte nicht an Gott, aber dann schickte ihn das Wirtschafts-Komitee der Kibbuz-Bewegung in Israel zur AgroExpo-Messe für Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie nach Usbekistan. Velvale befand sich im Flugzeug auf dem Weg nach Russland, als an Bord eine Bombe explodierte. Das Flugzeug stürzte ab und alle 187 Passagiere starben, ausgenommen Velvale und seine Sekretärin Gila. Denn zur Zeit der Explosion waren beide in einer der hinteren Toiletten und vögelten um die Wette. Als das Rettungsteam sie fand, waren sie halb nackt, aber unversehrt. Und das, wie Velvale den Sanitätern erklärte, war der Beweis, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. An diesem Tag wurde Velvale gläubig. Und ohne seine Frau Sara, die seine Herumhurerei satthatte und ihn deshalb mit einem Küchenmesser erstach, würde er wohl bis heute dreimal täglich beten und alle 613 Gebote des jüdischen Glaubens befolgen.
Als Sara Kuzik nach sieben Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde, brachte ein israelischer Radiosender einen kurzen Bericht darüber. Der Journalist Rafael Shapiro, der seit Langem in Deutschland lebte, hörte die Sendung und entschied sich, eine Geschichte daraus zu machen. Er packte leichte Klamotten, Sandalen und eine Sonnenbrille ein und buchte einen Billigflug nach Israel. In einem Tel Aviver Hostel angekommen, packte er den Koffer wieder aus, setzte sich an den Tisch und drückte den Startknopf seines Laptops. In der Mitte des Bildschirms erschien ein Lichtpunkt, der sich zu einer Linie verbreiterte und dann mit einem Zischlaut verschwand. Endstation.
Mit dem kaputten Laptop unter dem Arm ging Shapiro zu einem Computerladen in der Ben Yehuda Street. Doch der Fachmann erklärte ihm, das Gerät sei zu alt, und eine Reparatur lohne sich nicht. Shapiro war deprimiert. Einen neuen Rechner konnte er sich nicht leisten, sein Geld reichte kaum für das Hostel, und in Israel war alles noch viel teurer geworden. Theoretisch hätte er sich mit Stift und Heft behelfen und später das fertige Manuskript abtippen können. Diese Arbeitsweise verlangte jedoch eine gewisse Disziplin, die nicht gerade Shapiros Stärke war. Er schaffte es ja nicht einmal, seine eigenen Notizen zu entziffern.
Es war drei Uhr nachmittags, als Shapiro den Computerladen verließ. Die Sonne knallte auf die staubige Straße und das Quecksilber kletterte auf 41 Grad, die sich in der feuchten Luft der Stadt wie 50 anfühlten. Shapiro schleppte sich die Hayarkon Street entlang und suchte nach Schatten. Auf der Straße gab es keinen, also ging er in die nächste Bar.
»Die Klimaanlage ist kaputt, aber das Bier ist kalt«, sagte der gelangweilte Barmann und schenkte Shapiro ein Glas lauwarmes Bier ein. Es war trotzdem das Beste, was dieser Tag ihm bisher zu bieten hatte.
Wo er sein T-Shirt gekauft habe, fragte der Barmann und zeigte auf Shapiros St.-Pauli-Trikot.
»In Hamburg«, sagte Shapiro.
»Hamburg«, wiederholte der Mann und sah Shapiro mit neuem Interesse an. »Lebst du da?«
»Seit über 30 Jahren«, gab Shapiro zurück und hoffte, dass dem Barmann die Fragen ausgingen.
»Und wie ist es so, mit Nazis zusammenzuleben?«, fragte der Mann hartnäckig weiter.
Das wusste Shapiro nicht so genau. Sein Sohn und dessen Mutter, beide reine Deutsche, waren immer sehr nett und seine anderen Freunde auch. In Vergleich zu allen anderen Ländern, die er kannte, war in Deutschland sogar die Regierung ziemlich freundlich. Wenn Shapiro vor der Wahl stünde, als Jude in Deutschland oder als Palästinenser im Israel des 21. Jahrhunderts zu leben, wäre ihm Deutschland lieber.
»Die Deutschen haben das Böse im Blut«, fuhr der Barmann unbeirrt fort. Mit dieser These kam der Mann Hitler ziemlich nah. Auch der hatte geglaubt, Menschen nach ihrem Blut beurteilen zu müssen. Das sagte Shapiro aber nicht.
»Was machst du beruflich?«, wollte der Barmann wissen.
Shapiro antwortete so knapp wie möglich, dass er Autor sei und für eine neue Geschichte recherchiere.
»Mein Vater war auch Schriftsteller«, sagte der Barmann und reichte Shapiro die Hand. »Shimon«, stellte er sich vor. »Shimon Dubnow. Mein Vater war Holocaust-Überlebender, hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Es wurde aber nie veröffentlicht.«
Das interessierte Shapiro nicht besonders, aber dann dachte er an die Hitze draußen auf der Straße und beschloss, ein zweites lauwarmes Bier zu trinken und sich die Geschichte des Barmannes anzuhören.
Und die ging so: Im Alter von drei Jahren war David Dubnow, der Vater des Barmannes, mit seiner Mutter nach Palästina gekommen, um ein neues Leben anzufangen. Die restliche Familie war im Krieg verschollen. Das wollte Davids Mutter aber nicht hinnehmen. Bis zu ihrem Tod drei Jahre später hatte sie täglich die Radiosendung »Suche nach Verwandten« gehört und zahlreiche Briefe in die Welt geschickt, ohne je eine Antwort zu erhalten.
Nach dem Tod seiner Mutter nahmen Bekannte der Familie den kleinen David auf. Das Leben mit dem Waisenkind erwies sich jedoch als schwierig, so dass David im Ben Shemen Youth Village landete. Das Internat lag auf dem Land, und das Leben dort tat David gut. Die Sonne und das gesunde Essen waren genau das Richtige für die Entwicklung des Jungen, und mit seinem Talent für Kampfsport konnte er sich unter den anderen Kindern leicht durchsetzen. Er war ein echter Rabauke.
Im Gymnasium entdeckte David dann den jüdisch-russischen Historiker Semjon Dubnow.
»Kennst du doch.«
Shapiro kannte ihn. In Israel weiß jeder Schüler, wer Semjon Dubnow war. Seine zehn Bände der Weltgeschichte des jüdischen Volkes stehen in den Regalen jeder Schulbibliothek. Dubnow hatte in St. Petersburg gelebt und geforscht und sich besonders für die Chassidim-Bewegung interessiert, diese Phase der Aufklärung im Judentum. Ab 1923 war er Professor für jüdische Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin, 1933 floh er vor den Nazis nach Lettland. Als die Deutschen das Land im Juni 1941 eroberten, wurde Dubnow im Rigaer Ghetto interniert. Soweit bekannt, schoss ihm am 8. Dezember 1941 ein Gestapo-Offizier, ein früherer Student aus Heidelberg, eine Kugel in den Kopf. Es gibt noch ein paar andere Gerüchte über das Ableben des Simon Dubnow, doch keiner weiß mit Sicherheit, welche Version die richtige ist. Und Dubnow selbst kann man ja nicht mehr fragen.
Das Waisenkind David entwickelte die fixe Idee, dieser Semjon Dubnow sei ein Verwandter von ihm. In den nächsten Ferien, die seine Mitschüler zu Hause bei ihren Familien verbrachten, saß David von morgens bis abends in der Nationalbibliothek in Jerusalem. Dort las er alles, was ihm in die Hände fiel, und er vergaß nichts. Naturwissenschaft, Literatur, Gesellschaft, Biologie … Am meisten aber interessierte sich David für Geschichte – und besonders für die von Semjon Dubnow. Er suchte fieberhaft nach Beweisen für eine Verbindung zwischen ihm und dem Historiker, doch er fand nichts.
Wochen verbrachte David damit, den Stammbaum seiner Familie bis ins 19. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Als Napoleon den Juden die französische Staatsangehörigkeit verlieh, siedelte ein gewisser Max Dubnow ins Elsass über. Obwohl Max nur ein armer Schneider war, hatte er eine Vision: »Männer werden immer Kriege führen. Ein Geschäftseinbruch in dieser Branche ist folglich nicht zu erwarten.« Sagte es und gründete eine Schneiderei für Uniformen. Max Dubnow wollte die Armee beliefern, doch die Generäle kauften ihre Uniformen lieber in Paris. Dafür aber gewann die Schneiderei das Zollamt und die örtliche Polizei als Kunden. Das Geschäft lief gut und Max Dubnow konnte seine Familie anständig ernähren. Es war schließlich sein Urenkel Hermann, der die französische Armee mit Uniformen versorgte. Seitdem war die Familie wohlhabend. Dann brach der Zweite Weltkrieg aus und die Spuren der Familie verloren sich.
Shapiro seufzte in sein Bierglas.
»Als er mit der Schule fertig war, suchte mein Vater noch immer nach einem Beweis für seine Verwandtschaft mit Semjon Dubnow«, erzählte der Barmann weiter. »Deshalb hat er sogar die kyrillische Schrift und Russisch gelernt.«
Nach seinem Militärdienst fand David Arbeit bei einer Sicherheitsfirma und heiratete Noga, die Sekretärin seines Chefs Menachem. In den ersten Wochen waren sie glücklich, doch bald merkten sie, dass sie einander nur wenig zu sagen hatten. Noga interessierte sich weder für Geschichte noch für Davids Theorien über seine Verwandtschaft mit Semjon Dubnow. Sie freute sich aber für ihn, dass er einen derart wichtigen Mann in seiner Familie hatte, und schlug vor, den gemeinsamen Sohn nach ihm zu benennen. Semjon, oder eben Shimon auf Hebräisch.
Shapiro hoffte auf ein baldiges Ende der Geschichte, aber Shimon dachte gar nicht daran, also bestellte Shapiro ein drittes lauwarmes Bier.
Kurz nach der Geburt seines Sohnes 1972 schickte seine Firma David als Sicherheitsbegleiter einer israelischen Delegation nach Bukarest. Von dieser Mission kehrte er nicht zurück. Niemand konnte sagen, wo er geblieben war. Noga reichte eine Vermisstenanzeige ein, doch die Polizei konnte nicht helfen. Also reiste Noga nach Bukarest. Nicht, weil ihr David besonders gefehlt hätte, sondern weil sie einen Vater für ihren neugeborenen Sohn haben wollte. Der israelische Konsul in Rumänien berichtete Noga von einem toten Israeli, der zu ihrer Beschreibung von David passte. Die Leiche sei auf dem jüdischen Friedhof in Bukarest hinter der alten Synagoge begraben worden. Man stellte Noga einen Totenschein aus, und sie flog zurück nach Israel. Ein paar Monate darauf heiratete sie ihren Chef Menachem, gerade rechtzeitig, damit Shimon sein erstes Wort, Papa, in dessen Gegenwart sagen konnte. Wegen der verblüffenden Ähnlichkeit mit Menachem kam niemand auf die Idee, dass Shimon nicht dessen Sohn sein könnte.
Noga hatte David längst aus ihrem Gedächtnis gestrichen, als dieser 1974 plötzlich wieder in Israel auftauchte. Er trug einen buschigen Bart und war tief religiös geworden. Beim Polizeiverhör erklärte er, dass er die vergangenen zwei Jahre nicht in Bukarest, sondern in Riga verbracht habe. Er sei dorthin gereist, um Nachforschungen über seine im Krieg ermordete Familie anzustellen. Die Reise nach Riga verstieß allerdings gegen das israelische Militärgesetz, da Israel zu der Zeit keinerlei diplomatische Beziehungen zu Lettland unterhielt, das Teil der UdSSR war. Dafür hätte David für 15 Jahre ins Gefängnis wandern können, auch weil er einer Eliteeinheit der Armee angehört hatte, also Geheimnisträger war. Das Militärgericht befand David jedoch für unzurechnungsfähig und ließ ihn laufen. Seinen Job bei der Sicherheitsfirma war er allerdings los.
Nachdem ihr erster Ehemann wieder aufgetaucht war, musste Noga die Ehe mit Menachem annullieren lassen, und David Dubnow nahm seinen Platz im großen Ehebett wieder ein. Noga arrangierte sich damit. Die Tage verbrachte David in der Synagoge und nachts, wenn er nach Hause kam, ging sie in Menachems Wohnung, die nur ein paar Straßen entfernt lag. Shimon selbst, gerade vier geworden, kam mit dem fremden Vater weniger gut klar. Als David zum ersten Mal nach Hause gekommen war, hatte er voller Panik zu schreien angefangen und sich unter dem Bett versteckt. Besonders Davids Bart jagte ihm Angst ein.
Nach einigen Wochen verließ Noga David und zog mit ihrem Sohn zu Menachem. Ihren offiziellen Ehemann David Dubnow sah sie nur noch einmal im Monat, wenn sie die Post holte. Nach weiteren sechs Monaten bekam sie ihr zweites Kind, Miki, das sowohl mit Shimon als auch mit Menachem Ähnlichkeit hatte.
David Dubnow schrieb in den nächsten Jahren an einem Bericht über seine Zeit in Riga, zuerst auf einer Hermes-Baby-Schreibmaschine und zwanzig Jahre später, als er noch immer an seinen Erinnerungen arbeitete, auf einem Laptop. Veröffentlicht hatte er jedoch nichts. Verleger und Zeitungsredakteure hielten seine Verwandtschaft mit Semjon Dubnow für Schwindel und die Recherche in Riga für unprofessionell. Wahrscheinlich lasen sie sein Manuskript nicht einmal. Verständlich, denn der etwas verwirrte, bärtige Mann wirkte durchaus suspekt. Den Rest seines Lebens hatte David Dubnow in Einsamkeit verbracht, bis er dann vergangene Woche gestorben war. Heute Mittag werde er auf dem Friedhof Kiryat Shaul beerdigt, vermutlich in alleiniger Begleitung von vier Sargträgern und einem Rabbiner.
Warum Shimon nicht zur Beerdigung seines Vaters gehe?, fragte Shapiro den Barmann. Der zuckte mit den Achseln. Er kenne David kaum, und außer dem Namen Dubnow habe er nichts mit ihm gemeinsam. Außerdem müsse er nun die Wohnung renovieren und den ganzen Schrott seines Vaters wegwerfen. Einzig ein paar Gebetsbücher und der alte Laptop, auf dem David geschrieben habe, seien noch brauchbar. Mit den Sachen würde er aber eigentlich auch nichts zu tun haben wollen.
Beim letzten Satz wurde Shapiro wach. Ob er ihm den Laptop abkaufen könne?, fragte er den Barmann.
»Den kannst du gerne haben«, sagte Shimon und reichte Shapiro den klobigen Computer über den Tresen. Geld wollte er dafür nicht.
Am nächsten Tag besuchte Shapiro Sara Kuzik. Sie erzählte von ihrem Mann und wie sie ihn in einem Anfall von Wut erstochen hatte. »Würde jede andere Frau genauso machen«, behauptete Sara Kuzik. Eine banale Geschichte, die Shapiro innerhalb von drei Tagen auf Dubnows Laptop niederschrieb. Er wartete, bis die Frau von der Hostel-Rezeption ihre Mittagspause machte, steckte das Druckerkabel in seinen Laptop und drückte auf Print. Die Maschine knurrte laut und das erste Blatt kam raus. Einige Minuten später hielt Shapiro ein frisch ausgedrucktes Manuskript in den Händen.
Auf den Seiten stand aber nicht die Geschichte von Sarah Kuzik, sondern Davids Reisebericht aus Riga.
Aus demTagebuch vonDavidDubnow – November 2000
Auf einer Tour durch den Stadtteil Neve-Tzedek, unweit vom Alma-Strand, habe ich ein verlassenes Haus entdeckt. Viel konnte ich nicht sehen, weil Fenster und Türen mit Brettern vernagelt waren, trotzdem fühlte ich mich von diesem Haus magisch angezogen. Im Garten stand ein alter Baum, dessen Äste über das Dach ragten. Ich kletterte hinauf, aus purer Neugier, und versuchte, ins Innere des Hauses zu schauen, als der Ast, auf dem ich saß, abbrach und ich aufs Dach fiel. Die alten Ziegel hielten meinem Gewicht nicht stand und ich krachte auf den Boden einer wunderhübschen alten Synagoge. In Anbetracht meiner Vergangenheit, von der ich in diesem Buch erzählen will, konnte das kein Zufall sein.
In den nächsten Wochen fand ich heraus, dass die Synagoge über 100 Jahre alt war und seit den 70ern leer stand. Im Jahr 2000 sind Grundstücke im Stadtteil Neve-Tzedek bei Immobilienmaklern sehr begehrt. Um so eine Ruine zu kaufen, müsste man schon ein paar Millionen Dollar hinlegen. Ein sehr profitables Geschäft, und mittlerweile stehen schicke Villen und Restaurants an der Stelle historischer Gebäude. Mir wurde sofort klar, dass meine Lebensaufgabe darin bestand, neues Leben in die alte Synagoge zu bringen. Ich habe einen Verein zum Erhalt und zur Restauration der alten Synagoge gegründet und mir ein Zimmer in der Nähe gesucht. Beim Umzug habe ich Aufzeichnungen über meine Reise nach Riga gefunden, seit 1974 hatte ich daran geschrieben. Ich habe mir einen Laptop gekauft und damit begonnen, die Erinnerungen auf den Computer zu übertragen. Hier ist meine Geschichte, getreu meinen alten, handschriftlichen Notizen.
Erstes Leben
I
Tel Aviv, 7. Oktober 1985
Mein Name ist David Dubnow, ich bin 37 Jahre alt und von Beruf … Ja, eigentlich habe ich gar keinen. Als Waisenkind hat man mich ins Ben Shemen Youth Village gesteckt, wo ich 1966 mein Abitur gemacht habe. Danach habe ich meine drei Jahre Militärdienst absolviert. Zunächst im Gazastreifen und später bei einem Einsatz im Libanon. Ich habe diese Zeit überlebt, weil ich kein Risiko eingehe. Ich lege keinen Wert darauf, nach meinem Tod eine Ehrenmedaille zu erhalten.
Ich sehe keineswegs schlecht aus. Man versucht uns ständig weiszumachen, dass Aussehen nicht wichtig sei. Das sagen aber nur die Hässlichen. Stellt euch Alain Delon vor mit einem Pferdegesicht wie Fernandel und dem Körper von Woody Allen. Da würde ihm die schönste Seele der Welt auch nicht helfen. Ohne seine hübsche Fresse hätte sich Romy Schneider nie in ihn verliebt. Sie wäre in Berlin geblieben, hätte mit zwanzig Jahren Harry Meyen geheiratet und wäre nie als erfolgreichste deutsche Schauspielerin aller Zeiten in Erinnerung geblieben – es sei denn, ihr Harry wäre selbst auf die Idee gekommen, einem drittklassigen französischen Schauspieler namens Alain Delon eine Nebenrolle in einem Film mit Romy anzubieten. In diesem Fall hätte niemand vorhersagen können, wohin das Ganze geführt hätte.
Ich wollte aber nicht von Alain Delon erzählen, sondern von mir. Ihr fragt euch bestimmt, was ein Israeli im besten Alter im sowjetischen Riga zu suchen hat, und vor allem, warum er fast zwei Jahre in dieser Stadt geblieben ist. Das kann ich euch sagen, obwohl die Antwort auf die erste Frage mit der zweiten überhaupt nichts zu tun hat.
Als mein Sohn Shimon geboren wurde, war ich erst 24. Kein Alter, um eine Familie zu gründen. Hatte ich auch nicht so geplant. Aber ich war einsam und sie auch. Also haben wir geheiratet und ein paar Monate später kam Shimon zur Welt. Ich hätte nie gedacht, dass Babys so hässlich sind. Und sie scheißen pausenlos, mindestens dreimal am Tag. Essen und scheißen, scheißen und essen, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Ich verfiel in eine tiefe Depression und wollte mich trennen, konnte mir aber zwei Haushalte nicht leisten.
Nach der Armee hatte ich einen Job in einer Sicherheitsfirma angenommen. You Secure hieß die. Sollte heißen: Deine Sicherheit. Die Idee für den Namen kam von meinem Chef Menachem, der in der Armee mein Kommandant gewesen war. Man hat uns zwar erzählt, dass es in korrektem Englisch Your Security heißen müsste, aber Menachem wollte es kurz und knapp, so wie man es aus der Armee eben kennt. Ein kurzer Name vermittelt Entschlossenheit. So waren wir damals drauf.
Mein Job war es, reiche Geschäftsleute, die viel Bargeld oder Diamanten bei sich trugen, auf Reisen zu begleiten. Manchmal, wenn es weniger Kundschaft gab, stellte mich die Firma in ein Fußballstadion. Oft wollten die Fans den Schiedsrichter dazu bringen, seine Meinung zu ändern, und mein Job war es, sie davon abzuhalten. In mancher Hinsicht war diese Arbeit gefährlicher als ein Einsatz im Gazastreifen. Dort hatte ich ein M16 Gewehr in der Hand. Auf dem Fußballfeld sind automatische Waffen verboten.
Ich stand nicht besonders auf diesen Beruf. Die Reichen, die ich auf Geschäftsreisen begleitete, waren mir zu unheimlich und die Fußballfans zu gefährlich. Ich träumte von Südamerika oder Thailand, aber so eine Reise war mir zu teuer. Damals verdiente ich nicht viel, und das Wenige reichte kaum für Miete und Babynahrung, die das Kind gleich wieder auskotzte oder … Aber das sagte ich ja schon.
Dann jedoch bekam ich die Chance meines Lebens. Die Firma sollte den Schutz für eine wichtige Persönlichkeit auf dem Weg nach Rumänien organisieren. Es war alles sehr geheimnisvoll und erst im Flugzeug erfuhren wir, dass wir Israels Premierministerin Golda Meir begleiteten, die auf persönliche Einladung des Diktators Nicolae Ceauşescu nach Bukarest reiste, um dort zusammen mit Anwar as-Sadat dessen historischen Besuch in Jerusalem vorzubereiten. Weil alles so streng geheim war, bekam ich das Diplomatenvisum eines Mitarbeiters im Außenministerium – als Tarnung. Mein angeblicher Job war es, ein Tourismusabkommen zwischen Israel und Rumänien vorzubereiten. Dafür hatte ich Prospekte von Reiseunternehmen und Hotels im Gepäck. In Bukarest bekam ich dann nochmal ähnliche Prospekte auf Rumänisch.
Das Treffen zwischen Meir und Sadat fand aber nicht statt, denn Sadat kam gar nicht erst nach Bukarest. Ein Jahr später wurde auch klar, warum: Zu dem Zeitpunkt plante er schon den Jom-Kippur-Krieg und hatte gar nicht vorgehabt, nach Rumänien zu reisen. Das geplante Treffen mit Golda war nur ein geniales Ablenkungsmanöver gewesen.
Golda war sauer und flog am nächsten Morgen mit einem Flugzeug der israelischen Luftwaffe zurück. Ich gehörte nicht zu ihrem festen Team, deshalb gab es keinen Platz für mich. Stattdessen wurde ich auf eine Romania-Airlines-Maschine gebucht. Leider gab es nur einmal wöchentlich einen Flug nach Tel Aviv, also musste ich noch ein paar Tage in Bukarest warten. Glücklich war ich darüber nicht. Drei Tage später saß ich am Flughafen, um endlich nach Hause zu fliegen, als die Abflug-Tafel einen Flug nach Riga ankündigte. Die Maschine würde in dreißig Minuten starten.
Da erwischte es mich. In Riga hatte doch Semjon Dubnow seine letzten Jahre verbracht! Wenn ich jetzt die Gunst der Stunde nutzte, würde mein Traum wahr werden. Ich würde Semjon Dubnow in Riga treffen. Das meinte ich natürlich nur als Metapher; Semjon Dubnow war doch 1941 im Krieg ermordet worden. Mir war klar, dass ich kurz davor war, einen großen Fehler zu begehen. Abgehalten hat mich das nicht.
Die Sachbearbeiterin am Schalter griff zum Telefon und sagte etwas auf Rumänisch. Dann lächelte sie nett und sagte, dass ich Glück hätte, es gebe noch einen freien Platz nach Riga. Mit dem Diplomatenpass und ein paar Dollar in bar war es auch möglich, meinen Flug nach Tel Aviv umzubuchen. Ein paar Minuten später saß ich im Flieger. Noch immer etwas unsicher schaute ich zum Fenster hinaus. Alles sah ruhig aus. Es gab keine Anzeichen dafür, dass mich jemand suchte. Ich schaute nervös auf die Uhr. Die letzten Passagiere stiegen ein, dann startete die Propellermaschine, und wir waren in der Luft.
Bis zur Zwischenlandung in Prag verlief alles glatt. Doch dann mussten wir drei Stunden warten, ohne zu wissen, warum. Es gab keine Durchsagen und keiner traute sich, etwas zu fragen. Ich wusste es aber: Man hatte inzwischen mitbekommen, dass ich nicht in der Maschine nach Tel Aviv saß. Der rumänische Geheimdienst hatte Fragen gestellt und ziemlich bald hatten sie herausgefunden, dass ich mich auf dem Weg nach Riga befand. Deshalb die Zwischenlandung in Prag. In ein paar Minuten würde die Polizei an Bord kommen und mich verhaften. Es würde eine diplomatische Affäre geben und die rumänische Regierung würde mich der Spionage beschuldigen. Die Israelis würden sich natürlich nicht einmischen und ich würde die nächsten Jahre in einem russischen Knast verbringen – wenn ich Glück hatte. Wenn nicht, würden sie mich zurück nach Israel verfrachten, wo ich wegen Landesverrats den Rest meines Lebens in einem Militärgefängnis absitzen würde. Was hatte mich nur dazu getrieben, dieses Risiko einzugehen? Die Spannung war nicht auszuhalten und ich wollte mich schon stellen, als zehn sowjetische Generäle, mit mehr Orden als Platz auf der Brust, ins Flugzeug stiegen. Zwei Stunden später landeten wir in Riga.
II
Ein Polizist in grauer Uniform betrachtete meinen Pass, schlug ihn falsch herum auf und blätterte darin herum, bis er die richtige Seite mit meinem Bild fand. »Israel«, sagte ich und lächelte nervös. Der Polizist sah mich unbeeindruckt an und sagte etwas auf Lettisch. Weil ich nicht antwortete, wiederholte er es etwas lauter und dann noch einmal auf Russisch.
Ich verstand Russisch, dachte aber, es wäre von Vorteil, wenn ich es dem Beamten nicht zu einfach machte.
»English«, sagte ich trotzig.
Der Polizist griff zum Telefon und sagte wieder etwas auf Lettisch. Dann gab er mir ein Zeichen; ich solle mich auf die Seite stellen und warten. Klar, mit einem israelischen Pass hatte ich nichts anderes zu erwarten. Es war echt eine blöde Idee gewesen, nach Riga zu kommen. Das hatte ich schon gewusst, als ich in Bukarest ins Flugzeug gestiegen war.
Zwanzig Minuten später kam eine blonde Polizistin auf mich zu. Mit einem winzigen Lächeln auf ihren schmalen Lippen hätte sie sogar hübsch sein können. Sie lächelte aber nicht. Sie sah mich nur streng an, und auch sie verglich mein Gesicht mit dem Foto in meinem Pass.
Die Reise war unerwartet gekommen und ich hatte nur einen Tag Zeit gehabt, um meinen Diplomatenpass ausstellen zu lassen. In der Eile war ich zu einem Laden in der Allenby Street gegangen. Der Fotograf war ein deutscher Emigrant, der früher in der DDR politische ›Kriminelle‹ fotografiert hatte. Entsprechend sahen seine Passfotos aus.
Die Polizistin gab mir ein Zeichen; ich solle mitkommen. Wenn es mit den Zeichen so weitergeht, wird die Welt bald ohne Sprache klarkommen. Dann werden diese Zeichen zu einer internationalen Kommunikation, die jeder überall auf der Welt versteht.
Ich folgte der Polizistin in einen fast leeren Raum. Sie deutete auf einen Stuhl und ging wieder weg. Eine weitere Stunde verging, bis zwei neue Polizisten hereinkamen. Der eine, ein Offizier, trug eine Brille mit dicken Gläsern. Der andere konnte Englisch. Der Offizier sagte etwas auf Russisch, und der Englischkönner übersetzte:
»Wer hat Sie hergeschickt?«
»Ich bin Tourist«, sagte ich ohne große Hoffnung, dass sie mir glauben würden. Taten sie auch nicht. Sie wussten Bescheid, dass ich in Bukarest für die Israelische Botschaft tätig gewesen war, und das allein reichte schon als Beweis, dass ich ein Spion war. Dafür würde man mich vor ein Militärgericht stellen und zum Tode verurteilen. Dann lächelte der Offizier freundlich und erklärte mir, dass sie keine Barbaren seien. Ich könne ruhig die Wahrheit sagen, und man würde schon eine Lösung finden. Ich sei doch im Besitz eines Diplomatenpasses.
Ich wiederholte, was ich schon gesagt hatte, und behauptete weiterhin vehement, keine Ahnung zu haben, wovon sie überhaupt redeten. Der Englischkönner wollte etwas sagen, aber der Offizier gab ihm ein Zeichen zu schweigen. Schon wieder Zeichen. Der Offizier legte meinen Diplomatenpass auf dem Tisch und fixierte mich mit seinem uniformgrauen Blick. Ich zog einen Prospekt aus der Tasche und reichte ihn dem Offizier.
»Ich arbeite für das Verkehrsministerium in Jerusalem. Wir suchen neue Märkte für den israelischen Tourismus.«
Der Offizier legte den Prospekt zur Seite und schimpfte auf Russisch, in Worten, die man in keinem Lehrbuch finden wird. Dann beschuldigte er mich, in ziemlich gutem Englisch, ein Spion und ein Lügner zu sein, mit Betonung auf Lügner.
»Es gibt keine Wirtschaftsabkommen zwischen Israel und Lettland«, sagte der Offizier.
»Aber zwischen Israel und Rumänien schon. Ich repräsentiere ein Reiseunternehmen«, sagte ich, nicht sehr überzeugend.
Das Lächeln des Offiziers verschwand. Er sei kein Idiot, sagte er, und es sei ein großer Fehler von mir, ihn zu unterschätzen. Als Mitarbeiter der Israelischen Botschaft müsse ich die Regeln doch kennen. Es sei nicht persönlich gemeint, aber das mit dem Todesurteil sei keine leere Drohung. Ich solle mich außerdem beeilen, weil er für heute Abend einen Tisch im Restaurant reserviert habe und sich nicht ewig mit mir beschäftigen könne. Was ich in Riga zu suchen habe, wolle er wissen.
Insgesamt lief es nicht ganz so schlimm, wie ich erwartet hatte. Keine Schläge, bis jetzt jedenfalls nicht. Ich kannte es auch anders. In der Armee war ich im Kampf gegen Terroristen ausgebildet worden, und ich kannte mich mit allen möglichen Waffen aus. Es ist von Vorteil, wenn man eine in der Hand hat. Hatte ich aber nicht, und der Offizier war eiskalt. Er konnte mit mir machen, was er nur wollte, und kein Mensch auf der Welt würde es je erfahren. Aber selbst wenn, was könnte die israelische Regierung schon für mich tun? Klar hatte ich Angst. Ich wusste, wie wir aus Palästinensern Geständnisse herausholten. Das konnten die Russen auch und sicher nicht weniger effizient. Früher oder später bekamen sie die Wahrheit zu hören, aber was für eine? Der KGB interessierte sich bestimmt nicht für Semjon Dubnow, und auch nicht für einen Waisen, dessen Vater im KZ umgebracht worden war und dessen Mutter sich das Leben genommen hatte. Von meiner Verwandtschaft zu Semjon Dubnow zu erzählen, wäre auch nicht schlau. Die nahmen mir ja nicht mal die Israelis ab.
Der Offizier hörte sich meine Geschichte schweigend an. Als ich fertig war, sagte er höflich, dass man so eine blöde Geschichte gar nicht erfinden könne. Daher tendiere er dazu, mir zu glauben.
»Es gibt allerdings einen Schwachpunkt in Ihrer Erzählung«, fügte er hinzu. »In Ihrem Pass steht, dass Sie 1948 geboren wurden.« Der Offizier legte eine dramatische Pause ein, bevor er weiterredete. »Es ist nicht meine Angelegenheit, aber wenn Ihr Vater im KZ gestorben ist, also spätestens 1945, und wenn ich keinen Rechenfehler mache, sind drei Jahre vergangen zwischen dem Tod ihres Vaters und ihrer Geburt. Sie sind also nicht nur ein Lügner, sondern auch ein Bastard. Ihre Mutter hat einen anderen gefickt.«
Der Gesichtsausdruck des Offiziers verriet mir nicht, ob er mich beleidigen oder tatsächlich nur auf einen Denkfehler hinweisen wollte. All die Jahre hatte ich die Lügen meiner Mutter über meinen Vater, das Holocaust-Opfer, geglaubt. Für sie lebte er vielleicht weiter. Sie sah ihn in den Augen jedes Mannes, mit dem sie ins Bett stieg. Männer ohne Gesicht. Und einer von denen hatte mich gezeugt. Erinnerungen an eine unglückliche Kindheit kamen hoch, Einsamkeit, die schon immer mein Zuhause gewesen war, und ich konnte meine Tränen nicht mehr zurückhalten.
Dieser russische Offizier hatte nur wenige Minuten gebraucht, um mich zu knacken. Zwischen den Tränen war ich auch ein bisschen beeindruckt.
Allmählich wurde es ihm unangenehm. »Mossad!«, sagte er verächtlich. Dann machte er kehrt und ging. Der Englischkönner folgte ihm.
Es war schon spät am Abend, als die blonde Polizistin zurückkam. Ein bisschen Englisch konnte sie plötzlich auch. Sie führte mich aus dem Verhörraum. Trotz meines Protests bestand sie darauf, meinen Koffer zu tragen.
Draußen war der Himmel grau und es regnete. Vor dem Flughafenterminal wartete ein schwarzer Wolga mit laufendem Motor. Wir stiegen ein und der Fahrer fuhr sofort los. Ich wusste nicht, was sie mit mir vorhatten. So schlimm konnte es aber nicht werden, sonst hätte man mich in Handschellen in einen geschlossenen Polizeiwagen verfrachtet.
Auf den Straßen waren hauptsächlich Frauen mit Kopftüchern zu sehen und Soldaten, viele von ihnen mit den weißen Schirmmützen der Marine. Und alle liefen, als seien sie in Eile. Es gab nur wenige Autos, die Menschen hier fuhren mit der Straßenbahn. Bahnschienen und Strommasten, wohin ich blickte, und alles in kräftigen Farben, als wäre die Stadt Teil eines Märklin-Eisenbahnmodells. Dann endlich hielten wir vor einem großen Gebäude und Blondi bedeutete mir mitzukommen.
Ein Beamter in Zivil saß an einem großen Holztisch, auf dem drei Telefonapparate standen, und musterte mich neugierig. Er reichte mir die Hand und begrüßte mich auf Englisch mit meinem vollen Namen, David Dubnow. Woher kannte er meinen Namen? Der Mann lachte und zeigte auf meinen Pass.
»Um keine Zeit zu verschwenden, kommen wir gleich zum Geschäftlichen. Sie können erstmal in der Stadt bleiben«, sagte der Beamte. »Und wenn Sie dann nach Israel zurückkehren, können Sie uns ein paar kleine Dienste erweisen. Nichts Illegales, sondern als Touristenagent. Sie repräsentieren doch ohnehin ein Reiseunternehmen, daher sollte das ganz in Ihrem Sinne sein.«
»Habe ich eine Alternative?«, fragte ich.
Der Beamte lächelte. »Klar haben Sie die: zur weiteren Untersuchung nach Russland zu reisen. Einmal dort, kann allerdings niemand sagen, wie es enden wird. Die Russen sind bei Weitem nicht so freundlich wie wir hier in Lettland.«
Mir war klar gewesen, dass ich am Ende alles erzählen würde. Was ich wusste, war kein Staatsgeheimnis, es war aber auch nicht das, was der Beamte hören wollte.
»Ich war Teil des persönlichen Sicherheitsteams von Premierministerin Golda Meir. Meine Aufgabe bestand darin, das rumänische Hotelpersonal in Bukarest zu überprüfen, bevor es die Suite der Premierministerin betreten durfte. Mehr weiß ich wirklich nicht. Zu Hause bin ich Angestellter einer privaten Sicherheitsfirma. Mein Job für die Regierung war nur temporär. Für Sie bin ich nutzlos.«
»Ist das Ihr erster Besuch in der UdSSR?«, fragte der Beamte.
Ich nickte.
»Haben Sie noch andere Ziele außer Riga?«
»Bisher nicht, aber wenn Sie mich hinschicken wollen, könnte es dann bitte St. Petersburg sein?«
»Es gibt keine Stadt, die so heißt, Herr Dubnow.«
»Entschuldigung, ich meinte natürlich Leningrad.«
Der Beamte lachte herzlich. »Mit der richtigen Einstellung werden all Ihre Träume in Erfüllung gehen«, sagte er und gab mir meinen Diplomatenpass zurück.
Blondi begleitete mich hinaus. Vor der Tür gab sie mir meinen Koffer, lächelte so nett, wie sie nur konnte, und wünschte mir, in gebrochenem Englisch, einen angenehmen Aufenthalt in Riga, der schönsten Stadt des Baltikums. »Hier«, sagte sie dann wieder ganz ernst und überreichte mir auch noch eine Visitenkarte.
Ich war froh, wieder auf freiem Fuß zu sein, dennoch war ich beunruhigt. Was wollten sie von mir? Ich war doch kein Spion. Ich wusste nichts, das sie auch nur annähernd interessieren könnte. Klar, Israel gehörte zur westlichen Welt, offiziell war ich der Feind. Aber daraus würden sie keine Staatsaffäre machen. Und warum hatten sie mich wieder gehen lassen? Gerade das machte mich sehr misstrauisch.