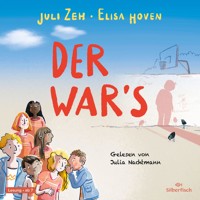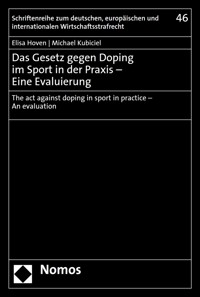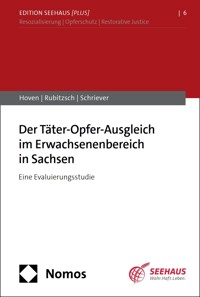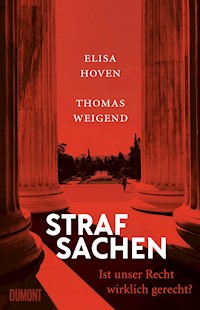18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wem oder was können wir noch glauben? Digitale Neuheiten wie Social Bots oder Deepfakes, aber auch Täuschungen durch Medien und Politik erschüttern zunehmend unser Vertrauen in die demokratischen Institutionen. Die Verfassungsrichterin Elisa Hoven zeigt, worin die größten Gefahren dieser Entwicklung liegen und was wir tun müssen, um den gesellschaftlichen Frieden zu retten. Anhand von Beispielen aus der Migrationspolitik, der Coronapandemie oder dem Klimawandel erläutert sie, wie Falschinformationen und eine einseitige Berichterstattung die Grundlagen gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse zerstören. Um den vollständigen Vertrauensverlust in die Politik und den Siegeszug radikaler Kräfte zu stoppen, fordert sie fundamentale Änderungen. Dazu gehören eine umfassende Überarbeitung des Strafrechts und die Schaffung weiterer Digitalgesetze, eine Abkehr vom Haltungsjournalismus sowie die Vermittlung umfassender Medienkompetenz in den Schulen. Noch können wir unsere friedliche, offene Gesellschaft bewahren. Doch wir müssen handeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Digitale Entwicklungen wie Social Bots und Deepfake-Videos, aber auch gezielte Täuschungen in Politik und Medien prägen zunehmend den öffentlichen Diskurs. Elisa Hoven analysiert, welche gesellschaftlichen Risiken damit verbunden sind – und wie sich Falschinformationen auf zentrale Bereiche wie Migrationspolitik, Klimadebatten oder die Innere Sicherheit auswirken.
Anhand konkreter Beispiele zeigt sie, dass manipulierte Inhalte das Vertrauen in demokratische Entscheidungsprozesse untergraben und die politische Mitte schwächen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, fordert die Verfassungsrichterin eine differenzierte Reform des Strafrechts, neue digitale Regulierungen, eine Abkehr vom Haltungsjournalismus sowie eine Stärkung der Medienkompetenz, besonders bei jungen Menschen.
Ein wichtiges Plädoyer für eine offene, faktenbasierte Debattenkultur – und für den Schutz demokratischer Institutionen in Zeiten digitaler Umbrüche.
© Madlen Krippendorf
Elisa Hoven ist Professorin für Strafrecht und Direktorin des Instituts für Medienrecht an der Universität Leipzig sowie Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Sie schreibt regelmäßig für Die Zeit und für die Welt und wird als Expertin in TV-Sendungen eingeladen. 2023 veröffentlichte sie zusammen mit Thomas Weigend bei DuMont ihr Sachbuch ›Strafsachen‹. Im Februar 2025 erschien ihr erster Roman ›Dunkle Momente‹.
Elisa Hoven
DAS ENDE DER WAHRHEIT?
Wie Lügen, Fake News und Framing unsere Gesellschaft bedrohen – und was wir dagegen tun müssen
Dieses Buch beruht auf Tatsachen. Einige Namen wurden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte geändert.
E-Book Auflage 2025
© 2025 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1140-4
www.dumont-buchverlag.de
Kapitel 1
Das Zeitalter der Lüge
Im vergangenen Jahr habe ich zwei Bekannte zu einem Mittagessen getroffen – das uns fast die Freundschaft gekostet hätte. Wir sprachen über die damals aktuellen Wahlen und kamen schnell auf das Thema Migration. Hannah seufzte. Ja, die Zuwanderung sei das größte Problem unseres Landes. Matthias, ein langjähriger Studienkollege und bis dahin auch guter Freund von Hannah, war entsetzt. Deutschland sei ein Zuwanderungsland und Migration unerlässlich, um unseren Wohlstand zu sichern. Die Diskussion wurde zunehmend hitzig und emotional, der Ton wütend und bald vorwurfsvoll. Ich fragte Hannah dann, was genau ihr Sorge bereitete. Wenig überraschend betraf es mein Arbeitsfeld: Straftaten durch Ausländer. Ehrenmorde, Clankriminalität, Drogenhandel. Jeden Tag, so meinte Hannah, würde es in Deutschland zu hundert Vergewaltigungen durch ausländische Männer kommen. Matthias widersprach. Er habe erst kürzlich gelesen, dass Ausländer in keiner Weise krimineller seien als Deutsche, das von Hannah benannte Problem gäbe es nicht. Hannah verwies auf eine Zunahme von Messerangriffen durch Migranten, Matthias auf die Taten von Rechtsextremisten. Sie warf ihm vor, den Medien alles zu glauben, er hielt entgegen, dass sie auf Fake News in den sozialen Netzwerken hereinfalle. Die Diskussion war längst keine mehr, sondern ein Streit, in dem der eine den anderen nicht verstand.
Was ich mit Matthias und Hannah im Kleinen erlebt habe, ist Teil eines großen gesellschaftlichen Problems. Wir vertrauen nicht mehr denselben Quellen, wir bewegen uns in unterschiedlichen Informationswelten und werden mit Unwahrheiten gefüttert, die wir kaum mehr als solche entlarven können. Falsche Informationen und einseitige Berichte prägen die Grundlagen unseres Denkens – und so machen wir uns ganz verschiedene Vorstellungen von der Wirklichkeit, von den gesellschaftlichen Problemen und möglichen Lösungen. Für den gesellschaftlichen Frieden und für die gemeinsame Bewältigung der Konflikte des 21. Jahrhunderts ist das Gift.
Wie Lügen unsere Gesellschaft bedrohen
Wir leben in einem Zeitalter der Unwahrheit. Donald Trump sagt im Fernsehen, dass Migranten Katzen und Hunde essen – und wird zum zweiten Mal zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt. In Deutschland inszeniert eine Partei den Koalitionsbruch, Papiere über den längst geplanten D-Day gelangen an die Presse. Friedrich Merz pocht im Wahlkampf auf die Schuldenbremse. Sie schütze, so wiederholt er immer wieder öffentlich, den Wohlstand auch der jungen Generation. Tage nach der Wahl vollzieht er eine Kehrtwende und setzt ein Schuldenpaket in Milliardenhöhe durch. Dafür wird sogar das Grundgesetz geändert. Gerichte verbieten Angaben von Faktencheckern – weil sie selbst unwahr sind.1 Und Mark Zuckerberg trennt sich gleich ganz von den Faktenprüfern auf Facebook und Instagram. Die Lüge kommt von allen Seiten. Auch 58 Prozent der Deutschen lügen – und zwar täglich, das besagt jedenfalls eine Studie.2 Die meisten von uns lügen, mal fast unbemerkt aus Höflichkeit, mal ganz bewusst, um unsere Ziele zu erreichen. Einige Lügen sind gesellschaftlich akzeptiert, andere bringen einen ins Gefängnis. Manche Unwahrheiten haben sich tief in unser Gedächtnis gebrannt, das Weltgeschehen beeinflusst, politische Karrieren beendet oder Kriege beginnen lassen. Der Streit um die Wahrheit fasziniert uns. Die Verfahren gegen Jörg Kachelmann oder Gil Ofarim haben die Medien monatelang beschäftigt, wir wollen wissen, wer die Wahrheit sagt und wer lügt.
Unwahrheiten sind Teil unseres Alltags, Grundlage krimineller Geschäftsmodelle und Mittel im öffentlichen Meinungskampf. Menschen lügen aus politischer oder ideologischer Überzeugung, sie lügen in unterschiedlichen Situationen, im Krieg und im Frieden, im Wahlkampf, bei Dates und im Geschäftsleben. Dabei wird heute nicht unbedingt mehr gelogen – aber anders und vor allem effektiver. »Fake News« gibt es zwar nicht erst seit Donald Trump, doch noch nie war die Gefahr von Falschinformationen so groß wie im Zeitalter der Digitalisierung und der sozialen Medien. Fake News erreichen über soziale Netzwerke in Sekundenschnelle Hunderttausende von Nutzern, Social Bots verbreiten und kommentieren die falschen Meldungen und erhöhen so ihre Reichweite. Bilder lassen sich so manipulieren, dass Original und Fälschung mit bloßem Auge nicht zu unterscheiden sind. Deepfakes machen uns glauben, dass eine Politikerin den Fleischkonsum verbieten will oder dass der Präsident der USA China den Krieg erklärt.
Moderne Technologien verändern auch die Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns kennenlernen und miteinander Geschäfte machen. Betrügerische Mails finden ihren Weg über den gesamten Globus, Täter können über Kontinente hinweg nach Opfern suchen. Dabei spielt ihnen ein weiteres Phänomen unserer Zeit in die Karten: die Vereinzelung der Menschen und die Unverbindlichkeit unserer Beziehungen. Ziel der Betrüger sind häufig ältere Menschen, die mit modernen Technologien überfordert und nicht mehr, wie noch in früheren Zeiten, fest in einen Familienverband integriert sind. Auch in Sexualbeziehungen hat es die Lüge leichter, wenn das Kennenlernen anonym im Internet stattfindet, die Begegnungen flüchtig und austauschbar sind. Zugleich ist die Verfolgung der Taten durch die globale Vernetzung der Betrüger kaum mehr möglich, die Täter verstecken sich hinter falschen Accounts und in Ländern, die sie nicht ausliefern. Die KI lässt Täuschungen immer echter erscheinen, Betrüger können mit einfachen Programmen Websites fälschen oder Daten abfangen, da immer mehr Transaktionen online stattfinden. Dabei entsteht ein gefährliches Ungleichgewicht gerade zwischen technisch versierten Betrügern auf der einen und älteren, von den Entwicklungen der Technik überforderten Menschen auf der anderen Seite, die dadurch leicht zu Opfern werden.
Ohne Lügen funktioniert das menschliche Zusammenleben nicht, das meinen zumindest viele Sozialforscher. Kaum eine Beziehung würde es überstehen, wenn wir immer und ausnahmslos ehrlich miteinander wären. Aber die neue Alltäglichkeit der Unwahrheit schafft für uns und unsere Gesellschaft ein drängendes Problem: Sie bedroht den gesellschaftlichen Frieden und die Funktionsfähigkeit des demokratischen Systems. Denn Lügen stellen die Grundlagen unserer Entscheidungsprozesse infrage: Wenn wir nicht von denselben Tatsachen ausgehen, wie können wir dann sinnvoll miteinander diskutieren? Daran scheiterte auch das Gespräch von Hannah und Matthias. Die beiden lesen unterschiedliche Zeitungen, andere Berichte im Internet und in den sozialen Medien. Der Algorithmus erkennt schnell, was sie bewegt – und spielt ihnen Beiträge mit denselben Themen und den immer gleichen Meinungen zu. Hannah erhält Texte, in denen die Kriminalitätszahlen überhöht werden, falsche Artikel über nie begangene Verbrechen, wütende Anklagen gegen einen Staat, der nichts gegen Ausländerkriminalität unternimmt. Matthias hingegen werden Berichte angezeigt, die jedes Kriminalitätsproblem leugnen und Zahlen falsch herunterrechnen (dazu ausführlich in Kapitel 4). Es entstehen zwei unterschiedliche Wahrheiten, die so weit voneinander entfernt sind, dass sich die beiden nicht mehr verstehen können. Wenn Matthias überzeugt ist, dass es kein Kriminalitätsproblem gibt, wird er Hannahs Position als irrational und fremdenfeindlich deuten. Hannah hingegen wirft Matthias vor, aus moralischer Überheblichkeit reale Herausforderungen von Migration zu ignorieren.
Anfällig für Lügen und Einseitigkeit sind gerade politische Reizthemen. Während der Covid-19-Pandemie kursierten zahlreiche Falschbehauptungen über das Virus, die Impfstoffe, die Zahl der Toten oder die Wirkung der Gegenmaßnahmen. Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist das Netz voll von manipulierten Fotos und Deepfake-Videos. Nicht anders im Nahostkonflikt. Und zum Klimawandel finden sich die absurdesten Behauptungen, untermauert von scheinbaren Fakten und angeblichen Expertenmeinungen. All das spaltet unsere Gesellschaft: Wer eine Information für wahr hält, wird eine andere Politik befürworten als derjenige, der ihr keinen Glauben schenkt. Gemeinsame gesellschaftliche Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit sind jedoch nur möglich, wenn unsere Einschätzungen und Entscheidungen auf ähnlichen Fakten beruhen und nicht durch Unwahrheiten beeinflusst werden.
Der neuen Normalität der Lüge werden dann Forderungen nach mehr absoluter Wahrheit entgegengehalten. Liefern sollen sie Faktenchecker und vor allem die Wissenschaft: Follow the Science! Doch ist es so einfach? Auch die Wissenschaft hat selten »die Wahrheit«, sondern versucht, sich ihr bestmöglich anzunähern. Dazu gehörten Fehlschläge, Falsifizierungen von zuvor plausibel klingenden Thesen und auch der Irrtum. Das Einfordern unbedingter Wahrheit und die Ablehnung gegenteiliger Ansichten in Medien und Politik können zu einer Verengung des gesellschaftlichen Diskursraumes führen. Auch das ist gefährlich für eine Demokratie und für die Prozesse sachlicher Entscheidungs- und Wahrheitsfindung, die von offener und kritischer Auseinandersetzung leben. Wird gegen Medien und Politik der Vorwurf erhoben, selbst die Unwahrheit zu sagen, Wahrheiten zu verschweigen oder ein unvollständiges Bild der Wahrheit zu zeichnen, droht ein Vertrauensverlust in demokratische Institutionen – der bedrohlicher ist als jede Lüge in den sozialen Netzwerken. Das Gefühl, von Politik und Medien nicht wahrhaftig informiert zu werden, hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass sich Menschen von den traditionellen politischen Parteien und den Leitmedien abwenden – und nach Alternativen suchen. Staat und Medien werden dann zum Teil des Problems, das sie eigentlich bekämpfen sollen.
Lügen können auf der Weltbühne stattfinden oder im kleinen Kreis, sie können den demokratischen Diskurs gefährden und das Vertrauen, das wir ineinander haben. In diesem Buch wird es um Wahrheit und Lügen in den großen Kommunikationsräumen gehen, in den Medien und in der Politik, um Lügen über den Klimawandel, das Corona-Virus und Kriege, um Fake News, Verschwörungserzählungen und Deepfakes, aber auch über die Wahrheit im Privaten, über Lügen für Geld oder für Sex. Ich werde darüber schreiben, welche Systeme, Methoden und Techniken dabei genutzt werden und welche massiven Folgen die Allgegenwärtigkeit der Lüge für den gesellschaftlichen Frieden und das soziale Miteinander haben kann.
Wir stehen vor der Frage, wie wir den Angriffen auf die Wahrheit begegnen wollen. Wie viel Verlust an Wahrheit verträgt unsere Gesellschaft? Wo ist der Kipppunkt zwischen einer noch akzeptablen Lüge und einer Unwahrheit, auf die das Recht mit einem Verbot reagieren muss? Noch hinkt das Recht den aktuellen Entwicklungen hinterher. Es hat in vielen Fällen keine Antworten auf die aktuellen Herausforderungen für die Wahrheit. Unser Strafgesetzbuch von 1871 kennt weder Deepfakes noch Social Bots, die alten Vorschriften bilden die neuen Probleme nicht ab. Wieso bestraft das Recht die Täuschung, wenn das Opfer Geld verliert – nicht aber, wenn es um Sex geht? Ist es richtig, dass falsche Wahlversprechen, unwahre Aussagen über den Klimawandel oder die Verbreitung von Fake News über die Corona-Pandemie bislang straflos sind? Schützen wir damit den freien Diskurs – oder nehmen wir zu viele Lügen hin und gefährden damit die Grundlagen unseres Zusammenlebens? Auch in der Anwendung ist das Recht oft zu schwerfällig. Der Strafverfolgung werden nicht ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um mit den weltweit und im Schutz des Internets agierenden Tätern Schritt halten zu können.
Wenn die Unwahrheit unsere Gesellschaft bedroht, dann müssen wir uns auch darüber verständigen, was Wahrheit ist, was Lüge und was dazwischen liegt, wie wir die Wahrheit finden und wo sie uns verschlossen bleibt. Wir müssen verstehen, welche Rolle moderne Technologien, künstliche Intelligenz und soziale Medien für die Wahrheit spielen. Wir müssen neue Wege finden, wie wir mit Wahrheit und Lüge umgehen – in den Schulen, in öffentlichen Debatten und in den Medien, aber auch in unserem Recht.
Gibt es die Wahrheit überhaupt?
Ein Mann und eine Frau verbringen eine Nacht miteinander. Während er die kurze Affäre in guter Erinnerung behält, erlebt sie die sexuellen Handlungen als Missbrauch. Später konfrontiert sie ihn, es kommt zum Streit. Sie wirft ihm vor, ihre Verletzlichkeit und seine berufliche Stellung ausgenutzt zu haben. Er reagiert wütend. Sie sei zu ihm gekommen und habe sich durch die Affäre Karrierevorteile verschaffen wollen. Zwei Menschen haben dieselbe Situation vollständig unterschiedlich erlebt. In dieser Szene aus der US-amerikanischen Serie The Morning Show werden zwei Wahrnehmungen der Wahrheit gezeigt, und beide Protagonisten halten die eigene Version für die richtige.
Die meisten von uns werden schon einmal die Erfahrung gemacht haben, dass wir ein eigenes Verhalten ganz anders wahrgenommen haben als unser Gegenüber. In vielen Streitigkeiten, ob in der Familie oder unter Freunden, heißt es: »Du hast doch gesagt, dass …« – »Nein, das habe ich nicht!« Und häufig sind, wie die Protagonisten der Morning Show, beide sicher, die Wahrheit zu sagen. Das stellt uns vor die Frage, ob es überhaupt die eine Wahrheit gibt. Wie relativ ist das, was wir für absolut richtig halten?
Die Frage danach, was »Wahrheit« ist, wie sie sich zur Wirklichkeit und Realität verhält, beschäftigt die Philosophie seit der Antike. Aristoteles hat Wahrheit und Unwahrheit wie folgt unterschieden: »Zu sagen nämlich, das Seiende sei nicht oder das Nicht-Seiende sei, ist falsch, dagegen zu sagen, das Seiende sei und das Nicht-Seiende sei nicht, ist wahr.«3 Eine Aussage ist nach dieser sogenannten Korrespondenztheorie also wahr, wenn sie mit den realen Gegebenheiten übereinstimmt. Die Definition entspricht am ehesten dem, was wir im Alltag als Wahrheit bezeichnen würden. Die Aussage »Das Auto ist rot« ist wahr, wenn das Auto rot lackiert wurde; sie ist unwahr, wenn für das Auto blaue Farbe verwendet wurde.
So einfach wie eine Fahrzeuglackierung liegen die Dinge allerdings meist nicht. Die Korrespondenztheorie geht davon aus, dass eine Wirklichkeit existiert, die sich durch Beobachtung erfassen lässt. Wenn Wahrheit voraussetzt, dass sich Aussage und Tatsachen entsprechen, dann muss aber bestimmt werden können, was Tatsachen sind. Hier setzt die Kritik an. Unser Verständnis von Tatsachen sei das Ergebnis von Interpretation, es gebe keine Tatsache, die für jeden Menschen dasselbe bedeute. Ein Gegenstand könne nicht losgelöst von seinem Betrachter existieren. Identische Bedeutungen könne es allenfalls im Bereich der Logik geben, etwa bei mathematischen Sätzen, an denen – so die Erklärung von Thomas Hobbes – keine eigennützigen Interessen bestehen.4 In Abgrenzung zur Korrespondenztheorie entwickelten sich Ansätze, die Wahrheit in erster Linie als diskursive Konstruktionen begreifen. Die verbreitete Kohärenztheorie etwa bestimmt Wahrheit in Bezug auf die innere Kohärenz von Aussagen. Eine Aussage ist danach wahr, wenn sie sich in einen bestehenden Zusammenhang anderer Aussagen schlüssig einfügt. Konsenstheoretiker wie Jürgen Habermas sehen als Bedingung für die Wahrheit von Aussagen »die potentielle Zustimmung aller anderen«.5 Wenn eine Äußerung wahr sein soll, muss sie intersubjektiv (für jedermann) und intertemporal (für jede Zeit) Geltung beanspruchen können.
Doch auch ein diskursives Verständnis sieht sich Kritik ausgesetzt. Denn die Annahme, dass ein Gegenstand nur in Abhängigkeit von der Person existiert, die ihn wahrnimmt, ist nicht zwingend. Ein Objekt ist nicht dasselbe wie die Vorstellung, die man sich von ihm macht. Wir müssen von einer Existenz der Dinge als solcher ausgehen und unsere Wahrnehmungen als – fehleranfällige – Annäherungen an diese Wirklichkeit begreifen. In den Worten Karl Poppers: »Die Wahrheit ist objektiv und absolut […]. Aber wir können niemals ganz sicher sein, dass wir die Wahrheit, die wir suchen, gefunden haben. Wir dürfen die Wahrheit nicht mit der Sicherheit, mit ihrem sicheren Besitz verwechseln.«6
Ein Ansatz, der die Wahrheit nicht als vorgegeben versteht, sondern sie durch Konsens konstruiert, löst sich von einem objektiven Wirklichkeitsverständnis. Wenn Wahrheit nur eine Konstruktion ist, dann verliert sie ihr Potenzial als kritisches Korrektiv. Wer den Wahrheitsskeptizismus auf die Spitze treibt und die Existenz objektiver Wahrheit verneint, der öffnet den Weg in eine postfaktische Gesellschaft, die den Diskurs abschottet gegen Evidenzen und gegen rationale Kontrolle. Wenn es keine Wahrheit gibt, dann kann man auch die Lüge nicht kritisieren.
Das Strafgesetzbuch geht davon aus, dass es Tatsachen gibt, die wahr oder unwahr sein können. Tatsachen werden verstanden als konkrete Vorgänge oder Zustände der Vergangenheit oder Gegenwart, die sinnlich wahrnehmbar in die Wirklichkeit getreten und damit dem Beweis zugänglich sind. Einige Wahrheiten werfen kaum Probleme auf. Das gilt für rein äußere Ereignisse: Hat A auf B geschossen oder nicht? Hat A zu B gesagt, er solle seine Kette mit Davidstern einpacken? Hat A sexuelle Handlungen vorgenommen oder nicht? Die Vorgänge als solche sind beweisbar, eine Videoaufnahme würde klar belegen, ob A geschossen, diskriminiert oder vergewaltigt hat. Anders verhält es sich bei inneren Tatsachen. Die Strafe für A fällt anders aus, wenn er B töten und nicht nur verletzen wollte. Die Wahrheitsermittlung ist hier für die Gerichte schwierig. Da sie nicht in den Kopf des Täters schauen können, müssen sie aufgrund objektiver Umstände auf seinen inneren Willen schließen. Welchen Grund hatte er für den Schuss, wie viel Erfahrung mit Waffen, wohin hat er gezielt – all diese ermittelbaren Fakten sind nicht die Wahrheit, sondern Versuche, sich ihr anzunähern.
Wie relativ ist die Wahrheit?
Es ist bekannt, dass wir uns Wahrheiten konstruieren, Informationen unterschiedlich aufnehmen und gewichten. Psychologen haben eine Vielzahl kognitiver Verzerrungen identifiziert, die unsere Wahrnehmung, unser Denken und Urteilen beeinflussen. Besonders bekannt ist der »Confirmation Bias«. Danach tendieren Menschen dazu, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie bestehende Gewissheiten bestätigen. Demgegenüber werden Hinweise ausgeblendet oder relativiert, die das eigene Überzeugungssystem infrage stellen.
Eine US-amerikanische Studie hat versucht, diesen Effekt zu erklären.7 Die Forscher haben im Jahr 2004 dreißig Männer ausgewählt, von denen die eine Hälfte Anhänger von George W. Bush, die andere Unterstützer von John Kerry waren. Den Probanden wurden Äußerungen der jeweiligen Präsidentschaftskandidaten vorgespielt, in denen sie sich selbst widersprachen. Die Teilnehmer hörten also zunächst ein Statement, in dem Kerry Streichungen von Steuererleichterungen forderte, und anschließend eine spätere Aussage, in der er die früheren Kürzungspläne bestritt. Während sie mit den Äußerungen konfrontiert wurden, lagen die Probanden in einem MRT-Scanner.
Die Auswertung der Daten ergab: Hörten die Teilnehmer die Aussage, die ihrer Annahme über ihren Kandidaten widersprach, wurden Hirnareale besonders stark durchblutet, die im vorderen Bereich der Hirnrinde liegen und als Verarbeitungsstationen für Stresserleben, negative Gefühle und Schmerz zuständig sind. Bei den widersprüchlichen Aussagen des Kontrahenten, dessen Integrität nicht Teil des eigenen Weltbildes war, trat ein solches Aktivierungsmuster nicht auf. Kurz gefasst: Werden unsere Überzeugungen in Zweifel gezogen, ist das schmerzhaft – und was schmerzhaft ist, vermeiden wir.
Der Confirmation Bias zeigt sich besonders in unserem Medienkonsum: Die wenigsten Menschen lesen sowohl die Welt als auch die taz. Trotz der immer vielfältigeren Angebote bleiben wir meist in unserer Blase. Algorithmen können diesen Effekt verstärken, weil sie uns Inhalte basierend auf unserem vorherigen Nutzungsverhalten anzeigen. Es werden uns dann immer wieder Beiträge präsentiert, die eine bestimmte Haltung oder ein bestimmtes Thema zum Gegenstand haben.
Ich habe vor einigen Jahren eine Studie zur Darstellung von Ausländerkriminalität in den sozialen Medien durchgeführt. Nachdem ich einige Tage entsprechende Beiträge gesucht hatte, wurden mir täglich neue Meldungen zu Straftaten durch Migranten angezeigt. Auf einmal war Kriminalität durch Ausländer omnipräsent. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie schnell völlig unterschiedliche Realitäten entstehen können. Das, was wir als gesellschaftliche Probleme oder globale Bedrohungen wahrnehmen, haben wir nur zu einem geringen Anteil selbst erlebt – das meiste erfahren wir durch die Medien, die wir konsumieren. Wir können in derselben Straße leben wie unser Nachbar und trotzdem in einer völlig anderen Welt – mit ganz anderen Vorstellungen von der Wahrheit.
Wir beobachten Ereignisse nie wirklich neutral, sondern stets aus unserer Perspektive, also mit all unseren Erfahrungen, Erkenntnissen und Überzeugungen im Hinterkopf. Vor einiger Zeit habe ich eine Talkshow gesehen, das Thema – Waffenlieferungen in die Ukraine – war kontrovers, die Gäste unterschiedlicher Ansicht. Ich war froh, dass der Experte, der meine Position vertrat, souverän und überzeugend war, während seine Gegnerin unsicher und unfreundlich auftrat. Dachte ich. Am nächsten Tag telefonierte ich mit einer Freundin, die in der Frage auf der anderen Seite stand. Sie hatte die Talkshow ebenfalls gesehen – und klang triumphierend. Mein Experte sei überheblich gewesen, laut, aber ohne Substanz, die Expertin hingegen sachlich und ruhig. Ich konnte nicht glauben, dass wir dieselbe Sendung geschaut hatten.
Dass Menschen eine Situation aufgrund ihrer Voreinstellung anders erleben, belegen auch wissenschaftliche Untersuchungen. In einer Studie aus den USA befragten Forscher die Zuschauer eines Football-Spiels, bei dem es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen war.8 Die Befragten hatten Ursprung und Ablauf des Konflikts völlig unterschiedlich wahrgenommen. Die Fans des Teams aus Dartmouth waren überzeugt, dass die Spieler aus Princeton den Streit begonnen hatten; die Anhänger von Princeton erinnerten sich genau, dass die Gewalt von den Spielern aus Dartmouth ausgegangen war. Wir bewerten das Auftreten von Personen, den Inhalt ihrer Äußerungen und sogar die Abläufe von Ereignissen im Lichte unserer persönlichen und politischen Vorannahmen, wir schauen also tatsächlich durch eine ganz eigene Brille auf die Welt.
In Deutschland schauen die meisten von uns zumindest in einem Punkt durch dieselben Gläser: Wir nehmen unsere Welt eurozentriert wahr. Das heißt, wir betrachten globale politische Entwicklungen aus der Perspektive europäischer Kulturgeschichte, unserer Interpretation historischer Ereignisse und unserer Überzeugung von den richtigen Normen und Werten. Unsere Schulbücher erzählen eine andere Geschichte als die Bücher aus China, Indien und Japan. Der Westen sieht sich selbst als Zentrum der Welt, die Länder, die nicht zu uns gehören, definieren wir in Beziehung zu uns: Der Osten ist entweder nah, mittel oder fern, ganz nach mitteleuropäischer Sicht. Der Historiker Robert B. Marks formuliert die Kritik so: »Europa macht Geschichte, der Rest der Welt besitzt keine, bis er mit Europa in Kontakt tritt. Europa ist das Zentrum, der Rest der Welt seine Peripherie.«9
Ganz deutlich zeigt sich der unterschiedliche Blick auf die Welt daran, wie wir sie darstellen. Auf den Weltkarten, wie wir sie kennen, ist Europa im Mittelpunkt. Dabei ist die Darstellung nach der sogenannten Mercator-Projektion natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten, die Erde zu betrachten. In China sieht die Weltkarte anders aus, das »Reich der Mitte« steht im Zentrum, Europa liegt am westlichen Rand. Alles eine Frage der Perspektive. Und: Keine der Weltkarten bildet tatsächlich die Wirklichkeit ab. Die Erde ist rund – und aus einer Kugel kann man keine zweidimensionale Landkarte falten. Daher ist jede Darstellung der Kontinente und Staaten verzerrt. Russland zum Beispiel scheint auf unserer Weltkarte riesig zu sein, beinahe doppelt so groß wie Afrika. In Wahrheit verhält es sich entgegengesetzt; Afrika hat eine Fläche von etwa dreißig Millionen, Russland von rund siebzehn Millionen Quadratkilometern. Gebiete, die sich nahe an den Polen befinden, werden optisch gestreckt. Zieht man Russland an den Äquator, sieht das Land gleich deutlich kleiner aus.
Der Fokus auf die westliche Welt prägt auch die Wissenschaft. Eine Analyse der wichtigsten amerikanischen Zeitschriften im Bereich der Psychologie aus den Jahren 2003 bis 2007 kam zu dem Ergebnis, dass etwa 95 Prozent der Probanden für psychologische Studien aus westlichen Industrieländern stammten.10 Die Menschen in diesen Ländern machen nur 12 Prozent der Weltbevölkerung aus, sie bestimmen aber die wissenschaftliche Sicht auf menschliches Verhalten.
Dass nicht alles wahr ist, was uns wahr erscheint, zeigt bereits die Biologie. Auf unserer Netzhaut haben wir einen blinden Fleck an der Stelle, an der unser Sehnerv in das Auge eintritt. In dieser Region gibt es keine lichtempfindlichen Fotorezeptoren, dort haben wir also keine Möglichkeit, etwas visuell wahrzunehmen. Doch der blinde Fleck fällt uns überhaupt nicht auf – denn unser Gehirn täuscht uns. Es nutzt die Informationen aus der umliegenden Umgebung, um ein vollständiges Bild unserer visuellen Welt zu erschaffen. Wir sehen also etwas, das gar nicht da ist.
Die schmale Grenze zwischen Wahrheit und Lüge
Wir haben gesehen, dass Wahrheit oft relativ ist. Vieles, was wir für wahr halten, mag aus anderer Perspektive zweifelhaft sein. Trotz der notwendigen Skepsis gegenüber absoluten Wahrheitsansprüchen gibt es einen Kern von Wirklichkeit, den eine Rechtsordnung als Wahrheit anerkennen muss, um die gemeinsamen Grundlagen einer Gemeinschaft, aber auch den Schutz des Einzelnen vor Täuschungen zu gewährleisten.
Einige Aussagen sind auf dieser Basis recht problemlos als Lügen einzustufen. A sagt, B habe ihn auf einer Feier beschimpft, dabei war B gar nicht im Raum. C sagt aus, dass das Fahrzeug von D deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei, obwohl C gar keine Sicht auf die Unfallstelle hatte. E behauptet, Politiker F habe die voraussetzungslose Aufnahme aller Migranten gefordert; F hat eine solche Rede allerdings nie gehalten.
Manche Abweichungen von der Wahrheit sind jedoch weniger eindeutig zu bewerten. Überspitzungen und Verkürzungen bewegen sich auf der Grenze zwischen Lüge und Wahrheit. Wenn ich von einer Mitarbeiterin in den höchsten Tönen schwärme und nur am Rande fallen lasse, dass ihre einzige Schwäche ist, nicht immer pünktlich zu sein, ist es dann wahr oder unwahr, wenn mein Gesprächspartner ihr später berichtet: »Deine Chefin hat gesagt, dass du unpünktlich bist.« Die Information als solche stimmt, aber sie gibt Ton und Anliegen falsch wieder, verkehrt eine an sich lobende Äußerung in eine Kritik.
Bei Überspitzungen verhält es sich ähnlich. Stellen wir uns vor, dass eine Zeitung titelt: »Irrer Gesetzgeber! Beleidigungen im Internet sollen mit zwei Jahren Haft bestraft werden!« Tatsächlich wurde der Strafrahmen für öffentliche Beleidigungen auf zwei Jahre angehoben. Das ist aber lediglich die Höchststrafe – die in der Praxis so gut wie nie verhängt wird. Auf Beleidigungen gibt es, wenn die Verfahren nicht eingestellt werden, fast ausnahmslos Geldstrafen. Der Pressebericht ist nicht ganz falsch, schließlich hat der Gesetzgeber ein Strafmaß von zwei Jahren eingeführt. Er gibt die Rechtslage allerdings nicht vollständig wieder und macht aus einer Möglichkeit einen Befund.
Ein weiteres Beispiel: Jemand schießt ein Foto von einem Soldaten, der sich mit einer Waffe am Gürtel über einen Gefangenen beugt. Das Bild erweckt den Eindruck, der Soldat würde den anderen misshandeln. Dass der Soldat dem Mann tatsächlich einen Becher Wasser reicht, ist auf dem Foto nicht zu erkennen. Wahrheit oder Lüge? Für die Wahrheit sind selektive Berichte und einseitige Informationen eine besondere Herausforderung. Zeichnet man ein wahres Bild gesellschaftlicher Probleme, wenn Aspekte verschwiegen, Daten zurückgehalten oder Hintergründe vage gehalten werden? Auf diese Weise können unterschiedliche Wahrheiten entstehen, auch wenn der Informationskern derselbe bleibt. Für das Vertrauen in die Berichterstattung der Medien ist gerade diese Form der unvollständigen oder einseitigen Darstellung von Wahrheit gefährlich (hierzu Kapitel 2 – Medien und Wahrheit).
Eine besondere Rolle bei der Kommunikation von Informationen spielt die Sprache. Durch Metaphern und Bilder wird ein Deutungsrahmen gesetzt, der einen Inhalt positiv oder negativ konnotieren kann. Die Linguistin Elisabeth Wehling erklärt die Bedeutung von Frames mit der Wirkung von Sprache im menschlichen Gehirn: »In unserem Kopf ist unser gesamtes Wissen über die Welt abgespeichert. Wenn ich zum Beispiel sage ›Hammer‹, wird nicht nur das Bild eines Hammers aufgerufen, sondern das Gehirn simuliert auch die zugehörige Armbewegung. Immer wenn mein Denkapparat ein Wort verarbeiten muss, ruft er diese Muster auf, sonst kann er Wörtern keine Bedeutung zuschreiben.«11 Spricht ein Politiker etwa von einer »Flüchtlingswelle«, rufen wir unbewusst das Bild der Welle ab, wir assoziieren Migration dann mit Bedrohung und Kontrollverlust. Die Forderung nach einer Anhebung von Steuern kann unterschiedlich wahrgenommen werden, je nachdem, ob von einer »Steuerlast« oder einer »Steuerverantwortung« die Rede ist. Und eine »Impfnachweispflicht« lässt sich besser verkaufen als ein »Impfzwang«. Wir können uns diesen Frames nicht entziehen, sie werden immer aktiviert, wenn wir ein Wort hören oder lesen. »Außer, man hält sich die Ohren zu«, sagt Elisabeth Wehling. Ihr Rat: Wir müssen unsere Naivität gegenüber der Bedeutung der Sprache überwinden; also Formulierungen hinterfragen, gerade wenn sie bewusst eingesetzt werden, um Inhalte mit Emotionen zu verknüpfen.
An der Grenze zwischen Lüge und Wahrheit liegen auch Fälle, in denen eine Aussage für sich genommen richtig ist, aber dadurch eine andere – unwahre – Bedeutung erhält, dass man sie aus ihrem Kontext löst oder in einen falschen einbettet. Nele Pollatschek hat in einem Essay in der Süddeutschen Zeitung ein spannendes Beispiel gebildet.12 Ein Mann namens Moische Goldenstein – der Fall ist fiktiv – spricht öffentlich über den Tod seines Großvaters in Auschwitz und das Leid der Hinterbliebenen. Tatsächlich ist Moische Goldenstein kein Jude, seinen Namen hat er beim Standesamt ändern lassen, und sein Großvater ist als SS-Mann bei einem Arbeitsunfall in Auschwitz ums Leben gekommen. Der Satz »Mein Großvater ist in Auschwitz gestorben« ist erst einmal zutreffend. Aber Kontext und Absender lösen, und so ist es gewollt, andere Assoziationen aus.
Ob eine Äußerung wahr oder unwahr ist, lässt sich nicht unabhängig von ihren Umständen beurteilen. Kein Bild, kein Satz und keine Aussage steht in einem Vakuum, er ordnet sich in ein Kommunikationsverhältnis ein, knüpft an die Prämissen eines Diskurses an, bezieht die Personen von Adressat und Absender ein. Eine Aussage steht nie »für sich«, sondern immer auch im Kontext; eine vordergründig richtige Aussage kann daher eine Unwahrheit sein.
So sieht es auch das Recht. Der Bundesgerichtshof hatte folgenden Fall zu entscheiden: Der Angeklagte hatte Schreiben an Unternehmen versandt, in denen er ein Angebot zur Eintragung in eine angeblich von ihm geführte Datenbank unterbreitete. Die Schreiben waren allerdings so gestaltet, dass sie wie Rechnungen aussahen. Es gab keine individuelle Anrede oder Grußformel, es wurde ein zu zahlender Betrag, aufgeschlüsselt nach Netto- und Bruttosumme, ausgewiesen und ein ausgefüllter Überweisungsträger beigefügt. Dass es sich um ein bloßes Leistungsangebot handelte, ergab sich erst aus den »Bedingungen« auf der Rückseite, in kleiner Schrift mit hellgrauer Farbe. 351 Unternehmen fielen auf die Scheinrechnungen herein und überwiesen insgesamt 433 198,43 DM.
Die Verteidigung machte geltend, dass der Angeklagte niemanden getäuscht habe. Das Schreiben enthalte die Wahrheit. An keiner Stelle stand »Zahlungsaufforderung« und auf der Rückseite war auch ausdrücklich der Hinweis auf das Angebot abgedruckt. Das Gericht folgte dem allerdings zu Recht nicht. Für die Beurteilung als wahr oder unwahr kommt es nicht nur auf den Wortlaut an, sondern auf den Gesamtkontext. Die gesamte Gestaltung des Schreibens zielte darauf ab, den unwahren Eindruck einer offenen Rechnung zu erwecken. Dass kleingedruckt auf der Rückseite ein wahrer Satz stand, konnte daran nichts ändern.
Wahrheit ist also nicht ohne den Kontext zu bestimmen. Eine Äußerung, die im Zusammenhang mit ihren Begleitumständen ein Bild zeichnet, das die realen Verhältnisse nicht wiedergibt, ist unwahr. Aber wie ist es, wenn etwas nicht gesagt wird? Kann man lügen, ohne zu sprechen? Das Recht geht davon aus. In vielen Fällen ist das unproblematisch, nämlich dann, wenn wir durch unsere Handlung etwas miterklären, ohne es ausdrücklich zu formulieren. Wer im Restaurant ein Essen bestellt, der muss nicht sagen, dass er bezahlen wird – das erklärt er konkludent mit. Wenn er kein Geld dabeihat, dann liegt in seiner Bestellung die unwahre Behauptung, später die Rechnung zu begleichen.
Kann eine Meinung unwahr sein?
Auch für die Meinungsfreiheit ist die Frage nach der Wahrheit von großer Bedeutung. Artikel 5 unseres Grundgesetzes schützt die freie Meinungsäußerung. Darunter fallen Werturteile, aber auch Tatsachen, da sie ein öffentliches Informationsinteresse befriedigen können. Nicht vom verfassungsrechtlichen Schutz der Meinungsfreiheit erfasst sind hingegen bewusst und zum Zeitpunkt der Äußerung erwiesen unwahre Tatsachenbehauptungen. So hat das Bundesverfassungsgericht für das Leugnen des Holocausts festgestellt: »Bei der untersagten Äußerung, daß es im Dritten Reich keine Judenverfolgung gegeben habe, handelt es sich um eine Tatsachenbehauptung, die nach ungezählten Augenzeugenberichten und Dokumenten, den Feststellungen der Gerichte in zahlreichen Strafverfahren und den Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft erwiesen unwahr ist. Für sich genommen genießt eine Behauptung dieses Inhalts daher nicht den Schutz der Meinungsfreiheit.«13
Es kommt also für die Bewertung einer Aussage entscheidend darauf an, ob es sich um eine unwahre Tatsachenbehauptung oder um ein Werturteil handelt. Werturteile mögen moralisch gut oder schlecht, vernünftig begründet oder irrational sein; objektiv wahr oder unwahr sind sie aber nicht. Und damit nur in wenigen Fällen strafbar. Die Abgrenzung zwischen Werturteil und Tatsache ist nur auf den ersten Blick einfach. Werturteile sind gekennzeichnet durch eine Stellungnahme, sie sind subjektiv und geben die Meinung einer Person wieder, während sich Tatsachenaussagen auf objektive Vorgänge beziehen. Der Grat zwischen Meinung und Tatsache kann aber schmal sein. Ein Beispiel: Nach einem verlorenen Prozess ärgert sich der Kläger über den Richter. Er regt sich über das Urteil auf und schreibt: »Das ist doch Rechtsbeugung! So eine Unverschämtheit habe ich noch nie erlebt.« Handelt es sich nun um eine Tatsachenbehauptung? Schließlich ist Rechtsbeugung ein Straftatbestand, und es ließe sich objektiv prüfen, ob die Voraussetzungen der Strafvorschrift erfüllt sind. Die Gerichte gehen hier jedoch trotzdem von einem Werturteil aus. Denn es ist anzunehmen, dass der unterlegene Kläger hier nicht wirklich einen strafbaren Rechtsbruch behaupten, sondern seine Empörung über das Urteil zum Ausdruck bringen wollte. Meinung, keine Tatsache, damit auch weder wahr noch unwahr und nicht strafbar.
Ein anderes Beispiel: Nach dem Überfall der Hamas auf Israel sollte ein Tatbestand eingeführt werden, der das Leugnen des Existenzrechts Israels unter Strafe stellen würde.14 Hier war aber schon der Begriff falsch: Leugnen kann man Tatsachen, nicht Meinungen. Bei Äußerungen, die sich gegen die Existenz des Staates Israel richten, stehen aber nicht Tatsachenbehauptungen, sondern Meinungsäußerungen im Vordergrund. Während die Frage, ob ein Staat gegenwärtig völkerrechtlich anerkannt wird, eine beweisbare Tatsache ist, gilt dies nicht für die Frage, ob ein Staat völkerrechtlich anerkannt werden sollte. Hierbei handelt es sich um eine politische Meinung. Auch wenn Israel selbstverständlich ein völkerrechtlich anerkannter Staat ist, ist die Frage, ob er es auch sein oder bleiben sollte, ob er also einen Anspruch auf Existenz hat, einer Wertung zugänglich. Damit würde der Vorschlag keine falsche Tatsachenbehauptung, sondern eine Meinung bestrafen. Und das erlaubt unser Recht in dieser Form nicht: Gesetze, die sich gegen eine bestimmte Meinung richten, sind grundsätzlich nicht zulässig (mehr dazu in Kapitel 5).
Kapitel 2
Medien und Wahrheit
Können wir der Presse noch vertrauen?
Wir sind heute so gut und gleichzeitig so schlecht informiert wie noch nie. Das Internet ermöglicht uns Zugang zu unzähligen Studien, Fachaufsätzen und journalistischen Beiträgen aus aller Welt. Doch darin liegt zugleich die Krux: Studien zeigen, dass sich eine Informationsüberflutung negativ auswirken kann.15 Zu viele Informationen überfordern uns, machen uns passiv und lassen uns schlechtere Entscheidungen treffen. Der US-amerikanische Autor John Naisbitt bringt es auf den Punkt: »Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen.«16
Woher wissen wir, welchen Informationen wir vertrauen können und welchen nicht? In den großen, traditionellen Medien gibt es zwar Kontrollen durch Redaktionssitzungen und Rechercheteams – aber wir werden sehen, dass auch das nicht immer funktioniert. Die Kritik an den deutschen Leitmedien ist in den letzten Jahren lauter geworden. Rechtspopulisten schimpfen auf die »Lügenpresse« – zu Recht das Unwort des Jahres 2014 –, einige Medienwissenschaftler bemängeln zumindest eine zu einseitige Sicht auf »die Wahrheit«. In den sozialen Netzwerken ist die Situation ungleich dramatischer. Fehlinformationen verbreiten sich hier weitgehend unkontrolliert, werden auf verschiedenen Plattformen geteilt und so zu »alternativen Fakten« – übrigens das Unwort des Jahres 2017.
Lügen in den Medien sind besonders problematisch, da sie die Grundlagen für unsere Meinungsbildung verändern. Wir können nicht selbst in ein Kriegsgebiet fahren, haben in der Regel keine eigene Expertise in Virologie oder Klimaforschung. Wir müssen in vielen, überaus wichtigen Bereichen des Lebens auf das vertrauen, was uns im Fernsehen, in Zeitungen und im Internet gesagt wird. Im Januar 2024 besuchte ich eine Diskussionsveranstaltung mit Juli Zeh und Olaf Scholz. Das Gespräch war klug, ernst und lustig zugleich, die Auseinandersetzung respektvoll und interessant, beide machten eine gute Figur. Am nächsten Tag las ich einen Artikel über die Veranstaltung in der Zeitung – und fragte mich, ob der Journalist eine andere Debatte gesehen hatte. Oder sehen wollte. Die Kritik sei scharf gewesen, die Stimmung gereizt, Scholz habe – natürlich – kaum Applaus geerntet. Meine Wahrnehmung des Abends war eine völlig andere. Nach der Veranstaltung war noch fast zwei Stunden lang mit viel Freude miteinander diskutiert worden. Der Artikel enthielt keine direkte Lüge, aber er war auch nicht wahr. Die Darstellung in den Medien prägt die öffentliche Stimmung und beeinflusst damit Gesellschaft und Politik. Aber so schädlich Fake News und einseitige Berichterstattung für die Gesellschaft sein können – strafrechtlich verboten sind sie in aller Regel nicht.
Reportagen zwischen Dichtung und Wahrheit: Der »Fall Relotius«
Der Fall des Spiegel-Reporters Claas Relotius hat 2018 hohe Wellen geschlagen. Nachdem ihm ein Kollege auf die Spur gekommen war, stellte sich heraus, dass viele der teilweise preisgekrönten Reportagen von Relotius über weite Strecken frei erfunden waren. Wer die Texte heute liest, der muss sich wundern, weshalb der Betrug so lange unentdeckt blieb. In dem Artikel »Königskinder« (erschienen im Spiegel, Ausgabe 28/2016, 9. Juli 2016) etwa schreibt Relotius über ein syrisches Geschwisterpaar im Alter von zwölf und dreizehn Jahren, Waisen, die vor dem Krieg in die Türkei geflohen sind und nun als Schrottsammler und Näherin arbeiten. Der Text beginnt wie folgt:
»An einem frühen Morgen in diesem Sommer geht Alin, ein Mädchen mit müden Augen, 13 Jahre alt, allein durch die noch dunklen Straßen der Stadt Mersin und singt ein Lied. In klappernden Sandalen läuft sie durch die Fabrikviertel, vorbei an verfallenden Gebäuden, an Hunden, die noch schlafen, und an Laternen ohne Licht. Das Lied, das sie singt, handelt von zwei Kindern, denen kein Leben offenstand und die doch, als sie schlimmstes Leid ertragen hatten, gerettet werden sollten.«
Alles passt zu gut zusammen, das Mädchen mit den »müden Augen«, die Trostlosigkeit und Einsamkeit der Stadt und das Lied, das so glänzend auf das Schicksal der Protagonistin und ihres Bruders anspielt. Vermutlich ist nichts davon wahr; als endlich Nachforschungen betrieben werden, lässt sich nicht einmal die Existenz des Mädchens belegen. Der angebliche Waisenjunge, der in einem »Verschlag aus Wellblech und Brettern« mit »neun Jungen aus Homs und aus Aleppo« hausen soll, lebt tatsächlich mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in einer Wohnung. Viele von Relotius’ Geschichten wirken konstruiert und unwahrscheinlich, es gibt kaum Ambivalenz, alles fügt sich nahtlos ineinander. Aber: Hinterher ist man immer schlauer. Bei Erscheinen der Reportagen gab es keine Zweifel, Relotius wurde mit Preisen überhäuft, er galt als einer der herausragendsten Nachwuchsjournalisten.
Was kann man im »Fall Relotius« über das Lügen lernen? Mögliche Motive für Lügen in den Medien gibt es einige. Ein Journalist könnte eine politische Agenda verfolgen und Geschichten so drehen, dass sie in sein Weltbild passen. Oder es geht um wirtschaftliche Interessen: Fake News mit hohem Empörungswert können Klickzahlen schaffen, das werden wir später noch sehen. Bei Relotius ging es aber wohl um etwas anderes. Seine Reportagen machten ihn zu einem Star in der Journalistenwelt, Relotius wurde bewundert, sein Talent hoch gelobt. Zum Text »Königskinder« schrieb ihm ein Kollege aus dem Ressort: »Weiß gar nicht, wann mich ein Text zuletzt so mitgenommen hat. Unerträglich starker Text.«17 Die Begeisterung für seine Arbeit wird ein großer Antrieb gewesen sein, der Beifall und die Preise schienen ihm Recht zu geben. Erfolg kann süchtig machen und Lob unter Druck setzen, weiter besondere Texte zu liefern.
Bei einer Reportage über amerikanische Kleinstädte, in denen die Menschen mutmaßlich Donald Trump gewählt haben, kommt Relotius nicht weiter. Die Realität ist zu vielschichtig für eine stringente Geschichte, die Personen zu ambivalent, um ein eindeutiges (oder einseitiges) Bild zu vermitteln. Also denkt sich Relotius einen vielsagenden Einstieg aus. In Fergus Falls in Minnesota, in dem Relotius seine Geschichte spielen lässt, kündigt schon der Ortseingang die Engstirnigkeit und den Rassismus an, der offenbar von einer US-amerikanischen Kleinstadt erwartet wird. Neben dem Willkommensschild soll es ein zweites Schild geben, »aus dickem Holz in den gefrorenen Boden getrieben«, dort »steht in großen aufgemalten Buchstaben: ›Mexicans Keep Out‹ – Mexikaner, bleibt weg.« Ein solches Schild hat es jedoch in Fergus Falls nie gegeben. Relotius denkt sich Personen aus, als würde er einen Roman schreiben, Menschen, die nicht existieren, und Ereignisse, die nie stattgefunden haben. Die Kinder der örtlichen Highschool lässt er ihre Vorbilder für den amerikanischen Traum malen: »Die meisten malten Donald Trump.« Dass man ihm seine Prosa ohne jeden Zweifel abnimmt, wundert Relotius selbst. In seiner späteren Befragung durch die Spiegel-Kommission gibt er an, dass er sich beim Schreiben oft selbst sagte: »Come on! Im Ernst jetzt? Damit kommst du niemals durch!«18
Doch er kommt damit durch, für eine sehr lange Zeit. Er verwendet einige Energie auf die Tarnung seiner Lügen. Gegenüber Kollegen kommuniziert er angebliche Rückschläge, schreibt, dass er bei einer Geschichte nicht weiterkommt, die Protagonisten nicht erreichen kann. Als er durch die Recherchen seines Kollegen Juan Moreno zunehmend in Bedrängnis gerät, fälscht er E-Mails, die seine inszenierten Geschichten bestätigen. Seine einstigen Chefs, wie der ehemalige Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo, fragen sich später: »Waren wir blind, waren wir, ich, zu begeistert von allzu perfekten Texten?«19 Der Reiz scheint groß zu sein. Im Zeitalter von Netflix erwarten die Leser offenbar Stücke mit großer Dramaturgie. Relotius’ Texte funktionieren, sie haben eine Message, schildern interessante Charaktere und ergreifende Schicksale. Dass sie glatt sind, durchkomponiert bis zum Schluss, dass sich jede Person und jedes Ereignis perfekt in das Bild fügt, das der Text zeichnen möchte, stört nicht. Im Gegenteil: Ein E-Mail-Verkehr zwischen Relotius, Moreno und dem damaligen Ressortleiter Matthias Geyer spricht Bände. Dort heißt es:
»Wir suchen nach einer Frau mit Kind. Sie kommt idealerweise aus einem absolut verschissenen Land (…) Sie setzt ihre Hoffnung auf ein neues, freies gutes Leben in USA (…) Es muss eine sein, die mithilfe eines Kojoten über die Grenze will (…) Die Figur für den zweiten Konflikt beschreibt Claas (…) Dieser Typ wird selbstverständlich Trump gewählt haben, ist schon heiß gelaufen, als Trump den Mauerbau an der Grenze angekündigt hat, und freut sich jetzt auf die Leute dieses Trecks, wie Obelix sich auf die Ankunft einer neuen Legion von Römern freut (…) Wenn ihr die richtigen Leute findet, wird das die Geschichte des Jahres.«20
Mich erinnert das an Dynamiken, die wir im Strafrecht aus der Unternehmenskriminalität kennen. Ich habe mich viel mit Bestechungen ausländischer Amtsträger durch Mitarbeiter deutscher Firmen beschäftigt. Dort lief es häufig so, dass die Unternehmensführung den Mitarbeitern klare Vorgaben machte: Ihr müsst in diesem Land einen bestimmten Umsatz machen, nur dann gibt es den Bonus. Natürlich war der Leitung bekannt, dass das betroffene Land hoch korruptionsanfällig war. Und natürlich hätte man die Mitarbeiter nie ausdrücklich aufgefordert, Geschäfte mit Bestechungszahlungen zu machen. Aber durch die feste Zielvorgabe stand fest, was – im Zweifel um jeden Preis – zu erreichen war. Wie der Mitarbeiter das anstellte, interessierte das Unternehmen nicht. Relotius musste einen skrupellosen Trump-Anhänger finden, voller Vorfreude auf Auseinandersetzungen mit Migranten. Ihn zu erfinden war nicht schwer.
Vor allem aber geht es offenbar gar nicht darum, die Probleme an der amerikanischen Grenze und die Beweggründe der Betroffenen wirklich zu verstehen. Stattdessen steht die Geschichte bereits fest, und nun sollen Menschen gefunden werden, die in das beschlossene Narrativ passen. Das offenbart nicht nur ein höchst zweifelhaftes Verständnis von Journalismus, sondern dürfte auch ein ganz entscheidender Grund für die Lügen in Relotius’ Reportagen sein. Wenn man nichts mehr erfahren möchte, wenn man bereits weiß, was man schreiben wird – weshalb nicht die Person einfach erfinden? Wem schaden ein paar Korrekturen, eine erfundene, aber doch so ins Zeitgeschehen passende Figur? Relotius wird gefeiert, der Verlag profitiert, die Leser sind glücklich über spannende Geschichten, die gut ins eigene Weltbild passen. Die Versündigung an »der Wahrheit« ist demgegenüber ziemlich abstrakt und ziemlich weit weg.
Der Abschlussbericht der internen Aufklärungskommission des Spiegels kommt zu dem Ergebnis, dass die massiven Fälschungen bei Relotius eine Ausnahme waren, es aber eine Reihe von »Verfälschungen« gegeben habe. Die Ausführungen im Bericht sind interessant:
»Es geht meist darum, dass Tatsachen nicht korrekt oder nicht vollständig dargestellt wurden; entweder aus dramaturgischen Gründen, weil sich eine Geschichte geschmeidiger erzählen lässt, wenn man beim Beschreiben nicht ausschließlich an Fakten gebunden ist, oder aus weltanschaulichen Gründen, weil sich eine Geschichte stringenter erzählen lässt, wenn man widersprüchliche Fakten weglässt. Die Kommission hat bei ihren vielen Gesprächen mit Redakteuren, Dokumentaren und Justiziaren den Eindruck gewonnen, dass es sich hier nicht nur um gelegentliche Ausreißer handelt, sondern zum Teil um unterschiedliche Auffassungen davon, was in einem journalistischen Text noch zulässig ist und was nicht.«21
Wenn der Reiz so groß ist, weil die Lüge eine Geschichte vordergründig besser und die Arbeit leichter macht, muss es mehr Kontrollen geben. Durch Menschen, die von der Lüge nicht direkt oder indirekt profitieren, etwa durch eine eigenständige Abteilung im Verlag, die unabhängig von der Redaktion arbeitet.
Was ist Reportage, was ist Lüge, was ist strafbar?
Ein Journalist berichtet der Spiegel-Kommission davon, dass in Journalistenschulen Fragen wie »Darf es eine Kunstfigur in Reportagen geben?«, »Darf der Reporter dem Leser suggerieren, er habe selbst Beobachtungen gemacht, obwohl er nicht vor Ort war?« oder auch »Dürfen störende Fakten weggelassen oder fehlende ergänzt werden, um die Geschichte rund zu machen?« keinesfalls klar verneint, sondern mit »Ja, in einem gewissen Umfang« beantwortet wurden. Wenn Journalisten aber lernen, so der Spiegel-Bericht, »ihre Protagonisten zu formen, Widersprüchliches und Sperriges wegzulassen, schwarz-weiß zu erzählen, Grautöne zu meiden, die Wirklichkeit der Dramaturgie unterzuordnen, Geschichten rund zu machen«, dann entfernen wir uns weit von der Wahrheit. Die Vereinigung verschiedener Menschen in einem Protagonisten oder das Weglassen retardierender Momente in einer Erzählung wird häufig als zulässige »Verdichtung« einer Reportage angesehen. Doch die Grenze zur Lüge ist hier schmal, Verdichtungen sind oft Vereinfachungen, sie reduzieren ein vielschichtiges Geschehen auf eine scheinbar klare Aussage und schaffen damit falsche Bilder der Realität.
Der Fall Relotius hat dem Journalismus einigen Schaden zugefügt, er hat all diejenigen bestätigt, die den Medien nicht vertrauen, die von »Lügenpresse« sprechen und sich ihre Informationen nur noch über Social-Media-Plattformen holen. Juan Moreno, der den Skandal schließlich aufdeckte, schreibt in seinem Buch: »Die Leichtigkeit, mit der ich früher Lügenpresse-Krakeeler belächelt habe, ist dahin.«22
Doch obwohl Relotius seine Leser und seinen Arbeitgeber betrogen und der Glaubwürdigkeit der Medien erheblich geschadet hat, ist sein Handeln nicht strafbar. Das Verbreiten von Lügen, selbst in Zeitschriften mit großer Reichweite, erfüllt für sich genommen keinen Straftatbestand. Eine Grenze wird erst dann überschritten, wenn eine Person verleumdet wird, also unwahre Tatsachen über sie verbreitet werden, die sie in der öffentlichen Meinung herabwürdigen können. Aber bei Relotius geht es selten um solche abwertenden Informationen, außerdem sind seine Protagonisten entweder frei erfunden oder weit weg. Für eine Strafverfolgung wegen Verleumdung müssten sie aber einen Strafantrag in Deutschland stellen, sonst kann die Tat nicht verfolgt werden; das nennen wir »absolutes Antragsdelikt«.
Ein strafrechtlicher Vorwurf stand allerdings im Raum: Spendenbetrug. Viele Leserinnen und Leser des Spiegels