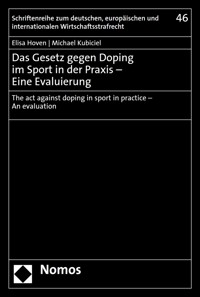9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Strafrecht polarisiert, fasziniert und empört wie kaum ein anderes Thema. Immer wieder gibt es Straftaten, die uns verunsichern, da sie unsere grundlegenden Regeln und Werte infrage stellen. Diese Verunsicherung wächst, wenn es zum Prozess kommt: Oft sind die Urteile der Gerichte für viele nicht nachvollziehbar. Eine Zahl, die dies eindrucksvoll belegt: Einer Umfrage zufolge halten fast 60 Prozent der Bevölkerung die Verurteilungen durch deutsche Strafgerichte für »zu milde«. Das Vertrauen in Justiz und Rechtsstaat schwindet. Elisa Hoven und Thomas Weigend greifen in ihrem Buch spektakuläre und prominente Fälle auf, die verwundert, besorgt oder empört haben. Sie erklären, ob ein Kannibale ein Mörder ist, ob man einen Einbrecher erschießen darf und ob es richtig ist, dass ein 13-jähriger Vergewaltiger nicht verurteilt wird. Die Autor*innen zeigen, wie es zu den Urteilen kam und weshalb das Recht so ist, wie es ist. Das Buch macht deutlich, wo die Stärken unseres Rechtssystems liegen, aber auch, wo Recht und Gerechtigkeit in Konflikt treten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Im Namen des Volkes?
Das Strafrecht polarisiert, fasziniert und empört wie kaum ein anderes Thema. Immer wieder gibt es Straftaten, die uns verunsichern, da sie unsere grundlegenden Regeln und Werte infrage stellen. Diese Verunsicherung wächst, wenn es zum Prozess kommt: Die Urteile der Gerichte sind für viele Bürger und Bürgerinnen häufig nicht nachvollziehbar. Eine Zahl, die dies eindrucksvoll belegt: Einer aktuellen Umfrage zufolge halten fast sechzig Prozent der Bevölkerung die Verurteilungen durch deutsche Strafgerichte für »zu milde«.
Elisa Hoven und Thomas Weigend greifen in ihrem Buch spektakuläre und prominente Fälle auf, die verwundert, besorgt oder empört haben. Anhand des »Ku’ Damm-Raser-Falls« diskutieren sie, ob Raser Mörder sind. Der Fall der Gruppenvergewaltigung von Mülheim wiederum stellt die Gerichte sowie Leser und Leserinnen vor die Frage, ob und wie ein zwölfjähriger Vergewaltiger bestraft werden sollte. Und im Kapitel über den »Fall Kristina Hänel« beleuchten die Autoren kritisch das Gesetz, das Informationen über Schwangerschaftsabbrüche verbot.
Stets analysieren sie, warum die Gerichte so und nicht anders geurteilt haben, und fragen, ob das juristisch wie ethisch vertretbar ist. Dabei zeigen sie die Grenzen und Bedingungen unseres Rechtssystems auf.
© Maya Claussen (E. H.) / Heike Zons (T. W.)
Elisa Hoven ist Professorin für Strafrecht und Direktorin des Instituts für Medienrecht an der Universität Leipzig sowie Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Sie schreibt regelmäßig u.a. für die ZEIT und die Welt und wird als Expertin in TV-Sendungen eingeladen.
Thomas Weigend war bis 2016 Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität zu Köln. Er hat zahlreiche Bücher und wissenschaftliche Beiträge zum Strafrecht und zum Strafprozessrecht veröffentlicht und an verschiedenen renommierten ausländischen Universitäten gelehrt.
Elisa Hoven Thomas Weigend
STRAFSACHEN
Ist unser Recht wirklich gerecht?
E-Book Auflage 2023
© 2023 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Stephane Leroy / EyeEm / GettyImages
Satz: Fagott, Fffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-8292-2
www.dumont-buchverlag.de
In einigen der 18 authentischen Fälle, die wir in den folgenden Kapiteln vorstellen und diskutieren, sind die Namen der beteiligten Personen allgemein bekannt. In den meisten Fällen geht es jedoch um Täter und Opfer, die auch in den veröffentlichten Urteilen der Gerichte nicht mit ihrem vollen Namen genannt werden. Wir bezeichnen diese Personen mit Vornamen und Anfangsbuchstaben der Nachnamen, die wir teilweise den Akten entnommen, teilweise erfunden haben. Die Namen wurden dabei so gewählt, dass sie den ethnischen Hintergrund der Beteiligten reflektieren, soweit dieser bekannt war.
Einleitung
Was ist gerecht?
True-Crime-Formate haben Hochkonjunktur. Ob auf Netflix, in Romanen oder Podcasts – wir sind von Straftaten schockiert, empört, aber auch fasziniert. Wir fragen uns, was einen Menschen dazu bringt, einen anderen zu verletzen, zu töten oder gar zu verspeisen (Kapitel 5). Verbrechen lösen Emotionen aus. Wir genießen den Nervenkitzel eines Krimis, Angst lässt unser Gehirn Adrenalin und Endorphine ausschütten. Aber wir fühlen auch mit den Opfern. Ihr Schicksal berührt uns, wir möchten wissen, wie sie die Taten verarbeitet haben und wie ihre Angehörigen mit dem Schmerz umgehen.
Lesen wir von einem Verbrechen, interessiert uns aber vor allem eines: Hat der Täter seine gerechte Strafe bekommen? Wenige Medienberichte lösen mehr Empörung aus als Schlagzeilen wie »Gericht verhängt mildes Urteil für Kinderschänder« oder »Serieneinbrecher kommt wieder auf freien Fuß«. Das Bedürfnis nach Bestrafung ist im Menschen tief verwurzelt. Das belegen verschiedene Studien der Verhaltensökonomie. In einem Experiment ließ der Wirtschaftswissenschaftler Ernst Fehr eine Gruppe Studierender mit kleinem Kapital Einsätze machen. Die Spieler konnten entscheiden, ob sie ihr Geld investieren wollten oder nicht. Für jeden Einsatz gab es vom Spielleiter mehr Geld zurück, das aber an alle Spieler in der Gruppe gleich verteilt wurde. Für den einzelnen Spieler war es also am profitabelsten, selbst nicht zu investieren und den Profit aus den Einsätzen der Mitspielenden einzustreichen. Für die Gruppe war ein solch egoistisches Verhalten natürlich schlecht – wer im Sinne des Teams investierte, verlor am Ende, wenn die anderen nicht mitmachten. Weil es immer jemanden gab, der nur an den eigenen Gewinn dachte, ließ die Kooperationsbereitschaft von Runde zu Runde nach. Nun aber änderte Fehr die Regeln. Den Spielern wurde mitgeteilt, wer investiert hatte und wer nicht. Plötzlich stieg die Bereitschaft zur Kooperation erheblich, egoistisch ist man lieber heimlich. Entscheidend war aber eine andere Regel: Die Spieler konnten jetzt einen Mitspieler bestrafen, der sein Geld behalten und der Gruppe geschadet hatte. Wenn sie eine Geldeinheit investierten, wurden dem unkooperativen Mitspieler drei Einheiten abgezogen. Die Spieler machten von dieser Möglichkeit regen Gebrauch. Und das, obwohl ihr Bestrafungsverhalten ihnen nicht nutzen konnte – denn jeder spielte nur ein einziges Mal mit demselben Mitspieler zusammen. Es ging also nicht um Abschreckung oder um Besserung, sondern allein um Vergeltung.
Doch warum ist es uns so wichtig, dass andere für ihr Fehlverhalten sanktioniert werden? Der Wunsch nach Gerechtigkeit ist im Menschen fest verankert. Schon Kleinkinder haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Studien zeigen, dass sich bereits Dreijährige für andere Kinder einsetzen, denen Spielzeug oder Süßigkeiten weggenommen werden. Aber nicht nur Menschen haben ein starkes Gefühl für gerechtes oder ungerechtes Verhalten. Berühmt geworden ist ein Experiment mit zwei Kapuzineräffchen, die beide eine Belohnung erhalten. Das erste Äffchen bekommt eine Gurke und isst sie mit Freude. Doch als dem zweiten Äffchen eine noch begehrtere Weintraube gegeben wird, verweigert das erste Äffchen die nächste Gurke und wirft sie wütend aus dem Käfig. Auch Affen haben also das Bedürfnis nach fairer Behandlung. Sozialpsychologen gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit in Gruppen, die auf Kooperation angewiesen sind, ohne Gerechtigkeit nicht funktionieren würde. Beute muss also fair geteilt werden. Wer sich zu viel nimmt, benachteiligt die anderen; sein Verhalten muss sanktioniert werden.
Aber: Warum verlangt unser Gerechtigkeitsempfinden nach einer angemessenen Strafe? Würde es nicht genügen, dem Dieb das erbeutete Portemonnaie wieder abzunehmen und dem Opfer zurückzugeben? Wäre das nicht gerechter, als den Dieb darüber hinaus noch mit einer Geldstrafe zu belegen? Schließlich wird mit der Strafe nicht nur der Status quo wiederhergestellt, sondern dem Täter ein weiteres Übel auferlegt. Mit diesem Argument wird das Strafrecht immer wieder infrage gestellt: Es profitiere doch niemand davon, wenn ein Mensch ins Gefängnis gehen muss. Tatsächlich haben diese Bedenken bereits Eingang in das Strafverfahren gefunden. Wir bemühen uns zunehmend um Alternativen zur klassischen Strafe. Gerichte können zum Beispiel auf eine Strafe verzichten, wenn es zu einem »Täter-Opfer-Ausgleich« gekommen ist und der Täter Wiedergutmachung geleistet hat. Das ist aber die Ausnahme.
Im Grundsatz bleibt es dabei, dass unser Gerechtigkeitssinn verlangt, den Täter nicht straflos davonkommen zu lassen. Wer die Rechtsgüter eines anderen verletzt – etwa dessen Leben, Körper oder sexuelle Selbstbestimmung –, der überdehnt die eigene Freiheit zu Lasten seines Opfers. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht, das nur durch eine Einschränkung der Freiheit des Täters aufgehoben werden kann. Durch den Diebstahl des Portemonnaies verletzt der Täter unsere Rechtsordnung, die den Diebstahl verbietet. Er stellt sich gegen die Regeln, die wir uns für unser Zusammenleben gegeben haben. Diese Verletzung würde allein durch die Rückgabe des Portemonnaies nicht ausgeglichen.
Das Recht macht durch die Strafe deutlich, dass es den Verstoß gegen unsere gemeinsame Ordnung nicht akzeptiert. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat das die »Negation der Negation« genannt – der Täter verneint das Recht, und das Recht muss diese Verneinung wiederum verneinen, um seine Geltung zu bewahren. Das klingt ziemlich abstrakt, hat aber auch einen ganz greifbaren Kern. Schwere Straftaten erschüttern unser Vertrauen in andere Menschen, in unsere Sicherheit und in unser Recht. Die Bestrafung des Täters, das zeigen Studien, stellt unseren Glauben an eine gerechte Welt wieder her. Wie wichtig eine gerechte Bestrafung von Verbrechen ist, macht auch das Bundesverfassungsgericht immer wieder deutlich. Der Rechtsstaat, so die Karlsruher Richter, könne »sich nur verwirklichen, wenn ausreichende Vorkehrungen dafür getroffen sind, dass Straftäter im Rahmen der geltenden Gesetze verfolgt, abgeurteilt und einer gerechten Bestrafung zugeführt werden«.
Aber der Täter verletzt durch sein Verhalten nicht nur eine Regel der Allgemeinheit (zum Beispiel »Du sollst nicht töten«), sondern auch individuelle Rechtsgüter der Betroffenen (das Leben des Opfers). Wir verbieten jede Form der Selbstjustiz. Wir sagen zum Beispiel den Eltern eines ermordeten Kindes, dass sie dem Täter kein Haar krümmen dürfen. Das ist viel verlangt. Aber wir können das verlangen, weil der Staat garantiert, dass er – in geordneten und rechtsstaatlichen Bahnen – den Täter zur Verantwortung zieht. Die Straftat ist in erster Linie ein Konflikt zwischen Menschen. Die wenigsten Verletzungen lassen sich so problemlos ungeschehen machen wie die Wegnahme eines Portemonnaies. Körperverletzungen, sexuelle Übergriffe, Tötungen – hier kann Gerechtigkeit nicht durch eine Rückkehr zum Zustand vor der Tat hergestellt werden. Und auch bei einem Diebstahl ist es mit der Rückgabe der Sache nicht immer getan. Denn die Erfahrung, dass ein anderer das eigene Eigentum verletzt hat, kann Angst machen. Durch die Strafe trägt der Staat einem wichtigen Bedürfnis des Opfers Rechnung – nämlich ihm zu sagen, dass die Gemeinschaft das Handeln des Täters verurteilt und sich auf die Seite des Verletzten stellt. Die Bestrafung dient damit der Bewältigung der in der Straftat liegenden individuellen Unrechtserfahrung. Jan Philipp Reemtsma, der 1996 entführt und erpresst wurde, hat diese Funktion der Strafe ganz richtig beschrieben: Der Staat muss dem Opfer bestätigen, dass ihm nicht ein bloßes Unglück widerfahren ist, sondern Unrecht. Es ist auch ein Gebot der Gerechtigkeit, eine Ungerechtigkeit als solche zu benennen.
Das Recht regelt die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Um akzeptiert zu werden, muss es sich daran orientieren, was eine Gemeinschaft als gerecht empfindet. Wenn die Menschen in einem Land nicht überzeugt sind, dass die Gesetze, denen sie unterworfen sind, einen fairen Ausgleich der verschiedenen Interessen vornehmen, werden sie das Vertrauen in den Staat und seine Ordnung verlieren. In einer Demokratie muss das Recht die Überzeugungen der Mehrheit widerspiegeln.
Es ist also ein ernst zu nehmendes Problem, wenn ein Urteil von der Öffentlichkeit als ungerecht empfunden wird. Man kann das nicht damit abtun, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger eben keine Juristen sind und die Gerichte es schon besser wissen werden. Gegen die Beachtung des Gerechtigkeitsempfindens der Bevölkerung werden immer wieder Studien zitiert, denen zufolge etwa die Hälfte der Deutschen die Todesstrafe als gerechte Strafe ansehen – deren Einführung wäre heute ein großer zivilisatorischer Rückschritt. Aber man sollte auch darauf achten, wie solche Befragungsergebnisse zustande kommen. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat etwa vor einigen Jahren folgende Frage gestellt:
»Am 16.Mai soll in den USA der Bombenattentäter von Oklahoma hingerichtet werden. Bei dem Anschlag auf ein Regierungsgebäude waren 168Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Nach jüngsten Umfragen befürwortet die große Mehrheit der Amerikaner die Todesstrafe. Wie sehen Sie das: Soll in Deutschland die Todesstrafe für besonders schwere Verbrechen wieder eingeführt werden oder nicht?«
Hier wird eines der schwersten denkbaren Verbrechen geschildert, mit fast 200 getöteten Personen. Noch dazu eine Tat, die jeden hätte treffen können und deshalb besonders Angst macht. Außerdem wird in der Befragung erwähnt, dass viele andere Menschen die Todesstrafe befürworten – die Befragten müssen also annehmen, dass diese Einstellung gut vertretbar zu sein scheint. Im Zustand der Empörung über die geschilderte Tat liegt die Antwort dann nicht mehr fern: »Ja, der verdient den Tod.« Dass fast 50Prozent der Deutschen aber tatsächlich in einem Land mit Todesstrafe leben möchten, kann wohl bezweifelt werden. Trotzdem: Solche Befragungen zeigen, dass es gefährlich sein kann, wenn sich das Recht zu sehr an aktuellen Stimmungen orientiert – die vorübergehend sein können und nicht selten von den Medien angeheizt werden. Zumal die lautesten Stimmen nicht notwendig die Meinung der Mehrheit sind. Die ist oft ruhiger und besonnener, als es aufgeregte Kommentare im Internet erwarten lassen. Im Übrigen schützt das Recht sich selbst vor bestimmten Änderungen. Unsere Verfassung zieht den Gesetzen Grenzen. Die Todesstrafe ist zum Beispiel nach Art.102 des Grundgesetzes endgültig abgeschafft.
Es kann also nicht darum gehen, öffentlichen Gerechtigkeitsvorstellungen blind zu folgen. Aber wenn Rechtsempfinden und Recht nicht übereinstimmen, dann haben Juristinnen und Juristen die Aufgabe, das Recht zu erklären. Einen Beitrag hierzu wollen wir mit unserem Buch leisten. Wir schildern echte Straftaten und echte Urteile, die in der Öffentlichkeit für Unverständnis gesorgt haben. Bei denen sich viele fragen: Ist das gerecht?
Für den Eindruck, Strafurteile seien ungerecht, kann es unterschiedliche Gründe geben. Es gibt Fälle, in denen das Gesetz in Ordnung ist, aber von einem Gericht nicht richtig angewandt wurde; davon erzählen wir in Teil I. In den Fällen von Teil II liegt das Problem dagegen im Gesetz selbst, das zu eng oder zu weit formuliert sein kann. Das ist häufig dann der Fall, wenn es um politisch heikle Fragen geht und die politischen Parteien wichtige Punkte einfach ausklammern oder schlechte Kompromisse schließen.
In den in Teil III beschriebenen Fällen ist das Recht an sich gut und richtig. Aber Gesetze sind abstrakt formuliert, sie müssen allgemeingültige Regelungen treffen und können daher nicht jedem Einzelfall gerecht werden. Und das Recht muss oft Grenzen ziehen. Der »Berliner Zwillingsfall« (Kapitel 7) und der Fall des zwölfjährigen Vergewaltigers (Kapitel 8) sind dafür gute Beispiele. Es mag ungerecht erscheinen, dass jemand wegen eines Verbrechens, das er kurz vor seinem 14. Geburtstag begangen hat, nicht bestraft werden kann – aber das Gesetz muss ein konkretes Alter als Grenzlinie bestimmen.
Manchmal entsprechen die geltenden Gesetze nicht mehr unseren Vorstellungen von gerechter Bestrafung, darum geht es in Teil IV. Das ist etwa dann der Fall, wenn sich neue Kriminalitätsphänomene zeigen oder wenn sich unsere Wahrnehmung von richtigem und falschem Verhalten ändert. So ist unsere Gesellschaft in den letzten Jahren in Bezug auf sexuelle und psychische Gewalt deutlich sensibler geworden (Kapitel 11 und 12).
In Teil V stellen wir Urteile vor, die zunächst ungerecht erscheinen, die aber bei genauerer Betrachtung doch richtig sind. Das Gesetz verfolgt dann ein sinnvolles Anliegen, das vielleicht nicht auf den ersten Blick deutlich wird.
Bei den Fällen, die wir in Teil VI beschreiben, geht es um Verhaltensweisen, die in den Augen der meisten Menschen unmoralisch sind, wie der Geschlechtsverkehr zwischen Geschwistern (Kapitel 15). Doch reicht das aus, um Menschen zu bestrafen?
In wenigen Fällen, davon handelt Teil VII, muss das Recht ungerechte Ergebnisse sehenden Auges hinnehmen: Zwar sollte Gerechtigkeit das Ziel einer Rechtsordnung sein, aber das Recht muss auch andere wichtige Grundsätze wahren. So lassen wir Folter auch dann nicht zu, wenn sie Leben retten kann (Kapitel 17). Und wir verzichten auf die gerechte Bestrafung des Täters, wenn seine Taten zu lange zurückliegen oder er schon einmal freigesprochen wurde (Kapitel 18); hier geben wir der Rechtssicherheit den Vorrang vor der Gerechtigkeit.
Unsere Fälle zeigen, dass schwierige Sachverhalte und neue Entwicklungen das Strafrecht immer wieder vor neue Fragen stellen. Das Recht muss hier Antworten finden, sich erklären oder sich wandeln, um weiterhin als gerecht erlebt zu werden. Was wir bestrafen und wie wir es tun, sagt viel über uns als Gesellschaft aus. Das Recht geht uns alle an. Reden wir darüber!
TEIL I
Gerichte machen Fehler
Glücklicherweise kommt es nicht oft vor, dass ein Gerichtsurteil schlicht falsch ist. Aber manchmal ist es so, und dann reagiert unser Gerechtigkeitsgefühl mit Empörung, und das vollkommen zu Recht. Die Grünen-Politikerin Renate Künast musste 2019 eine solche Fehlentscheidung des Landgerichts Berlin zu ihrem Nachteil erleben. Der Beschluss des Gerichts lässt sich juristisch kaum nachvollziehen. Er bringt zum Ausdruck, dass Nutzer von sozialen Medien gegenüber einer Politikerin selbst die übelsten Beschimpfungen äußern dürfen, ohne sich strafbar zu machen. Solche Fehleinschätzungen der Justiz sollten nicht vorkommen. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht – die höchste deutsche Gerichtsinstanz – den Beschluss des Berliner Landgerichts später in klaren Worten als Verletzung des Persönlichkeitsrechts von Frau Künast bezeichnet, und 2022 wurde der Beschluss schließlich vollständig aufgehoben.
Kapitel 1
Der »Fall Renate Künast«
Tut das Strafrecht genug gegen Hass und Hetze im Netz?
Eine Politikerin wird als »Stück Scheiße« und »Drecks Fotze« beschimpft. Ein Gericht sieht darin einen Ausdruck der Meinungsfreiheit, den eine Politikerin hinzunehmen habe. Der Fall schlägt hohe Wellen – und hat so auch ein Gutes: Die Gesellschaft diskutiert endlich über die Gefahren des digitalen Hasses. Ein Prozess des Umdenkens beginnt. Die Justiz nimmt Hass im Netz zunehmend ernst und der Gesetzgeber ändert das Recht, um den neuen Bedrohungen durch digitalen Hass gerecht zu werden.
Im Mai 1986 wird im Berliner Abgeordnetenhaus über Gewalt gegen Kinder diskutiert. Die Abgeordnete Ingvild Kiele und ihre Partei, die Alternative Liste, möchten vom Senat Informationen über körperliche, sexuelle und seelische Gewalt gegen Kinder erhalten. Manfred Jewarowski von der CDU-Fraktion stellt eine Zwischenfrage. Er will von der Abgeordneten Kiele wissen, wie sie zu einem Antrag der nordrhein-westfälischen Grünen steht. Die hätten die Aufhebung der Bestrafung von sexuellen Handlungen an Kindern gefordert. Renate Künast, damals 30Jahre alt und Mitglied des Abgeordnetenhauses, ruft: »Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist!« Denn die Grünen in Nordrhein-Westfalen hatten ihren Antrag auf gewaltlose Sexualkontakte beschränkt. Der Zwischenruf erscheint aus heutiger Sicht nicht sehr glücklich. Aber Renate Künast hat nie entsprechende Anträge der Grünen unterstützt. Ihr Anwalt sagt, dass sie nur die gezielt falsche Wiedergabe des Antrags durch den CDU-Abgeordneten berichtigen wollte.
Im Mai 2015 berichten zwei Journalisten der »Welt« über die Angelegenheit. In dem Text »Ein Zwischenruf mit Spätfolgen« fragen sie: »Klingt das nicht, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt okay?«1 Im März 2019 postet der Netzaktivist Sven Liebich, den der Verfassungsschutz der rechtsextremen Szene zuordnet, auf seinem Facebook-Account ein Foto von Renate Künast mit dem falschen Zitat: »Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist der Sex mit Kindern doch ganz ok. Ist mal gut jetzt.« Der Beitrag erzielt über 85.000Interaktionen und löst einen Shitstorm gegen Künast aus. Einige der Beschimpfungen lauten:
»Dieses Stück Scheisse. Überhaupt so eine Aussage zu treffen zeugt von kompletter Geisteskrankheit.«
»Schlampe«
»Drecks Fotze«
Künast wendet sich an das Landgericht Berlin. Sie beantragt, von Facebook die Nutzerdaten zu bekommen, um die Personen hinter den Kommentaren ausfindig machen zu können. Voraussetzung für eine Herausgabe der Daten durch Facebook ist, dass es sich um strafbare Inhalte handelt, also etwa um eine Beleidigung. Was eine Formalie zu sein scheint, wird ein Skandal. Denn das Landgericht Berlin lehnt den Antrag ab. Die Äußerungen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt und nicht strafbar.
Die Entscheidung des Berliner Landgerichts traf in der Öffentlichkeit auf großes Unverständnis. Und das zu Recht. Denn allein die oben zitierten Aussagen sind geradezu Lehrbuchbeispiele für Beleidigungen. Dass das Gericht eine so falsche Entscheidung treffen konnte, liegt auch an der Formulierung des Strafgesetzes. §185, der die Beleidigung regelt, lautet: »Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe (…) bestraft.« Damit hat es sich der Gesetzgeber ein wenig zu leicht gemacht. Der Tatbestand unterscheidet sich von allen anderen des Strafgesetzbuches dadurch, dass er die strafbare Handlung gar nicht beschreibt. So funktioniert ein Strafgesetz eigentlich nicht. Es heißt schließlich nicht »Der Diebstahl wird bestraft« oder »Der Raub wird bestraft«, sondern das Gesetz beschreibt genau, was einen Diebstahl und was einen Raub ausmacht. Bürgerinnen und Bürger müssen auf Grundlage des Gesetzes abschätzen können, welches Verhalten ihnen verboten wird.
Meinungsfreiheit versus Persönlichkeitsrecht
Der Beleidigungstatbestand hat seine Konturen allein durch die Gerichte erfahren. Und dabei bewegt er sich in dem besonders sensiblen Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Die Freiheit der Meinungsäußerung wird in Art.5 des Grundgesetzes geschützt. Sie findet ihre Grenzen allerdings in den »allgemeinen Gesetzen«, also Gesetzen, die nicht die Äußerung einer bestimmten Meinung verbieten. Ein solches Gesetz ist §185 des Strafgesetzbuchs. Der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts Johannes Masing formuliert es in einem Interview mit der »taz« so: »Es gibt einen wichtigen Unterschied, der oft übersehen wird: Die Meinungsfreiheit gibt gegenüber dem Staat das Recht, inhaltlich jede Ansicht und Idee zu äußern; die Grenze liegt in der Form, das heißt in der Aggression, die die Friedlichkeit der Auseinandersetzung verlässt. In Bezug auf andere Personen darf ich jedoch nicht alles sagen, denn deren Persönlichkeitsrecht begrenzt die Meinungsfreiheit. Deshalb können Ehrverletzungen oder falsche Aussagen über Dritte zu Recht strafbar sein, auch wenn sie eine Meinungsäußerung sind. Wo die Grenze konkret verläuft, muss im Einzelfall in der Regel abgewogen werden.«2 Die Äußerung muss also immer im Kontext gesehen werden – was war der Anlass, gegen wen richtete sie sich? –, denn in einem freiheitlichen Staat ist selbstverständlich auch eine überspitzte oder sogar polemische Kritik erlaubt. In jedem Fall strafbar ist aber die sogenannte »Schmähkritik«. Sie liegt dann vor, wenn nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Das Bundesverfassungsgericht ist bei der Wertung von Äußerungen als Schmähkritik zurückhaltend und nimmt sie »bei einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage nur ausnahmsweise an«. Die Karlsruher Richterinnen und Richter haben aber auch entschieden, dass Schmähkritik vorliegt, wenn »schwerwiegende Schimpfwörter – etwa aus der Fäkalsprache« – verwendet werden. Bei Formulierungen wie »Stück Scheiße« oder »Drecks Fotze«, die keinerlei Sachbezug mehr erkennen lassen und Frau Künast in menschenverachtender Weise als Person herabwürdigen, handelt es sich geradezu um Paradebeispiele von unzulässiger Schmähkritik. Dann kommt es auch gar nicht mehr darauf an, was der Anlass für die Äußerungen war und ob sich die Täter mit guten Gründen über das – falsche – Zitat empören durften. Die Meinungsfreiheit ist ein überaus hohes Gut, aber sie gestattet es nicht, andere Menschen in solcher Weise zu beschimpfen. Das verbietet das Strafrecht mit guten Gründen.
Renate Künast legt Verfassungsbeschwerde ein. Und bekommt recht. Im Dezember 2021 entscheidet das Bundesverfassungsgericht, dass die Berliner Gerichte zu hohe Hürden für eine Beleidigungsstrafbarkeit aufgestellt haben. Denn selbst wenn keine Schmähkritik vorgelegen hätte, wäre eine Beleidigung deshalb nicht automatisch ausgeschlossen gewesen. Die Schmähkritik ist nur eine besonders drastische Form der Beleidigung, bei der man nicht weiter überlegen muss, ob sie strafbar ist oder nicht. Auch Äußerungen unterhalb dieser Schwelle können strafbar sein, hier muss das Gericht zwischen dem Ehranspruch des Betroffenen und der Meinungsfreiheit des Täters abwägen. Dabei spielen die Umstände der Aussage, ihre Reichweite und die Wortwahl eine Rolle. All das hatten die Berliner Richter übersehen – und sich allein darauf berufen, dass Renate Künast »den Angriff als Politikerin im öffentlichen Meinungskampf hinnehmen« müsse.
Müssen Politiker mehr hinnehmen?
In der Vergangenheit hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder betont, dass bei Angelegenheiten von öffentlichem Interesse und beim politischen Meinungskampf der Meinungsfreiheit besonderes Gewicht zukommt und der Schutz des Betroffenen tendenziell zurückstehen muss. Welche Äußerungen sich jemand gefallen lassen muss, soll auch davon abhängen, welche Position er innehat und welche öffentliche Aufmerksamkeit er für sich beansprucht. Die Grenzen zulässiger Kritik sind daher, so das Bundesverfassungsgericht, bei Politikern grundsätzlich weiter zu ziehen als bei Privatpersonen. Das ist auch richtig, sofern es um Kritik in der Sache geht – schließlich muss Machtkritik in einer Demokratie erlaubt sein, auch wenn sie überspitzt oder polemisch ist. Hausdurchsuchungen nach kritischen Äußerungen über Politiker sind daher nicht ungefährlich. Sie verstärken bei vielen Menschen den Eindruck, dass sie sich nicht mehr frei äußern können.
Im Künast-Urteil macht das Bundesverfassungsgericht aber eines klar: Eine persönliche Verächtlichmachung oder Hetze muss sich niemand gefallen lassen, eine Politikerin genauso wenig wie jeder andere. Und noch einen anderen Punkt hebt das Gericht hervor: Der Schutz der Persönlichkeitsrechte von Politikern liegt nicht nur in ihrem eigenen, sondern auch im öffentlichen Interesse. Warum? Die Bereitschaft zur Ausübung öffentlicher Ämter ist entscheidend, damit staatliche Institutionen funktionieren. Ohne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ohne Land- und Gemeinderäte können Kommunen nicht verwaltet werden. Hass gegen sie kann dazu führen, dass viele diese Arbeit nicht mehr machen möchten. Und tatsächlich: Untersuchungen zeigen, dass zunehmend Politikerinnen und Politiker von digitalem Hass betroffen sind. In einer Umfrage unter weiblichen Bundestagsabgeordneten gaben 11Prozent an, dass die Beleidigungen und Bedrohungen sie an ihrem Beruf als Politikerin zweifeln und übers Aufhören nachdenken ließen.3 Derartige Befunde sind auch bei Politikerinnen und Politikern auf kommunaler Ebene zu beobachten. In einer Studie zu digitalen und analogen Gewalterfahrungen erklärten 10Prozent der befragten Kommunalpolitiker, dass sie ernsthaft erwägen, wegen der Gewalterfahrungen das Mandat niederzulegen.4
»Silencing«-Effekte
Hass, der in sozialen Netzwerken, in Kommentarspalten oder Internetplattformen geäußert wird, ist mehr als nur ein Angriff auf die Betroffenen. Das zeigt sich nicht nur bei Politikern. Studien ergaben, dass gerade im rechtsextremistischen Lager digitaler Hass eingesetzt wird, um bestimmte Personen oder Gruppen einzuschüchtern. Das nennt man den »Silencing-Effekt«: Die Opfer sollen durch Beleidigungen und Bedrohungen so unter Druck gesetzt werden, dass sie sich aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Und genau das berichten uns Betroffene von digitalem Hass. Sie haben sich öffentlich geäußert und wurden dafür in den sozialen Netzwerken und in E-Mails beschimpft und bedroht. »Also man achtet schon darauf: Postet man überhaupt? Was postet man? Man muss sehr bewusst die Themen und die Texte auswählen, und das führt dann eher dazu, dass man sich zunehmend zurückhält.« Und: »Für mein Leben bedeutet das, dass ich auf keinem Internetportal mehr erscheinen werde, das wird es nicht mehr geben für mich.« Dieser Effekt tritt nicht nur bei dem unmittelbaren Adressaten der Hassnachrichten ein. Studien zeigen, dass Internetnutzer, die Hassreden im Netz beobachtet haben, danach seltener ihre politische Meinung äußern. In einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, die wir mit einem Meinungsforschungsinstitut durchgeführt haben, gaben im Jahr 2022 50Prozent der Befragten an, aus Angst vor digitalem Hass schon einmal einen Beitrag nicht gepostet oder ihn bewusst vorsichtiger formuliert zu haben. Unter ihnen waren nicht nur Personen, die selbst digitalen Hass erfahren hatten; auch 43Prozent derjenigen, die bislang nicht Adressaten herabwürdigender Äußerungen waren, stimmten dieser Aussage zu.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch zwei weitere Studien. In einer Umfrage der Landesanstalt für Medien NRW erklärten 32Prozent, dass sie sich an Online-Diskussionen aus »Angst vor beleidigenden Kommentaren« nicht beteiligen würden.5 In einer von Richter et al. durchgeführten Untersuchung gaben 54Prozent der Befragten an, sich aus Sorge vor digitalem Hass mit der Äußerung politischer Ansichten im Internet zurückzuhalten.6
Bereits die Wahrnehmung von Beschimpfungen anderer kann also Menschen in ihrer Meinungsäußerung vorsichtiger werden lassen. Gerade weil Hass im Netz von einem großen Publikum wahrgenommen wird, ist er so gefährlich.
Werden Frauen anders beleidigt als Männer? Der Fall Luisa Neubauer
Frauen werden nicht häufiger Zielscheibe von Hass als Männer, aber sie werden anders beleidigt. In einer unserer Studien haben wir beobachtet, dass Herabwürdigungen von Frauen regelmäßig an ihr Geschlecht anknüpfen.7 Häufig wird eine Geringschätzung von Frauen zum Ausdruck gebracht, etwa in Äußerungen wie: »Ist doch echt nur eine Quotentrulla« oder »Frauen zurück in die Küche«. Sehr verbreitet sind sexualisierte Kommentare, die von abwertenden Äußerungen über das Aussehen der Betroffenen bis hin zu Vergewaltigungsfantasien reichen.
Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer wurde Opfer einer solchen Beleidigung. Im Januar 2020 veröffentlichte der Politiker Eckhard Mackh auf seinem öffentlichen Facebook-Account ein Foto von Luisa Neubauer und schrieb dazu: »Also völlig unverständlich finde ich das nicht, daß Kaeser die anwerben wollte. Man muß ihr ja nicht zuhören« und »Süßes Foto, oder etwa nicht?« Der Post wurde mehrfach gelikt und kommentiert. Unter anderem von Akif Pirinçci, einem 1959 in Istanbul geborenen deutsch-türkischen Schriftsteller, der durch seine »Katzen-Kriminalromane« international bekannt geworden ist. In den letzten Jahren ist Pirinçci zunehmend mit islam-, frauen- und schwulenfeindlichen Äußerungen aufgefallen, Gerichte habe ihn bereits wegen Volksverhetzung und Beleidigung verurteilt. Sein 2014 erschienenes Buch trug den Titel »Deutschland von Sinnen. Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer«. Unter das Foto von Luisa Neubauer schrieb er: »Ja, würde ich sofort ficken, auch wenn ich mir danach stundenlang das Klima-Zeug anhören müßte.«
Luisa Neubauer erstattete Strafanzeige und verklagte Pirinçci auf eine Geldentschädigung wegen Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts. Und sie hatte Erfolg. Pirinçci musste 6.000Euro Entschädigung an Neubauer zahlen und wurde im Strafverfahren zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Bei weiteren Beleidigungen droht ihm also tatsächlich Haft. Aber war das richtig? Pirinçci jedenfalls sieht seine Verurteilung nicht ein. Er habe Neubauer doch nur ein Kompliment gemacht, sie als begehrenswerte Frau dargestellt und damit »aufgewertet«. Die Gerichte argumentieren ganz anders – und das unserer Ansicht nach zu Recht. Das Landgericht Frankfurt a.M. sieht in der Äußerung von Pirinçci eine strafbare Schmähkritik. Denn Pirinçci habe Neubauer auf ein bloßes Sexualobjekt reduziert, das zeige auch seine vulgäre und sexistische Sprache. Um eine sachliche Auseinandersetzung mit ihrer politischen Position sei es ihm nicht gegangen, sondern – so das Gericht – allein um eine Diffamierung und Einschüchterung der jungen Frau, die er zum »Objekt frauenverachtender und entwürdigender Anwürfe gemacht« habe. Unsere Gesellschaft und auch unsere Gerichte sind sensibler geworden im Umgang mit sexuellen Belästigungen, egal ob körperlich oder verbal. Aktuell wird schon darüber diskutiert, das sogenannte Catcalling unter Strafe zu stellen, also das Hinterherrufen und Pfeifen auf der Straße. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ist ein Tatbestand aus dem Jahr 1871 noch zeitgemäß?
Die neuen Bedrohungen durch digitalen Hass hatte man nicht im Blick, als der Beleidigungstatbestand im Jahr 1871 ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Damals dachte man an Beschimpfungen zwischen Nachbarn oder im Wirtshaus. Vor dem Siegeszug des Internets wurde sogar diskutiert, den Beleidigungstatbestand abzuschaffen – denn wer hat nicht schon einmal einem anderen zum Beispiel im Straßenverkehr ein böses Wort zugerufen? Doch durch das Internet haben Beschimpfungen eine ganz neue Dimension bekommen. Sie werden nicht nur von den Beteiligten wahrgenommen, sondern auch von einer breiten Öffentlichkeit. Dass Freunde, Familie und Arbeitgeber die Äußerungen lesen können, stellt für die Betroffenen eine große Belastung dar. Der Hass verfolgt sie oftmals noch Jahre später, da die Kommentare nicht immer gelöscht werden oder sich wiederherstellen lassen. Und Herabwürdigungen können das Bild des Betroffenen in der Öffentlichkeit beeinflussen – manch einem kann der Gedanke kommen: Vielleicht ist ja doch ein wahrer Kern an den Beschimpfungen? Es überrascht daher nicht, dass Betroffene unter körperlichen und psychischen Folgen leiden; Panikattacken, Schlafstörungen und sogar Suizidgedanken sind verbreitet. Ein Opfer berichtet:
»Wirklich ein großer Verlust von Sicherheitsgefühl, Schlafstörungen, zum Teil hat sich das auch nochmal ausgewirkt in schlechterem Essverhalten, also im Grunde alles, was so in Richtung, sage ich mal, depressive Episoden geführt hat. Und ja, also ich habe es jetzt nicht diagnostiziert, aber ich würde schon denken, dass ich auch so eine posttraumatische Belastungsstörung habe, was das angeht.«
Diese Gefahren von Herabwürdigungen gerade im Internet hat das Strafrecht lange Zeit nicht abgebildet, das Strafgesetzbuch war einfach zu alt. Doch der »Fall Künast« hat die Politik aufgerüttelt. Mit dem »Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität« von 2021 wurde die Höchststrafe für öffentlich begangene Beleidigungen – also gerade solche in Internetforen oder Kommentarspalten – von einem auf zwei Jahre angehoben. Außerdem wurde der strafrechtliche Schutz von Politikern erweitert. Eine Beleidigung wird jetzt härter bestraft, wenn sie geeignet ist, das öffentliche Wirken eines Politikers zu erschweren. Über weitere Ergänzungen wird derzeit diskutiert, zum Beispiel über höhere Strafen für die Beteiligung an sogenannten Hatestorms (wenn also eine Person eine Vielzahl von Hasskommentaren erhält) oder für sexualbezogene Beleidigungen.
Und was machen Facebook und Co.? – Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz
Alle Änderungen des Strafrechts bringen allerdings wenig, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft die Täter nicht ermitteln können. Denn viele, die im Internet Hass verbreiten, tun das nicht unter ihrem richtigen Namen. Werden Hasskommentare zur Anzeige gebracht, müssen die Behörden erst einmal herausfinden, wer sich hinter einem Account verbirgt. Dafür können Informationen wie die bei der Anmeldung hinterlegte Mailadresse oder Handynummer hilfreich sein. Die großen Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube verweigern allerdings oft die Herausgabe dieser Daten. Häufig sind daneben keine weiteren Ermittlungsansätze vorhanden; Verfahren müssen dann eingestellt werden.
Doch das Ermitteln der Täter ist nur ein Aspekt, für den eine Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern nötig ist. Den Betroffenen von Hass im Netz geht es auch darum, dass die Hassnachricht schnell gelöscht wird. Aus diesem Grund wurde im September 2017 das »Netzwerkdurchsetzungsgesetz«, kurz »NetzDG«, erlassen. Die sozialen Netzwerke werden darin unter anderem verpflichtet, den Nutzern ein Meldeverfahren für rechtswidrige Inhalte zur Verfügung zu stellen. Geht eine solche Meldung ein, müssen die Netzwerke die Inhalte prüfen und sie – wenn sie als rechtswidrig eingeschätzt werden – innerhalb einer Frist entfernen oder den Zugang zu ihnen sperren. Bei wiederholten Verstößen drohen den Betreibern erhebliche Bußgelder.
Das NetzDG ist auf breite Kritik aus der Rechtswissenschaft, den Medien und der Zivilgesellschaft gestoßen. Problematisch ist zum einen, dass nicht ein Gericht, sondern der Betreiber selbst entscheidet, ob eine Äußerung einen der Straftatbestände verletzt und letztendlich gelöscht wird. Zum anderen befürchten insbesondere Journalisten eine Beschädigung der Presse- und Meinungsfreiheit durch »Overblocking«: Das Gesetz könne dazu führen, dass die Betreiber gemeldete Inhalte vorschnell löschen, um den Arbeitsaufwand einerseits und das Sanktionsrisiko andererseits zu minimieren. Dadurch würden auch zulässige Meinungsäußerungen gelöscht und der kontroverse Diskurs eingeschränkt.
Ob es zu einem solchen »Overblocking« tatsächlich kommt, ist in der Forschung umstritten. In einer Studie der Organisation HateAid, die Betroffene von digitalem Hass unterstützt, wurde der Umgang mit hundert Meldungen von ganz offensichtlich rechtswidrigen Kommentaren auf Facebook untersucht. Lediglich in 33Fällen löschte Facebook den Inhalt. Andere Studien deuten hingegen darauf hin, dass es durchaus zu vermehrten Löschungen kommt – allerdings weniger wegen des NetzDG als wegen eigener »Community-Standards« der Plattformbetreiber.
Mit dem NetzDG hat Deutschland eine Vorreiterrolle bei der Regulierung digitaler Plattformen eingenommen. Inzwischen wurde auch auf europäischer Ebene nachgezogen: Der Digital Services Act (Gesetz über digitale Dienste) schafft europaweit Regeln für Plattformbetreiber, die in der EU tätig sind. Das NetzDG wird damit weitgehend abgelöst. Auch im Digital Services Act sind Melde- und Beschwerdeverfahren und eine Löschpflicht für illegale Inhalte vorgesehen. Die Kritik daran, dass letztlich die Plattformbetreiber über die Löschung von Inhalten entscheiden, bleibt.
Facebook und Co. haben erhebliche Macht über die öffentliche Kommunikation. Staaten können zwar versuchen, die Betreiber durch ihre Gesetze zum Löschen bestimmter Inhalte zu verpflichten, angesichts der unglaublichen Menge von Inhalten und der Anonymität vieler Nutzer sind sie aber vor allem auf Kooperation angewiesen. Und Betreiber können durch ihre internen Verhaltensregeln die Grundlagen der Kommunikation weltweit verändern. Im Oktober 2020 entschied Facebook, keine Holocaust-Leugnung mehr auf seinen Seiten zu akzeptieren – obwohl sie in den meisten Ländern der Welt nicht illegal ist. Es kommt längst nicht mehr nur darauf an, wie ein Staat die Grenzen der Meinungsfreiheit zieht, sondern was Facebook und Co. erlauben. Deren Geschäftsführer entscheiden also sehr weitreichend darüber, was öffentlich gesagt werden darf – und was nicht.
TEIL II
Gesetze können ungerecht sein
Wenn uns Gerichtsurteile als ungerecht erscheinen, sind daran keineswegs immer die jeweiligen Richterinnen und Richter schuld. Sie können einen Fall schließlich nicht einfach nach ihrem – und vielleicht unserem – Gerechtigkeitsgefühl entscheiden, sondern sind strikt an die geltenden Gesetze gebunden. Speziell für das Strafrecht gibt unser Grundgesetz in Artikel 103 vor, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn ihre Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war. Selbst wenn ein Verhalten eindeutig strafwürdig ist, können die Gerichte es also nicht sanktionieren, wenn die Strafgesetze das nicht vorschreiben. Im Jahr 1899 hatte das Reichsgericht – damals das höchste Gericht in Deutschland – über den Fall eines Mannes zu entscheiden, der eine fremde Stromleitung angezapft hatte, um sein Zimmer kostenfrei zu beleuchten. Angeklagt war er wegen Diebstahls. Aber der Tatbestand des Diebstahls im Strafgesetzbuch setzt die Wegnahme einer »fremden beweglichen Sache« voraus – und elektrische Energie ist keine »Sache«. Nun könnte man meinen, dass die Gerichte ihn trotzdem verurteilen sollten, denn der Unrechtsgehalt seines Handelns ist dem eines Diebstahls vergleichbar, schließlich hat er eigenmächtig Strom, der ihm nicht zustand, entzogen. Doch ein solches Vorgehen ist den Gerichten verwehrt. Der Gesetzgeber musste daher ein neues Gesetz erlassen: Seit 1900 ist die »Entziehung elektrischer Energie« ein eigener Straftatbestand.
Otto von Bismarck wird das Zitat zugeschrieben: »Gesetze sind wie Würste, man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden.« Tatsächlich wird mit der Formulierung eines Gesetzes nicht immer die sachlich beste Lösung verwirklicht, sondern sie ist das Ergebnis politischer Verhandlungen der Regierungsparteien. Häufig stehen sich bei der Frage, ob etwas unter Strafe gestellt werden soll, verschiedene gesellschaftliche Interessen gegenüber: auf der einen Seite die Freiheit des Einzelnen, Handlungen nach dem eigenen Willen vorzunehmen, und auf der anderen Seite der Schutz der Menschen, deren Rechtsgüter durch diese Handlungen gefährdet werden können. In einigen politisch und ethisch besonders kontroversen Fällen lässt sich dieser Konflikt kaum auflösen. So ist es etwa bei der Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen. Während einige Menschen das Selbstbestimmungsrecht der Frau hochhalten und Abtreibungen ganz straflos stellen wollen, betonen andere den Schutz des ungeborenen Lebens und fordern eine stärkere Einschränkung von Schwangerschaftsabbrüchen. Der Dissens zwischen diesen beiden Gruppen spiegelt sich auch im parlamentarischen Prozess wider. Dann muss der Bundestag versuchen, eigentlich unvereinbare Positionen in einem Gesetz zu verbinden. Das Ergebnis sind nicht selten politische Kompromissgesetze, die Widersprüche und Lücken enthalten. Davon erzählen Kapitel 2 und 3. In anderen Fällen war zwar kein politischer Druck vorhanden, der Gesetzgeber hat sich aber zu einseitig auf einen Grundsatz festgelegt und dabei nicht bedacht, dass die Anwendung des Rechts zu ungerechten Ergebnissen führen kann (Kapitel 4).
Kapitel 2
Alkohol in der Schwangerschaft
Darf man ungeborenes Leben straflos schädigen?
Eine Mutter trinkt während der Schwangerschaft Alkohol, und ihr Kind kommt mit schweren körperlichen und geistigen Schäden zur Welt. Ein Pharmaunternehmen vertreibt ein Medikament für schwangere Frauen, das zu erheblichen Missbildungen bei ihren Kindern führt. In beiden Fällen lautet das Urteil: straflos. Das Ergebnis erscheint ungerecht, aber eine strafrechtliche Regelung ist tatsächlich hoch problematisch. Weshalb lassen sich Recht und Gerechtigkeit hier so schwer in Einklang bringen?
»Alkohol in der Schwangerschaft: Behindertes Kind verklagt die eigene Mutter« – so titelte der Berliner Kurier im September 2020. Ganz so war es nicht. Das fünfzehnjährige schwerbehinderte Mädchen hatte nicht selbst Klage erhoben und auch nicht gegen die eigene Mutter. Aber das Jugendamt und später die Pflegefamilie des Mädchens hatten eine Opferentschädigungsrente vom Land Sachsen-Anhalt beantragt. Weshalb?
Als Sabine G. zum dritten Mal schwanger wird, ist sie schwer alkoholkrank. Zwei Kinder hat sie bereits verloren, das zweite mit hoher Wahrscheinlichkeit als Folge ihres Alkoholmissbrauchs. Doch sie trinkt weiter. 2005 wird ihre Tochter Katrin geboren. Der Säugling leidet unter Entzugserscheinungen, muss ärztlich versorgt werden. Sabine G. gibt das Kind in Pflege; ihre gesundheitlichen und erzieherischen Kompetenzen sind, so heißt es später im Urteil, überschritten. Im Februar 2008 stellen Ärzte im sozialpädiatrischen Zentrum eine globale Entwicklungsverzögerung bei Katrin G. fest. Ein Jahr später wird bei ihr das Fetale Alkoholsyndrom diagnostiziert und eine fünfzigprozentige Behinderung bescheinigt.
2009 beantragt das Jugendamt des Landkreises B. die Gewährung einer Beschädigtenversorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz.
Dieses Gesetz verpflichtet den Staat, das Opfer eines »vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs gegen seine Person« bei Bedarf zu versorgen. Im Fall von Katrin G. verweigert das Land eine Zahlung. Der Fall geht bis vor das Bundessozialgericht. Dort geben die Richter dem Land recht und lehnen einen Anspruch der Tochter ab. Die Begründung: ihrer Mutter sei rechtlich nichts vorzuwerfen.