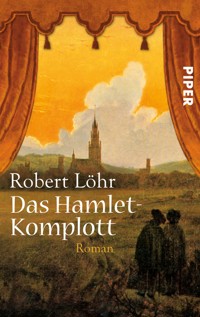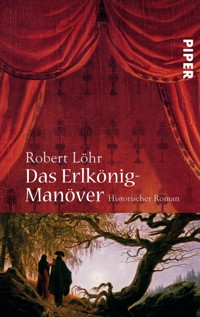
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Februar 1805 setzt eine bunte Truppe im Schutz der Dunkelheit über den Rhein: Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller, Achim von Arnim und Bettine Brentano sowie Heinrich von Kleist und Alexander von Humboldt. Ihr Auftrag: den wahren König von Frankreich aus dem französisch besetzten Mainz zu befreien. Ihr Gegner: Kaiser Napoleon I., der mächtigste Mann der Welt. Mit intelligentem Witz und fundierter Sachkenntnis beschert uns Robert Löhr einen hinreißenden historischen Roman um die Ikonen der deutschen Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Originalausgabe
4. Auflage Mai 2010
ISBN 978-3-492-95069-5
© Piper Verlag GmbH, München 2007 Umschlag: semper smile, München Umschlagabbildungen: Adolphe Roehn/Getty Images (oben) und Caspar David Friedrich »Mann und Frau, den Mond betrachtend« / akg-images (unten) Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vater tötet den Sohn oder die Tochter. Bruder liebt und tötet die Schwester, Vater tötet ihn. Vater liebt die Braut des Sohns. Bruder tötet den Bräutigam der Schwester. Sohn verrät oder tötet den Vater. FRIEDRICH SCHILLER, Entwurf für das Drama »Die Braut in Trauer« (2. Teil der »Räuber«)
1
OSSMANNSTEDT
»Sackerment!«, rief Goethe, als ihm hinterrücks eine verkorkte Flasche Burgunders so heftig über dem Schädel zerschmettert wurde, dass ihm der Schlag in alle Glieder ging. Er hatte nicht einmal mehr die Zeit gehabt, seinen Daumen aus dem Mund der Frau zu nehmen. Benommen lehnte er sich an den Tisch, um nicht in die Knie zu gehen, aber schon hatte der andere ihn am Kragen gepackt und herumgewirbelt, bereit, ihn mit einem Fausthieb niederzustrecken. Schiller hatte indes das Geweih samt Schädel und Trophäenbrett gegriffen und ließ es nun auf dem Rücken des Angreifers niedersausen. Als der Mann ohnmächtig zu Boden ging, knirschten die Scherben unter seinem Leib. Während Schiller das Geweih nicht aus der einen Hand gab, stützte er mit der anderen seinen Freund, bis der seine fünf Sinne wieder zurechtgesetzt hatte.
Abzüglich des Mannes, den Schillers Hieb überwältigt hatte, sahen sie sich vier ausgewachsenen Männern gegenüber, die nun vom reglosen Körper ihres Kameraden aufblickten – kräftigen Landmännern, die, würde es zu einem Faustkampf kommen, weder abgeneigt noch ungeübt schienen. Die Frau verließ den Platz auf der Bank, um das Gefecht aus sicherer Entfernung zu verfolgen, derweil der Wirt der Schenke hastig Krüge und Flaschen einsammelte, um ihnen das Schicksal des Burgunders zu ersparen.
Goethe hob beschwichtigend die Hände. »Messieurs, keine Hast und kein böses Blut. Ich bin durchaus willens, für die Unannehmlichkeiten aufzukommen.«
»Das werden Sie, Sie vermaledeiter Leichenfledderer«, sagte einer der Bauern und legte seine lederne Schürze ab. »Das bezahlen Sie teuer. Und zwar in ganz besondrer Münze.«
Die beiden Dichter traten gleichzeitig einen Schritt zurück, doch hinter ihnen war nur die Wand, und die Tür nach draußen befand sich hinter den vier Männern, die sich ihnen jetzt näherten. Schiller sah zu Goethe. Der zuckte mit den Achseln.
»Dem Manne kann geholfen werden«, sagte Schiller, schwang das Geweih über dem Kopf, traf den mutigsten ihrer Angreifer am Kiefer und holte ihn von den Beinen. Die drei anderen traten vor und entrissen Schiller den Tierschädel, um dann einen Hagel von Faustschlägen auf ihm niedergehen zu lassen. Ein Hieb ins Gesicht spaltete seine Lippe, einer in den Magen raubte ihm den Atem. Nun stürzte sich Goethe mit einem Sprung auf die Bauern und riss einen von ihnen mit sich zu Boden, wo sie kämpfend bald in die eine, bald in die andere Richtung rollten.
Schiller war indes wieder zu Luft gekommen und rannte, den Kopf eines Bauern in seine Armbeuge gezwungen, gegen einen Holzbalken, an dem sein Opfer schlafend niedersank. Dann eilte er zu Goethe – der, auf den Dielen liegend, von seinem Obermann schmerzhafte Knüffe einstecken musste –, und mit einem Fußtritt trennte er die beiden Kämpfer. Schließlich stürzte er einen Tisch, Platte voran, gegen die Männer, sodass Goethe und ihm genügend Zeit blieb, die rettende Tür zu erreichen und aus dem Wirtshaus zu fliehen – wobei sie alle Stühle in ihrem Weg umwarfen, um die Jagd der Verfolger zu behindern.
Kaum dass sie die Tür hinter sich zugeschlagen hatten, griff Goethe nach dem Spaten, mit dem der Wirt den Schnee vor dem Eingang beseitigt hatte, und steckte ihn so zwischen Türknauf und Rahmen, dass die rasenden Bauern sie von innen nicht zu öffnen vermochten. Nur ihre Flüche fanden dumpf den Weg nach draußen.
Schiller stützte sich mit den Händen auf seinen eigenen Knien ab und wartete, bis sich sein Atem wieder beruhigt hatte. Goethe hatte sich mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt. Blut, Schweiß und Wein auf seinem Kopf dampften in der stillen Winterluft. »Ich fühle mir das innerste Gebein zerschmettert«, keuchte er, »und lebe, um es zu fühlen.« Er legte eine Hand auf seinen Scheitel und schmeckte danach von den Fingern. »Meinen Kopf hätte ich wohl geopfert, aber um den guten Wein ist es mir schade.«
Schiller richtete sich auf, und mit spitzen Fingern entfernte er zwei blutige Scherben aus Goethes Haar. »Wir haben unsre Mäntel in der Stube vergessen.«
»In der Tat. Und da wir gerade von der Stube sprechen: Warum ist es eigentlich so still da drinnen geworden?«
Es war deshalb in der Stube so still geworden, weil die drei Bauern den hinteren Ausgang genommen und das Wirtshaus nun umrundet hatten. Als ihre wütenden Fratzen hinter der Ecke erschienen, brachen die beiden Weimarer ihre Atempause ab und gaben erneut Fersengeld. Der Weg zur Straße war von den Bauern versperrt, also mussten sie das Dorf anders verlassen, zwischen den Häusern hindurch und über die Stoppelfelder. Der Schnee war schwer und tief, sodass Jäger wie Gejagte nur langsam vorankamen, wie auf einem Bogen Vogelleim, und in der mondlosen Dunkelheit mehr als einmal stürzten. Das Feld fiel bald ab, hörte schließlich ganz auf, Feld zu sein, und wurde Flussufer. Die beiden liefen hinunter bis zum Fluss, aber Schiller setzte keinen Fuß aufs Eis.
»Tod und Verdammnis!«, schimpfte er. »Die Ilm.«
»Wohlan, überqueren wir sie.«
»Von Herzen Dank, aber ich übergebe mich lieber dem Lumpenpack als den Fischen.«
»Es ist Februar. Gehen Sie nur, das Eis wird uns tragen.«
»Ihr Wort darauf?«
»Gehen Sie nur, ich gebe Ihnen mein Wort«, erwiderte Goethe.
»Der Himmel bewahre mich vor Ihrer Narrheit. – Alter vor Schönheit.«
Ohne zu zögern, setzte Goethe seinen Stiefel aufs Eis, und wiewohl es hohl unter seiner Sohle knackte, hielt die verschneite Eisfläche seinem Gewicht stand. Schiller säumte bis zuletzt, aber als ihre Jäger auf keine zehn Schritt herangekommen waren, folgte er Goethe. Auch die drei Bauern schickten sich an, den Ilmfluss zu überqueren. Sie sprangen erst dann wieder zurück ans sichere Ufer, als Schiller auf dem letzten Meter mit beiden Beinen einbrach und bis zu den Oberschenkeln in der Ilm versank. Er zeterte wie ein Besenbinder, bis ihn Goethe vom Eise befreit hatte.
»Sie gaben mir Ihr Ehrenwort, dass ich nicht einbreche!«
»Ich habe mich offensichtlich geirrt. Aber wir sind in Sicherheit.«
Als Schiller wieder auftrat, quoll eisiges Wasser aus seinen Stiefeln. Seufzend setzte er sich auf seinen Hosenboden in den Schnee, um die Stiefel ganz zu leeren.
Ein Schneeball landete zwischen den beiden. Der jüngste der Bauern am anderen Ufer hatte keinen Stein zum Werfen gefunden und sich sein Geschoss daher selbst aus Schnee geformt.
»Daneben!«, rief Goethe, die Hände als Trichter um den Mund geformt.
»Wir wissen, wo Sie wohnen, Herr Geheimrat!«, rief der Wortführer mit erhobener Faust über den Fluss zurück. »Frohlocken Sie nicht zu früh! Wir werden Ihnen einen Besuch in Weimar abstatten, den Sie so bald nicht vergessen werden!«
»Ich freue mich jetzt schon. Sie werden wohl empfangen sein, meine Herren«, erwiderte Goethe lächelnd. »Bis dahin: Leben Sie Kohl!«
Der Bauer zog seinen jungen Genossen, der bereits Schnee für einen zweiten Ball presste, am Kragen hoch, und gemeinsam stapften die drei zurück nach Oßmannstedt, die Schultern gegen die Kälte hoch an den Kopf gezogen.
»Mich friert«, klagte Schiller, nachdem ihm Goethe wieder auf die Beine geholfen hatte. »Kalt, kalt und feucht!«
»Wollen wir zu Wieland und uns dort aufwärmen?«
»Ich will nicht zu Wieland, ich will heim.« Schiller rieb sich die Arme mit den Händen warm und sah sich im Schein der Sterne nach der Straße um. »Das alles wäre sicherlich nicht passiert, wenn wir stattdessen über die Urpflanze diskutiert hätten.«
Sie hatten am Mittag Weimar in Richtung Apolda verlassen und beim Wandern entlang der Ilm über Gott und die Welt geplaudert – erst über Napoleon Bonapartes prunkvolle Krönung zum Kaiser der Franzosen zu Notre-Dame de Paris, dann über Napoleons Pläne für Europa und schließlich über das Volk der Franzosen als solches und warum deren Revolution so außerordentlich missglücken musste. Darüber hatten sie die Zeit und die Welt um sich herum so sehr vergessen, dass sie sich beim Einbruch der Nacht in Oßmannstedt wiederfanden, wo sie ihre Unterredung in der ersten und einzigen Schenke bei einer Linsensuppe mit geräuchertem Speck, viel Brot und noch mehr Wein fortsetzten.
Durch das Geweih eines Damhirsches, welches über einem der Fenster hing, auf das Thema gebracht, war Goethe auf den Zwischenkieferknochen zu sprechen gekommen, und sie hatten von der Politik auf die Wissenschaft umgesattelt. Mit Erlaubnis des Wirts nahmen sie den Achtender vom Nagel, und Goethe legte anhand des Tierschädels dar, wo genau der besagte Knochen mit der Kinnlade verwachsen war und dass seine Existenz beim Menschen bislang nur deshalb verworfen wurde, weil das Zwischenkieferbein bereits vor der Geburt nahtlos mit dem Kiefer verwachse. Dieser unscheinbare Knochen, der Schlussstein im menschlichen Gesicht, sei somit nicht mehr und nicht weniger als ein Beweis dafür, dass bei aller Verschiedenheit der lebendigen Erdwesen überall eine Hauptform zu herrschen scheine; ein Bauplan, nach dem Mensch und Tier gleichermaßen erschaffen waren.
Nun wurden auch die anderen Gäste der Wirtsstube auf Goethes Referat aufmerksam, und als Antwort auf die neugierigen Blicke wiederholte der Geheimrat, was er vorher Schiller veranschaulicht hatte, sosehr ihn auch Letzterer daran zu hindern suchte – als ahne er bereits, in welcher Katastrophe die anatomische Vorlesung enden würde. Denn die Oßmannstedter hörten Goethe anfangs aufmerksam zu, schienen aber am Ende gar nicht damit einverstanden, so mit allen anderen Kreaturen Gottes großer Schöpfung in einen Topf geworfen zu werden. Als sie gar hörten, dass Goethe seine lästerlichen Erkenntnisse im Leichenturm zu Jena zutage gefördert hatte, wurde ihr Protest laut. Nicht einmal jetzt wollte Goethe auf seinen Freund hören, der ihm riet, den Vortrag abzubrechen. Er wurde vielmehr seinerseits lauter, um die Kritiker zu übertönen. Als er schließlich entnervt in den Gaumen der einzigen anwesenden Frau griff, um das Zwischenkieferbein am lebendigen Objekt nachzuweisen, und sie erschrocken aufschrie, so gut es mit der Hand des Geheimen Rats im Mund eben ging, hatte einer der Bauern kurzerhand die ungeöffnete Weinflasche über Goethes Schädel zerschmettert – und nur der Ilm war es zu verdanken, dass die Weimarer Oßmannstedt mit heiler Haut wieder verlassen konnten.
»Eines muss man Ihnen lassen: Mit Ihnen wird es einem nie langweilig«, sagte Schiller, als sie spät in der Nacht auf der Esplanade voneinander Abschied nahmen. Sie hatten den Weg zurück von Oßmannstedt im strammen Marsch bestritten, sodass ihnen trotz der fehlenden Mäntel warm geworden war. Schiller nieste. »Obwohl mir dieser Ausflug zweifelsohne noch ein kaltes Fieber bescheren wird.«
»Langeweile ist ärger als ein kaltes Fieber.«
Schiller lächelte. »Ganz recht: Man muss im Leben wählen zwischen Langeweile und Leiden. Aber das nächste Mal, wenn Sie ins Umland wollen, um dem Pöbel zu erklären, dass der Mensch bloß ein Tier ohne Fell ist, fragen Sie doch bitte Knebel statt meiner, ob er Sie begleitet. Oder vielmehr beschützt.«
»Sehen wir uns morgen?«
»So Gott will«, erwiderte Schiller, den Fuß schon zum Gehen gewandt. »Gute Nacht! Oder ich sagte besser: Guten Morgen.«
2
WEIMAR
Am Vormittag des 19. Februar 1805 wurde Goethe durch ein Rütteln und Schütteln und laute Rufe unsanft aus dem Schlaf gerissen. Trunken von den Oßmannstedter Weinen und erschöpft von der Wanderung zurück, war er erst wenige Stunden zuvor bäuchlings ins Bett gefallen, ohne sich seines Gehrocks zu entledigen. Selbst die Stiefel trug er noch.
»Gute Güte, Weib! Brennt es?«
»Nein.«
»Also! Warum dann, rasende Megäre, dies Zetergeschrei?«
»Der Herzog schickt nach Ihnen«, erklärte Christiane. »Er lässt ausrichten, es sei dringlich.«
»Dann lass ihm ausrichten, ich komme gegen Abend«, sprach Goethe mit belegter Stimme. Er setzte beide Füße auf den Boden, beide Ellenbogen auf die Knie und stützte den Kopf in beide Hände. »Herrgott, ich habe vielleicht einen Elefantenschädel.«
»Reißen Sie sich zusammen. Geheimrat Voigt war hier. Er sagt, die Sache dulde keinen Aufschub.«
»Voigt?« Goethe knurrte. »Habe ich nicht einmal Zeit für meine Toilette?«
»Nein. Hoch mit Ihnen, alter Mann, wenn Sie nicht wünschen, dass ich Sie mit einer Handvoll Schnee von der Fensterbank vollends aufwecke. Ich bringe Ihnen einen Gehrock, der nicht nach Wein stinkt, und eine Perücke, die Ihr Andenken an die letzte Nacht überdeckt. Ich möchte im Übrigen nicht wissen, was Sie getrieben haben. Vermutlich wissen Sie es selbst nicht mehr.«
»Wen Gott hasst, dem gibt er so eine Frau«, murmelte Goethe und griff sich an den Hinterkopf. Dort, wo ihn in der Nacht die Flasche getroffen hatte, hatte sich eine unappetitliche Kruste aus trockenem Blut und Wein gebildet. Im Spiegel sah er, dass sich zudem sein linkes Auge unter den Faustschlägen schwarz gefärbt hatte und angeschwollen war. Rote Flecken waren auf seinen Wangen verteilt, und ein Mundwinkel war eingerissen. Während Christiane seine Sachen holte, wusch er sich eilig das Gesicht. Beim Abtrocknen fand er eine weitere Glasscherbe im Nacken, die er in die Waschschüssel warf. Dann rückte Christiane die Perücke auf seinem Kopf zurecht, derweil er einen großen Becher lauwarmen Kaffees hinunterstürzte. In der Tür drückte sie ihm eine Semmel in die Hand und einen Kuss auf den Mund, und kauend trat er auf den Frauenplan. Es war eisig kalt und windstill, und der Himmel hatte die Farbe des schmutzigen Schnees.
Er lief, so schnell es das glatte Pflaster zuließ, und wenn ihn jemand grüßte, nickte er nur. Eine Gruppe Gänse wich ihm schnatternd aus und kämpfte, als er passiert hatte, um eine Brosame, die von seiner Semmel zu Boden gefallen war.
Nach einigen Metern schloss ein junger Mann zu Goethe auf. »Herr von Goethe! Herr Geheimrat, so bleiben Sie doch einen Moment stehen!«
»Wenn ich auch morgen noch Geheimrat sein will, darf ich gerade das nicht. Es eilt, wissen Sie.«
»Erlauben Sie mir dann freundlicherweise, dass ich Sie wenigstens ein Stück des Weges begleite.«
»Gerne«, erwiderte Goethe mit halb vollem Mund. »Aber sollte ich ausgleiten, wird Ihnen die unrühmliche Aufgabe zukommen, meinen Sturz zu bremsen.«
Als sie gemeinsam den Markt überquerten, nahm Goethe den Burschen in Augenschein. Er hatte die dunklen Haare über dem ovalen, fast kindlichen Gesicht in die Stirn gekämmt, und obwohl er einen langen Mantel trug und den Schal um Hals und Kopf gewickelt hatte, sah Goethe seiner Gesichtsfarbe an, dass er lange in der Kälte ausgeharrt hatte – und über einen belebenden Schritt nur dankbar sein konnte.
»Hochwohlgeborener Herr von Goethe, ich begegne Ihnen gewissermaßen auf den Knien meines Herzens«, setzte der junge Mann an. »Ich war bis vor Kurzem Leutnant des preußischen Heeres und war, wie auch Sie, auf dem Feldzug am Rhein, habe aber jetzo dem Militär den Rücken gekehrt, um ganz und gar meiner Bestimmung zum Dichter zu folgen.«
»Das machte uns entweder zu Kollegen oder zu Konkurrenten.«
Der junge Mann bemerkte erst jetzt das Veilchen, das auf Goethes Auge blühte. »Ei, was zum Henker, Herr Geheimrat! Was ist mit Ihnen geschehen? Was hat Ihnen das Gesicht so verrenkt?«
»Ein Kritiker meines Werks. – Was kann ich für Sie tun?«
»Ich komme auf Empfehlung von Wieland, bei dem ich derzeit logiere und der meint, Sie, Goethe, seien sowohl als der größte lebende und von mir sehr bewunderte Poet Teutschlands wie auch als Direktor des hiesigen Hoftheaters die rechte Adresse, ein Lustspiel aus meiner Feder zu präsentieren, welches bislang zwar unbekannt, aber sicherlich dazu angetan ist, Sie und das geneigte Weimarer Publikum trefflich zu amüsieren und zu belehren.«
Goethe blieb einen Augenblick stehen und zwinkerte seinem Gegenüber zu. »Mein junger Freund, wenn Ihr ganzes Lustspiel aus solchen Schachtel- und Aberschachtelsätzen besteht, dann wird es selbst das geneigteste Publikum wohl eher verwirren und ermüden als amüsieren und belehren.«
Der andere erwiderte das Lächeln nicht. »Wieland sagte mir, das Theater hätte einen großen Bedarf an Komödien.«
»In der Tat. Je trostloser das Zeitgeschehen, desto größer der Wunsch nach Zerstreuung«, sagte Goethe und zwängte den allzu großen Rest der Semmel in seinen Mund. »Bie beupfen Komöbienbichber bürfen baher auf Mapoleon hoffen.«
»Dann müssen Sie mein Stück spielen, Euer Exzellenz.«
»Bevor ich Ihr Stück spielen muss, muss ich es zuallererst lesen.«
»Dann lesen Sie es. Lesen Sie es, Herr Geheimrat, und falls Sie Fragen dazu haben sollten oder Vorschläge, werden wir darüber sprechen. Aber bitte geben Sie es nicht aus der Hand. Ich hoffe auf Euer Exzellenz guten Willen.«
Er öffnete die Knöpfe seines Mantels mit zitternden Händen und förderte das darunter verborgene Stück zutage. Es war eine kleine Ledermappe, in der sich eine Abschrift des Lustspiels auf billigem Papier befand, mit einem Leinenfaden behelfsweise gebunden. Goethe zögerte einen Moment, aber da ihn der Bursche plötzlich mit so empfindsamer Miene ansah, einen Tropfen Rotz an der Spitze der roten Nase, getraute er sich nicht, das angebotene Werk abzulehnen.
Sie waren über ihre Unterhaltung am Residenzschloss angelangt, und Goethes Weggefährte verabschiedete sich nun mit zahlreichen Höflichkeiten. Das Manuskript war zu groß für jede von Goethes Taschen, sodass er es in den Händen halten musste. Er ärgerte sich schon jetzt darüber, dass er es angenommen hatte, denn seine Ankunft mit einem Buch in der Hand würde vermuten lassen, er hätte sich auf dem Weg nicht geeilt, sondern vielmehr Muße genug für Lektüre gehabt. Er beschleunigte seine Schritte im Hof des Schlosses, für den Fall, dass jemand seine Ankunft durchs Fenster beobachten sollte. Und tatsächlich kam Geheimrat Voigt mit hurtigen Schritten die Treppe herab, noch während sich Goethe im Eingang den Schnee von den Sohlen trat.
Der gleichaltrige Minister brach mitten in der Begrüßung ab, als er Goethes zerschundenen Antlitzes gewahr wurde. »Herrje, Goethe! Sie sind ja grün und blau wie ein Harlekin! Sind Sie beim Weinstampfen unter die Hacken geraten?« Er rümpfte die Nase. »Sie riechen zumindest ganz danach.«
Goethe übergab Hut und Mantel einem Lakaien und folgte Voigt ins obere Stockwerk. Über den Anlass dieses Treffens des Geheimen Consiliums konnte selbst Voigt keinen Aufschluss geben. Im weiß-goldenen Audienzsaal erwartete sie Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, der sich ein Leopardenfell gegen die Kälte um den Nacken gelegt hatte, mit drei Gästen, die um einen Tisch mit Tee und Gebäck versammelt waren. Als sämtliche Diener den Raum verlassen und die schweren Türen hinter sich geschlossen hatten, legte Goethe die Ledermappe auf einem Seitentisch ab, und Carl August stellte die Anwesenden vor. Im Kamin loderte ein Feuer, und Goethe hoffte inständig, dass der Rauch wenigstens den Geruch des getrockneten Burgunders in seinem Kragen überdeckte. Er hätte auch das Hemd wechseln sollen.
Der erste der drei Gäste war ein Captain der britischen Armee mit dem Namen Sir William Stanley. Sir William war in Zivil gekleidet, in einen dunklen Frack mit hohem Stehkragen, einer weißen Seidenkrawatte und olivgrünen Leinenhosen in hohen Stiefeln. Ein Zweispitz lag neben ihm auf dem Polster der Recamière sowie ein Spazierstock mit einem elfenbeinernen Knauf in der Form eines Löwenkopfs. Sein Gesicht war schmal wie seine Lippen, und entweder war seine verdrießliche Physiognomie gottgegeben oder nur Ausdruck seines Missfallens am hier ausgeschenkten Tee, den er unberührt in der Porzellantasse vor sich hatte erkalten lassen. Er hatte bis eben in der neusten Ausgabe von London und Paris geblättert, und offen vor ihm lag der Nachdruck einer englischen Karikatur auf die Kaiserkrönung Napoleons, auf der ein geradezu pygmäischer Korse in viel zu großen Roben dem misslaunigen Papst zum Altar folgte, zu seiner Linken die unnatürlich aufgedunsene Kaiserin Joséphine und der Teufel selbst als Ministrant.
Der Zweite in der Runde, Baron Louis Vavel de Versay, ehemals Legationsrat der niederländischen Gesandtschaft in Paris, hätte leicht für einen jüngeren Bruder Carl Augusts gelten können, denn auch er hatte das rundliche Antlitz mit dem seltsam hervorstehenden Kinn und die gleichen freundlichen Augen. Im Gegensatz zum demokratisch gekleideten Stanley schien de Versays Garderobe noch aus den Krönungszeiten Josephs II. herzurühren: ein blauer Gehrock mit Goldborten und eine Zopfperücke, die sein Haar bis auf den dunkelblonden Backenbart bedeckte.
Von Anbeginn gebannt waren Voigt und Goethe aber vom Anblick des dritten Gastes, einer Frau, die sich mit dem Holländer den Platz auf der Chaiselongue teilte – denn ihr Gesicht war von einem dichten grünen Schleier bedeckt, an dem nur ihre braunen Locken einen Weg vorbei fanden. Sie trug ein schwarzes Kleid, das unter der Brust mit einer Schleife geschnürt war, und einen großen Schal über den Schultern. Als Carl August sie vorstellen wollte, geriet er unvermittelt ins Stocken, und sie half ihm aus: »Sophie Botta«, sagte sie, während sie den beiden Geheimen Räten ihren Handrücken zum Kuss reichte. Die Grazie ihrer Bewegungen ließ nicht daran zweifeln, dass sich hinter dem Schleier nur noch mehr Schönheit verbarg.
»Wir haben uns hier zusammengefunden«, hob Carl August an, als alle Platz genommen hatten, »weil wir der gemeinsamen Überzeugung sind, dass der Emporkömmling Napoleon Bonaparte nach seiner aberwitzigen und unrechtmäßigen Krönung zum Kaiser der Franzosen danach strebt, sein falsches Empire weiter auszudehnen und Europa mit Krieg zu überziehen – und weil es unsre Überzeugung ist, dass man ihm darin Einhalt gebieten kann und muss. Als Briten, Holländer und Deutsche sprechen wir auch stellvertretend für Spanier, Schweden und Russen – und nicht zu vergessen für die Anhänger eines Frankreich, welches sein Heil im friedlichen Zusammenleben mit den anderen Völkern sucht und nicht in ihrer Unterwerfung.« Hier wies er auf die verschleierte Frau Botta. »Ich bin der Meinung, dass es vor allem im Interesse der Deutschen liegen sollte, Bonaparte aufzuhalten. Denn dass er die französische Grenze bereits bis an den Rhein getrieben hat und Holland besetzt und Mainz zur wahren Bastion ausgebaut, erhellt, in welche Richtung er sich weiter auszudehnen gedenkt. Die deutschen Staaten sind untereinander zerstritten und nur auf den eigenen Vorteil bedacht und so unfähig, eine gemeinsame Armee zu erheben, dass jedes Fürstentum allein leichte Beute für Bonaparte ist. Ganz davon abgesehen, dass einige deutsche Fürsten, allen voran die Baiern, ehr- und vaterlandslos genug sind, gemeine Sache mit dem Despoten zu machen, in der Hoffnung, als Belohnung für ihren Verrat ein paar Krümel vom Kuchen davonzutragen. Die französischen Truppen standen schon einmal an der Fulda, kurz vor Eisenach, und ich habe wenig Interesse, sie je wieder dort zu sehen.«
»Nicht zuletzt steht der Korse in seinem eigenen Land sehr unsolide da«, ergänzte Stanley. »Und Kriege sind, wie wir wissen, eine formidable Art und Weise, innenpolitische Schwächen zu verschleiern und das Volk hinter sich zu vereinen.«
»Unsolide?«, fragte Voigt nach. »Ist das Volk denn nicht auf Napoleons Seite? Ganz Frankreich hat ihm zugejubelt, als die Krone auf sein Haupt gesenkt wurde.«
»Ganz Frankreich hat auch Ludwig XVI. zugejubelt, als die Krone auf sein Haupt niederging. Und ebenso laut haben sie gejubelt, als das Fallbeil aufs selbige Haupt gesenkt wurde. – Von allen Völkern ist, Ihr Pardon, Madame, vorausgesetzt, das Geschlecht der Franken wohl am wankelmütigsten in seiner Gunst und Missgunst. Aber Bonapartes Kriege haben die Franken viel Geld gekostet und das Land in eine wirtschaftliche Misere getrieben; und die Verschleppung und Ermordung des unschuldigen Herzogs von Enghien, dem er zu Unrecht vorwarf, ein Attentat auf sein Leben geplant zu haben, hat die Zahl seiner Feinde in Frankreich nur erhöht. Außerdem erinnern sich die Franken allmählich daran, dass ihre Revolution den Königsthron nicht hatte abschaffen sollen, nur um Platz für einen Kaiserthron zu machen. Die verhasste Aristokratie, die die Sansculotten mit der Guillotine ausgerottet wissen wollten, züchtet Bonaparte jetzt nach, indem er immer neue Anhänger in den Adelsstand erhebt.«
»Unser Anliegen ist es also«, erklärte nun der Holländer, »Bonaparte aus dem Wege zu räumen, mit welchen Mitteln auch immer, und durch einen Herrscher zu ersetzen, der bei den Franken populärer ist. Denn wenn wir Bonaparte vernichten, aber keinen adäquaten Nachfolger anbieten, geht die Krone lediglich an seinen Bruder oder seinen Stiefsohn über oder an ein andres Mitglied seiner neugeschaffenen kaiserlichen Familie.«
»Populärer als Napoleon?«, fragte Voigt. »Und welcher Herrscher wäre dies?«
Da niemand in der Runde antwortete, tat es Carl August. »Ludwig XVII.«
»Der Bruder des geköpften Königs? Der Comte de Provence?«
»Nein.«
»Der Comte d’Artois?«
»Nein, keiner seiner Brüder. Wir meinen tatsächlich Seine Majestät Ludwig XVII., den Dauphin von Viennois Louis-Charles, Herzog der Normandie, Sohn von Ludwig XVI. und Marie Antoinette und legitimer Nachfolger auf dem französischen Königsthron.«
Voigt sah zu Goethe und Goethe zu Voigt, aber offenbar war es den anderen ernst, sodass sich Goethe endlich zu Wort meldete. »Der Dauphin starb vor zehn Jahren in der Gefangenschaft. In der Familie hat allein seine Schwester Marie-Thérèse-Charlotte die Revolution überlebt.«
Als Sophie Botta ihm antwortete, tat sie dies mit einem entzückenden Akzent: »Sie täuschen sich, Herr von Goethe, oder vielmehr: Sie wurden getäuscht, wie auch der Rest der Welt getäuscht wurde, insbesondere aber seine Kerkermeister. Es stimmt, dass Louis-Charles krank war, als man ihn im Pariser Temple festhielt, aber es stimmt nicht, dass er an seiner Krankheit starb. Statt seiner starb ein andrer Knabe, ein krankes Waisenkind von gleichem Wuchs und gleichem Alter. Louis-Charles wurde in einer Verkleidung aus dem Temple entführt. Und als der falsche Dauphin auf dem Friedhof Sainte-Marguerite begraben wurde, war der echte längst in Sicherheit. Seine Flucht aus Frankreich führte ihn mit wechselnden Begleitern über Italien und England schließlich nach Amerika.«
»Bei allem Respekt, Madame Botta: Das ist eine Räuberpistole, wie ich sie in meinen Werken nicht wilder fabulieren könnte. Erlauben Sie mir gnädigst, dass ich Ihnen kein einziges Wort von diesem bourbonischen Märchen glaube.«
»Alle, die den Dauphin kannten und die terreur überlebt haben, werden bezeugen können, dass es der leibhaftige Sohn Louis’ Seize ist: die Kammerdiener und Zofen von Versailles, die Minister, vor allem aber seine Schwester, die Madame Royale.«
»Und wer sollte für diesen Austausch verantwortlich zeichnen? Sie haben selbst gesagt, dass die Royalisten unter den Jakobinern nahezu ausgerottet wurden.«
»Es war kein Royalist, sondern ein Republikaner: der Vicomte de Barras. Er wollte mit dem Knaben Druck auf Louis’ Bruder ausüben, den Comte de Provence, der, sollte es je zu einer Restauration kommen, der nächste König würde. Dass ihm der Dauphin im Laufe seiner Flucht entwischte, entsprach freilich nicht seinen Plänen.«
Carl August legte eine Hand auf Goethes Bein. »Meine Anwesenheit und die Anwesenheit der Repräsentanten dreier Staaten ist Beweis dafür, dass Madame Bottas Geschichte der Wahrheit entspricht: Der Dauphin lebt – oder vielmehr: Ludwig XVII. lebt. Wir wollen, dass er den französischen Königsthron besteigt, die Jakobiner, die Bonapartisten und die Royalisten aussöhnt und das Blutvergießen in Europa beendet. Ganz davon abgesehen, dass das leidige Kapitel der Französischen Revolution damit endgültig zugeschlagen wäre und der Krankheitsherd Frankreich aufhört, gesunde Staaten mit seiner unheilbringenden Revolutionsepidemie zu infizieren.«
»Louis ist jetzt achtzehn Jahre alt und damit alt genug für den Thron«, ergänzte Sophie Botta. »Wenn er mit der rechten Paarung von Bescheidenheit und Entschlusskraft auftritt, wird ihn das Volk mit offenen Armen empfangen. Louis Dix-sept wird wieder für das Volk regieren und nicht, wie Bonaparte, für sich selbst.«
»Und wo befindet sich der Dauphin jetzt?«, fragte Voigt.
»Ah«, sagte die verschleierte Dame nur.
Goethe nickte. »Ich ahne bereits, dass sich hinter diesem Ah der Grund verbirgt, weshalb wir hier sind. Wo also ist der Dauphin?«
»Er segelte von Boston nach Hamburg«, erklärte sie. »Dort sollte er von preußischen Offizieren in Empfang genommen werden. Stattdessen wurde er aber von der französischen Polizei abgefangen und verschleppt. Sie erinnern sich, dass der Vicomte de Barras verantwortlich war für die Entführung Louis’ aus dem Temple? Nun, als er und Bonaparte noch nicht gebrochen hatten, vertraute er ihm das Geheimnis des Austauschs an. Seitdem ist Bonaparte so unerbittlich auf der Suche nach dem Thronfolger wie einst Herodes auf der Suche nach dem Jesuskind. Und wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir seinen Polizeiminister unterschätzt haben: Fouché hat Louis ausfindig gemacht, und seine Männer haben ihn nun in ihrer Gewalt.«
»Allmählich verliere ich den Überblick.«
Trotz des Schleiers konnte Goethe sehen, dass die Madame lächelte. »Nur Mut, Herr von Goethe, wir nähern uns dem Ende unsrer Ausführungen. Wie Sie sich denken können, ist Bonaparte daran interessiert, dass kein Mensch je von Louis’ Existenz erfährt. Sollte sich der junge Mann, der in Hamburg vom Schiff gegangen ist, als ein Schwindler herausstellen – und diese Vermutung liegt natürlich nahe –, wird Bonaparte ihn entweder als Schwindler einsperren oder schlicht aus dem Land jagen. Sollte es aber tatsächlich Louis Dix-sept sein … dann zweifeln wir nicht daran, dass ihn dieser Unmensch ebenso rasch und skrupellos aus dem Weg räumen wird wie jüngst den beklagenswerten Duc d’Enghien.«
Carl August schob einige der Teetassen beiseite und schuf somit Platz für eine kleine Karte von Europa, die zuvor unter dem Tisch gelegen hatte. »Fouché hat mittlerweile die Suche angewiesen nach dem ehemaligen Kindermädchen von Louis-Charles, einer gewissen Madame de Rambaud. Sobald diese gefunden ist, werden sich Louis und sie auf halbem Wege zwischen Paris und Hamburg wiedersehen: in Mainz, der ersten Stadt auf französischem Territorium.«
»Warum bringen sie ihn nicht gleich nach Paris?«
»Wir nehmen an, aus Gründen der Geheimhaltung. In Paris ist die Gefahr zu groß, dass der Dauphin auch von andren Menschen erkannt wird. Deshalb bleibt er in Mainz. Die Rambaud soll noch im Laufe dieser Woche eintreffen – all dies natürlich in strengem Gewahrsam. Sie wird kommen, den Dauphin identifizieren, und dann wird Louis noch vor Ort und insgeheim hingerichtet. So ist der Stand der Dinge.«
Goethe sah auf die Karte, die noch aus einer Zeit war, da das Heilige Römische Reich bis zur Saar reichte, nicht nur bis zum Rhein. »Und was ändern wir an diesem unschönen Stand der Dinge?«
Sir William räusperte sich. Baron de Versay gab noch etwas Zucker in seinen ohnehin schon zu süßen Tee.
»Sie kennen sich seit jungen Jahren bestens aus im besetzten Mainz«, sagte der Herzog, »und besser noch, seitdem wir die Stadt damals belagerten. Stellen Sie eine Truppe von guten Männern zusammen, brechen Sie unverzüglich nach Mainz auf, und befreien Sie den Dauphin, bevor ihn Madame de Rambaud identifizieren kann und bevor ihm der Kaiser auch nur ein Haar krümmt.«
»Ich?«
»Ich wüsste keinen, dem ich diesen bedeutsamen Auftrag lieber anvertraute.«
»Sie scherzen, Durchlaucht. Ich bin nicht der Mann, dem Sie das Schicksal Frankreichs und Europens in die Hände legen wollen. Warum kümmern sich statt meiner nicht die Onkel des Dauphins, der Comte de Provence und der Comte d’Artois, um ihren Neffen?«
Sophie Botta seufzte. »Weil sie ichsüchtige Feiglinge sind, die selbst darauf hoffen, eines Tages König zu werden, und deshalb gar nicht wollen, dass der Dauphin ihnen den Platz auf dem Thron nimmt.«
»Und was ist mit den Emigrierten? Ganz Deutschland wimmelt doch von geflohenen Anhängern der Bourbonen, denen es ein Herzensanliegen wäre, ihr Zinnober für den jungen König zu spendieren.«
»Ganz richtig. Aber alle, die unter ihnen für diese Kampagne in Frage kämen, werden auf Schritt und Tritt beobachtet. Ihr Engagement würde Louis nur in Gefahr bringen. Fouché hat ein dichtes Netz von Spitzeln unter den Emigrés und ihren deutschen Gastgebern aufgebaut.« Sie führte einen Finger an die dunkelgrüne Seide vor ihrem Gesicht. »Nur deshalb trage ich diesen verwünschten Schleier, der mir das Leben verleidet: Weil ich nicht einmal in diesen gastlichen Hallen fernab von Paris riskieren kann, dass man meine wahre Identität erkennt – so unbedeutend sie auch sein mag. Ich erinnere abermals an den Duc d’Enghien: Napoleons Fänge reichen bereits weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. Wäre dem nicht so, Herr Geheimrat, bei Gott, ich säße längst in einer Kutsche auf dem Weg nach Mainz.«
Goethe erwiderte nichts, und weil auch die anderen Anwesenden schwiegen, war es mit einem Mal still im Audienzsaal. Das Feuer prasselte im Kamin, und im Magen des holländischen Diplomaten blubberte der Tee. Voigt öffnete den Mund, aber es kam kein Wort heraus. Vermutlich war der Minister dankbar, dass er nicht mit auf diese prekäre Reise geschickt werden sollte, und kein Kommentar seinerseits sollte dies aufs Spiel setzen. Stattdessen betrachtete er das Gemälde, das hinter Sir William an der Wand hing, als hätte er ein bislang unentdecktes Detail in der dargestellten Jagdszene bemerkt.
Schließlich erhob sich Carl August. »Gestatten Sie, dass ich mit dem Geheimrat ein Wort im Separee wechsle.«
Goethe verabschiedete sich mit einem Nicken von den Gästen und folgte dem Herzog in den benachbarten Raum.
»Mir brummt der Schädel«, sagte Goethe. »Eine zwote Flasche hätte nicht mehr Schaden anrichten können als diese unfassbare Darstellung.«
»Gestern getrunken?«
»Auch das. Hätte ich gewusst, dass ich heute Napoleon stürzen soll, wäre ich gestern gewiss früher zu Bett gegangen.« Goethe trat ans Fenster und sah hinaus auf die Kegelbrücke über der Ilm. In der Eisdecke des Flusses war eine lächerlich kleine Lücke geblieben, kaum drei Schritt im Quadrat, in der nun, wie es schien, sämtliche Schwäne Weimars versammelt waren und durch fortwährendes Strampeln und Paddeln zu verhindern suchten, dass das Eis auch ihren letzten Wasserbesitz einschloss. Goethe wäre heute gern noch etwas Schlittschuh gelaufen.
»Du zögerst. Warum? Bewunderst du Napoleon?«
»Nun – ein Kerl, den alle Menschen hassen, der muss was sein. Was Shakespeare in der Poesie, Mozart in der Musik, das ist eben jener in seiner ungleich hässlicheren Kunst. – Aber dass ich ihn bewundere, heißt nicht, dass ich mich scheue, ihn zu bekämpfen. Man kann auch seine Feinde bewundern.«
»Dann, mein Freund, bitte ich dich mit aller Hingabe, die ich aufbringen kann: Bekämpfe diesen Feind. Geh nach Mainz, und rette den wahren König von Frankreich.«
»Höre, Carl, das ist kein Kinderspiel. Du könntest mich ebenso gut bitten, in der Hölle Rachen hinabzusteigen und eine verlorene Seele zu retten. Und Mainz! Ausgerechnet Mainz!«
»Immerhin haben wir uns in Mainz kennengelernt, alter Kerl.«
Goethe wandte sich vom Fenster ab. »Wer ist die Französin? Sophie Botta ist nicht ihr richtiger Name.«
»Nein. Aber ich kenne ihre wahre Identität und sage nur so viel darüber: Sie hat allen Grund, sich zu verschleiern und Fouchés Männer zu fürchten. Doch die Dame ist von allerhöchster Glaubwürdigkeit, und sie verfügt über eine bemerkenswerte Tapferkeit. Und das Antlitz eines Engels. Mehr darf ich selbst dir nicht sagen, denn ich habe einen Eid geleistet.«
»Und wie kommt es überhaupt, dass du dich dieser denkwürdigen Allianz angeschlossen hast?«
»Von allen Staaten des Deutschen Reiches muss mein Herzogtum Napoleon als die saftigste Beute scheinen: Wir sind zwar klein, halten aber eine Schlüsselposition in der Mitte Deutschlands, und das Heer Sachsen-Weimars gegen die französische Armee hieße eine Ratze gegen einen Löwen antreten lassen. Ich habe mich als Gastgeber vieler königstreuer Franzosen hervorgetan und aus meiner Abneigung gegen den Korsen nie einen Hehl gemacht. Und ich habe sämtliche Feldzüge gegen Frankreich begleitet. Vielleicht bin ich in den Augen des Kaisers nur ein kleines Licht, aber umso bestimmter wird er es auslöschen wollen. Sollte Napoleon gegen Deutschland marschieren – und das wird er, so wir die Hände untätig in den Schoß legen –, dann muss ich nicht nur um mein Herzogtum, sondern auch um mein nacktes Leben fürchten.« Carl August packte seinen Freund an beiden Armen, und mit ehrlicher Verzweiflung sagte er: »Wenn ich je deine Hilfe gebraucht habe, dann jetzt. Hilf mir, und du sollst fürder alles haben, was du von mir verlangst.«
Auf dem Heimweg verfasste Goethe im Geiste eine Liste mit den Dingen, die er dem Herzog abverlangen wollte: die stufenweise Verminderung der Fron- und Steuerlasten für die Bauern des Fürstentums, die Ernennung Hegels zum Professor der Philosophie an der Jenenser Universität und schließlich die Entfernung der vom Herzog so verehrten Karoline Jagemann vom Hoftheater, denn die fortdauernden Ränke und Machtspielchen der Schauspielerin raubten ihm den letzten Nerv. Dieser herkulische Dienst für Carl August sollte seinen Preis haben, und es würde nicht bei Versprechungen bleiben. Wieder am Frauenplan angelangt, kam Goethe der Gedanke, dass in der Mitte des Platzes eigentlich noch genügend Raum für eine bronzene Statue … – und verwarf ihn sogleich wieder.
Christiane kam ihm entgegen, während er im Flur seine Stiefel auszog, und fragte ihn, ob er nun zu frühstücken oder vielmehr Mittag zu essen gedenke. Doch mitten in ihrer Aufzählung möglicher Speisen verstummte sie, als er von seinen Stiefeln aufblickte.
»Gibt es etwa Krieg?«, fragte sie.
Goethe schüttelte lächelnd den Kopf. »Nein, aber ich muss dennoch fort. Der Herzog schickt mich nach … Hessen.«
»Was sollten Sie in Hessen?«
»Diplomatische Obliegenheiten. Aber versprochen: Ich werde nicht länger als eine Woche fort sein, und ich bringe dir eine Bouteille feinsten Rheinweines mit.« Goethe nahm die Perücke ab. Die Wärme darunter hatte den Schorf aufgeweicht, und zwei Blutflecken hatten die weißen Perückenhaare hellrot eingefärbt. »Schlag mir ein paar Eier in die Pfanne und Speck dazu. Ich bin hungriger als Schwager Kronos. – Wo ist mein Sohn?«
»August ist im Garten und baut einen Mann aus Schnee.«
»Schick ihn zu Schillern. Er soll augenblicklich kommen, und wenn ihn darob die Inspiration verlässt!«
»Die Inspiration für einen Schneemann?«
»Nicht doch August, du Schaf! Ich rede von Schillern.«
In seinem Arbeitszimmer stellte Goethe den ledernen Ranzen, den er zuletzt auf einer Wanderung durch den Thüringer Wald genutzt hatte, auf den Tisch in der Mitte des Raumes und füllte ihn mit Kleidern für seine Reise nach Mainz; schmucklos genug, jeglicher Aufmerksamkeit zu entgehen, und warm genug für den Frost, der über Deutschland lag. Dann sammelte er zusammen, was er für nötig hielt: einen Wasserschlauch aus Sizilien und einen Hirschfänger mit einem Griff aus Horn, den ihm sein Herzog in der Schweiz geschenkt hatte. Ein Seil, das er mit in den Harz genommen, aber weder dort noch später je benutzt hatte. Eine Öllampe aus Messing aus den Ilmenauer Bergwerken. Und schließlich einen Kompass, der ihm den Weg in die Champagne und zurück gewiesen hatte. Er wartete, bis ihm Christiane das dampfende Frühstück in einer schwarzen Eisenpfanne gebracht hatte, bevor er begann, auch unter seinen Waffen die dienlichsten herauszusuchen. Er entschied sich für ein einfaches Stilett und zwei Pistolen. Dazwischen nahm er immer wieder eine Gabel voll des Omeletts. August war zurückgekehrt und gab im Garten seinem Schneemann den letzten Schliff. Vom Turme Sankt Peter und Paul schlug es Zwölf.
Bald pochte es an der Tür, und Schiller trat herein, auch er von den grünen und blauen Siegeln des gestrigen Streits gezeichnet. »Was gibt es? Hat Knebel etwa keine Zeit? Oder keine Lust?« Schiller fand Goethe über sein Pulverhorn und ein Säckchen Bleikugeln gebeugt. »Meiner Treu, Goethe! Sie werden sich doch nicht etwa an den braven Oßmannstedtern blutig rächen wollen?«
»Mitnichten. Der Gegner, gegen den ich mich mit diesen Pistolen wappne, ist größer als eine Handvoll Bauern. So recht betrachtet, ist es der größte Gegner, den man sich heutigentags unter allen Lebenden nur suchen kann.«
Als Schiller begriff, dass Goethe nicht scherzte, schwand das Lächeln von seinen Lippen. »Von wem reden Sie?«
»Vom Franzosenkaiser.«
»Sie wollen dem leibhaftigen Napoleon die Stirn bieten?«
Derweil Goethe weitere Utensilien auf dem Tisch ausbreitete, um zu entscheiden, welche von ihnen er seinem knappen Marschgepäck hinzufügen sollte, berichtete er seinem Freund, was ihm seinerseits von Carl August und den anderen zugetragen worden war. Schiller zog sich einen Stuhl heran und hörte aufmerksam zu.
Als Goethe geendet hatte, fragte Schiller: »Ist’s Wahrheit, was ich jetzt gehört?«
»Ja.«
»Also kam ich, um Abschied zu nehmen?«
»Nein. Um mich zu begleiten.«
Die Männer sahen einander stumm in die Augen, bis Schiller fragte: »Wie meinen?«
»Ich möchte Sie bitten, mich nach Mainz zu begleiten, weil ich Sie als klugen und rüstigen Streiter kenne und weil ich mir für diesen Auftrag keinen mutigeren Weggefährten wünschen könnte.«
»Hum.«
»Was heißt hier hum? Sie haben doch Mut.«
»Mut hab ich genug, um barfuß mitten durch die Hölle zu gehen – aber warum ich? Warum Sie, wo wir schon davon anfangen? Warum wählen Carl August und dies verschleierte Bild einer Frau ausgerechnet Sie aus? Was ist’s überhaupt, das sich hinter diesem Schleier verbirgt? Und gibt es für eine solche Aufgabe von weltveränderischer Bedeutung keine fähigeren, keine jüngeren Männer? Beispielsweise in der herzoglich Sachsen-Weimarschen Armee? Mainz ist eine Festung.«
»Unabweislich. Aber dies wird keine Belagerung, sondern ein Eingriff. Und da kostet’s Mühe und List; dafür braucht’s keine Soldaten, sondern Denker – gerne auch altersweise Denker«, sagte Goethe. »Zweifeln Sie etwa an der Geschichte des Dauphins?«
»Nein. Die Historie hat mich gelehrt, dass noch viel unwirklichere Begebenheiten wirklich waren. Und, ehrlich zu sagen, ich hatte etwas in der Art bereits vermutet. Ich halte es nur für bedenklich, nein, geradezu unratsam, sich mit dem Dämon der Staatenpolitik anzulegen. Ich dachte, wir beide hätten beschlossen, der Gegenwart zu entsagen und uns nur noch dem zu widmen, was ewig ist – nämlich der Wahrheit und der Schönheit.«
»Aber ich kann nicht tatenlos zusehen, wie Napoleon unser Reich in Brand steckt. Er hat uns Deutschen alle Gebiete links des Rheins entrissen, aus Köln Cologne gemacht, aus Koblenz Coblence und aus Mainz Mayence. Und er wird Deutschland weiter fressen.«
Schiller lächelte. »Der Weltbürger Goethe mit einem Mal so heilig-römisch, so deutsch-national? Das sind ganz ungewohnte Töne aus Ihrem Munde.«
»Wohl, Sie kennen mich besser: Mir ist es im Grunde gleich, ob Mayence hessisch ist oder preußisch oder pfälzisch oder eben französisch, Mainz bleibt Mainz – aber ich fürchte wie der Herzog um unser kleines Weimar, das bleiben soll, was es ist.«
Schiller drehte seinen Stuhl, um die gekreuzten Arme auf der Lehne ablegen zu können. »Lassen Sie mich für einen Moment des Teufels Advokat sein: Käme Napoleon, er schenkte unserm rückständigen Land vielleicht so manchen Fortschritt.«
»Ein Geschenk, eingewickelt mit einem Band aus Blut und Tränen. Seinen Mordsinn kenne ich: Ein Mann, der sich nicht um das Leben von Millionen von Menschen schert; der von sich selbst sagt, es wäre besser für das Heil der Menschheit, er hätte nie gelebt – wenn ich seinen fortschrittlichen Code Civil um den Preis unsrer Kinder Leben bekomme, dann will ich ihn nicht.«
»Und um zu verhindern, dass der Despot den Krieg in unsern Grenzen anzündet, wollen Sie ihn durch einen anderen Despoten ersetzen. Ein Rückfall ins vergangene Jahrhundert, ins Ancien Régime.«
»Es müsste keiner sein!«, rief Goethe aus. Er ging hinüber zum Globus, der nahe dem Fenster stand, und drehte ihn, sodass Tag und Nacht im Sekundentakt verstrichen. »Denn schließlich retten wir Louis-Charles’ Leben, und wir begleiten ihn danach: Bedenken Sie nur, wie groß unser Einfluss auf ihn wäre! Er ist noch jung, er ist empfänglich. Wir können ihn lehren, aus den Fehlern seines Vaters und denen Napoleons zu lernen. Wir können das Kind nach unserm Sinne formen. Wir könnten ihn mit all den Idealen ausstatten, die wir selbst für richtig erachten. Es ist mir bei Carl August gelungen, aus einem vergnügungssüchtigen Springinsfeld einen aufgeklärten, gewissenhaften Herrscher zu bilden, und er hat ein unbedeutendes kleines Herzogtum zu größter Blüte geführt. Kaum auszumalen, was wir beide als Erzieher und Vertraute des Königs der schönsten Monarchie der Welt erreichen könnten!«
Schillers Blick wich von Goethe ab, wanderte einen Moment ziellos im Raum umher und fand schließlich den drehenden Erdball. Er blinzelte. »Warum, bitte, drehen Sie den Globus?«
»Ich weiß es selbst nicht.« Goethe umfasste mit der Hand die Arktis und hielt die Erdkugel an. »Aber eines noch, dann schweige ich: Man soll tun, was man kann, einzelne Menschen vom Untergang zu retten, umso mehr ein unschuldiges und viel gepeinigtes Waisenkind. Louis ist ein würdiger Mensch, und er soll in keinem schimpflichen Gefängnisse verschmachten oder gar enthauptet werden: Die freche Tyrannei, die es wagte, ihn zu fesseln, zückt schon den Dolch, ihn zu ermorden. Sein Hals wäre ein rechtes Fressen für den Scharfrichter. – Selbst wenn es also misslingt, ihn auf den Thron zu heben, will ich zufrieden sein, ihn vom Schafott und vom Schicksal seiner Eltern bewahrt zu haben. Sein Jahrhundert kann man vielleicht nicht verändern, aber man kann sich dagegenstellen und glückliche Wirkungen vorbereiten.«
Schiller nickte mit dem ganzen Oberleib, aber dennoch ganz unscheinbar. Er sagte eine ganze Weile nichts, derweil ihn Goethe, die Hand auf dem Nordpol, betrachtete. Dann erhob sich Schiller, geräuschvoll einatmend, von seinem Stuhl und blickte sein Gegenüber lächelnd an. »Wohlan! Es soll an mir nicht fehlen. Fordern wir unser Jahrhundert in die Schranken. Arm in Arm mit Ihnen kann es nur gelingen.«
Mit funkelnden Augen eilte Goethe Schiller entgegen, und die beiden Freunde packten des anderen Unterarm mit festem Griff.
»Arm in Arm!«, wiederholte Schiller. »Es soll mich kitzeln, Napoleon niederzuringen. Das Ziel ist würdig, und der Preis ist groß!«
»Ich bin überglücklich, mein teurer Freund. Nun fürchte ich mich weder vor Hölle noch Teufel.«
Die beiden lösten ihren Handschlag. »Meine Arbeit macht derzeit eh keine Fortschritte«, sagte Schiller, »da kömmt mir ein Ausflug an Rhein und Main nur gelegen. – Außerdem hat der gestrige Abend wohl zur Genüge bewiesen, dass Sie ohne meinen Beistand aufgeschmissen sind.«
»Woran schreiben Sie?«
»Etwas mit Piraten und einer Meuterei und Menschenfressern und einer Liebe auf hoher See. Aber es will mir so gar nicht von der Hand. Ich überlege bereits, die Piraten über Bord zu werfen und mich an eine Fortsetzung meiner ungemein erfolgreichen Räuber zu wagen.«
Goethe brummte.
»Hörte ich Sie brummen?«
Goethe brummte abermals.
Schiller hob nickend die Hände. »Wohl, Sie brummen zu Recht. Ich werde nichts dergleichen machen. Ich lasse die Räuber in Frieden ruhen, und stattdessen sollen unsre Heldentaten im Dienst des Friedens Inhalt meines nächsten Werkes werden. Lolo allerdings wird mich schelten, wenn ich ihr erzähle, dass ich nach Frankreich muss, und mich nur widerstrebend ziehen lassen. Aber ich war lange genug ein bemooster Philister mit der Nachtkappe auf dem Schädel und der Tobakspfeife im Mund hinterm warmen Ofen; jetzt sage ich dem Lehnsessel und der Seelenessigfabrik Weimar adieu!, ich will wieder den Staub der Straße schmecken, und zum Henker fahre das Privatleben! – Frisch also! Mutig ans Werk! Wann brechen wir auf?«
»Noch heute Nacht. Es fehlt uns freilich noch ein dritter Gefährte. Ein Mann, der sich wie kein Zwoter in Mainz und dem Rheinland auskennt, der Frankreich und seine Sprache so gut beherrscht, dass er selbst für einen Franken gelten könnte, der überdies fränkische Passierscheine besitzt – und der zum Glück gerade in unsrer Stadt weilt.« Goethe nahm seine Grubenlampe vom Tisch und entzündete den Docht an einer der Kerzen. »Wir müssen freilich in die Unterwelt hinabsteigen, um ihn zu finden.«
Schiller legte die Stirn in Falten. »In die Unterwelt? Wer ist es? Der Mephistopheles?«
Goethe lachte. »Nein. Alexander von Humboldt.«
»Oh.«
»Enttäuscht?«
»Von den Brüdern Humboldt ist mir Wilhelm, der Ältere, immer der liebere gewesen. Alexander imponiert sehr vielen und gewinnt im Vergleich mit seinem Bruder meistens nur, weil er ein Maul hat und sich geltend machen kann. Mir ist er suspekt.«
»Ich halte große Stücke auf Alexander. Ich verdanke ihm viel: Meine naturhistorischen Arbeiten sind durch seine Gegenwart wieder aus ihrem Winterschlafe geweckt worden. Ohne seine Ermutigung hätte ich das Studium der Osteologie nicht wiederaufgenommen und das Zwischenkieferbein nie entdeckt.«
Schiller fuhr mit zwei Fingern über den blutigen Riss in seiner Oberlippe. »Nach gestern Nacht bin ich versucht zu sagen: Es wäre besser unentdeckt geblieben. – Ist Humboldt nicht selbst ein halber Franzos? Lebt er nicht viel lieber in Paris denn in seinem heimatlichen Berlin?«
»Er liebt die Franken, aber er hasst Napoleon! Besser könnten wir es gar nicht treffen. Wir haben großes Glück, dass er zurzeit in Weimar forscht. Mein Ehrenwort, dass er sich als nützlich erweisen wird.«
Schiller winkte ab. »Das letzte Mal, als Sie mir Ihr Ehrenwort gaben, bin ich ins Eis eingebrochen.«
Sie liefen durch die Seifengasse und die Gärten zum Park und ein paar Treppen den Abhang zur Ilm hinab. Dort, wo der Hang dem Flussufer am nächsten kam, war ein Tor in den Fels gehauen, von einer Holztür mit schwarzen Eisenbeschlägen bedeckt. Darüber spannte sich ein Bogen aus Steinen, von dem die Eiszapfen hingen. Sie öffneten die Tür und folgten dem Schacht, der von hier durch den Kalkstein südwärts getrieben war. Je tiefer sie kamen, desto wärmer wurde es. Ein schmaler, von Steinplatten bedeckter Kanal war links in den Boden gehauen.
Nach einem kurzen Fußmarsch erreichten sie eine künstliche Höhle, in der im Schein mehrerer Lampen Alexander von Humboldt arbeitete, einen Hammer in der einen und eine grobe Bürste in der anderen Hand. Auf dem sandigen Boden zu seinen Füßen lagen ein Notizbuch und Gesteinsbrocken unterschiedlicher Größe. Auf einigen davon konnte man das Geflecht vorzeitlicher Pflanzen erkennen, andere stellten sich beim zweiten Blick als Knochen und Tierzähne heraus. Mantel und Jacke hatte Humboldt abgelegt, und der Tuffstein hatte sein Hemd und sein Halstuch braun eingefärbt. Auch sein Antlitz war schmutzig, und in die zerzausten Haare war ihm Kalkstein von der Decke gerieselt – doch selbst das konnte sein blendendes Erscheinungsbild nicht trüben. Seine Konturen, sein klarer Blick, der bronzene Glanz seiner tropengebräunten Haut – um so schöner im Vergleich zur Bibliothekarsblässe der beiden Dichter –: So stellte sich Goethe den jungen Faust vor, und wäre Humboldt Schauspieler, nicht Wissenschaftler, Schiller hätte ihn zweifelsohne als den Karl Moor besetzt.
Humboldt traf schier der Schlag, die beiden Weimarer Geistesgrößen vor sich in der Höhle zu sehen. Wiederholt wischte er seine staubige Hand an den Hosenbeinen ab, bevor er sie ihnen reichte. Um den Preußen nicht sofort mit ihrem unerhörten Anliegen zu überfallen, erkundigte sich Goethe erst nach dessen Forschungen – worauf Ersterer allerdings eine so umfassende Beschreibung der hiesigen Geologie und der fossilen Funde begann, dass Goethe ihn schließlich unterbrechen musste. Die Hände in die Hüften gestützt, lauschte nun Humboldt seinerseits den Ausführungen des Dichters den Dauphin betreffend. Dabei erwähnte Goethe freilich nur die Errettung, nicht aber die beabsichtigte Restauration Ludwigs XVII., und ebenso nannte er bis auf des Herzogs Namen keinen anderen. Während des Vortrags musterte Schiller Humboldt aus dem Winkel seiner Augen.
Goethe schloss mit der Bitte, Humboldt möge sich ihnen anschließen, worauf jener antwortete: »Ich habe mich bislang immer aus der Politik herausgehalten, denn sie ist eine der wenigen Wissenschaften, die mich nie interessiert haben – und ich meine, dass mir die Politik immer nur geschadet, nie aber genützt habe. Dennoch: Wenn mich die beiden Dioskuren von Weimar um meine Hilfe bitten, wäre ich ein Narr, nicht zu helfen. Ihnen, meine Herren, einen Wunsch abzuschlagen hieße Halbgöttern einen Wunsch abzuschlagen. Zählen Sie auf mich, ich begleite Sie mit Freuden, wohin immer Sie wollen, und sei es direkt in den Louvre.«
Erfreut bot Goethe seine Hand an, worauf Humboldt die seinige erneut am Hosenbein säuberte und ihm reichte.
»Und Ihre Steine?«, fragte Schiller beim Händedruck.
»Meine Fossilien werden getrost eine weitere Woche warten können, nachdem sie zirka einhunderttausend Jahre auf mich gewartet haben.«
Goethe wies auf die Geheimhaltung und die Eile ihres Projekts hin, und Humboldt versicherte, binnen einer Stunde reisefertig zu sein, denn er sei es gewohnt, schnell und mit leichtem Gepäck zu reisen. Während er seine Funde sortierte, verließen die anderen die Höhle. Draußen war es inzwischen ebenso dunkel, und nur dank Goethes Lampe fanden sie sicheren Trittes zurück in die Stadt. Am Frauenplan trennten sich die beiden.
In der Küche des Goethehauses warteten Christiane, August und Geheimrat Voigt beinahe schweigend auf des Dichters Rückkehr. Christiane hatte Voigt einen Tee serviert, und mit ihren Tassen gingen die beiden Räte hinauf ins Urbinozimmer. Dort entnahm Voigt einem ledernen Portefeuille deutsche und französische Wechsel und Münzen im Wert von zweitausend Reichstalern, je ein Dritteil zusammengelegt von Frau Bottas Emigrés und den Regierungen Sachsen-Weimar-Eisenachs und Großbritanniens; dazu hinlängliche Passierscheine aus der Kanzlei des Herzogs für freies Geleit im Reich; ferner eine Karte von Rheinhessen und eine von Mainz und schließlich die handgefertigte Kopie einer Skizze des Deutschhauses in Mainz, Sitz der französischen Präfektur und damit Ort des Tribunals über Louis-Charles de Bourbon. Voigt wies auf ein Porträt des Herzogs, das im Zimmer hing, und richtete abermals dessen Wünsche für ein gutes Gelingen der Mission aus und die eindringliche Bitte, Goethe möge sich bei den Tollhäuslern von Mainz auf keinen Fall in Lebensgefahr begeben. Alle weiteren Fragen würde Sir William beantworten können, der ihn mit seinen Männern bis Eisenach begleiten sollte.
Als Voigt fort war, widmete sich Goethe wieder seiner Ausrüstung. Christiane kam herauf, die Hände in der Schürze vergraben, und als sie die Banknoten sah, brach sie in Tränen aus, denn das Geld jetzt und Voigts höfliches Schweigen soeben waren ihr Indiz genug, dass ihr Wolfgang eine Reise antrat, die vielleicht seine letzte sein konnte. Er nahm sie in den Arm, drückte sie und trocknete ihre Tränen mit dem Ärmel seines Gehrocks. Er versprach, gut auf sich achtzugeben und nicht in Frankreich oder sonst wo in der Ferne, sondern einzig in seinem heimischen Lehnsessel zu sterben. Nach einem zärtlichen Kuss ging Christiane, ihm einen Reiseproviant zuzubereiten. Goethe schloss seinen Ranzen, schnürte eine schwere Decke darüber und verstaute seine Pistolen im Futteral. Die Zeit reichte noch aus, ein heißes Bad zu nehmen, das ihm sein Diener Carl bereitete und dessen Wirkung und Wohltat, so mutmaßte Goethe, für etwelche entbehrungsreiche Tage vorhalten musste.
Humboldt wartete bereits in der Tür des Goethehauses, zu seinen Füßen ein Tornister, als Goethe Schlag acht vors Haus trat. Es hatte zu schneien begonnen, und der Frauenplan lag dunkel und verlassen vor ihnen. Schiller stieß wenig später hinzu, einen langen Knotenstock in der Hand. Auch er trug einen Ranzen, an den er eine Armbrust gegurtet hatte. »Sie sind verwundert ob des seltsamen Gerätes auf meinem Rücken?«, fragte Schiller. »Nun, ich bin ein Meister auf der Armbrust. Diese stille Waffe ist der schnöde-lärmenden Pistole allezeit vorzuziehen. Ich nehme es auf mit jedem Schützen!«
Schiller war rasch gelaufen und nahm einen so tiefen Atemzug der kalten Luft, dass er hernach heftig husten musste. Goethe erkundigte sich, ob des Freundes angeschlagene Gesundheit überhaupt zulasse, die zu erwartenden Strapazen auf sich zu nehmen, worauf jener, nachdem er mit einem Schnupftuch die Mundwinkel getrocknet hatte, lächelnd erwiderte: »Diese Frage muss ich mir nicht von einem Mann stellen lassen, der zehn Jahre älter ist als ich.«
Humboldt wies die beiden auf eine vermummte Gestalt hin, die sich ihrer Gruppe von der Brauhausgasse her näherte. Goethe sah, dass es nicht der Brite war, und vermutete bereits einen Bonapartisten – da erkannte er den dichtenden preußischen Leutnant, der ihn am Mittag angesprochen hatte. Der Mann sah so durchfroren aus, als hätte er seitdem nicht einmal seine Finger am Kamin wärmen können. Er wünschte den beiden anderen, ohne sie hinter ihren schweren Schals zu erkennen, einen guten Abend und fragte Goethe, ob dieser inzwischen sein Lustspiel gelesen habe.
»Beileibe nicht«, antwortete der und erinnerte sich erst jetzt daran, dass er die Abschrift im Audienzsaal des Schlosses vergessen hatte. »Denn von allen Tagen, die Sie hätten auswählen können, haben Sie mich heute denkbar geschäftig angetroffen. Es tut mir leid, aber ich muss Sie vorerst vertrösten. Gute Nacht.«
»Wann werden Sie es lesen?«
»Sobald ich die Zeit dazu finde, aber das wird noch ein Weilchen hin sein. Gute Nacht.«
Der Leutnant warf einen Blick auf das Gepäck der drei. »Sie verreisen? Wohin?«
»Mit Verlaub, mein junger Freund, das darf ich Ihnen leider Gottes nicht anvertrauen. Nun gute Nacht.«
Aber der junge Mann ließ sich nicht vertreiben. Er starrte lange auf Goethes Ranzen, und als er wieder aufsah, hatten sich seine Wangen gerötet, und sein Ton war harsch. »Wieland sagt, ich werde die große Lücke in der dramatischen Literatur ausfüllen, die nicht einmal Sie und Herr von Schiller haben ausfüllen können. Ich werde Sie dereinst übertreffen, sei es mit oder ohne Ihre Unterstützung.«
Goethe wechselte einen amüsierten Blick mit Schiller. »So, sagt Wieland das? Nun, ich werde mich bei der Lektüre Ihres Stückes hoffentlich davon überzeugen können.«
»Nein. So lange warte ich nicht. Ich habe Ihr Urteil nicht nötig. Geben Sie mir das Werk zurück.«
»Ah«, sagte Goethe und räusperte sich. »Ich bitte um Verzeihung, aber ich habe es nicht bei mir. Es liegt derzeit im Schloss.«
»Was Henker! Ich hatte Sie doch ausdrücklich angewiesen, es nicht aus der Hand zu geben!«
»So beruhigen Sie sich. Es ist dort so sicher wie der Stern am Himmel und wird gewiss nicht abhanden kommen.«
Der Leutnant betrachtete Goethe mit schwerem Blick. »Gut – – Sie missachten mich. Sie missachten mich, weil Sie mich nicht kennen, und dafür hasse ich Sie. Leben Sie also wohl. Ich wünsche, dass Ihnen die Achse unter dem Hintern wegbricht und Sie nimmer von Ihrer Reise heimkehren mögen!«
Auf dem Absatz machte er kehrt, bevor Goethe etwas auf diese hitzige Rede erwidern konnte. Die drei Männer sahen ihm nach, wie er wutentbrannten Schrittes den Frauenplan überquerte und im Schneetreiben entschwand. Humboldt war der Letzte, der seinen Blick von ihrem nächtlichen Besuch löste.
»Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort«, meinte Schiller.
»In der Tat. Eben noch verehrt, jetzt schon verwünscht.« Goethe schüttelte den Kopf. »Dass doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt!«
»Ein zuckersüßes Bürschchen, in der Tat. Wer war die Kanaille?«
»Ein Leutnant aus Preußen, der nun Poetaster ward. Und bis vor einer Minute noch ein glühender Bewunderer meiner Kunst.« Als Schiller schmunzelte, fügte Goethe hinzu: »Spotten Sie nicht. Ein jeglicher muss sich einen Helden wählen, dem er die Wege zum Olymp hinauf sich nacharbeitet. – Wieland schickt einem doch immerzu die kauzigsten Menschen. Hoffen wir nur, dass auch aus diesem absurden Most zuletzt ein guter Wein wird.«
Endlich bogen nun auch vier königlich-britische Dragoner um die Ecke, gefolgt von einer zweispännigen Berline mit schwarzem Verdeck und brennenden Laternen rechts und links des Kutschbocks. Sie halfen dem schweigsamen Kutscher beim Aufladen ihres Reiseguts und stiegen dann zu Sir William in die Kabine. Mit einem Schlag seines Stocks gab der Brite das Signal zum Aufbruch, und während sich die Männer mit Kissen und Decken bequem und warm einrichteten, preschte die Kutsche mit ihrem Geleit auf der Erfurter Chaussee stadtauswärts.
3
FRANKFURT
Am Abend des darauf folgenden Tages erreichten die Gefährten die letzte Poststation vor Eisenach, wo die Pferde gewechselt wurden. Von der Anhöhe, auf der die Herberge lag, konnten sie bereits die Stadt sehen und die trutzige, schneebestäubte Wartburg in den Tannenhängen darüber. Sir William wurde von einem britischen Leutnant in Zivil erwartet, der ihnen die Botschaft übermittelte, dass Fouchés Männer Madame de Rambaud in Paris aufgetrieben hätten und nun über Luxemburg und Trier Richtung Mainz aufgebrochen seien. Dort würde das Kindermädchen spätestens in einer Woche eintreffen, und diese sieben Tage musste Goethe nutzen.
Sir William Stanley nahm jetzt Abschied, denn es war vereinbart, dass sich die Dragoner auf der Wartburg einrichten würden. Dort, auf sicherem deutschem Boden, in der Deutschen sichersten Burg, würde der Engländer auf Goethe warten und den Dauphin empfangen, um von hier aus eskortiert weiterzureisen, entweder nach Weimar oder nach Berlin oder gleich nach Mitau in Kurland, wo der Comte de Provence auf Einladung Zar Alexanders Hof im Exil hielt. Erst dann würde man die weiteren Schritte zur Absetzung Napoleons I. und zur Thronfolge Ludwigs XVII. beraten. Die Kutsche aber und ihr Kutscher – ein russischer Diener der Madame Botta mit Namen Boris, die Physiognomie eine originelle Mischung aus Spitzbüberei und Laune – standen weiter uneingeschränkt zu Diensten Goethes und seiner Begleiter.
Stanley, der die Fahrt hindurch recht still und maulfaul gewesen war, sprach nun aus, was ihm auf der Seele lastete. »Ich ahnte bereits, dass Ihre Gruppe klein werden würde, aber dass sie derart klein ist, überrascht mich doch. Wollen Sie mir erklären, Herr Geheimrat, wie Sie es anstellen wollen, mit der Hilfe zweier Zivilisten den König von Frankreich aus seiner Festungshaft zu befreien?«
»Nein, das will ich nicht«, erwiderte Goethe. »Denn neben Raschheit ist vor allem Verschwiegenheit geboten, und sollten Sie dem Feind in die Hände fallen, wovor Gott sei, oder gar dem Feind angehören, ist es besser, Sie wissen nichts von meinen Plänen.«
Sir William quittierte Goethes Entschluss mit einem Nicken. Dann nahm er einige Papiere aus seiner Tasche. »Sie haben dies im Schloss vergessen. Der Herzog bat mich, es Ihnen mitzugeben.« Es war die Komödie des zornigen jungen Dichters.
Während Stanley und seine Soldaten zur Wartburg ritten, passierte die schwarze Kutsche ohne Halt Eisenach. Die Passagiere breiteten Brot, Wurst und Schinken zum abendlichen Mahl auf der Pritsche aus, und Goethe entnahm einer mitgegebenen Kiste des Herzogs eine der vier Flaschen Champagnerweins, die darin in Stroh gebettet lagen. Er klopfte mit dem Fingernagel gegen das grüne Glas. »Carl August mag die Franken nicht leiden, doch ihre Weine trinkt er gern.«
»Sie haben vor dem Engländer geschwiegen, aber uns werden Sie Ihren Plan doch sicherlich anvertrauen«, sagte Humboldt, während er sich eine Ecke vom Brotlaib schnitt.