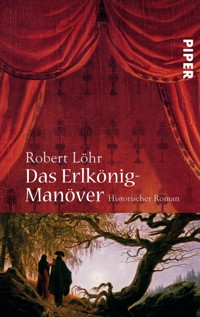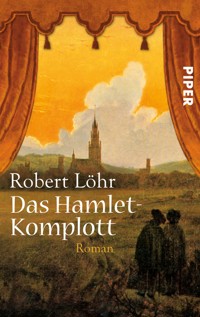
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1807: Während Napoleon I. Deutschland mit Krieg überzieht, gibt in der schwäbischen Provinz ein seltsames Wandertheater einen noch viel seltsameren Hamlet. Und verstünde die französische Geheimpolizei mehr von William Shakespeare, sie hätte längst Lunte gerochen. So aber ahnt keiner, dass sich hinter dem fahrenden Schauspieltrupp Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich von Kleist, August Wilhelm von Schlegel, Ludwig Tieck und Napoleons Erzfeindin Madame de Staël höchstpersönlich verbergen, die sich, als Schauspieltrupp getarnt, in höchst geheimer Mission befinden. In ihrem Gepäck: die tausendjährige Reichskrone, die Kleist auf einer Insel im Bodensee ausgegraben hat. Nun gilt es, die größte Krone der Christenheit nach Preußen zu schaffen, um sie vor Napoleon in Sicherheit zu bringen, der sich mit ihr zum Kaiser von Europa krönen will … Mit gewohntem Witz und profunder Kenntnis »seiner« Klassiker und Romantiker beschert Robert Löhr uns einen höchst vergnüglichen, überaus spannenden historischen Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95098-5
© Piper Verlag GmbH, München 2010
Umschlaggestaltung und Illustration: Cornelia Niere, München
Umschlagbild: Casper David Friedrich, Neubrandenburg
© Pommersches Landesmuseum, Greifswald
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Überhaupt glaube ich, dass man wohl tun würde, immer nur die allgemeine Situation, die Zeit und die Personen aus der Geschichte zu nehmen und alles übrige poetisch frei zu erfinden, wodurch eine mittlere Gattung von Stoffen entstünde, welche die Vorteile des historischen Dramas mit dem erdichteten vereinigte.
FRIEDRICH SCHILLER, Brief an Goethe (20.8.1799)
1
JENA
Den Morgen des 14. Oktober 1806 verbrachte Goethe im Garten über seiner Farbenlehre, derweil Napoleon vier Wegstunden ostwärts die preußische Armee zermalmte. Der Tag war zwar kalt, aber ausnehmend heiter, dienlich also für beider Anliegen, waren die Farben durchs Prisma doch ebenso klar zu erkennen wie die bunten Röcke der preußischen Soldaten. Morgens hatte die Schlacht begonnen, mittags schon befanden sich die Preußen auf der Flucht, derweil auf den Hügeln vor Jena zehntausend Mann verbluteten. Als das Donnergrollen der französischen Artillerie sich Weimar näherte, raffte Goethe verdrießlich Papier, Feder und Farben zusammen und ging zurück ins Haus.
Am späten Mittag speiste man gemeinsam, wie üblich, dann aber wurde Weimar zur Szenerie des Kriegstheaters, und als die ersten Kanonenkugeln durch die Dächer der Stadt schlugen, ward die Mahlzeit vorzeitig beendet. Goethe ließ Türen und Fensterläden verschließen. Wie eine Flutwelle den Unrat vor sich herspült, so stürzten nun die Überreste der preußischen Bataillone durch die Gassen der Stadt: Offiziere und Soldaten, Deserteure und Verwundete in wilder Auflösung begriffen, dazwischen Pferde und Wagen. Was immer bei der Flucht behinderte – seien es Gewehre, Säbel oder Tornister –, warf man schlicht von sich, dass die Nacheilenden darüber stolpern mussten. Dann kamen die Franzosen.
Aus Übermut, aber auch weil es mittlerweile dunkel geworden war, warfen die siegreichen französischen Fußsoldaten Fackeln in einige Häuser, und im Licht der Brände begann die Plünderung der Stadt. Preußen hatte die Schlacht verloren, aber Weimar musste die Zeche zahlen: Wessen Haus nicht angesteckt oder von einer Kanonenkugel durchbohrt wurde, dem wurde doch zumindest die Tür eingetreten, die Speisekammer und der Weinkeller ausgeräumt und Wäsche und Silber entwendet, und er konnte sich glücklich schätzen, wenn er und seine Familie die Plünderung mit heiler Haut überstanden hatten und die Franzosen lauthals singend weiterzogen: Wir plündern, wir futtern, wir bechern, wir schüren den Brand auf den Dächern.
Goethes Haus am Frauenplan ward verschont, denn hier sollte Marschall Ney höchstselbst samt seiner Entourage untergebracht werden. Doch der Maréchal de France blieb vorerst aus, und statt seiner quartierten sich sechzehn Husaren aus dem Elsass im Untergeschoss ein, die mit Brot und Pasteten verköstigt wurden und – die Schlacht in den Knochen und Goethes Wein im Blut – bald einschliefen. Weit nach Mitternacht gingen auch die restlichen Bewohner des Hauses zu Bett, die Gesänge der Marodeure als hässliches Wiegenlied im Ohr.
Goethe hatte noch keine Stunde geschlafen, als er durch Kolbenschläge gegen die Haustür wieder geweckt wurde. Riemer, der Hauslehrer von Goethes Sohn, trat in den Flur und rief den Franzosen durch die geschlossene Tür zu, dass das Haus unter dem Schutz Marschall Neys stehe, doch das scherte die Ankömmlinge nicht; vielmehr drohten sie, die Tür einzuschlagen, sollte man ihnen weiterhin den Einlass verweigern. Riemer öffnete also und ließ die drei Füsiliere herein. Auch ihnen brachte er Wein und kalte Speisen. Sie hatten deutlich mehr Durst als die Elsässer, aber deutlich weniger Anstand, und nach vollendetem Nachtmahl warfen sie sich samt Weinflaschen ungeniert in jene Betten, die man im Obergeschoss für Napoleons tapfersten General vorbereitet hatte.
An Schlaf war nun nicht mehr zu denken. Goethe wälzte sich von einer Seite zur anderen und lauschte den Geräuschen der Nacht: Rufe, Schüsse, Gelächter. Hin und wieder ging ein Fenster zu Bruch. Irgendwann fing einer der französischen Rüpel das Schnarchen an. Und schließlich hörte Goethe, wie eine Münze zu Boden fiel und einen Augenblick über die Dielen kreiselte, bevor sie von einem Stiefel zum Schweigen gebracht wurde.
Als Goethe in den Salon trat, stand vor dem aufgebrochenen Münzschrank, ihm den Rücken zugewandt, einer der drei Füsiliere, noch immer in voller Montur, darüber einen weißleinenen Kittel und am Dreispitz einen Blechlöffel. Eine nach der anderen klaubte er die Münzen aus ihrem samtenen Lager und stopfte sie in seine Patronentasche. Die fernen Flammen eines brennenden Hauses genügten, die Szenerie vollends zu beleuchten. Noch während Goethe unschlüssig auf der Schwelle verharrte, wurde der Franzose seiner gewahr. Augenblicks griff er zu seiner Muskete, die er gegen den Münzschrank gelehnt hatte, und setzte dem Hausherrn das Bajonett auf die Brust. Bevor Goethe einen Ton herausgebracht hatte, herrschte ihn der Soldat an, der verdammte Preuße möge sich umgehend zurückziehen, widrigenfalls würde er aufgespießt wie ein Hühnchen über dem Feuer.
Mit aller Autorität, die Goethe, barfüßig im Nachthemd, die Mütze auf dem Kopf, noch aufbringen konnte, erklärte er, dass er primo kein Preuße, sondern vielmehr Thüringer sei, dass er secundo den Raub seiner numismatischen Sammlung nicht dulden wolle und dass tertio Marschall Ney jeden Moment hier eintreffen könne – worauf der Löffelmann Goethe mit lautstarken Beschimpfungen in einem unappetitlichen Dialekt das Wort abschnitt.
Als Christiane, durch den Radau wachgerufen, in den Salon kam, griff Goethe gerade nach der Patronentasche des Soldaten, in der sich die Beute befand. Der Franzose stieß Goethe von sich, legte an und spannte den Hahn. Christiane griff nach der nächsten Waffe in Reichweite – aus Goethes Mineraliensammlung eine Druse von der Größe eines Brotlaibs – und schlug sie dem Franzosen auf den Kopf. Es krachte hohl. Beide fielen zu Boden wie ein Stein, der Stein und der Franzose. Goethe und Christiane blickten schweigend auf das Desaster zu ihren Füßen. Im Nachbarzimmer schnarchte der Kamerad des Füsiliers. Niemand im Haus schien den Streit bemerkt zu haben.
»Danke«, sagte Goethe.
»Bitte«, entgegnete Christiane. »Gut, dass der Stein zur Hand war.«
»Es ist kein Stein, meine Liebe, sondern ein Goethit aus einem Bergwerk im Sieger Land. Beachte nur die planvolle Anordnung der Kristalle im Innern! Was für ein sorgsamer Baumeister ist doch die Natur.«
Während Goethe die aufgeschnittene Druse in seiner Hand drehte, als sähe er sie zum ersten Mal, schaute Christiane nach dem Niedergeschlagenen.
»Ich werde das Ney erklären können«, sagte Goethe und wies auf die Münze, die der Franzose noch immer in einer Hand umklammert hielt. »Wenn der Kerl morgen früh erwacht, darf er diese da behalten, für die erlittenen Kopfschmerzen, und alle gehen zufrieden ihrer Wege.«
»Er ist tot.«
»Wie bitte?«
»Er ist tot.«
»Sag nicht tot!«
»Aber er ist tot. Sein Herz schlägt nicht mehr, Gott steh uns bei. Er ist tot!«
»Ich ertrag das Wort nicht. Sag: Er ist hin.«
»Mein lieber Geheimrat, hin ist hin und tot ist tot! Haben wir nicht andere Sorgen als die Wahl der Worte? Vor der Türe ist Krieg, nebenan schlafen ein und ein halbes Dutzend feindliche Soldaten, und in Ihrem Salon liegt ein Toter!«
»Sag nicht Toter!«
Goethe trat, um ein paar Schritte Abstand von der Leiche zu nehmen, ans Fenster, wischte sich die Hände in den Falten seines Schlafrocks sauber, obwohl er den Mann seit dessen Dahinscheiden gar nicht mehr berührt hatte, und versuchte sich ganz auf das zu konzentrieren, was nun zu tun sei. Draußen auf dem Frauenplan stöberten im Feuerschein einige Infanteristen nach Brauchbarem in dem Gerümpel, das die fliehenden Preußen zurückgelassen hatten. Ein Chasseur schoss auf ein herrenloses Schwein, das offensichtlich im Tumult ausgebrochen war, verfehlte es aber.
»Man wird uns vor ein Kriegsgericht stellen und erschießen lassen«, sagte Christiane.
»Nicht doch. An einem Tag wie heute fällt ein Opfer mehr oder weniger nicht ins Gewicht. Wir erzählen seinen Kameraden einfach, er wäre vorzeitig wieder aufgebrochen.«
»Und der Leichnam?«
»Schaff ihn fort. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus.«
»Aber wohin?«
»Ich weiß es nicht, ich habe keine Idee. Riemer soll dir helfen. Verscharrt ihn, verbrennt ihn, werft ihn in den Fluss; ich will gar nicht wissen, was ihr mit ihm macht. Nehmt seine Flinte mit.«
Derweil Christiane also zu Riemer eilte, klaubte Goethe mit zitternden Fingern seinen Besitz wieder zusammen – mit Ausnahme der Münze in der Faust des Toten, einer Gedenkmünze zur Kaiserkrönung Franz’ II. »Die gib dem Charon«, murmelte er –, und während Christiane und Riemer den Franzosen so leise wie möglich die Treppen hinabtrugen – sie an den Stiefeln, er unter den Achseln –, legte Goethe die Münzen zurück an ihren angestammten Platz im Schrank. Dann bürstete er den Teppich sauber und versteckte das Mordwerkzeug, den Goethit, zwischen den anderen Mineralien im Arbeitszimmer.
Ney kam mit seinen Männern im Morgengrauen, und als der Marschall erfuhr, dass Soldaten in den Zimmern schliefen, die man für ihn hergerichtet hatte, zog er den Säbel blank, stürmte ins Obergeschoss und trieb die insolenten Kerls mit der flachen Klinge aus den Betten. Ihnen blieb nicht einmal die Zeit, sich anzukleiden, geschweige denn sich nach dem Verbleib ihres Kameraden zu erkundigen. Drei Tage darauf, als der französische Generalinspekteur der Künste und Leiter des Musée Napoléon, Baron Dominique Vivant Denon, mit seinem Assistenten bei Goethe vorsprach, um dessen Kunstbesitz, insbesondere aber dessen numismatische Sammlung zu besichtigen, war auch der Schaden am Münzschrank behoben und damit die letzte Spur dessen beseitigt, was sich in der Schreckensnacht zugetragen hatte.
Und so blieb die Bluttat, die Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe und Christiane Vulpius leicht den Kopf hätte kosten können, ohne Nachspiel – mit einer Ausnahme: Fünf Tage nach der Schlacht von Jena nahm Goethe die Vulpius, seine langjährige Gefährtin und die Mutter seines Kindes, zur Ehefrau. Außer dem Brautpaar und Oberkonsistorialrat Günther waren nur Goethes Sohn und Riemer, die beiden Trauzeugen, anwesend. In der Jakobskirche, die noch am Vortag Lazarett gewesen war und kaum vom Blut der verwundeten Preußen gereinigt worden, feierte die Familie Goethe nun ihr Freudenfest. In die Trauringe ließ Goethe aber nicht das Datum der Trauung eingravieren, sondern den Tag der Schlacht von Jena, den 14. Oktober des Jahres 1806.
2
WEIMAR
Mitte Mai des darauffolgenden Jahres leitete Goethe die Proben zur Iphigenie auf Tauris. Mit seiner Laune war es nicht zum Besten bestellt, denn einige Schauspieler hatten erhebliche Lücken im Text aufgewiesen oder sich eben so sehr auf den Text konzentriert, dass sie darüber ihr Spiel ganz vergessen hatten. Zudem hatte ein ungeschickter Bühnenarbeiter mittelst seiner Leiter das Standbild der Diana vom Postament zu Boden gestoßen, wo es in tausend Teile zersprungen war. Vollends jedoch verlor Goethe die Geduld, als in der Hadesvision des Orest die Verstorbenen Atreus, Thyestes und Klytämnestra aus der Versenkung auftauchen sollten, der Hubboden sich aber plötzlich verkeilte und weder auf- noch abwärts wollte, sodass von den unglücklichen Atriden nur die Häupter in der Oberwelt erschienen, derweil ihre Körper in der Unterwelt gefangen blieben. Goethe brach die Probe unwirsch ab und gewährte den Schauspielern eine Pause, bis der Maschinist den Hubboden wiederhergestellt hatte. An der Bühnenkante lief er auf und ab, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, und jedermann mied es, ihm in die Augen zu sehen.
Am selben Abend sollte die Premiere sein: die erste Iphigenie seit Kriegsbeginn. Nach den Gefechten bei Jena und Auerstedt war Napoleon von Schlacht zu Schlacht und von Sieg zu Sieg geschritten; stolze Festungen wie Erfurt, Magdeburg, Spandau, Küstrin und Stettin hatten sich kampflos den Franzosen ergeben. Schon zwei Wochen nach dem Gewaltstreich von Jena war Napoleon in Berlin einmarschiert, während sich Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise bereits auf der Flucht in den östlichsten Zipfel Ostpreußens befanden: nach Memel, das nun Preußens provisorische Hauptstadt geworden war. Erst in der Koalition mit Russland, so hatte es den Anschein, hatte sich das Kriegsglück der preußischen Armee wieder gewendet, und im Februar, im Schnee- und Blutgestöber von Preußisch-Eylau, hatte man den Franzosen erstmals die Stirn bieten können. Aber das war Goethe gleich. Ostpreußen war fern, und sein Herzogtum hatte sich unmittelbar nach der Plünderung Weimars eh der Gnade Napoleons ergeben und war dem Rheinbund beigetreten.
»Ich mache mir Sorgen um die heutige Vorstellung«, sagte Goethe zu Kirms, der mit einigen Papieren in der Hand zu ihm auf die Bühne kam.
»Ich auch«, erwiderte der Hofkammerrat, »aber vermutlich aus anderen Gründen als den Ihrigen. Es sind noch zahlreiche Billets nicht verkauft, und ich fürchte beinahe, Sie werden heute Abend vor einem schütteren Parterre spielen. Der Kotzebue hingegen, übermorgen – restlos ausverkauft.«
»Wie schön. Haben Sie noch weitere kluge Ratschläge für meinen Spielplan, von Kotzebue einmal abgesehen?«
»Ja. Geben Sie künftig weniger Schauspiele und mehr Opern.«
»Weshalb?«
»Weil der Herzog höchstpersönlich darum bittet.«
»Respektive …«
»… respektive, ja, Frau Jagemann, die ihm, wie wir beide wissen, diesen Floh ins Ohr gesetzt haben dürfte.« Als Goethe die Augen verdrehte, fügte Kirms hinzu: »Es tut mir leid. Aber haben wir eine Wahl? Sich des Herzogs Mätresse zu widersetzen hieße, sich dem Herzog zu widersetzen.«
»Geben Sie mir Ihre Schlüssel.«
»Wozu brauchen Sie meine Schlüssel?«
»Ich will in den Hades hinabsteigen und nachschauen, weshalb dieser Teufel von Maschinist so lange braucht.«
Kirms überreichte Goethe das große Bund mit Schlüsseln für sämtliche Türen des Theaters und verschwand. Doch bevor auch Goethe die Bühne verlassen konnte, sprach ihn Amalie Wolff-Malcomi an, noch immer im Kostüm der Iphigenie, um Goethe einen Besucher anzukündigen, der schon seit geraumer Zeit im Foyer warte. Obwohl Goethe wenig Lust auf einen Besucher hatte, noch weniger auf einen unbekannten, unangemeldeten, bat er Amalie, diesen zu ihm auf die Bühne zu bringen.
Einer der Kulissenmaler, über und über weiß befleckt, brachte indes die neue Statue der Diana herein, die er aus Gips geschaffen hatte. Da der Gips noch nicht vollends getrocknet war, stellte er sie mit größter Vorsicht vor Goethe ab. Der Plastik merkte man die Eile, in der sie entstanden war, deutlich an, und so war sie nur ein ärmlicher Ersatz für das zerstörte Standbild. »Das ist sie, Herr Geheimrat«, sagte der Künstler.
»Wer? Die Brockenhexe?«
»Nein. Diana. Die jungfräuliche Göttin.«
»Jungfräulich?«, fragte Goethe und versuchte, bei der Statue ein Vorne und ein Hinten auszumachen. »Sie schaut eher aus, als stünde sie kurz vor der Niederkunft. Oder betrachte ich die Gute falsch herum und blicke in Wahrheit auf ihren Buckel?«
»Das ist der Faltenwurf ihres Gewandes«, erklärte der Mann betreten. »Halten zu Ehren, Euer Exzellenz, aber in so kurzer Zeit kann ich keine Meisterwerke schaffen.«
»Und deswegen, meinen Sie, sollen Orest und Pylades heute Abend das Standbild dieser ungestalten Gorgone stehlen?«
Amalie führte nun den Besucher heran, in dem Goethe zu seinem Erstaunen und zu seiner Freude keinen Geringeren als Ludwig Tieck erkannte: ein jugendlich-frisches Gesicht mit forschenden braunen Augen und ein Leib, den die Gicht hier und da hatte verwachsen und vorzeitig altern lassen. Tiecks Kopf lag immer etwas tiefer zwischen den Schultern, als wollte er sich permanent verneigen.
»Der junge Tieck! Was bringen Sie mir Gutes?«, sagte Goethe mit freundlicher Stimme. »Verzeihen Sie, dass ich Sie habe warten lassen.«
Tieck ergriff die dargebotene Hand und bedankte sich zugleich bei Amalie, dass sie ihn geleitet hatte. Die Schauspielerin verabschiedete sich mit einem Lächeln und einer gezierten Verbeugung.
»Freilich ist es eine Weile schon, dass wir uns nicht gesehen haben«, sagte Goethe.
»Sie luden mich zu einem schmackhaften Mittagsmahl«, entgegnete Tieck. »Zwei Wochen später brach der Krieg aus.«
»Ach ja, der Krieg. Nun teilt sich unser Leben also auf – in die Zeit vor dem Krieg und in die nach dem Kriege. Ich hoffe, Sie haben bislang nicht allzu viele Federn lassen müssen.«
»Ich habe, danke der Nachfrage, den Kopf eingezogen und die Schlachtfelder gemieden, wo ich nur konnte.«
»Das hätte ich auch gerne getan, nur kam in unserm Falle das Schlachtfeld zu uns. Haben Sie beim Hereinkommen die Delle gesehen, die uns eine französische Kanonenkugel ins Theater gedrückt hat? Wir haben uns in diesem Krieg wahrlich eine blutige Nase geholt. Preußen hingegen holt sich den Tod.«
Tieck warf einen Blick auf den pikierten Kulissenmaler und das Werk vor ihm. »Ich will Sie nicht lange inkommodieren, Herr von Goethe. Ich sehe, Sie haben zu tun.«
»In der Tat. Diese Woche vergeht unter angehender Theaterqual. Ich bin umringt von Krämerseelen, Einfaltspinseln und Pfuschern. Auf dieser Bühne bin ich Gott, aber ich bin dem wahren Gott darin ähnlich, dass er immer geschehen lässt, was er nicht will. Sehen Sie sich beispielshalber dieses Götterstandbild an. Es soll die Diana darstellen, wurde mir versichert. In wenigen Stunden hebt sich der Vorhang zur großen Neuinszenierung der Iphigenie auf Tauris, und alles, was ich habe, ist hier dieser Golem von Prag«, sagte Goethe und drückte einen Finger in den weichen Gips.
Schon wollte der Künstler abermals gegen den Tadel protestieren, da sagte Tieck: »Legen Sie ein Tuch darüber.«
»Ein Tuch?«
»Verhüllen Sie Ihre Diana mit einem Seidentuch, sodass sich ihre Physiognomie darunter nur andeutet. Verhüllt ist das Standbild geheimnisvoller, prächtiger und heiliger, als es das größte Meisterwerk unverhüllt je sein könnte. – Und Pylades hat ja wohl allen Grund, das kostbare Bild der Göttin vor dem Transport sorgsam zu verpacken.«
Goethe schaute zum Kulissenmaler, der Kulissenmaler schaute zu Goethe und nahm dann wortlos seine viel gescholtene Plastik wieder auf, um mit ihr nach einem passenden Tuch zu suchen.
»So haben Sie mir sehr schnell zumindest eine meiner unzähligen Sorgen nehmen können«, sagte Goethe. »Womit kann im Gegenzug ich Ihnen behilflich sein?«
»Nicht so sehr mir als vielmehr einem gemeinsamen Bekannten. Die Rede ist von Heinrich von Kleist.«
»Kleist? Aha. Was ist mit ihm?«
»Er ist in Kriegsgefangenschaft geraten. Wodurch er den französischen Behörden verdächtig wurde, weiß ich nicht zu sagen, aber man schickte ihn nach Joux, eine Festung nahe der Grenze zur Schweiz. Der Vorwurf lautet auf Spionage. Man hält ihn dort sicherer verwahrt als jeden Schwerverbrecher.«
Noch während Goethe nach Worten suchte, um seine Betroffenheit auszudrücken, nahm Tieck einen Brief aus seiner Weste und überreichte ihn Goethe. Er war an Tiecks Adresse in Ziebingen adressiert. Goethe zog den Brief aus dem Couvert und erkannte sofort die unleserliche Handschrift Kleists.
Mein verehrungswürdigster Freund,
ich wende mich in meiner bittren Not an Sie, weil Sie einst sagten, Sie stünden mir, wenn ich danach verlangte, mit Rat und Tat zur Seite, und weil Sie in der Vergangenheit wie kaum ein Zwoter sowohl Hilfsbereitschaft als auch Verschwiegenheit bewiesen haben. Ich schreibe Ihnen diese Zeilen, so phantastisch es klingt, hinter Mauern mehrere Fuß dick, hoch über den Gipfeln des französischen Juras.
So viel in Kürze: Ende Januar war ich auf dem Weg von Königsberg nach Dresden, von wo der Krieg längst weitergezogen war, als mich mein Unglück ereilte. Ich bin auf meiner Durchreise durch Berlin mit noch zwei jungen Landsleuten auf Befehl des Generalgouverneurs Clark arretiert und abgeführt worden. Ihnen den Grund dieser gewaltsamen Maßregel anzugeben bin ich nicht imstande, auch scheint es, als ob uns nichts zur Last gelegt würde als bloß der Umstand, dass wir von Königsberg kamen. Als wenn nun ein jeder, der von dort kommt, gleich ein Spion wäre! Erschrecken Sie nicht, es muss ein Missverständnis dieser Sache zugrunde liegen, denn auch nicht in Gedanken, wie Sie sich leicht überzeugen werden, mischte ich mich in den Streit der Welt. Kann man sich etwas Übereilteres als diese Maßregel denken? Man vermisst ganz das gute Urteil der Franzosen darin.
Die Reise ging nach Joux, einem Schloss bei Pontarlier, auf der Straße von Neuchâtel nach Paris. Nichts kann öder sein als der Anblick dieser auf einem nackten Felsen liegenden Festung, die zu keinem andern Zweck als zur Aufbewahrung der Gefangenen noch unterhalten wird. Wir mussten aussteigen und zu Fuß hinaufgehen; das Wetter war entsetzlich, und der Sturm drohte uns auf diesem schmalen, eisbedeckten Wege in den Abgrund hinunterzuwehen. Im Elsass und auf der Straße weiterhin ging der Frühling schon auf; doch hier, auf diesem Schlosse an dem nördlichen Abhang des Jura, lag noch drei Fuß hoher Schnee. Man brachte uns, jeden abgesondert, in ein Gewölbe, das zum Teil in den Felsen gehauen, zum Teil von großen Quadersteinen aufgeführt, ohne Licht und ohne Luft war. Unsre Fenster sind mit dreifachen Gittern versehen, und wie viele Türen hinter uns verschlossen wurden, das weiß ich gar nicht.
Was man nun mit mir und meinen beiden Gefährten will, weiß der Himmel, aber sollten die Franzosen an ihrem widersinnigen Vorwurf festhalten, ich sei ein preußischer Spion, dann graut mir vor ihrem Urteil. Vielleicht hat man mich auch nur auf Lösegeld festgesetzt und gibt mich gegen eine Summe Geldes wieder frei. Doch wer in Preußens derzeitiger Not entsinnt sich schon der Not eines Einzelnen, Unbekannten, Unbedeutenden, wie ich es bin?
Ich flehe Sie daher an, guter Tieck: Unternehmen Sie etwas, mich aus diesem Kerker zu holen; wenn nicht für mich, dann tun Sie es für Preußen, unser gemeinsames Vaterland, das dieser Tage unsre Hilfe dringender denn je nötig hat. Wie die Wilden dem, der ihnen das Leben gerettet, so lange dienen, bis sie im Gegenzug einmal ihn retten, so würde auch ich nicht ruhen, bis ich meine Schuld Ihnen zurückgezahlt hätte.
Ihr ergebenster
Heinrich von Kleist ehemals pr. Offizier.
Im Château de Joux (Doubs), den 27. März 1807
Von Zeile zu Zeile hatten sich tiefere Furchen in Goethes Stirn gegraben. »Das ist nicht gut. Es liest sich, als stünde Schlimmes zu befürchten, wenn ihm tatsächlich keiner hilft.«
»Ich werde ihm helfen.«
»Warum? «
»Aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil er mich darum bittet.«
»Mein verehrungswürdigster Freund… ich wusste gar nicht, dass Sie und Kleist so innig sind.«
»Das sind wir auch nicht. Wir kennen einander bislang nur aus unsern Briefen. Und ich bilde mir auch nicht ein, dass ich der Einzige bin, dem er ein derartiges Gesuch geschrieben hat. Aber ich bin vermutlich der Einzige, der diesem folgt.«
»Und der andere Grund?«
»Der lautet, dass ich Kleist für den größten Dramatiker unserer Sprache halte – nach Goethe – und verhindern möchte, dass er in einem Kerker verschmachtet, bevor sein Talent zu voller Blüte gelangt.«
»Holla. Sie sparen wahrlich nicht an Lorbeer. Der zweitgrößte Dramatiker, sagen Sie? Größer als Schiller?«
»Größer als Schiller, ja, Gott hab ihn selig. Auch wenn es nicht die feine Art sein mag, dies ausgerechnet heute zu sagen, am zwoten Jahrestag seiner Beisetzung.«
»Zwei Jahre ist es heute her?«, fragte Goethe gedämpft, eher sich selbst als Tieck. Und während er den Brief sinken ließ, wanderte sein Blick plötzlich in die Ferne, in Richtung des Prospekts, als wäre der Horizont von Tauris nicht nur gemalt, sondern wirklich, und als könne man auf dem glitzernden Meer die Segel zählen. Erst ein lautes Krachen aus der Versenkung und ein anschließender Fluch weckten Goethe aus seiner Schwermut. Er wendete sich wieder Tieck zu. »Sie wollen also das Unmögliche möglich machen und nach Joux reisen. Und der Krieg, der gerade tobt?«
»Ach, wo ist man im Kriege wohl sicher? Der Krieg tobt anderswo, im Osten, und wird meine Reise daher kaum beeinträchtigen. Und wenn Sie mich fragen, hat er sich eh bald ausgetobt. Es bräuchte schon ein Wunder, damit die Preußen und Russen den Franzosen noch standhalten könnten.«
»Ich verstehe. Und was führt Sie nun zu mir?«
»Wenden Sie freundlicherweise das Blatt«, entgegnete Tieck, auf den Brief weisend.
Goethe tat, wie ihm geheißen, und las darauf:
Postskriptum: Wenn Sie Unterstützung benötigen, suchen Sie Goethe in Weimar auf und zeigen Sie ihm dies Schreiben. Ich wüsste keinen edlern Menschen in Deutschland, und bei Weitem keinen, der so vieles möglich machen kann wie er.
Goethe faltete das Schreiben wieder zusammen und reichte es Tieck zurück. »Sie loben Kleists außerordentliches Talent; ein Urteil, das ich im Übrigen nicht so recht teile. Unbestritten ist aber in jedem Fall sein Talent, den Menschen, von denen er etwas begehrt, Honig um den Bart zu –«
»Sind Sie dabei?«, fragte Tieck unvermittelt, ehe Goethe ganz ausgeredet hatte.
»Wobei?«
»Begleiten Sie mich nach Joux? Bitte, schnell, antworten Sie mit Ja, oder zeigen Sie mir unverzüglich den Hinterausgang!«
»Wie, was, Hinterausgang? Sie reden wirr.«
»Sehen Sie den Klotz, der durchs Parterre auf uns zueilt? Das ist der Fuhrknecht, der mich nach Weimar gebracht hat. Seine Pferde warten auf dem Vorplatz, und mittlerweile schulde ich ihm acht Preußische Taler und zwei Groschen; eine Summe, die ich – mit Ausnahme der zwei Groschen – aber nicht besitze. Ich versprach ihm in die hohle Hand, Sie würden zahlen, und wenn Sie es nicht tun, schlägt er mich schwarz und blau wie Damaszener Stahl.«
Über Tiecks Schulter hinweg sah Goethe nun tatsächlich einen groben Burschen mit hochrotem Gesicht aufs Proszenium zulaufen, eine Peitsche in der Hand. Goethe trat an die Bühnenkante und hob beschwichtigend die Hände. »Halt, junger Mann, so bremsen Sie Ihren Galopp, Sie sollen Ihr Geld bekommen.« Dann wies er einen Lampenputzer an, den Postillon zu Kirms zu geleiten, welcher ihm augenblicklich das ausstehende Fahrgeld auszahlen solle.
Tieck atmete auf, als der Kutscher wieder fort war. »Vielen Dank. Und Dank auch, dass Sie mich zum Château de Joux begleiten. Genügen Ihnen zwei Stunden, um sich reisefertig zu machen? Ich will so schnell reisen, wie Pferde nur laufen können, und noch vor Fronleichnam in Frankreich sein.«
»Herr Tieck, es kann gar nicht die Rede davon sein, dass ich nach Frankreich fahre. Die Spesen will ich Ihnen gerne auslegen, um mein Scherflein zu Kleists Befreiung beizutragen, aber ich werde ganz bestimmt nicht, um Hunderte von Meilen zu reisen in der Hoffnung, ich könne etwas für einen Kriegsgefangenen tun, den man der Spionage verdächtigt, Weimar und dies« – hier umfing Goethe mit großer Geste Zuschauerraum und Bühne – »von einem Moment auf den nächsten verlassen.«
Tieck folgte seinem Blick unbeeindruckt. »Mit Verlaub, Herr von Goethe, aber auf mich machen Sie keinen sonderlich glücklichen Eindruck. Sie wirken vielmehr, als fehlte Ihnen etwas. Eine kleine Reise in die Berge würde Ihnen sicherlich guttun. Es ist Mai, kommen Sie, der Himmel ist blau!«
»Um zu begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht man nicht um die Welt zu reisen«, entgegnete Goethe kopfschüttelnd.
Da trat Oels im Gewand des Orest an die beiden Männer heran und bestellte vom Maschinisten einen Gruß; die Probe könne nun fortgeführt werden.
»Dann hat er den Hubboden wiederhergestellt?«, fragte Goethe.
»Ganz im Gegenteil«, antwortete Oels, »der Schaden sei so schwerwiegend, dass die Reparatur bis zum Abend unmöglich zu schaffen sei. Er wolle aber rechtzeitig ein paar Bretter über die offene Versenkung nageln, dass keiner von uns kopfüber in die Hölle stürzt. – Aber darf ich einen Vorschlag äußern, wie die Schwierigkeit leicht zu beheben sei, Herr Rat?« Bevor Goethe ihm abschlägigen Bescheid erteilen konnte, fuhr Oels rege fort: »Streichen Sie die Vision des Orestes für heute. Ich nehme es Ihnen auch nicht krumm, denn die Szene zählt ohnehin nicht zu meinen liebsten. Insbesondere die Demoiselles im Publikum hat mein Wahnsinn jedes Mal über Gebühr verschreckt. Und unsere drei toten Atriden werden Ihnen den freien Abend danken. Ich sprach mit Thyesten; ihm kratzt seit gestern der Hals, er ginge heute Abend also lieber ins Bett, als den Orest heimzusuchen.«
Auf Goethes Antlitz waren während der Plauderei des Schauspielers rote Flecken getreten. Ohne auf Oels’ Vorschlag einzugehen, zischte er nur: »Aus meinen Augen«, und als sich Oels schon auf der Flucht befand, rief er ihm nach: »Und wenn Sie heute Abend auch nur eine Silbe Ihres Monologes falsch sprechen, dann schwöre ich Ihnen, spielen Sie bis an Ihr Lebensende nur noch Naturburschen und Dümmlinge!«
Eine Stoffbahn, die ungeachtet seiner Anweisungen schon die ganze Probe über unnütz auf der Bühne herumgelegen hatte, bekam nun Goethes ganzen Unmut zu spüren: Er raffte den Stoff zusammen und warf ihn in den Orchestergraben, was so viel Staub aufwirbelte, dass er husten musste. »Wie man das Theater hassen kann«, sagte er zwischen zwei Hustern.
»Dann werde ich mich jetzt verabschieden«, sagte Tieck, während sich Goethe den Staub vom Rock klopfte.
»Warten Sie«, sagte Goethe und hielt den andern am Ärmel zurück. »Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht sollte ich diese Mottenwelt tatsächlich einmal verlassen und etwas frische Luft schnappen. Hier soll ich finden, was mir fehlt? Nein, ich glaube den hellen Wink des Schicksals zu verstehen, das mir durch Sie die Hand reicht, mich aus diesem stockenden, schleppenden bürgerlichen Leben herauszureißen. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.«
»Bravo!«, rief Tieck.
»Das wäre auch eine Entschuldigung, zur Premiere nicht zu erscheinen. Ich muss gestehen, es hat mir noch nie gelingen wollen, eine vollendete Aufführung meiner Iphigenie zu erleben. Und alles deutet darauf hin, dass es mir auch am heutigen Abend nicht gelingen würde.«
Mit diesen Worten ging Goethe von der Bühne ab und verließ das Theater, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzusehen. Tieck folgte ihm. Zwei Stunden später hielt eine Kutsche vor dem Haus am Frauenplan, und weitere zwei Stunden später hatte man den halben Weg nach Erfurt bereits zurückgelegt. Das Hoftheater und Weimar zu verlassen, ohne sich vorher bei allem und jedem zu verabschieden, erfüllte Goethe mit plötzlicher Energie. Er und Tieck waren mit einem Mal wie Orest und Pylades, die heimlich und verboten die Enge einer kleinen Insel flohen. Goethes Gepäck freilich bestand nicht aus einem gestohlenen Götterstandbild, sondern aus Büchern, Kleidern, etwas Proviant und dem schwachen, aber mit jeder Meile wachsenden Verdacht, sich auf eine große und möglicherweise unwiderrufliche Torheit eingelassen zu haben.
3
COPPET
Je näher man der Schweiz kam, desto öfter musste Goethe an seinen verstorbenen Freund denken, dessen letztes vollendetes Bühnenwerk, der Wilhelm Tell, diese Alpengegend doch so meisterlich beschrieben hatte; das einfach Große und Stille ihres Charakters, die ausgedehnten Weiden am Bergeshang, mit dem frischesten Grün überkleidet, wo dunkel einzeln stehende Tannen aus dem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden sich schäumende Bäche stürzen. Das Gespräch mit Tieck hatte eine verheilt geglaubte Wunde wieder aufgerissen, und eine Melancholie, mehr noch: ein Schmerz hatte von Goethe Besitz ergriffen, als hätte er Schiller eben erst zu Grabe getragen. Sein junger Reisegefährte bemühte sich nach Kräften, die Stunden in der Kutsche mit Unterhaltungen zu verkürzen, aber Tiecks höfliches romantisches Geplauder – oberflächliche Naturbetrachtungen und verdrießliche Tagespolitik – ließ Goethe nur umso mehr wünschen, statt Tieck säße Schiller ihm gegenüber und verliehe dem Gespräch mehr Form und mehr Tiefe.
Als Pollux gestorben war, hatte Zeus seinen Bruder Kastor vor die Wahl gestellt, entweder bei den Göttern auf dem Olymp ewig zu leben oder zum geliebten Pollux ins Totenreich hinabzusteigen und dabei seine eigene Unsterblichkeit einzubüßen. Kastor hatte sich für Letzteres entschieden, um Pollux wiederzusehen – Goethe aber hätte Schiller keinesfalls zu den Toten folgen wollen, und so war er wohl und übel, schien es, zu olympischer Unsterblichkeit verdammt. Und fürwahr: Sosehr auch Goethes leidige Nieren mitunter zwackten und das Pflaster der Straße seine Knochen durchschüttelte, war er sich doch gewiss, noch lange zu leben. Bei diesen methusalemischen Gedanken strich er sich zuweilen durch den Bart, der, um ihm für die Dauer der Reise Anonymität zu verschaffen, seit Weimar um sein Kinn gewachsen war.
Tieck betrauerte indes einen anderen Toten, der im Jahr zuvor in hohem Alter das Zeitliche gesegnet hatte – das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Die Fürstentümer, durch die sie reisten, ehemals Glieder des alten deutschen Reiches, waren nun Staaten des Rheinbunds, Verbündete des französischen Imperiums, von Napoleon behütet und ihm treu ergeben. Im Krieg von 1805 schon hatten sich Baiern, Württemberg und Baden auf Napoleons Seite geschlagen. Im Juli 1806 waren sie die Ersten gewesen, die in Paris die Rheinbundakte unterzeichneten, und im August hatten sie ihren Austritt aus dem Reich erklärt und sämtliche Reichsgesetze als gegenstandslos; sämtliche Reichstitel hatten sie abgelegt, selbst den würdigsten unter ihnen, den des Kurfürsten. Franz II., ihrer aller Oberhaupt, der letzte deutsche Kaiser, verhielt sich nun wie ein Fischer, dem der Fluss die Reuse entzweit hat und der sieht, dass er die Reuse nicht retten kann und alle Fische darinnen noch minder, der beides daher dem Strom überlässt und sich nur den größten der Fische sichert – seine Heimat Österreich. Am 6. August hatte Franz II., von Napoleon bedrängt und von seinen Kurfürsten verlassen, das Heilige Römische Reich für erloschen erklärt und die Kaiserkrone niedergelegt – jene Krone, mit der Otto I. mehr als acht Jahrhunderte zuvor in Rom das Reich ins Leben gerufen hatte.
Aber dieser 6. August 1806 war auch der Tag der Mobilisierung der preußischen Armee gewesen, und alle Deutschen, die der Gedanke an ein Ende des Sacrum Imperium entsetzt hatte, sahen nun in Preußen und nicht länger in Österreich den Verteidiger des Reiches. Doch wie waren ihre Hoffnungen bei Jena und Auerstedt zerstört worden! Und jetzt, ein halbes Jahr später, hatten die Truppen Napoleons, unterstützt von deutschen Regimentern aus Baiern und Württemberg unter der Führung seines Bruders Jérôme, den vermeintlichen Verteidiger des Reiches bis in den letzten Winkel Pommerns gehetzt, und Preußen selbst stand kurz vor seiner Vernichtung. Endgültig überzeugt von der Unbesiegbarkeit Napoleons, waren hastig alle anderen deutschen Staaten dem Rheinbund beigetreten – respektive all jene, die nicht vorher schon von ihm oder seinen Verbündeten einverleibt worden waren –, sodass Napoleon nun faktisch Kaiser der Deutschen war; Kaiser aller Deutschen mit Ausnahme jener in Dänisch-Holstein, in Schwedisch-Pommern, in Österreich und in jenem Fetzen, der von Preußen noch übrig war. Deutschland war sein, wie auch Italien und die Schweiz: Napoleon hatte seine Ankündigung wahr gemacht, ein neues Frankenreich größer als das Karls des Großen zu schaffen.
Als Tiecks und Goethes Kutsche das Zollhaus an der Grenze zwischen dem hessischen und dem badischen Großherzogtum passierte, ohne visitiert oder überhaupt angehalten zu werden, ertappte sich Tieck bei dem Gedanken, dass Napoleons Siegeszug nicht nur Schaden angerichtet hatte: Das Heilige Römische Reich war zwar Geschichte, aber zumindest war Europa von den Pyrenäen bis zur Elbe nun frei von Grenzen. Am Rhein entlang ging es südwärts, Pontarlier und dem Château de Joux entgegen, und nicht ein einziges Mal entdeckte Tieck am anderen Ufer französische Soldaten. Die Grenzen Frankreichs lagen nun anderswo.
Ein anhaltendes Ärgernis während der Reise blieb der Kutscher, mit dem Tieck wahrlich eine schlechte Wahl getroffen hatte. Mit den Dienstleistungen des Mannes konnten sie zufrieden sein, allein durch sein unartiges Betragen gegen seine Umgebung machte er ihnen fortdauernden Verdruss. Nicht nur gegen Gastwirte und Stallburschen entlang des Weges, nein auch gegen seine eigenen Passagiere betrug er sich äußerst rau, störrisch, grob und auffahrend, und die ihm deshalb zugegangenen Verweise Goethes konnten nur augenblickliche Wirkung hervorbringen, im Ganzen aber nicht fruchten. Endgültig unhaltbar bewies sich seine unbändige Gemütsart vor Yvonand am südlichen Ufer des Neuenburger Sees, als Tieck die sträflichen Unarten nicht länger hinnehmen wollte, worauf ein lebhafter Wortwechsel zwischen den beiden entsprang. Der Zank auf dem Bock dauerte wohl eine Viertelstunde, bis die beiden Männer zuletzt zu balgen anfingen und der Kutscher Tieck mit der Peitsche drohte. Die Reisenden sahen nun keine andere Wahl, als ihr Gepäck auf die Straße abzuladen und den Schwager seines Dienstes zu entbinden. Unter wüsten Schimpfreden lenkte das Subjekt seine Rosse zurück nach Deutschland, derweil Goethe und Tieck die Strecke zur nächsten Poststation zu Fuß hinter sich bringen mussten.
Sowohl hier als auch in der nächsten größeren Stadt blieb ihre Suche nach einer Kutsche, die sie über die französische Grenze zur Festung von Joux bringen würde, erfolglos, so viel Goethe aus seiner Reisekasse dafür auch bezahlt hätte. So beschlossen sie, einen Umweg zu machen: Sie nahmen die ordinäre Post Richtung Süden bis nach Coppet. In dieser Ortschaft zwischen den blauen Gipfeln des Jura und den blauen Wassern des Genfer Sees, keine halbe Meile vor der Grenze zu Frankreich, befand sich das Schloss einer von Goethes Bekanntschaften, der Baronin de Staël, Witwe des schwedischen Freiherrn Staël von Holstein, welche Napoleon aufgrund ihrer geschworenen Feindschaft, ihrer bissigen Schriften und ihrer umstürzlerischen politischen Kontakte ins Schweizer Exil verbannt hatte. Germaine de Staël-Holstein war das einzige Kind des überaus wohlhabenden Bankiers Necker, seines Zeichens letzter Finanzminister Ludwigs XVI., und die Hoffnung Goethes, in den Stallungen von Coppet eine entbehrliche Kalesche für ihre Fahrt nach Pontarlier zu finden, war daher mehr als berechtigt.
Sosehr Tieck auch die Verzögerung ihrer Weiterreise derart kurz vor dem Ziel bedauerte, so sehr freute ihn doch die unverhoffte Aussicht, im Haus der Witwe de Staël einen seiner engsten Freunde anzutreffen, August Wilhelm Schlegel, den älteren der Schlegel-Brüder, der – auf Empfehlung von Goethe – seit nunmehr drei Jahren in Coppet als Lehrer der Kinder der Baronin und als Hausfreund lebte und wirkte.
»Man hat mich schon oft nach Coppet eingeladen, ohne dass ich der Invitation gefolgt wäre«, erklärte Tieck, als sie das letzte Stück von der Straße zum Schloss liefen, »sowohl Schlegel als auch Madame baten mich zu kommen, sowie mein Bruder, der die Ehre hatte, einige bildhauerische Arbeiten für sie auszuführen. Sogar sie selbst hat er in Stein festgehalten, was in Anbetracht ihrer großen Beweglichkeit nicht für ein kleines Wunder zu halten ist.«
»Was hielt Sie zurück? Coppet ist schön gelegen, und es gibt keinen berühmteren Salon in ganz Europa.«
»Ich nehme an, es lag an der Art, wie die Baronin meinen Freund Schlegel zu sich gelockt und seitdem nicht mehr losgelassen hat. Einer der brillantesten Köpfe Deutschlands, der größte Kunstrichter unserer romantischen Bewegung und der beste Übersetzer aus zahllosen Sprachen – angestellt, um Kindern Arithmetik und Latein einzubläuen, in einer Position, die jeder Student füllen könnte! Es muss etwas wie Zauberei dahinterstecken. Coppet dünkte mich immer wie der Venusberg, in welchen Tannhäuser-Schlegel auf Nimmerwiedersehen gelockt ward.«
Goethe lachte auf. »Der Venusberg also! Ich hatte ähnliche Gedanken, jedoch antiker Natur. Ich dachte an die Odyssee.«
»Die Insel der Kalypso?«
»Nein, die der Circe, denn wenn einer erst aus ihrem Becher getrunken hat, dann sperrt sie das arme Schwein in einen der zahlreichen Koben und straft ihn fürder mit Missachtung. Stellen Sie sich einmal Schlegels Verblüffung vor, als er damals in Coppet eintraf und begriff, dass er weder der erste noch der letzte und schon gar nicht der einzige Mann war! Den Glücklichen, der eben in die Gärten der Zauberin hineintritt und von allen Seligkeiten eines künstlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts unangenehmer überraschen, als wenn ihm, dessen Ohr ganz dem Gesange der Nachtigallen lauscht, irgendein verwandelter Vorfahr unvermutet entgegengrunzt.«
Das Schloss der Zauberin, das auf einer Anhöhe über dem Dorf lag, war bald erreicht: ein kleiner, dreiflügliger Bau mit einem ausgedehnten Park, davor Stallungen und Wirtschaftsgebäude. Der Kammerdiener, zu dem sie vorgelassen wurden, schien über den unangemeldeten Besuch nicht verwundert. Ohne weitere Fragen zu stellen, ließ er beider Gepäck in separate Gästezimmer bringen. Madame befinde sich gerade mit ihren Kindern en plein air, erklärte er, und führte Goethe und Tieck sogleich durch den Ehrenhof in den anliegenden Park.
Zwischen jahrhundertealten Bäumen machten sich die Reisenden also auf die Suche nach ihrer Gastgeberin. Sie fanden zuerst ihr Abbild auf dem Relief, das Tiecks Bruder auf das marmorne Grabmal ihrer Eltern gemeißelt hatte. Dort kniete sie vor ihrem Vater, der milde auf sie herabblickte. Mit Lust am grausigen Detail schilderte nun Tieck, was ihm seinerseits der Bruder berichtet hatte; dass Necker nämlich den Leichnam seiner geliebten Frau nach dem Tod in Alkohol hatte einlegen lassen, um sie vor der Verwesung zu schützen – »eine eingeweckte Frau liegt darinnen, stellen Sie sich nur vor, alterslos wie eine Pflaume im Rumtopf« –, aber da war Goethe bereits angewidert weitergelaufen.
Schließlich entdeckten sie im Schatten einer Hainbuchenlaube drei Gestalten, und Goethe erkannte in einer von ihnen die Baronin de Staël: »Ein stumpfes Näschen, ein breites Gesicht – das nussbraune Mädchen dort, das muss sie sein.«
Tieck kniff die Augen zusammen. »Es ist wahr, was alle sagen: Schön ist sie nicht.«
»Was! Frauenschönheit will nichts heißen. Oder wissen Sie eine Frau in Europa, die einflussreicher ist als sie, Gemahlinnen von Königen und Kaisern ausgenommen?«
Germaine de Staël und ihre Kinder übten sich im Bogenschießen, indem sie einen Strohballen mit Pfeilen spickten. Die Baronin trug ein weißes Sommerkleid, kurz unter der Brust geschnürt. Obwohl sie klein und kräftig von Statur war und Dekolleté, Hals und Arme eher fleischig zu nennen, wirkten ihre Bewegungen dennoch anmutig, beinahe tänzerisch. Ihr Gesicht, dem allein die dunklen Augen Glanz verliehen, hatte fast etwas Mohrenartiges, und die schönen schwarzen Locken waren zur Mehrheit unter einen roten Turban gepfercht, den sie zum Schutz vor der Sonne trug.
Als Goethe und Tieck aus dem Schatten der Bäume traten, dass Staël ihrer gewahr wurde, ging sie ihnen entgegen, hoch erfreut über den überraschenden Besuch. Schon mit ihrem ersten Wort waren alle Makel vergessen, denn ihre Stimme und ihre Sprache hatten wahrlich bezirzende Qualitäten. Sie erkannte beide Männer sogleich, selbst Goethe hinter seinem weißen Bart, und begrüßte sie mit französischer Herzlichkeit. Ihr Sohn reichte die Hand, und ihre Tochter grüßte mit einem artigen Knicks. Goethe wollte sein Anliegen schildern, aber die Baronin ließ ihn kaum zu Wort kommen.
»Wie danke ich Ihnen, dass Sie mir endlich die Ehre des Gegenbesuches erweisen. Was habe ich Weimar genossen! Eine halbe Million Einwohner mehr, und es könnte Paris den Rang ablaufen!« Nun wandte sie sich von Goethe zu Tieck: »Und wie freue ich mich über Ihren Begleiter! Sie wissen, Monsieur Tieck, Schlegel kann niemanden loben, der nicht mindestens zweihundert Jahre tot ist, aber würde er es tun, Sie wären zweifellos der Erste auf seiner Liste. Sie riechen nach Fichte, Monsieur! Wie außerordentlich deutsch!«
»Zu viel der Ehre, Madame. Ich fürchte, das ist Schweiß.«
»Allerliebst! Wer bräuchte da noch Cologne! Ich wünschte, ich könnte so schwitzen. Sie haben übrigens Ähnlichkeit mit Napoleon, wussten Sie das?«
»Ja. Ich bitte um Entschuldigung.«
»Und was mein Hiersein betrifft«, erklärte Goethe, »verhält es sich umgekehrt. Ich bin vielmehr Herrn Tiecks Begleiter, nicht er der meinige.«
»Ich verstehe. Was gibt es Neues aus Weimar? Haben Sie noch immer ein Liebesverhältnis mit Ihrer Haushälterin?«
»Nein.«
»Gott sei’s gepriesen. Sie war, mit Verlaub, furchtbar gewöhnlich und gänzlich unter Ihrem Niveau.«
»Wir sind jetzt verheiratet.«
»Ah.«
Um das peinliche Schweigen, das darauf eintrat, zu beenden, räusperte sich Tieck und sagte aufs Geratewohl: »In was für einer Idylle Sie leben, Baronin!«
»Pah! Coppet ist nichts als ein gut ausgekleidetes Grab, wo die Post ankommt.« Sie ließ den Blick abschätzig über Park und Schlösschen streifen. »Es ist schwer, in dieser grausamen Zeit und diesem langweiligen Land einigen Elan zu behalten. Sehen Sie mich an: Ich vertreibe mir die Zeit damit, Pfeile auf einen Ballen Stroh abzuschießen, von dem ich mir vorstelle, es wäre Bonaparte. Wie armselig!«
»Sie sind zu harsch mit sich und der Schweiz.«
»Ich habe nun einmal für die Schweiz nichts übrig. Es ist eine Heimat von Pedanten und Krämern. Ihre Liebe zur Gleichheit entspricht nur dem Wunsch, jeden herunterzuziehen; ihre Freiheit ist Unverschämtheit und ihre Moral Langeweile. Und ihr Französisch ist so schleppend, dass es der Sprache allen Witz und Esprit raubt, die sie sonst vor allen anderen Sprachen auszeichnet. Wie geschmolzener Käse liegt es einem in den Ohren. Ich sehne mich sehr danach, wieder nach Paris zurückzukehren. Es gibt ein deutsches Wort, das das schmerzliche Verlangen heimzukehren ausdrückt; helfen Sie mir auf die Sprünge …«
»Heimweh?«
»Genau, Hemwé. Bei uns heißt es passenderweise la maladie suisse, die Schweizer Krankheit; diese unbestimmte Sehnsucht nach dem Vaterlande, sie hat mich befallen. Meine einzige Freude ist der illustre Besuch, den ich hier empfange, und so werde ich zumindest heute Abend keine Langeweile fürchten müssen. Sie bleiben hoffentlich einige Wochen? – Albert, Albertine, sammelt die Pfeile ein, wir kehren heim. Professor Schlegel hat euch doch sicherlich, wie ich ihn kenne, einiges an Schularbeiten aufgebürdet.«
Ehe sie sich versahen, hatte sich Staël bei ihnen eingehakt – Goethe zur Rechten und zur Linken Tieck – und führte sie zurück zum Schloss.
Am Abend, nachdem sich Goethe und Tieck gewaschen und umgekleidet hatten, traf man sich in der Galerie wieder, deren große Fenster den Blick freigaben auf den See und die Alpen dahinter. Madame de Staël hatte in einem Sessel Platz genommen und stickte an einer Brieftasche, derweil sie plauderte. Nun gesellte sich auch Wilhelm Schlegel dazu, der sich für den prominenten Besuch, von dem er unterdessen informiert worden war, sichtlich herausgeputzt hatte. Er trug einen silbergrauen Frack nach der neuesten Mode, Kniehosen und Seidenstrümpfe, feine Schuhe und eine gewaltig hohe Halsbinde. Tieck eilte mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. Schlegel, als der Ältere, erwiderte die Begrüßung mit Herzlichkeit, aber gelassener, und beide Freunde betrachteten sich stumm; dann fragten und sprachen sie allerlei Unbedeutendes durcheinander, wie es bei dergleichen Szenen des Wiedersehens wohl zu geschehen pflegt. Es wollte in ziemlich langer Zeit kein eigentliches Gespräch in Gang kommen.
Insbesondere darüber, dass Schlegel die Haare nun kurz trug, geriet Tieck gänzlich aus der Fassung, und ungeniert strich er ihm durch den Backenbart. »Oh du guter William! Wie ein Traum, dass ich dich wiedersehe! Hätte ich dich doch bald nicht wiedererkannt, so hast du dich verändert. – Aber Mensch!, du hast dir ja den Zopf abgeschnitten! Darum hatte mir auch deine ganze Erscheinung so etwas Wildfremdes.«
»Lieber Alter«, sagte Schlegel, »nimmst du denn auf den Geist der Zeit gar keine Rücksicht?«
»Geist der Zeit?«, entgegnete Tieck und langte sich an den eigenen Zopf, wie um sich zu vergewissern, dass er noch am Platze war, »sollen wir dem Baal denn gerade das Beste opfern, was uns zu Patrioten, zu echten Menschen macht? Hätte mir einer gesagt, der Wilhelm ist ein Spieler geworden, er säuft, er zieht mit Bären im Lande um, alles, alles hätte ich eher geglaubt! Sieht er nicht von hinten aus, als wäre er unter die Seeräuber geraten und hätte Wolle lassen müssen? Wie ein Atheist auf seine alten Tage. Herr von Goethe, sagen Sie, sieht er nicht aus wie ein Franzose?«
Die Diener brachten Wein und Kanapees, und Staël verlangte nun den Grund des unerwarteten Besuchs zu erfahren. Man rückte die Sessel in einen Kreis, und Tieck beschrieb, in welche Notlage Heinrich von Kleist durch die Wirren des Krieges gekommen war, las den Hilferuf vor, den ihm Kleist zwei Monate zuvor aus Joux geschickt hatte, schilderte ihre Reise in die Schweiz und zuletzt, nicht ohne Witz, ihr Zerwürfnis mit dem schnöden Kutscher. »Wir sind also nach Coppet gekommen in der Hoffnung, Sie würden uns eine Kutsche und Pferde ausleihen, damit wir zügig Joux erreichen und Kleist auslösen können.«
Madame de Staël und Schlegel warfen einander einen vielsagenden Blick zu. Staël räusperte sich. »Sie hätten nichts Unklügeres tun können, als mit Ihrem Vorhaben ausgerechnet mich aufzusuchen«, erklärte sie. »Sie wissen, wie Bonaparte über mich denkt?«
»Er hasst Sie.«
»Ja, und mehr noch: Er fürchtet mich. Das gereicht mir zu Freude und Stolz und erschreckt mich zugleich. Aber es bedeutet auch, dass er mich nicht aus den Augen lässt. Die Spione seines bestialischen Polizeiministers Fouché überwachen mein Anwesen tags und nachts, und ich zweifle nicht daran, dass auch unter meiner Dienerschaft der eine oder andere in seinem Sold steht. – Der freundliche Lakai, der Ihnen gerade den Wein nachschenkt: Er könnte ebenso gut eines von Fouchés hinterlistigen Geschöpfen sein.«
Besagter Diener wurde leichenblass, aber noch bevor er seinen Protest stammeln konnte, setzte Staël lächelnd nach: »Keine Angst, François, ich weiß, das bist du nicht. Oder etwa doch?« Als der verschüchterte Diener allen nachgeschenkt und die Galerie wieder verlassen hatte, fuhr sie fort: »Es ist mir untersagt, mich weiter als vier Stunden von Coppet zu entfernen. Ich erlaubte mir eines Tages bei einer einfachen Spazierfahrt zehn Stunden zurückzulegen; augenblicklich waren die Gendarmen hinter mir her, und den Postmeistern wurde anbefohlen, mir keine Pferde zu geben. Und wie sie mich bewachen und verfolgen, so bewachen und verfolgen sie auch meine Gäste. Würden Sie sich nach Ihrem Aufenthalt hier wieder auf den Heimweg nach Deutschland machen, Sie würden nie bemerken, dass man Sie auf Schritt und Tritt beobachtet hat, und die Spitzel würden spätestens in Basel ihr Interesse verlieren – wenn Sie jedoch nach Frankreich weiterreisen, um einen vermeintlichen preußischen Spion aus einer der sichersten Festungen des Landes zu befreien, dann werden sie Ihre Pläne ohne Zweifel gründlich durchkreuzen.«
Das sonst so standhafte Lächeln war von Tiecks Lippen gewichen. Als er bemerkte, dass alle Augen auf ihm ruhten, stand er auf und ging zum Fenster.
»Lassen Sie mich ganz ehrlich sein, Monsieur Tieck«, sagte Staël, »ich fürchte beinahe, Sie können nichts für Heinrich von Kleist tun. Sie werden ihn seinem Schicksal überlassen müssen. Alles andere wäre äußerst töricht und könnte am Ende dazu führen, dass Sie im Château de Joux als Kleists Zellennachbar enden. Es tut mir leid.«
Tieck blieb stumm. Er hatte den anderen den Rücken zugekehrt und betrachtete die Silhouette der Berge vor der herannahenden Nacht.
»Fouché terrorisiert Europa mit ein paar hundert Mann mehr als Napoleon mit Hunderttausenden«, rief ihm Schlegel zu. »Leg dich in Gottes Namen nicht mit ihm an. Er hat während der Revolution halb Lyon massakriert. Kein Jakobiner, nicht einmal Marat oder Robespierre, hatte je so viel Blut an den Händen wie er. Das Leben eines Menschen gilt ihm nicht mehr als das einer Fliege auf dem Sims. Herrje, Fouché ist so skrupellos, dass Napoleon selbst ihn fürchtet!«
François trat erneut herein. Die Baronin erhob sich daraufhin von ihrem Sessel und legte die Stickarbeit zur Seite. »Ihre Überlegungen müssen für heute Abend ruhen, meine Herren; nehmen Sie sie morgen wieder auf, oder vielleicht kommt Ihnen ja in der Nacht der rettende Einfall – jetzt aber ist es Zeit für Theater.«
»Wie!«, rief Goethe, »in diesen einsamen Gebirgen, zwischen diesen undurchdringlichen Wäldern hat die Schauspielkunst einen Weg gefunden und sich einen Tempel aufgebaut?«
»Nun, es ist nicht eben Monsieur Talma und die Comédie-Française«, erwiderte Staël, »vermutlich ist es sogar das genaue Gegenteil davon. Eine Gruppe wandernder Komödianten aus Piemont ist heute Mittag mit ihrem Thespiskarren hier eingetroffen – fünf Mimen, zwei Klepper und ein Hund, die wahrscheinlich erfahren haben, dass ich vermögend bin, nicht ohne das Theater leben kann und in meiner Drangsal sogar mit ihren dürftigen Künsten vorliebnehme. Man wird genügsam im Exil. Ich lade Sie herzlich ein, sich auf das Abenteuer ihrer Schauspielerei einzulassen.«
»Was wird gegeben?«
»Ich habe mir Racines Phädra gewünscht und werde sicherlich noch bereuen, diesen Kulissenreißern ausgerechnet mein Lieblingsstück zum Fraß vorgeworfen zu haben.«
»Ha!«, rief Schlegel so unvermittelt aus, dass alle zusammenschreckten. »Ich habe den Einfall, den wir gesucht haben, und er ist, mit Verlaub, brillant. Kommen Sie näher, hier sind hinter allen Türen und Tapeten Ohren.« Nachdem sich alle, auch Tieck, um Schlegel versammelt hatten, flüsterte dieser: »Morgen brechen die Schauspieler wieder auf, und ich weiß zufälligerweise, dass sie nach Norden wollen. Wir zahlen ihnen ein paar Francs extra … und dafür sollen sie Ludwig und Herrn von Goethe im Wagen verbergen, damit diese Coppet unbemerkt wieder verlassen können. – Geben Sie zu, Teuerste, das ist brillant!«
»Das werde ich nicht tun, zumindest nicht in Ihrer Gegenwart«, entgegnete Staël trocken. »Außerdem wollen die Herren letzten Endes nach Joux, und dorthin werden sie die Komödianten sicherlich nicht bringen. Nein, die Herren werden wohl etwas tiefer in die Tasche greifen und den Schauspielern den ganzen Karren samt Pferden abkaufen müssen. Und die Kleider gleich dazu, sich zu verkleiden.«
»Und zu zweit losreiten? Wer immer Coppet observiert, wird bemerken, dass die Gruppe unvollständig ist.«
»Ich werde die Herren Goethe und Tieck begleiten«, sagte Staël. »Dann sind wir zu dritt.«
»Sie scherzen!«, riefen Goethe und Schlegel wie aus einem Mund.
»Mitnichten. Ich will zu gerne wieder einmal Fuß auf französische Erde setzen, und wenn es nur die dröge Franche-Comté ist.«
»Baronin, das kann ich unmöglich verantworten«, wandte Goethe ein.
»Und ich noch minder«, pflichtete Schlegel bei. »Eben noch weisen Sie auf alle möglichen Gefahren hin und erwähnen den entsetzlichen Namen Fouchés, im nächsten Moment wollen Sie das alles selbst auf sich nehmen? Es wäre fahrlässig!«
»Was soll schon passieren? Das Exil ist eine Strafe, die jeder nach der Todesstrafe die härteste nennt. Ehe ich in Coppet am Nichtstun verrecke, will ich lieber riskieren, erneut Napoleons Zorn auf mich zu ziehen. Und wenn ich ihm bei diesem Ausflug einen preußischen Spion entreißen kann – umso besser. Es liegt eine Art körperlichen Vergnügens darin, einer ungerechten Gewalt Widerstand zu leisten.«
»Nein, Madame!«, rief Schlegel aus. Er war rot angelaufen. »Ich muss auf das Äußerste protestieren!«
»Machen Sie mir jetzt keine Szene, Wilhelm, Ihr Pensum für diese Woche ist erschöpft. Machen Sie uns lieber eine Freude und seien Sie mit von der Partie.«
»Sind Sie närrisch? Ich werde nichts dergleichen tun!«
»Natürlich werden Sie uns begleiten. Ich weiß es.«
»Immer noch diese Leichtfertigkeit! Wissen Sie denn nicht, dass ich dergleichen nicht hören kann noch mag?«
»Sie nennen die Schnelligkeit meiner Beobachtungen Leichtfertigkeit? Habe ich darum weniger recht, weil ich früher recht habe? Sie werden uns begleiten, weil Sie sich von Ihrem Freund Tieck nicht so bald wieder trennen wollen, und noch minder von Goethen, den Sie fast so sehr verehren wie mich. Wenden Sie sich nicht ab, es gibt keinen Grund, sich dessen zu schämen.«
Schlegel, dem diese Offenbarung seiner Hochachtung für Goethe tatsächlich unangenehm war, stand nun auf. Er lockerte seine Halsbinde. »Sparen Sie sich Ihren Atem, Madame, Sie werden mich nicht persuadieren.«
»Vor allem aber werden Sie uns begleiten«, fuhr Staël fort, »weil es Ihnen das Herz verbrennen würde, mich allein mit zwei hübschen Herren auf Spazierritt zu wissen, derweil Sie staubige Folianten wälzen.«
»Sie irren, Madame. Aber ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich an meine Bücher erinnern, deren Gesellschaft ich nun der Ihrigen vorziehen werde. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Reise, rate Ihnen jedoch, Herr von Goethe, und dir, Ludwig, ein letztes Mal davon ab. Was hingegen Sie betrifft, Madame, wäre es für mich wahrscheinlich das Beste, wenn man Sie tatsächlich in einen Kerker sperrte, denn dann müsste ich nicht länger –« Hier hatte er die Galerie bereits verlassen, den Rest seiner Rede mit sich nehmend.
Staël sah ihm kopfschüttelnd nach. »Sich mit dem Karren der Komödianten aus Coppet davonzustehlen – das ist doch wirklich ein brillanter Vorschlag, nicht wahr?« Sie legte Goethe eine Hand auf den Arm. »Ich muss Ihnen für diese interessante Bekanntschaft danken. Ich glaube nicht, dass es einen geistreicheren Menschen gibt als Wilhelm. Er ist klüger als fast alle Leute, die ich kenne. Sie haben mir wahrlich den besten aller Lehrer empfohlen.«
»Es ist nicht zu leugnen«, entgegnete Goethe, »Schlegel weiß unendlich viel, und man erschrickt fast über seine außerordentlichen Kenntnisse und seine große Belesenheit.«
»Vielleicht sollten Sie das dem armen Kerl bei Gelegenheit einmal kundtun«, meinte Tieck.
»Eher will ich meine Zunge verschlucken«, erwiderte Staël und griff nach einem silbernen Glöckchen auf dem Beistelltisch, um einen Diener zu rufen. Sie ließ den Kopf der Schauspielgesellschaft zu sich bitten, um ihm das Angebot zu unterbreiten, das Gespann sowie einige Kleider für die Dauer von mindestens einer Woche auszuborgen, derweil er und seine Truppe bei guter Bezahlung in Coppet verweilen sollten.
Vor Anbruch des nächsten Tages traf man in den Stallungen wieder zusammen. Goethe und Tieck waren die Ersten. François hatte noch in der Nacht sämtliches Gepäck und zwei Körbe mit Proviant in den Stall gebracht, und die Reisenden trugen bereits die entliehene Garderobe der Schauspieler: ein paar übel riechende Lumpen, in denen sich insbesondere Goethe unwohl fühlte. Als sich die Stalltür öffnete, erstaunten die beiden nicht wenig, denn zu ihnen trat Schlegel, ebenfalls in der Montur eines der Schauspieler, ein schwarzes Barett auf dem Kopf und ein Felleisen unter dem Arm. Schlegel warf ihnen einen solchen Blick zu, dass sich beide des Kommentars enthielten, aber wenig später nahm ihn Tieck beiseite, um seine Freude darob auszudrücken, dass der Freund sie nun doch begleitete. »Glaub mir, sie sprach gestern in den höchsten Tönen von dir, sobald du fort warst«, vertraute er Schlegel an. »Und ihre Anspielung auf Goethe und mich war ebenso unziemlich wie abwegig, denn wir sind beide verheiratet, und mich verlockt die Baronin heute weniger denn je.«
Schlegel hielt Tieck mit beiden Armen und die schlaflosen Augen fest auf ihn gerichtet. »Das hast nicht du in der Hand, mein Freund. Wer sich in sie verliebt und wer nicht, das ist allein ihre Entscheidung. Ich spreche aus schmerzlicher Erfahrung. Nimm dich in Acht.«
In Begleitung des italienischen Schauspieldirektors erschien nun auch Madame. Sie trug eine schlichte graue Pelerine und wie immer ihren Turban. Schlegel bestand darauf, dass sie den Kopfputz augenblicklich abnehme, denn dieses ihr Markenzeichen würde sie zweifellos verraten. Staël fügte sich. Über Schlegels Anwesenheit schien sie nicht im Geringsten überrascht.
Der Prinzipal, ein kümmerlich armer Teufel, den man an seinem verschabten graulich-braunen Rocke und an seinen übel konditionierten Unterkleidern für einen Magister, wie sie auf Akademien zu vermodern pflegen, hätte halten sollen, schickte sich an, mithilfe eines Stallburschen die Pferde vor den Wagen zu spannen. Wie die Ausstattung der Wanderbühne machten auch die beiden Gäule mit Namen Colla und Sapone einen ärmlichen, ja ungesunden Eindruck. Sie waren nichts als ein Paar dürre, abgehärmte Mähren; Knochen, an denen man hätte Sachen aufhängen können; Mähnen und Haare ohne Wartung und Pflege zusammengeknetet: das wahre Bild des Elends im Tierreich.
Ende der Leseprobe