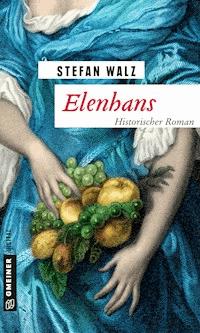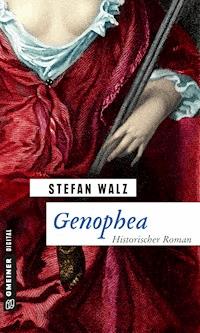Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
September 1683. Wien steht kurz vor der Eroberung durch die Osmanen. Auch Esslingen hat Soldaten zur Verteidigung entsandt. Während der Unruhen tritt die junge Pfarrerstochter Anna Catharina Haug in Esslingen ihre Stelle als Dienstmagd im ›Goldenen Adler‹ an. Der Plan ihres Vaters, die aufmüpfige Tochter so zur Räson zu bringen, scheint aufzugehen und auch in der Liebe ist das Glück ihr hold. Doch mit dem Einfall der Franzosen nimmt Anna Catharinas Leben eine jähe Wendung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Walz
Das Esslinger Mädchen
Historischer Roman
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literatur-Agentur Tübingen Frau Rose Bienia, Alberstraße 5, Tübingen
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von Bernardo Strozzi, »Madonna and Child with Infant Saint John«, ca. 1620 (© http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernardo_Strozzi_-_Madonna_and_Child_with_Infant_Saint_John_-_Google_Art_Project.jpg),
Andreas Kieser, »Esslingen am Neckar«, 1685 (© http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esslingen_am_Neckar,_Andreas_Kieser.png) und von Angelo Bronzino, »Portrait of Lucrezia Panciatichi«, ca.1540 (© http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucrezia_Panciatichi_by_Angelo_Bronzino.jpg)
ISBN 978-3-8392-4582-8
Inhalt
Impressum
Widmung
Erstes Buch
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Zweites Buch
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Drittes Buch
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Anhang
Personenverzeichnis
Lesen Sie weiter …
Widmung
Für Carola
Erstes Buch
Das Mädchen von Hochdorf
»me diu beavit« (sie hat mich lange Zeit beglückt)
Jeremias Haug, Pfarrer von Hochdorf
Prolog
Spätsommer 1683. Schicksalsnacht in Deizisau
Endlich hatte sich die Nacht über den Spitalflecken und seine geschäftigen Bürger gesenkt. Unbeirrt warf der Mond sein silberhelles Licht nieder und ließ die Wasser des nahen Neckars schimmern. Ein lauer Windstoß sang durch die Gärten. Laub raschelte, Zweige schlugen gegeneinander und man vernahm das Stöhnen der vollbehangenen Äste.
Draußen roch es nach Herbst.
Das Leben der Menschen, die unter der Hoheit des Esslinger Spitals standen, war entbehrungsreich und karg, weit mehr als bei ihren württembergischen Nachbarn. Der Deizisauer Schmied war lange Zeit schon Witwer, zusammen mit seinem Sohn, dem halbwüchsigen Lukas, hauste er in einer engen Wohnung im Oberstock der kleinen Dorfschmiede, nicht weit vom Fluss entfernt. Das Licht, das in dieser Nacht brannte, konnte man von Weitem sehen. In der Werkstatt unten war es hingegen ruhig geworden. Schon seit geraumer Zeit, seit der Schmied von dieser tückischen Krankheit heimgesucht wurde, blieb die Esse kalt und der Hammer ruhte auf dem Amboss.
Heute ging es mit ihm zu Ende. Das Leiden des Jakob Hutzenlaub war kurz, doch es kam mit aller Heftigkeit über ihn. Eine klamme Kälte vom Fluss her schlich ins Haus und der Tod war allgegenwärtig.
Auf dem kleinen Wandtisch im Flur flackerte die Wachskerze, das Fenster stand offen. Nervös schlug Lukas die Knie gegeneinander. Er legte die Hände dazwischen, damit sie vom vielen Zusammenschlagen nicht wehtaten. Unaufhörlich starrte er in die Kammer, wo ein anderes, jedoch weitaus düstereres Licht brannte. Er bemerkte nicht, wie der Luftzug sein Haar aufwirbelte und einzelne Strähnen wie Flachswickel zu Berge stellte. Eigentlich war er ein hübscher Junge, nur musste man schon genau hinsehen, um das zu erkennen, und in den schweren Zeiten machte sich keiner die Mühe. Der Junge hatte dunkelblondes Haar, so wie die meisten Leute hier. Es glich dem graublonden Fell der Hündin, die ihm ergeben zu Füßen lag. Genauso war die Farbe seiner Augen weder grau noch blau, noch im Ausdruck hart oder weich, sondern eher matt und traurig. Doch wenn ihn etwas fesselte, bekamen sie einen eigenartigen Glanz und verrieten Fantasie.
Die Stille war bedrückend. Der Hund spitzte die Ohren und stieß einen wolfsähnlichen Laut aus. Auch Lukas wurde aufmerksam. Die angelehnte Kammertür öffnete sich knarrend, wie von Geisterhand. Man konnte den Schatten des Pfarrers über das Bettlaken klettern sehen. Auch im Flur kamen die Elemente in Bewegung. Das Kerzenlicht drohte vom Wind gelöscht zu werden, der jetzt noch heftiger durch das Fenster strich und die beiden Fensterflügel aneinanderschlagen ließ. Blinzelnd beobachtete Lukas das Geschehen und erwartete, dass sich die Geister jeden Augenblick erheben und die irdischen Gesetze außer Rand und Band geraten würden.
Doch nichts dergleichen geschah.
Er fürchtete die Dunkelheit und schloss das Fenster. Inzwischen war genügend Luft hereingeströmt, um das Verderben aus Vaters Kammer hinauszutragen. Lukas hielt inne und spähte durch den geöffneten Spalt. Hinter der schlichten Bettlade konnte er den Sterbenden liegen sehen. Das Licht flackerte. Wie ein Phantom schlängelte sich der Schatten des Kirchenmanns durchs Zimmer. Die lateinischen Gebete ließen das Zeremoniell noch schauriger erscheinen, und ihn bedrängte eine beklemmende Vorstellung. Lukas war, als sei mit dem Wind ein Rabenvogel durchs Fenster geschwebt, der nun die Gestalt des Gevatters annahm. Der Sensenmann hatte es eilig. Mit breiten, fast unmenschlich langen Schritten betrat er die miefige Kammer, wo Vater ihn schon erwartete.
Obwohl Lukas die kindlichen Lippen fest aufeinanderpresste, konnte er das Zähneklappern nicht verhindern. Um der aufsteigenden Kälte Herr zu werden, schlug er die Arme über Kreuz. Der große Mann im schwarzen Habit war unterdessen aus dem Zimmer getreten und umfasste die schlotternden Schultern des Jungen.
Lukas sah ihn mit großen Augen an. Das Traumgewölk löste sich auf.
»Er will dich noch einmal sehen«, erwiderte der Geistliche beruhigend. »Habe keine Angst«, sprach er dem Jungen Mut zu, »dein Vater blickt in das Licht der Erleuchtung, in sein Herz kehrt allmählich der göttliche Frieden ein.«
Natürlich kannte Pfarrer Wagner das belastete Vater-Sohn-Verhältnis. So wie er auch um die düstere Vergangenheit der Familie Hutzenlaub wusste. Nie hatte der Vater ein gutes Haar an seinem grüblerischen Kind gelassen. Es reichte schon ein Funken, ein kleines Missgeschick oder ein falsches Wort, und es brannte lichterloh. Eins ums andere Mal hatte er Lukas schon halb tot geprügelt und es hätte schlimm enden können, wenn der Pfarrer nicht rechtzeitig eingeschritten wäre.
»Nun fasse Mut und spute dich!«, wiederholte Wagner, diesmal streng und unnachgiebig. »Es bleibt nicht mehr viel Zeit.«
Lukas nickte gefasst. Ungern löste er die schützende Umarmung. Vor der Türschwelle wandte er sich noch einmal um. Doch das strenge, vorgerichtete Kinn des Pfarrers duldete keine Umkehr. Als Lukas die Kammer betrat, stieg ihm ein süßlicher Gestank in die Nase. Er atmete durch den Mund und blieb mit gesenktem Blick vor der Bettlade stehen. Näher traute er sich nicht heran. Vages Licht zeichnete Vaters eingefallene Silhouette nach. Der alte Schmied hustete und neigte abgemüht seinen Kopf. Mit glasigen Augäpfeln musterte er seinen Sohn. Schmatzend öffnete sich der Mund, der dünne Speichelfäden zog. Das Sprechen fiel dem Vater schwer. Lukas mühte sich, die gepressten Worte zu verstehen. Es galt, lange Sprechpausen zu überstehen, in denen der Vater um Atem und Fassung rang. Erst als er den Blick zur Decke richtete und den Augenkontakt zu seinem Kind aufgab, wurden die Sätze deutlicher.
»Du bist noch einmal gekommen, so wie ich’s dir geheißen habe? Das war nicht immer so!«, raunte der Vater. Seine Strenge war unüberhörbar. Selbst an der Schwelle des Todes konnte er sie nicht ablegen.
»Nein, Herr Vater … ich meine … ja, Herr Vater, das war nicht immer so. Doch ich habe mich stets darum bemüht!« Lukas’ Stimme zitterte. Diesmal unterdrückte er den Widerspruch, der ihm auf der Zunge lag. Das war ihm selten gelungen und die Hoffnung, dem Vater damit gefällig zu sein, entbrannte in ihm. Mutig, nach einer versöhnlichen Geste Ausschau haltend, starrte er auf die ausgetrockneten Lippen des Sterbenden. Doch sie blieben stumm. Vaters Gesicht erinnerte Lukas an die leblosen Masken der Schausteller, die jedes Jahr zur Kirchweih durchs Dorf zogen.
Der Vater röchelte. Schließlich fuhr er fort. »Martins Leben liegt in den Händen des Allerhöchsten«, sagte er tadelnd, als beschuldigte er insgeheim Lukas, dass er noch nicht im Soldatenalter war. »Sein Blut wird auf dem Schlachtfeld versickern, während du, Lukas, mein Schand- und Sorgenkind, mich als Einziger überdauern wirst.« Er hielt inne und bemühte sich, eine gute Seite daran zu finden. Und siehe da, zum ersten Mal konnte man in seiner Geste so etwas wie Nachsicht oder Güte ausmachen.
»So liegt es nun an dir, dass man der Meinen wohl gedenkt …« Hutzenlaub bündelte alle Kräfte in den letzten Satz, den er erstaunlich laut und voller Inbrunst aussprach: »Junge – leg die Torheit ab! Sie wird dir Unheil bringen. Werde ein tüchtiger Handwerker und tilge endlich diesen Fluch – ein für alle Mal!«
Einen Fluch? Aber Lukas wollte nicht nachhaken, schließlich lag der Vater im Fieberwahn. Er redete sicher blanken Unsinn. »Ja, Herr …«, wieder stimmte er zu und wünschte, dem Vater gefällig zu sein. Dann senkte er traurig den Kopf. Von nun an sah er nicht auf.
Unbemerkt war der Deizisauer Kirchenmann eingetreten. Während er die Hand auf das sterbende Haupt legte, galten seine Worte Lukas: »Ich habe mit Meister Eberspächer von Esslingen alles Nötige besprochen. Du wirst bei ihm in die Lehre gehen, so wie zuvor dein Bruder. Der Vater wünschte es so!«
Der Schmied nickte ein letztes Mal, Wagners Worte bestätigend.
Eilends versuchte Lukas, alles gut zu machen, was ihm in Vaters Augen all die Jahre nicht gelungen war. »Herr Vater …«, entfuhr es seinem bibbernden Mund. Um die Tränen zu verbergen, wischte er mit dem Hemdsärmel übers Gesicht. »Meister Eberspächer wird keinen Grund zur Klage haben, ich …«, beschwor er. Mitten im Satz bedeutete ihm die erhobene Hand des Pfarrers, das Zimmer zu verlassen.
In dieser Nacht lag Lukas noch lange wach.
Als die Todesstunde kam, verschwand die Kälte aus dem Haus. Friede kehrte ein, auch in das Herz des Jungen, der neben der Trauer eine ferne Hoffnung spürte. Er wusste nicht, woher sie kam, doch er bildete sich ein, in Vaters Gesicht, als er ging, so etwas wie zufriedenen Stolz ausgemacht zu haben. Dieser Umstand erwärmte sein Herz und beruhigte seine Seele. Er gab Lukas den Mut, den er so dringend benötigte. Denn schon am frühen Morgen begann mit der Fahrt nach Esslingen sein neues Leben …
Kapitel 1
Die Pfarrerstochter von Hochdorf
Etwas abseits vom letzten Gehöft, auf einer blühenden Wiese, hatten sich die Töchter des Dorfpfarrers niedergelassen. Anna Catharina hatte die Beine untergeschlagen. Die zweitälteste Tochter von Magister Haug war gerade 16 Jahre alt geworden. Ungeduldig sah sie zum Hängenloh hinauf, dort führte die Kirchheimer Landstraße von Notzingen herunter. Hin und wieder blickte sie bange zurück. Zum Glück war vom Pfarrhaus nur das rote Ziegeldach zu erkennen und so waren sie wenigstens für eine gewisse Zeit vor den wachsamen Blicken der Eltern und der Dörfler geschützt.
Am allerliebsten genoss Anna Catharina die Zweisamkeit mit Marietta, ihrer jüngsten Schwester, die gerade vier geworden war. Marietta war ein Naturell von ausgesprochener stiller Zufriedenheit. Auch hatte sie für diejenigen, die ihr freundlich begegneten, stets ein bezauberndes Lächeln übrig. Sie schien mit sich und der Welt, die sie umgab, im Reinen zu sein und flocht gedankenverloren an einem Blumenkranz.
Im Gegensatz zu ihr war Anna Catharina unruhig, sie fürchtete ständig, bei allem, was sie tat, beobachtet zu werden. Und so geisterte der innere Aufpasser durch ihre Gehirnwindungen. Eigentlich war es ja Vaters Stimme, die da zu ihr sprach. Was er wohl sagen würde, wenn er die Geschwister der Muße frönend antreffen würde? Anna Catharina konnte es sich denken. Wie der Teufel das Weihwasser, so scheute der Vater den Müßiggang, der seiner Auffassung nach die Tür in ein lasterhaftes Leben öffnete. Dabei war er nicht etwa ein unfairer Mensch. Nein, denn was er von seinen Kindern verlangte, das lebte er ihnen auch vor. »In der Muße wuchern die tollsten Gedanken«, hatte er heute Morgen noch geschimpft. Wie so oft hatte Anna Catharina den Worten nicht den nötigen Ernst beigemessen, denn bei aller Strenge wusste sie doch, wie sie ihn mit einem Lächeln oder einem Blick beschwichtigen konnte. Anna Catharina war wie ein Schmetterling, der die Freiheit mehr liebte als alles andere. Sie bemitleidete die armen Bauern, die von den Jahreszeiten und der Stundenglocke getrieben wurden. Sie hingegen konnte die Süße des Lebens noch schmecken, so wie jetzt, wo ihr der laue Spätsommerwind Düfte von reifem Obst und gemähtem Gras um die Nase strich.
Pünktlich begann das Glockengeläut. Schon seit Anna Catharina denken konnte, schlug man um zwölf die Türkenglocke1 an. Davon abgelenkt schnellten die Blicke der Mädchen zum Kirchturm hinauf. Nein, Anna Catharina verschwendete keinen einzigen Gedanken an die bedrängte Stadt am anderen Ende der Welt. Das Schicksal Wiens, ganz gleich, welches es auch war, konnte für das ferne Württemberg doch nicht von Bedeutung sein, daran glaubte sie fest. Ihre einzige Sorge galt dem Besucher aus Deizisau, der sich heute angekündigt hatte, und natürlich Mardochai, dem jüdischen Händler, der längst hätte hier sein müssen.
Die Zeit verrann, schon war es fünf nach zwölf und die Glocken verstummt. Noch war das Hundsgespann des Juden nicht in Sicht. Eigentlich war er pünktlich. Im Sommer kam er dienstags, einmal im Monat, lange vor dem Zwölf-Uhr-Läuten.
Nervös wühlte Anna Catharina in ihrer Schürzentasche. Sie fühlte den kleinen, silbernen Handspiegel, den sie immer bei sich trug. Der Spiegel war ein Geschenk von Mutter gewesen, die sich des Öfteren über den Spross, der etwas aus der Art geschlagen war, den Kopf zermarterte. Sie wusste genau, was Anna Catharina gefiel. Der Vater ahnte davon natürlich nichts. Nun nahm Anna Catharina das verbotene Utensil mit dem kunstvoll geschmiedeten Griff zur Hand und hielt es vors Gesicht. Wie gerne sie sich darin bewunderte! Es war ihr durchaus bewusst, dass der Schöpfer ihr eine Schönheit beschert hatte, die über das gewöhnliche Maß hinausreichte. Dabei war es ein Jammer, sie nicht zeigen zu dürfen und die blond gekräuselten Haare unter der strengen Ohrenhaube verbergen zu müssen. Sie zupfte einzelne Haarfransen darunter hervor. Plötzlich hielt sie inne, da Wagenräder ratterten. Rasch schob Anna Catharina den Spiegel ein und sprang auf. Sie hielt Ausschau und strich fahrig die weiße Schürze zurecht. Doch weit und breit war nirgends ein Hundsgespann zu sehen. Nur eine Eselkarre kam näher. Ein schmächtiger Mann mit einem runden Spitzhut lenkte sie. Anna Catharina erkannte ihn sofort. Es war Mardochai, der Jude, der ihr überschwänglich entgegenwinkte. Was für ein blechernes Getöse! Marietta riss staunend die kindlichen Augen auf und drängte sich schutzsuchend an den Rockzipfel der großen Schwester.
Das Gefährt blieb stehen. Mardochai hob den runden Hut und verneigte sich. »Schalom, die Damen!«, grüßte er fröhlich. Dann stieg er vom Kutschbock, um die hintere Pritsche zu öffnen.
Ein Hüne war der Jude wahrlich nicht, ganz im Gegenteil. Anna Catharina konnte ihm leicht über die Schulter sehen, während er in seinen Sachen wühlte.
»Ich handle neuerdings mit Kupfergeschirr und Alteisen«, erklärte Mardochai, ohne aufzusehen. »Auch mit Weinstein und Wachskerzen …, wenn du magst …« Zweifellos besaß der Jude nicht nur eine ausgesprochene Spürnase für nachgefragte Waren, er war auch ein Energiebündel, der es immer wieder schaffte, Interesse zu wecken, wo eigentlich keines existierte.
»Nur Blechgeschirr und Eisenwaren?«, fragte die Pfarrerstochter enttäuscht und zog die Worte wie eine zähe Masse in die Länge. Sie hatte sich schon so auf die neuesten französischen Stoffe gefreut, die Mardochai normalerweise mitbrachte. Überhaupt verwunderte sie, wie er sich in dem Gerümpel zurechtfinden konnte.
»Plus Weinstein und Wachskerzen«, fügte Mardochai penibel erklärend hinzu. »Ach, Kindl, du hast den ganzen Schtat doch gornischt nötig. Ober ich will mol sen, ob ich woß schejnes finden kun.«
Da er offensichtlich nicht das fand, was er suchte, runzelte er die Stirn. Doch beim näheren Durchsehen einer Kleidertruhe, färbte sich seine Stimme mit dem gewohnt triumphierenden Klang. »Was sogt man dazu …, ejne schicke Schnürbrust.« Er zerrte ein Brokatkorsett hervor und hielt es vor seinen Bauch. Anna Catharina wollte nach dem Kleidungsstück greifen, doch Mardochai entzog es ihr. »Nejn, wenn ich es mir so recht überlege«, er tippte mit dem Zeigefinger nachsinnend auf die Unterlippe, »ist das nicht das Richtige für ein braves Christenmädchen. Das Gepränge ist ein halbes Vermögen wert und unbezahlbar für dich!« Als er das Korsett in die Truhe zurückgequetscht hatte, griff er mit der Linken in seine Brusttasche hinein. Dabei sah er die Pfarrerstochter neckend an. »In dieser Hand hab ich wos, was viel besser zu dir passen kennte. Ich sog dir, es ist ganz nach deinen Wuntschn und gar nicht teuer. Es kostet dir eben mal 18 Kreuzern und wenn du das Geld hast, will ich es dir gerne losn.«
Anna Catharina hatte rote Gesichtsflecken bekommen, das passierte immer, wenn sie aufgeregt oder wütend wurde. Mardochai machte es aufreizend spannend. Er kramte ein Bündel bedruckter Papiere aus der Manteltasche, das er der Pfarrerstochter unter die Nase fächerte. Als jene zugreifen wollte, zog er die Hand prompt zurück. »Normalweise trägt die Pandora2 die französische Staatstoilette durch ganz Europa«, erklärte er. »Ober die Franzosen sind findige Leute. Eine Zeitung, die sich fast jeder leisten kun, ist doch das Allerbeste. Na, Kindl, hast du vielleicht Lust?« Schon hielt er die rechte Hand auf. Das Blatt verstaute er solange unter dem Mantel.
Anna Catharina tastete nach ihrem Beutel, der an einer Kordel am Kleid hing. Während sie im Beutel kramte, verlor sie Mardochai keine Sekunde aus den Augen. Endlich konnte sie ein paar Münzen greifen und in die winkende Hand des Juden legen.
»Das sind aber nur zwej!«, beanstandete der Händler und wog abschätzend den Kopf.
»Leider habe ich nicht mehr. Aber da wir gute Freunde sind …« Mit den schön geschwungenen Wimpern blinzelnd, neigte sie den Kopf zur Seite und grinste schelmisch. Für einen Moment verschwammen die Rollen und man konnte nicht mehr erkennen, wer von beiden der Gewieftere war.
»Und du glaubst wirklich, das reicht? Ich meine, die bejden Sechs-Kreuzer-Stücke in Verbindung mit unserer Freundschaft?«
Anna Catharina behielt den Hundeblick bei. Auf diese Weise schaffte sie es normalerweise, den Vater zum Einlenken zu zwingen. Und wie konnte es anders sein, auch bei Mardochai war sie erfolgreich, denn dessen Faust hatte sich längst behütend über den Geldstücken geschlossen. Bewundernd nickte er und lobte: »Jo, ejns muss man dir wirklich losn. Du verstehst wos vom Geschäftemachen.«
Anna Catharina platzte vor Neugierde, als sie die Errungenschaft endlich in den Händen hielt. Der Krämer bestieg den Kutschbock und sah zufrieden auf die beiden herab. »A schejnen Dank, Mejdl«, grüßte er die Ältere und rief der Jüngeren ein »sej gesund« zu. Dann schwang er die Zügel und der Wagen schwankte davon. Marietta blickte ihm nach. Man hörte Mardochai ein hebräisches Lied trällern, das aber allmählich unter dem blechernen Klappern verklang.
Derweil studierte Anna Catharina das Deckblatt und raunte die groß aufgedruckten Lettern gebrochen nach. »Mercure Galant.« Sie reffte die Stirn, denn der Schriftzug ergab für sie keinen Sinn. Mit einem Male löste sich die Begeisterung in Enttäuschung auf. »Was soll ich damit nur anfangen?«, maulte sie. »Ich kann das Zeug höchstens zum Feuermachen oder auf dem Abort verwenden«, und sann die Landstraße zum Talbach hinab, wo Mardochais Karren längst verschwunden war. Unbeachtet ließ sie die Seiten durch die Finger fliegen. Überall nur welsches Geschreibsel. Nirgends gab es Bilder. Sie sah schon nicht mehr hin. Ziemlich am Schluss wurde ihr nachlassendes Interesse dann doch noch geweckt.
Mardochai hatte nicht zu viel versprochen! Die Abbildungen am Ende zeigten modische Gewänder, die mit Borten, Litzen und Volants kunstvoll verziert waren. Die gezeichneten Damen trugen mantelartige, offene Überkleider, eine Art Robe und darunter einen passenden Rock, der nach hinten gerafft eine Schleppe formte. Daneben waren aufreizende Negligés skizziert, mit Taft-, Tüll- und Spitzenbesätzen noch und nöcher geschmückt. Vor allem bewunderte sie die seltsam hochtoupierten Frisuren, die den pudelartigen Hurluberlu3, der Anna Catharina von den hiesigen Patrizierfrauen bestens bekannt war, bei Weitem in den Schatten stellten.
Staunend ging sie neben der Schwester in die Hocke und stieß sie mit dem Ellenbogen an. »Marietta, schau! Ist das nicht wunderschön?« Der unbändige Wunsch kam in ihr auf, diesen Liebreiz nachzuahmen. Der Gedanke ließ sie nicht mehr los, das eigene Haupt mit einer solchen Frisur zu düpieren und die platt gedrückten Locken aufzupeppen. Es war verführerisch und aufwühlend zugleich.
Anna Catharina bemühte sich, mehr zu erfahren, und versuchte verbissen, der französischen Sprache ihr Geheimnis zu entlocken. Sie stammelte den erklärenden Hinweis, der unter dem Bild geschrieben stand, nach. »Duchesse de Fontange.« Kurzerhand warf sie die monströse Haube auf die Erde und wühlte sich in den Haaren. Aber sie begriff sehr schnell, dass die Haartracht so einfach nicht zu bändigen war. Sie würde einen Steifmacher benötigen, irgendwas in der Art, und vielleicht ein Haarnetz.
»Wo bleibst du denn? Na los, nichts wie hin, zum Hühnerstall …«, trieb sie Marietta an, ihr zu folgen.
Sofort wurde Marietta vom Eifer der großen Schwester gepackt und ließ sich anstandslos mitreißen.
1 Um göttlichen Beistand zu erbeten, wurde im Türkenkrieg 1663 – 1665 wieder die Türkenglocke geläutet. Außerdem Einführung des Buß- und Bettags und einer Türkensteuer.
2Modepuppe, die mit der neuesten Mode gekleidet von Frankreich nach England, Deutschland und Italien geschickt wurde.
3 Frisur mit zu beiden Seiten des Gesichts angehäuften Locken.
Kapitel 2
Die Frisur der Herzogin
Obwohl die Zwölf-Uhr-Glocke längst verklungen war, war von den beiden Schwestern im Hause noch nichts zu sehen. Eigentlich hätte Anna Catharina auf Geheiß des Vaters dem inzwischen eingetroffenen Gast das Mahl auftragen sollen, das am heutigen Tag recht üppig ausfiel und geradezu einlud, rechtzeitig bei Tisch zu erscheinen. Zur Kohlsuppe gab es sogar Braten. Vater Haug hatte eigens dafür zwei fette Kapaune4 geschlachtet. Nein, an genügend Zehnthühnern fehlte es im pfarreigenen Hühnerstall wahrlich nicht!
So packten die Geschwister Justinia und Maria alleine in der Küche mit an. Man hörte sie werkeln und gehorsam den Anweisungen von Mutter Susanna folgen. Jene selbst hatte nämlich das Federnrupfen übernommen, da Anna Catharina sich bei der gestrigen Vorbereitung unter einem Vorwand verdrückt hatte. Knuspriger Bratengeruch schwebte schon bald verlockend durchs ganze Haus und warb um Appetit.
Jeremias Haug und sein ältester Sohn Matthäus hatten den Deizisauer Pfarrer Wagner in der Stube empfangen. Der Gast aus dem Esslinger Spitalort war ein großer Mann mit markanten Gesichtszügen. Wäre er kein Gottesdiener gewesen, so hätte man ihn leicht als gut aussehend bezeichnen können. Konzentriert tippte er mit steifen Fingern an seine Schläfe und lauschte den Worten des um zehn Jahre älteren Amtskollegen und Gastgebers. Die Türken vor Wien, das war auch im Hochdorfer Pfarrhaus das alles beherrschende Thema. Dementsprechend gedrückt war auch die Stimmung.
»Aus meinem Brief wisst Ihr bereits, weshalb ich Euch um Hilfe ersucht habe.«
Matthäus schluckte hart, als Vater auf die bekannten Schwierigkeiten zu sprechen kam. Sicher, für ein Mädchen war Anna Catharina etwas zu vorlaut. Manchmal fehlte es an Bescheidenheit, Gehorsam und Fleiß. Dafür war sie stets aufrichtig und nie verlogen! In letzter Zeit häuften sich allerdings ihre Eskapaden, das musste er zugeben. War sie früher der fröhliche Sonnenschein der Familie, um den man diese allerorts bewunderte, so mangelte es heute an geeigneten Mitteln, sie zu maßregeln. Selbst wenn der Vater die Rute auspackte, reagierte Anna Catharina ausschließlich mit Trotz.
Unruhig ruckte Matthäus auf seinem Sitz und hoffte, dass der Gast nicht allzu streng richten würde.
»Hm, der Tag meines Amtsantritts, vor fünf Jahren«, begann Wagner, in sich gekehrt, um von der einzigen Begegnung zu berichten, »liegt weit zurück. Sie muss ja mittlerweile ein junges Fräulein geworden sein.« Er rieb gequält im linken Auge. »Vielleicht solltet Ihr sie verheiraten? Das hat schon manches Wunder bewirkt. Oder findet sich kein geeigneter Gemahl, ich meine, mangelt es dem Kind an Schönheit?«
»Beileibe, daran hat es der Herrgott nicht fehlen lassen«, erwiderte der Magister dösig und war sogleich wieder bei der Sache. »Vergesst die Verheiratung, Wagner. Das Sakrament der Ehe kommt für Anna Catharina noch viel zu früh. Sie würde sich trotzig verweigern, und als Hausfrau wäre sie eine denkbar schlechte Wahl.«
Der Besucher verlagerte sein Körpergewicht bequem und stützte seinen Kopf. Mit der freien Hand schwenkte er den Zinnbecher und begutachtete das Ölen des Weins. »Fürwahr, ein guter Tropfen. Man sollte nicht glauben, dass Trauben in Hochdorf so gut gedeihen«, setzte er beiläufig an. Dann sah er auf. In den nachdenklichen Augen begann das Feuer seines Intellekts zu lodern. »Letzten Sonntag habe ich Jakob Hutzenlaub zu Grabe getragen. Auch er glaubte die Seele seines Sohnes vor Gott verloren. Doch nicht jedes Schaf der Herde gleicht dem anderen, das solltet Ihr doch wissen.«
Wagners Ansatz über das Lasterhafte und Sündenvolle war pietistisch gefärbt. Für Wagner war das Böse nicht im Charakter begründet, dem man durch Strenge und Zucht begegnen musste. Nein, nach seiner Meinung sollte man die Menschen in ihrer Religiosität durch das Bibelstudium unterstützen, damit sie mit einem geschulten Gewissen ein gottgefälliges Leben führen konnten.
»Magister Haug …«, fuhr er salopp fort, mit einer gehörigen Portion Selbstüberzeugung im Ton, »macht es nicht unnötig spannend und bittet Euer Sorgenkind herein.«
Haug musterte Wagner mit skeptischen Blicken. War der Kollege, dem der Ruf eines Vormunds voraneilte, für seine Belange wirklich der Richtige? Er zweifelte und schlug nachdenklich seinen Magisterrock über, um das ausgefüllte Wams mit den auseinanderklaffenden Silberknöpfen darunter zu verbergen.
Jetzt bat er Matthäus, die Familie zu holen.
Als die Männer unter sich waren, beugte sich der Magister über den Tisch und sah sein Gegenüber finster an: »Es ist nicht das, was Ihr denkt«, raunte er. »Nicht die sonst übliche Widerspenstigkeit, der ich längst Herr geworden wäre, das könnt Ihr mir glauben.« Er ließ sich gegen die Stuhllehne sacken und blies die aufgestaute Luft aus. »Zu schweren Feldgeschäften ist sie erst gar nicht zu gebrauchen und die Küchenarbeit verrichtet sie widerwillig, eher schlecht als recht. Stattdessen verbringt sie den lieben langen Tag mit stundenlangem Müßiggang im Garten. Ich fürchte, manch junge Magd könnte ihrem schlechten Beispiel Folge leisten.«
Wagner trank seinen Becher aus und wuchtete das geleerte Gefäß auf die Tischplatte. Dann nahm er endlich Haltung an, und genauso klang auch seine Stimme. »Man erkennt, dass Ihr ein treuer Diener Eures Herrn und Fürsten seid. Ich toleriere Euren Standpunkt, doch laut den Spenerschen Lehren obliegt es alleine dem Grundherrn und vor allem dem Kirchenmann selbst, ein erzieherisches Beispiel zu geben.« Wieder schob Wagner die ›Pia Disideria‹ über die Tischplatte. »Lest Speners Bekenntnis«, sagte er betend. »Es wird Euch in mancherlei Dingen die Augen öffnen und Euch im Bezug auf Eure Tochter zur Erleuchtung führen.«
Als er geendet hatte, sprang die Tür auf. Fünf der sieben Haug’schen Kinder samt ihrer Mutter traten ein.
Der Gast erhob sich und beobachtete aufmerksam. Seine Augen vergruben sich tief unter den gebogenen Brauen, während er nach dem schwarzen Haug’schen Schaf Ausschau hielt. Derweil nahm die Familie unter Getuschel in einer Linie Aufstellung. Die Eltern positionierten sich ganz außen. Mutter Haug stand ganz links, neben dem jüngsten anwesenden Spross, dem siebenjährigen Friedrich. Die Mittvierzigerin war erstaunlich gut gekleidet, fast wie eine gutsituierte Stadtbürgerin. Das Taftkleid war ungewöhnlich lang und berührte sogar den Boden. An Farben war es jedoch schlicht und in standesgemäßem Schwarz. Ungewöhnlich für eine Pfarrersfrau wirkte dagegen das grüne Schnürkorsett, das ihre schlanke Figur durchaus zu betonen wusste. Den Brustausschnitt verbarg sie züchtig unter einem ausladenden Halskragen. Außerdem trug sie ein leichtes Fuchsmäntelchen, was ihr laut der Kirchenordnung eigentlich untersagt war.
Der mit einfachem Magisterrock gekleidete Hausherr trat auf der anderen Seite hinter seinen ältesten Sohn. »Matthäus ist fürwahr ein fleißiger Zimmerergeselle«, lobte er und sah forschend zu dem jungen Mann auf, der seinen Vater weit überragte. »Nach der Lossprechung5 wird er auf die Wanderschaft gehen und danach, so hoffe ich, die Meisterschaft erlangen.« Er ging weiter und legte die Hand auf die Schulter seiner ältesten Tochter. Justinia war gerade dem Heiratsalter entwachsen und hatte die kurzen Beine und den gedrungenen Rumpf vom Vater geerbt. Sie versuchte einen vornehmen Knicks, der ihr aber gründlich misslang. Viel zu unausgewogen, beinahe schlampig wirkten ihre Bewegungen, denen man nur mit viel Fantasie weiblichen Reiz abgewinnen konnte.
»Ich hoffe, endlich einen Ehemann für Justinia zu finden«, erklärte der Magister geplagt und tat einen Schritt seitwärts. Anstatt Anna Catharina anzutreffen, fand er die 14-jährige Maria vor. Jeremias Haug warf einen fragenden Blick zu seinem Eheweib hinüber, die mit einem unschlüssigen Schulterzucken antwortete.
Maria knickste eifrig und tief, ohne namentlich aufgerufen worden zu sein. Trotz ihrer Jugend überragte sie Justinia um eine Scheitelhöhe. Sie machte einen steifen und zugeknöpften Eindruck, hatte aber die Vorzüge der Mutter geerbt, die Figur, das ovale Gesicht, aber auch die schmale Höckernase. Im Gegensatz zu der kleidsamen Hausherrin waren die Töchter allesamt uniformgleich in graue Kleider mit weißen Umschürzen gepfercht, die jegliche Fraulichkeit verbargen. Die Haare trugen sie streng und zurückgekämmt unter engen Hauben.
Der Hausherr legte die Hand nun auf den Schopf des zehnjährigen Jakob. Als der Vater den Namen seines Sprosses nannte, schaute dieser wie ein Spitzbub von unten auf. Jetzt trat Jeremias Haug in Blickkontakt mit dem Besucher. Er war hellhörig geworden.
Im Flur tappten Schritte. Wie abgehackt kamen sie hinter der geschlossenen Tür zum Stehen. Eine ganze Weile herrschte gespannte Stille, bis die Zimmertür aufflog. Marietta spazierte gehemmt mit angelegten Armen und gebeugten Ellenbogen herein. Sie sah weder nach links noch nach rechts und nahm zielgerichtet den angestammten Platz neben Friedrich ein. Mutter rückte auf. Dabei staunte Susanna nicht schlecht. Ihr Kind war mit Hühnerdreck beschmutzt, überall klebten Federn, sie sah aus wie eines der Hühner, in deren Gesellschaft sie sich offensichtlich vergnügt hatte.
Pfarrer Haug ahnte das Unheil voraus, das in Person von Anna Catharina das Zimmer betreten sollte. Gerade, als Susanna ausholen und das Kind dem Gast vorstellen wollte, blieb ihr das Wort im Halse stecken. Vater Haug schnappte nach Luft. War Mariettas Anblick schon eine Schmach gewesen, so übertraf der Auftritt von Anna Catharina die schlimmsten Befürchtungen. Die blonde Jungfer stolperte über die Türschwelle und war über die Aufwartung dermaßen überrascht, dass sie stocksteif dastand. Auf ihrem Haupt herrschte eine regelrechte Haarkonfusion. Längst hatte sich die improvisierte Hochfrisur nach beiden Seiten geteilt und die beiden Flügel standen fast brettartig ab. Das Eiweiß hatte der Schwerkraft genauso wenig entgegenzusetzen wie die eingewobenen Stoffbänder.
Den ›Mercure Galant‹ hielt Anna Catharina noch in der Hand. Jeder im Zimmer konnte sehen, woher sie ihre Inspiration geschöpft hatte. Den Tadel der Eltern und die Skepsis des Besuchers beantwortete die Heranwachsende mit einem verlegenen und breiten Grinsen, das sich bis hinter die Ohren zog. Nur die fleckenartige Röte im Gesicht verriet ihre innere Erregung. Mutter hatte die Zeitschrift längst konfisziert und ließ sie hinter dem Rücken verschwinden. Amüsiert steckten die Geschwister ihre Köpfe zusammen.
Lästerliches Getuschel.
Heimliches Gelächter.
Maria und Jakob, die laut ausprusteten, zündelten gefährlich an der väterlichen Geduld, die kurz vor dem Ausbruch stand. Um keinen Flächenbrand zu riskieren, hielten sie einander die giggernden Mäuler zu.
Rein äußerlich wahrte Wagner die Contenance. Vergewissernd strich er über das eigene Haupt, als fürchte er eine ähnliche Unordnung. Gekünstelt versuchte er sich an einem Lächeln, das aber weitgehend seine Wirkung verfehlte. Fahrig hetzten seine Augen über die Gesichter der Anwesenden, vor allem Vater und Tochter bedachte er besorgt. Etwas umständlich begann er zu erklären, doch dann brachte er die Situation auf den Punkt: »Auch wenn die Dekane des Öfteren die Nase rümpfen, ist sich Doktor Wild nicht zu schade, selbst die Predigt zu halten. Er genießt die Rückendeckung des Rates. Kurz und gut: Esslingen wäre ein gutes Pflaster für Eure Tochter.«
Mutter Susanna scheuchte ihre Kinder hinaus. Sie selbst blieb mit den beiden Pfarrern und Anna Catharina im Raum. Wagner wartete noch, bis die Tür verschlossen war. Dann wandte er sich an die 16-Jährige. »Falls dein Vater damit einverstanden ist, wirst du beim Schwager des Bürgermeisters Walliser lernen, was für ein gutes und gottgefälliges Leben nötig ist. Lerne Demut, Kind! Der ›Goldene Adler‹ ist ein gut situiertes Haus, die erste Herberge der Stadt Esslingen. Ferner hat der Wirt einen unverheirateten Sohn, Friedrich. Er wäre eine gute Partie, falls er Gefallen an dir findet.«
Noch immer schien er verwirrt, schritt zur Tafel und füllte seinen Becher randvoll. »Den christlichen Heerscharen und den Deinen zum Wohle«, prostete er seinem Pfarrkollegen zu. Beinahe stolperte er über seine eigenen Worte. Während er den Kelch schon an die Lippen setzte, fügte er rasch hinzu: »Die hoffentlich siegreich und gebessert heimkehren.« Hastig schluckend spülte er seinen Unglauben hinab.
Anna Catharina schlug traurig die Wimpern nieder. Das Lachen war ihr vergangen und die rosigen Flecken im Gesicht vermehrten sich rasend. Dies waren die Vorboten der nahenden Ohnmacht. Am liebsten wollte die junge Frau Augen und Ohren vor der Realität verschließen. Wie ein bockiges Kind kniff sie die Lider zusammen und krampfte die Hände um die Ohrmuscheln, sodass das Blut aus den Fingern wich. Die vollen Lippen pressten sich zu einem schmalen Strich, sie entschied, den Atem anzuhalten, so lange, bis Vater einlenken würde.
Der jedoch nickte geplagt, aber zustimmend.
Anna Catharinas Knie wurden butterweich. Schließlich erlöste sie die Ohnmacht, sie sank rückwärts in die Arme ihrer Mutter.
4kastrierter Mastgockel
5bestandene Gesellenprüfung
Kapitel 3
Die Geräusche der Nacht
Der September war gerade sieben Tage alt. Noch blieben die Stadttore Esslingens bis abends um zehn geöffnet, und das Gesindel, das die Dörfer und Weiler unsicher machte, strömte herein, um sich im inneren Mauerring der Reichsstadt einzunisten. Doch allzu lange würde das fröhliche Treiben nicht mehr währen, denn mit den kürzer werdenden Tagen wurden auch die Stadttore früher geschlossen. Bereits nächste Woche sollte die Weinglocke die braven Bürger schon um sechs heimwärts rufen. Für die Obdachlosen begann die ungemütliche Zeit.
Die Dunkelheit hatte sich längst über die Stadt gesenkt. Ein weißer Vollmond schien am Firmament, und während die Esslinger wohlverdiente Bettruhe hielten, versahen die Seiler droben auf der Burg die Hochwacht. Unten, im Schutz der Nacht erwachte eine ganz andere, nämlich buntere Welt: Es war der geheime Kosmos der Heimatlosen, Vagabunden und Gaukler.
Mit Einbruch der Nacht schlichen verwegene Gestalten und zwielichtige Schatten durch die Straßen und verbargen sich hinter schummrigen Häuserecken und Abbruchruinen, vor allem in den einstigen Klöstern, wie dem der Barfüßer, Augustiner und dem von Sirnau.
Über den Verbleib des christlichen Heeres war noch keine Nachricht eingegangen. Die Ungewissheit lastete deshalb schwer auf den Gemütern. Aber spätestens bei Tagesanbruch musste es weitergehen – irgendwie! Dabei sorgte vor allem die Geistlichkeit für weiteren Verdruss. Für jene war das Kriegsunglück nämlich Grund für weitere Maßregelungen. Eilig wurden neue Zuchtgesetze erlassen, und jeden Tag machten weitere Gerüchte von dubiosen Einschränkungen die Runde. Die einfachen Leute hinterfragten sich selbst und wachten fleißig ob der Redlichkeit ihrer Nachbarn. Niemand lachte oder musizierte mehr. An Tanz dachte man ohnehin schon gar nicht, denn das war den biederen Stadtvätern ein Dorn im Auge gewesen. Sogar die Patrizierschaft verpönte es, wenigstens tat diese nach außen hin so. Denn von dem, was wirklich in der Bürgerstube vor sich ging, ahnte der kleine Mann natürlich nichts. Unentwegt brütete Oberpfarrer Wild, manchmal bis in den Morgen hinein, über dem Katechismus, der das Erziehungsinstrument für die Esslinger Jugend werden sollte. Doch heute Nacht war auch die Arbeitsstube des frommen Speziales im letzten erhaltenen Flügel des einstigen Barfüßerklosters dunkel geblieben.
Seit über einer Woche schon wohnte Lukas im Katharinenhospital. Er hatte seine Schlafstätte in der Gesindestube. Wieder einmal lag er endlos lange wach. Die dumpfen Geräusche im Bauch der Stadt verunsicherten ihn. Das Geflüster der Gassenknechte, die mit dem Stadtwächter Rundgänge machten, hallte herauf. Ganz fern ließ die Schelle der Hochwacht die Stunde verlauten. Es war der Beweis dafür, dass doch die Zivilisation und nicht das Chaos die Nacht beherrschte. Auch die Glocke am Steuerhaus begann, synchron mit der Hochwache, ihr angenehmes Spiel. Lukas beschlich eine befremdliche Sicherheit, welche das Heimweh und den Wunsch nach Geborgenheit nur wenig zu lindern vermochte. Einen Atemzug später vibrierte die blecherne Schlaguhr vom Ostgiebel des Spitalgebäudes und vermengte sich mit dem Ruf der reichsstädtischen Rathausglocke.
Er zählte die Schläge. Es war 2 Uhr nachts.
Draußen nahten jetzt die Schritte der Nachtumgänger. Sie hielten direkt unterhalb seiner Stube an. Ihre Laternen spiegelten sich im Fensterglas, aber der lange Schatten der Sankt Dionyskirche verschlang sie schon bald. Die Männer waren zur Hauptwache auf der Inneren Pliensaubrücke unterwegs, wo sie von einer ausgeschlafenen Rotte abgelöst werden sollten. Lukas dachte an die Mahnworte Meister Eberspächers. Oh – und es waren unbeschreiblich viele! Eines davon lautete: ›Wehe, wenn du an den verbotenen Versammlungen der Studenten oder Handwerksburschen teilnimmst und jauchzend durch die Straßen vagierst und wie sie nächtlichen Unfug treibst, dann steht mächtig Ärger ins Haus.‹ Wie des Meisters Groll aussehen würde, das ahnte Lukas, dem dabei die Wut des Vaters in Erinnerung kam. Lukas solle stets auf das Ansehen Eberspächers achtgeben, so warnte der Meister weiter, das gehörigen Schaden nehmen würde, falls man den Lehrbuben einmal morgens aus dem Käfig auslösen musste. Ein solcher Vorfall könnte ihm seine berechtigten Hoffnungen, einen Sitz im Dreizehnerrat zu erlangen, zunichtemachen. Es hatte Lukas bislang davon abgehalten, den nächtlichen Geräuschen zu folgen, die er zwar fürchtete, aber auch anziehend fand. Oft glaubte Lukas, dass sie geradezu nach ihm riefen. Er wälzte sich unruhig auf seinem Lager, von der einen Seite zur nächsten und wieder von vorn. Es war ein ungemütliches Bett mit durchgelegener Strohmatratze und mottenzerfressener Zudecke.
Vaters Ableben hatte eine große Leere in seinem Herzen hinterlassen. Weit öfter dachte er dagegen an seinen Bruder, der mit den Reichstruppen irgendwo im fernen Österreich lagerte, wo die Bundesgenossen schon bald auf eine gewaltige osmanische Streitmacht treffen würden. Vielleicht war Martin, der sein einziger Verwandter war, schon verloren und mit ihm das gesamte Abendland? In letzter Zeit krochen die Erinnerungen an Vater langsam in ihm hoch. Sein letztes, verbissenes Lächeln hatte sich in Lukas’ Gedächtnis eingemeißelt. – Wieder unterbrach das Knistern und Knacken über ihm die Rückschau. Es füßelte auf dem Dachboden, als ob eine Armada von Mäusen zugange wäre. Lukas wusste: Dort oben lagerten die spitaleigenen Getreidevorräte – und es waren mehr als tausend Scheffel! Ob es wirklich Mäusefüße waren oder doch der Geisterspuk, konnte er nicht wirklich sagen. Denn natürlich kursierte da manche Mär. So soll der Brand im Caspart-Haus vor einigen Jahren von einem feuerspeienden Drachen verursacht worden sein. Mitten in der Flammenhölle stiegen Dämonen aus dem Räuberturm. Im Mönchskittel und Nachtpelz spukten sie dort herum, bis der damalige Vorbesitzer so verschreckt war, dass er das Anwesen, oder was davon übrig blieb, an Christof Caspart, den Krämer, veräußerte. – Und was es mit dem Krokodil im Spitalkeller auf sich hatte, das mit Vorliebe faule Spitalknechte verspeiste und in Wirklichkeit vielleicht dieser Drache war, davon wollte Lukas lieber nichts wissen. Schaudernd schlug er die Decke über den Kopf und bemerkte gar nicht, wie es, bis auf die Schnarchlaute seiner Zimmergenossen, plötzlich ruhig wurde.
Minuten später knarrte die Stiege auf dem Flur. Ganz langsam wurde die Tür aufgeschoben. Im Nachthemd huschte jemand durchs Zimmer und verkroch sich flugs unter einer Bettdecke, wo er sogleich sägend wie ein Holzmacher ins Reich der Träume hinüberdämmerte. Denselben Ausflug wiederholte dieselbe Person jede Nacht, wovon sie erst zwei Stunden später zurückkehrte. Lukas war zwar jung, doch nicht dumm! Er wusste, dass über der Amtsstube der Offizianten, drüben im Westflügel, die Zimmer der Frauen lagen. Problemlos konnte man über das Treppenhaus dorthin gelangen, ohne dass die Oberen irgendwie Verdacht schöpfen konnten. Nachdem der Nachtschwärmer eingeschlafen war, kehrte endlich Stille ein. Lukas wunderte sich, dass heute vom Weingärtnermeister im Untergeschoss nichts zu hören war. Adam Kindsvatter, so hieß der Weinmann, war eigentlich ein recht freundlicher Geselle. Offensichtlich war ihm durch die Kindsvatterin ein schweres Los beschieden, denn er musste sie manchmal so lautstark verprügeln, dass die Schläge und das Geschrei zu ihm hoch durch die Decke drangen. An seine Mutter konnte sich Lukas nicht erinnern. Als sie damals starb, war er noch ein ganz kleiner Bub gewesen. Überhaupt war ihm die fürsorgliche Wärme einer Frau fremd …
Der Nachtwächter, der am Markt die nächste Strophe anstimmte, rief ihn in die Gegenwart zurück. Seinem schrägen Gesang jaulte ein Hund nach.
Drei Personen ehren wir,
In der Gottheit für und für.
Der Strophe nach zu urteilen, war es gerade 3 Uhr früh – die Todesstunde von Vater. Die Nacht würde für Lukas spätestens um halb fünf enden. Er glaubte seine Hündin, die er Canis nannte, am Fuße seines Bettes. Nun war er so müde geworden, dass die bleierne Bettschwere es verhinderte, sich davon zu vergewissern. Auch der Wille, den Geräuschen zu folgen, erlahmte und so hallten die nächtlichen Rufe fern in seinen Gehörgängen wider: »Lukas hilf, Lukas komm …«
Schließlich mündeten die Stimmen in einen Traum. Eine wunderschöne junge Frau erschien. Sie hatte langes, blondes Haar und erhob sich feengleich über der Stadt. Das helle Licht, das ihr Kleid durchschien, umrahmte sie zugleich. Geblendet verdeckte Lukas sich das Gesicht. Doch schon bald tauchte ein böser Schatten auf, der den Glanz völlig verschlang. Er nahm die Form eines Dolches an.
Das Messer stach der Schönen mitten ins Herz.
Kapitel 4
Von Unglücksraben und Trantüten. Die Straßenkinder …
Langsam löste sich das nächtliche Grau von den Häuserfassaden und das mächtige, weitläufige Geviert des Katharinenhospitals erwachte. Der Mief aus der Armen- und Krankenstube im Westflügel war beißend, es roch nach Siechtum und Tod. Die brusthohe, kalte Friedhofsmauer von Sankt Dionys, die direkt daran angrenzte, trug maßgeblich zu dieser Atmosphäre bei. Auch die verwinkelten Nischen im Predigerkloster, gleich dahinter, das seit der Reformation der Stadt gehörte, verhalf nicht gerade dazu, den düsteren Eindruck zu verbessern.
Nach dem Auszug der Mönche waren die leeren Gebäude des Klosters allmählich neuen Bestimmungen zugeführt worden. So fanden die Waisen ebenso einen neuen Hort wie die Lateinschüler und das Collegium Alumnorum, wie man die Eliteschulen der Esslinger Geschlechter nannte. Einmal im Jahr jedoch, am Sonntag nach Jakobi, kehrte der längst vergessene Prunk dorthin zurück. Im ehemaligen Klosterhof, wo die Linden- und Obstbäume in voller Blüte standen, hisste man die Fahnen des Spitals und der Stadt und verzierte die Balustrade mit grün-roten Girlanden und der Bürgermeister trat vors Volk. Dann erwachte der Ort aus seinem Dornröschenschlaf und wurde zum Schauplatz des alljährlichen Schwörtags. Alt und Jung, ob Bürger oder Beisitzer waren auf den Beinen und halfen, die neuen Amtsinhaber zeremoniell zu vereidigen. Das Schwörfest lag erst zwei Monate zurück. Jos Spindler und Philipp Weickersreutter gingen als zweite und dritte Bürgermeister schon in ihre 14. Amtszeit, während der regierende Georg Friedrich Walliser erst sein zweites Jahr vor sich hatte.
Neben den Schmutzwinkeln befanden sich im Spitalgeviert auch genügend andere, weitaus freundlichere Plätze. So residierten die reichen Pfründer im Nordflügel, dem Neuen Bau, wie man die letzte Erweiterung von Sankt Katharina nannte. Die Mettingertor-Straße mit den prächtigen Häuserfassaden und schönen Fachwerkgiebeln führte unmittelbar daran vorbei. Schon seit 6 Uhr früh zogen die Bauern aus Mettingen durchs Tor herein, und mit ihnen kamen Händler und Fuhrwerke, die die Stadt binnen Kurzem mit regem Leben erfüllten. Vereinzelt trotteten Weingärtner, deren Wingerte an die Spitalkelter gebannt waren, verschlafen durch das Beutau-Tor. Auch der Ost-Flügel, der an den Markt anstieß, war recht ansehnlich. Aus Joseph Hienlens Apotheke traten erste Kunden. In der Schrannenhalle unter dem Steuerhaus tummelten sich die Bürgersfrauen unter den Arkadengängen.
Als Lukas erwachte, wunderte er sich, wie hell es im Zimmer war. Herumschwirrende Staubpartikel juckten in seinem Nasenflügel und brachten ihn zum Niesen. Die Betten ringsherum waren allesamt verwaist. Die Spitalglocke hatte ihn geweckt, er lauschte ihren Schlägen. Es waren zehn!
Augenblicklich kam sein Blut in Wallung. Mit einem Male saß er gerade. »Canis?«, stieß er beunruhigt aus und rief seine hündische Gefährtin gleich noch einmal. Aber diese gab keinen Laut. »Los, du Faultier, wach endlich auf«, versuchte es Lukas noch mal und tastete nach ihr. Aber statt dem borstigen Fell fand er nur blanke Holzdielen. Verwundert rieb er sich die Augen. Aber es änderte nichts an der Tatsache, dass Canis verschwunden war – und er verschlafen hatte. Ruckartig wühlte er sich aus den Laken. Lukas dachte keine Sekunde an die Arbeit, die schon lange auf ihn wartete, sondern nur an Canis, die er unbedingt wiederfinden musste. Ganz gleich, ob es Eberspächer nun passte oder nicht. Im Gehen stieg er in die Beinlinge seiner Kniehose und hüpfte bis zur Tür, wo er mit einem finalen Hopps den Hosenbund über das Gesäß reffte und die Hosenträger überschlug. Halb angezogen rannte er das Treppenhaus hinab und übersprang dabei mehrere Stufen gleichzeitig. Ohne Strümpfe und Schuhe erreichte er barfüßig den Innenhof. Das weiße Zwilchhemd hing wild aus der Hose. Überall war geschäftiges Treiben. Aus der Wagnerei hallte Gehämmer und im Bindehaus gleich daneben war Küfer Autenriet gerade dabei, den letzten Eisenring über ein neues Fass zu schlagen. Probehalber rollte es der Knecht sogleich polternd über den Hof zu den fertigen, die übereinadergestapelt auf potenzielle Käufer harrten.
Auch der Lehrling des Pfisters war unterwegs. Er schob einen mit Backwaren beladenen Handkarren in Richtung Osttor und fuhr beinahe über die Zehenspitzen des Nachzüglers, der verwirrt Ausschau hielt. Trotzdem war Lukas flink genug, rechtzeitig auszuweichen und gleichzeitig eines der duftenden Brötchen zu erhaschen, die die Bedürftigen im Spital am Morgen übrig gelassen hatten und die jetzt in der Brotschranne zum Verkauf feilgeboten wurden. Der Bäckersbub staunte ob der Dreistigkeit nicht schlecht, aber brachte keinen Ton zustande und setzte seinen Weg unbeirrt fort.
Hungrig biss Lukas in das Knäuschen und blickte sich um. Canis sah er nirgends, auch nicht beim Rohrenbrunnen, wo sie normalerweise den morgendlichen Durst stillte. Besorgt folgte er dem Pfister auf den Marktplatz und wurde auf ein Mädchen aufmerksam, das vor dem gegenüberliegenden Haus kniete. Sie war ungefähr in seinem Alter und trug ein flickenübersätes Wollkleid. Der abgemagerte Leib wirkte fast schon kränklich.
Hier in dem vornehmen Bezirk der Stadt würde der Büttel sie sicher bald auflesen und im hohen Bogen aus der Stadt schmeißen. Bettelei vor der Behausung der Datts, einem der ältesten Esslinger Patriziergeschlechter, war eine denkbar schlechte Wahl. Das Mädchen gehörte wohl zu dem Gesindel, das unerlaubt herumstreunerte und Almosen ergatterte. Wenn überhaupt, dann war Betteln allenfalls den Studenten oder Handwerksburschen erlaubt, und diese mussten schon ein Zeugnis des Oberpfarrers oder ihres jeweiligen Zunftmeisters vorweisen können. Eine Haube trug das Lumpenmädchen nicht. Das braune Haar hing ungezähmt über die knochigen Schultern. Es spürte Lukas’ neugierigen Blick, und als dieser sich näherte, sah es müde auf. Ein paar verlauste Haarfransen verirrten sich in dem schmutzigen Anlitz. Gierig fixierte es Lukas’ Hand, und ohne sich von der Stelle zu bewegen, reckte es den zerfledderten Ärmel nach der Leckerei.
Lukas sah sie kauend an. Doch er war anständig genug, den Rest mit ihr zu teilen. Er staunte nicht schlecht über das schlingende Maul, denn in Windeseile war das Brot verdrückt. Ein Geräusch wie das Ticken eines Stockes nahte. Lukas brauchte eine Weile, bis er den Blick von dem Mädchen abwenden und das Geräusch ergründen konnte, das sich jetzt aus dem Marktgemurmel herauslöste. Jemand mit einem Gehstock, der im Gleichtakt aufs Pflaster schlug, näherte sich unentwegt und hielt jetzt neben ihm an. Lukas wollte aufsehen, aber er kam nicht mehr dazu, denn er wurde hinterrücks grob am Arm gepackt.
Erschrocken fuhr Lukas herum.
Eberspächer ballte die Faust. Die andere Hand hatte sich zangengleich um den schlanken Oberarm des Schützlings gewunden. Er sprach, wenn er mit Lukas redete, in der dritten Person. »Hutzenlaub – das sieht ihm gleich!«, herrschte der Meister ihn an. Aus dem Augenwinkel musterte er das Straßenmädchen grimmig und zog, bevor er sich erneut dem Ausreißer zuwandte, die buschigen Brauen zusammen. »Er wollte sich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken und sich aus dem Staub machen?«
Lukas versuchte zusammenhanglose Erklärungen, die allesamt ins Stocken gerieten, noch ehe er sie auf den Punkt gebracht hatte.
»Ist es nicht schlimm genug, dass er, ein zünftiger Schmied, den lieben Tag verschläft, wie sonst nur die Schlafhauben vom Magistrat? Jetzt will er sich feige aus der Verantwortung stehlen! Deshalb nichts wie her mit ihm! Derartige Ungezogenheit werde ich ihm rechtzeitig austreiben, oder sollte ich gar mit dem Vormund ein ernstes Wörtchen reden?«
Was für eine Unterstellung. Lukas faul und feige? Verärgert zappelte er sich aus der Umklammerung frei, was aber zur Folge hatte, dass der Griff noch fester wurde. Nie hatte Lukas die Absicht gehabt, sich vor den Pflichten zu drücken.
»Nichts von alledem ist wahr«, beeilte er sich zu erklären, damit Eberspächer ihm nicht ins Wort fallen konnte. »Es ist wegen Canis. Sie ist fort …«
»Aha, diesen gefräßigen Mistköter meint er, der heute Morgen vor dem Tor gewartet hat?« Eberspächer lockerte den Griff und sah den Burschen an. Sein Ausdruck war jetzt gar nicht mehr so böse, sondern eindringlich und ernst. »Dein Hund hat in der Metzig6 vom Hans-Leonard Mayer Innereien gestohlen. Der Mayer ist kein Guter! Er hat das Vieh durch die halbe Stadt gehetzt.«
Lukas schluckte schwer. Der beilschwingende Metzger erschien ihm im Geiste. »Und wo ist sie jetzt?«, fragte er bestürzt und presste den aufgestauten Atem aus den Lungen.
Meister Eberspächer hob und senkte unschlüssig die Achseln. »Keine Ahnung, aber eins sei ihm gewiss: Hätte der Mayer das Mistviech geschnappt, dann wäre Hackfleisch aus ihr geworden.«
»Aber …« Lukas riss die Augen noch weiter auf. Übereifrig wollte er schon loslaufen, um Canis zu suchen, aber der Meister packte fest zu.
»Hiergeblieben, Jungchen. Wenn der Köter dem Mayer entkommen kann, dann ist er schlau genug, sich durchzuschlagen.«
Lukas nickte gefasst und würgte den Kloß hinunter. Er ließ sich ziehen und sah auf den Marktplatz zurück. Das Straßenmädchen war wie vom Erdboden verschluckt.
Bange Stunden vergingen, bis endlich der Mittag kam. Eberspächer blieb stur. Den ganzen Tag erlaubte er Lukas weder, eine Verschnaufpause einzulegen, noch, zur Stärkung ein Vesper zu sich zu nehmen. Die Schale Morgenmus, die Lukas sowieso verschlafen hatte, war ebenso tabu wie die darauffolgende Brotzeit oder das Mittagessen. Dennoch hatte er es an Fleiß nicht fehlen lassen, denn, in der Hoffnung, früher entlassen zu werden, hatte er wie ein Berserker geschuftet, Kohlen geschleift und Rohlinge erhitzt. Derartige Tätigkeiten waren ihm wohlvertraut. Hundertmal hatte er sie zu Hause schon ausführen müssen. So wusste er im Schlaf die richtige Anlassfarbe des Eisens, damit es für den jeweilig nächsten Arbeitsgang die nötige Fließeigenschaft zum Treiben des Rohlings erhielt. Von klein auf war Lukas Vater zur Hand gegangen. Nur am Amboss, mit Hammer, Stempel oder Stemmeisen, stellte er sich ziemlich ungeschickt an, und daran hatte sich auch bei Eberspächer nicht besonders viel gebessert, egal, wie sehr er sich anstrengte.
Am Nachmittag ließ Eberspächer dann Milde walten und schickte seinen Lehrbuben mit einem frisch beschlagenen Pferd zum Marstall hinüber. Das langweilige Gerede des Stallmeisters hielt Lukas ewig hin. Ein besonders pflichtbewusster Pferdeknecht machte ihn mit jedem einzelnen Pferd bekannt, so kam es Lukas, der nur bedingt zuhörte, wenigstens vor. Insgesamt 60 Rosse beherbergte der Marstall. Es gab kraftstrotzende Zuggäule, aber auch edle Reitpferde, die, so der Knecht, nur vom Spitalmeister Ernst Weickersreutter selbst und dessen Verwalter Wilhelm Ramser ausgeritten wurden, etwa dann, wenn sie in den spitaleigenen Dörfern, Deizisau, Vaihingen und Möhringen nach dem Rechten sahen. Über eins wurde Lukas sich währenddessen klar, auch wenn er sich die ganze Zeit über um Canis sorgte und darüber nachsann, wo er mit der Suche beginnen sollte: So schnell würde Eberspächer die Arbeit nicht ausgehen.
Kaum war Lukas vom Marstall zurück, gab man ihm einen weiteren Botendienst auf. In der Küfergasse galt es, eine fertige Wagenkette abzuliefern. Den ganzen Weg dorthin haderte Lukas wegen der Strenge des Meisters. Trotz Anraten hatte er den Leiterwagen nicht mitgenommen. Er war überzeugt, die Kette, die man zwar einfach hochheben konnte, geschwind zu schultern und sie schnell wie der Wind in die Untere Stadt zu tragen. Doch mit jedem Schritt wuchs das Gewicht. Die Kettenglieder schlängelten bald schellend über die Pflastersteine. So kam Lukas der Treppenabsatz vor der Kanzlei gerade recht. Dort sank er nieder. Sein Rücken schmerzte und sein Magen war vor Hunger und Sorgen ganz flau geworden. Von hier aus konnte er gut die Zentgasse überblicken. Dort hatten gerade zwei schwitzende Pferde, die vor einen vollbeladenen Fruchtwagen gespannt waren, angehalten. Lukas bekam das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Aber er zollte dem wachsenden Unbehagen wenig Beachtung. Warum auch, die Bauern waren schließlich mit dem Abladen und der Wagenführer mit dem Hofverwalter beschäftigt.
Bislang war Lukas aus dem Spitalgelände und den Gassen um den Markt nicht hinausgekommen. Die Orientierung fiel ihm schwer und die Ungewissheit, nicht genau zu wissen, wohin er gehen sollte, wühlte ihn auf. Was nur, wenn er den ›Goldenen Adler‹ in der Küfergasse nicht finden würde? Musste er dann den ganzen Weg mit dem schweren Eisenmonstrum zurückgehen? Forschend schielte er die Steinfassade, die hinter ihm aufragte, hoch. Die gotischen Fensterbögen erinnerten mehr an einen sakralen Bau als an ein Amtsgebäude. Was er nicht wusste, die einstige Allerheiligenkapelle war jahrhundertelang das Beinhaus der exhumierten Geschlechtergräber gewesen. Heute diente das aufgestockte Gebäude als Stadtarchiv. Etwa in der Mitte führte ein ummauerter Weg abschüssig durch einen kleinen Durchschlupf zum Kesselwasen hinab, der vom zweiarmigen Ross-Neckar umspült wurde. Wenn es still war, konnte man sogar die Schaufelräder der Schleifmühle walken hören.
Gerade als er sich erheben wollte, wurde in seinem Rücken plötzlich die Tür aufgerissen. Ein Patrizier im Herrenrock, Kniehosen, Seidenstrümpfen und Schnallenschuhen hatte es eilig. Mit einem Bündel unter dem Arm stürmte er ungehalten ins Freie. Doch wie hätte es anders sein können? Schon beim Aufstehen hatte sich das Unheil angekündigt! Der vornehme Herr stolperte über Lukas geradezu hinweg und riss den Unglücksraben gleich mit. Der Mann versuchte den Sturz noch abzuwenden. Dabei entglitten ihm die Akten, und die Blätter verteilten sich kreuz und quer auf der Straße. Mitten in den Papieren, die wie Schneeflocken auf ihn niederrieselten, kam er zu Fall und stöhnte.
Ein zweiter, bei Weitem jüngerer Patrizier erstarrte noch auf dem Treppenabsatz. Lukas hatte sich inzwischen aufgerappelt und sah verschreckt auf die entstandene Konfusion. Mit seiner abgeschürften Hand verschloss er den staunenden Mund.
»Onkel – um Gottes willen!« Der Mann im Türrahmen machte ein wütendes Gesicht. Er rang um Fassung, und da ihm scheinbar die Worte fehlten, wollte er mit seinem Gehstock auf Lukas losprügeln. Doch er besann sich gerade noch und eilte dem Gestürzten zu Hilfe.
In aller Aufregung sammelte Lukas die losen Blätter ein und versuchte sie sogleich, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Auch rannte er Schwärmen von Papier, die vom Sog in alle Himmelsrichtungen davongeweht wurden, hinterher. Inzwischen stand der Mann schon wieder und klopfte sich den Staub aus den Kleidern. Wie durch ein Wunder schien er unverletzt. Jetzt sah er Lukas verärgert an.
»Ich unterstelle dir mal, Bürschchen, dass es nur ein Versehen war«, sagte er in schulmeisterlichem Ton.
Lukas’ Wangen glühten wie das Abendrot, das sich über die Stadt senkte. Er war untröstlich und antwortete mit einem Kopfnicken. Vorsorglich zog er schon mal das Genick ein, die schallende Ohrfeige spürte er bereits im Gesicht. Der junge Patrizier reffte die Ärmel seines Justaucorps7 und näherte sich mit geballten Fäusten und Drohgebärden. Doch anstatt Lukas zu züchtigen, riss er die eingesammelten Papiere an sich. Der unausgesprochene Tadel brannte jedoch heißer als eine körperliche Züchtigung. Wieder hörte Lukas die Schelte des Vaters im Geiste, der ihn einen unfähigen Nichtsnutz nannte, der selbst zum Gänsehüten noch zu dumm war.
Der Ältere hatte in Lukas längst den unbescholtenen Burschen ausgemacht, der rein zufällig in das Unheil geraten war. Nun hatte dieser seine Lektion gelernt, befand er und mahnte noch: »Beim nächsten Mal stell dich etwas geschickter an. Ich hätte mir das Handgelenk brechen oder weit schlimmer den guten Rock zerreißen können.« Dann drehte er sich seinem Neffen zu, der verzweifelt versuchte, die Papiere zu ordnen, dabei aber feststellen musste, dass die Blätter schon erstaunlich gut sortiert waren. Dieser beobachtete den Jungen skeptisch, aber interessiert aus dem Augenwinkel. »Dabei, hm, soll Philipp erst nächstes Jahr das Amt des Stadtschreibers beerben«, vervollständigte der Alte und winkte seinem Nachfolger in spe, ihm zu folgen.
»Ich bin untröstlich, mein Herr«, antwortete Lukas beschämt und verbeugte sich. Erschöpft wischte er den kalten Angstschweiß von der Stirn. Derweil entfernten sich die Herrschaften. Lukas sann ihnen nach. Der alte Stadtschreiber zog das Bein nach. Er war derjenige, der das Wort führte, während sein Neffe aufmerksam zuhorchte. Über Lukas’ schienen sie kein Wort zu verschwenden. Offensichtlich gab es Wichtigeres zu bereden. Bei der Boltzeschen Apotheke blieben sie eine Weile stehen. Der Jüngere blickte einige Male aufmerksam zurück. Doch aus welchen Grund? Erst später erfuhr Lukas, wer die beiden Herrschaften gewesen waren. Philipp Datt war der Neffe des alten Stadtschreibers Johann Wilhelm Datt. Sie gehörten zu den einflussreichsten Esslinger Familien.
Lukas verfiel in Selbstmitleid. Er ließ sich auf die Stufe nieder und zog die Beine ganz dicht an den Leib. »Vaters Gericht war noch viel zu wenig«, schluchzte er. »Durch Schussligkeit und Ungehorsam bringe ich sogar die vornehmen Herren um ihre Gesundheit. Oh weh …, was bin ich doch für …« Er ließ die Stirn auf den Unterarm sinken, dabei wurde seine Gejammer jäh unterbrochen.
»Eine Trantüte?«, vervollständigte die helle Stimme ganz in seiner Nähe, um gleich darauf etwas nachdrücklicher und ruppiger zu werden. »Ja, eine Trantüte bist du – nichts weiter!«
Lukas schüttelte sich. An der Ecke Zehntgasse sah er das Lumpenmädchen ziemlich wacklig auf dem Kratzstein sitzen. Den Oberkörper hatte es stocksteif gegen die Hauswand gestemmt, so als wäre es ihr einziger Halt und die aneinandergelehnten Beine bloß Zierde.
»Meinst du mich?«, entgegnete er stutzig.
»Wen denn sonst? Oder hörst du jemand anderen jammern? Ich nicht! Mal ganz im Ernst. Bei deinem Anblick könnte ich Rotz und Wasser heulen.«
»Ehrlich?«, fragte Lukas vertrauensselig.
»Ja«, antwortete sie tonlos, und jeder, der unbefangen hinhörte, hätte die Ironie verstehen können. Nicht aber Lukas, der war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. »Es ist nicht etwa«, fuhr sie im farblosen Ton fort, »weil ich Mitleid mit dir hätte, sondern eher, weil ich mich für dich schäme!« Zum Schluss gewannen die Worte einen unfreundlichen Unterton. »Sieh dich an. Du kannst gehen, tanzen und springen. Deine Augen sind wach und klar. In ihnen spiegelt sich das Sonnenlicht. Was, Junge, soll der Herrgott noch alles tun? Soll er vielleicht Gold und Tand über dich niederregnen lassen?« Es schien sie wütend zu machen, dass ein gesunder, wohlgenährter Junge so undankbar war. Doch bevor sie sich vollends in Rage redete, wechselte sie das Thema und stellte eine belanglose Frage hintenan: »Weißt du eigentlich, was eine Trantüte ist?«
»Nein«, antwortete Lukas arglos, aber reckte interessiert das Kinn nach vorne.
»Dann will ich es dir erzählen. Also, auf dem Walfänger, der die ›Flotte Lotte‹ hieß, waren einst die Tranfässer alle. Und da die Seemänner eben findige Leute sind, dachten sie sich etwas aus. Aus Papier falteten sie große Tüten. Aber da es unter ihnen schlampige Matrosen mit dicken, klobigen Fingern gab, waren viele der Tüten undicht. Als die ›Flotte Lotte‹ schließlich mit ihrem reichen Fang in den Hamburger Hafen einlief, roch man den Waltran schon von Weitem.«
»Und was hat das alles mit mir zu tun?«
Ihre trüben Augen durchdrangen Lukas beinahe. »Die halbe Stadt hört dich schluchzen. Na ja, wenigstens hat dich so dein Hund finden können. Er hat eine feine Nase.« Sie lächelte, da sie in Lukas’ Augen einen Hoffnungsstrahl sah.
Canis kam aus der Gasse gesprungen und schmiss sich winselnd in den Arm ihres Herrn, der das aufgeregte Tier erleichtert drückte und sich von der schleimigen Zunge die Tränen aus dem Gesicht und das Blut vom Handrücken schlecken ließ.
»Aber ich sollte dich dafür loben, Lukas, dass du den Stadtschreiber stolpern lassen hast. So wehrlos, wie der auf dem Rücken lag, wie ein Maikäfer. Man hätte dem Alten das ganze Geschmeide vom Leib reißen und dem reichen Schnösel daneben flugs die Taschen leeren sollen. Schade, dass wir dich nicht schon früher gerochen haben.«
Nach kurzer, inniger Freude stutzte Lukas. Er stand auf und verschränkte die Arme vor die Brust. Während er sich dem Mädchen näherte, vergrub Canis zufrieden die Schnauze in ihrem Fell. »Du hörst dich wohl gerne selbst reden? Nicht wahr? Aber das ganze Geschwafel interessiert mich nicht, schon eher die Tatsache, was du mit Canis zu schaffen hast. Und überhaupt, woher kennst du eigentlich meinen Namen?«
»Sie ist schlauer als ihr Herr«, gab sie kühl zurück. »Aber vielleicht täusche ich mich ja. Beweise es und folge ihr heute Nacht. Und Lukas, vergiss nicht, die Stadt hat Ohren, besonders wenn es dunkel wird.« Das Mädchen zwinkerte herausfordernd, und im gleichen Moment vernahm Lukas dasselbe Trippeln wie heute Morgen. Auch Canis wurde hellhörig. Hechelnd umrundete sie ihren Herrn. Das lenkte Lukas kurz ab, und als er aufsah, war das Mädchen verschwunden. Nur eine ganze Meute davonrennender Stiefel war noch zu hören.
Verwundert blieb er zurück. Doch schon bald vergaß er die seltsame Begegnung, und die Pflichten holten ihn ein. Er eilte zurück zum Spital und besorgte den Leiterwagen. Es war schon Abend geworden, als er mit dem Hund endlich in die Küfergasse einbog. Der ›Adler‹ war gar nicht schwer zu finden. Die Zweifel waren also völlig umsonst gewesen. Doch dass er ausgerechnet vor einem Mädchen geweint hatte, das verzieh er sich nicht so leicht. Was für ein Schwächling er doch war – oder wie sie es so trefflich beschrieben hatte, eine Trantüte mit Löchern eben, deren miefenden Inhalt man von weit her hören und riechen konnte.