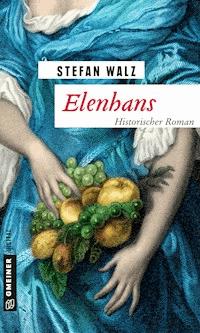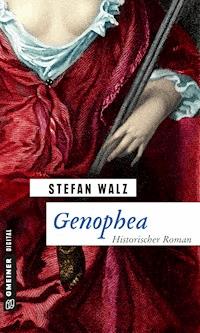Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Anno 1715: Der junge Schmuggler Fynn gewinnt Zugang zu einem illustren bürgerlichen Kreis: der „Teutschübenden Gesellschaft“ des Herrn Brockes. Dieser möchte ein Schauspiel inszenieren, benötigt dafür aber ein Buch, das sich im Besitz von Fynn befindet. Um sein Vorhaben umzusetzen, baut Brockes vor allem auf Ulrich König, den berühmten Opernlibrettisten. Als dieser Opfer eines Mordanschlags wird, gerät Fynn unter Verdacht. Auf der Flucht begegnen Fynn berühmte Persönlichkeiten. Zudem trifft er Sarah, das Mädchen ohne Lachen, dessen Mutter genau wie seine eigene aus Esslingen stammt. Diese Parallele führt Fynn schließlich auf die Spur von Königs Mörder ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Walz
Das Vermächtnis des Esslinger Mädchens
Historischer Roman
Zum Buch
Mord am Hofe Anno 1715: Der junge Schmuggler Fynn gewinnt Zugang zu einem illustren bürgerlichen Kreis: der „Teutschübenden Gesellschaft“ des Herrn Brockes. Der angesehene Dichter weiß um ein Buch, das Fynns Vater nach eigenen Erlebnissen selbst verfasste. Um das Vorhaben, die Geschichte als Schauspiel zu inszenieren, umzusetzen, benötigt Brockes die Unterstützung von Reinhard Keiser und Ulrich König, ihres Zeichens Komponisten und Librettisten an der Oper. Als König nach der Uraufführung der Keiser-Oper „Fredegunda“ Opfer eines Mordanschlags wird, gerät Fynn unter Verdacht. Hals über Kopf müssen er und seine Gefährtin Fenja fliehen. Auf der Reise begegnen den Vagabunden herausragende Persönlichkeiten jener Zeit, welchen sie gelegentlich, mit Witz und Charme, den Spiegel ihrer Unvollkommenheiten vor Augen halten. Schließlich treffen sie Sarah, eine Kaufmannstochter aus Calw, deren Mutter gebürtig aus Esslingen ist, genauso wie Fynns eigene. In Sarahs verworrenem Leben findet Fynn schließlich Parallelen zu Vaters Buch und damit das mögliche Motiv zu Königs Ermordung …
Stefan Walz wurde 1970 in Reutlingen geboren. Er war lange Jahre in der Industrie tätig und arbeitet heute als Ausbilder in der Jugendberufshilfe. Seiner schriftstellerischen Leidenschaft, die 2006 an einem verregneten Sonntagnachmittag begann, kann er seitdem mehr Zeit widmen. Damals entdeckte er im Familienstammbuch die Geschichte eines Vorfahren, der im Dreißigjährigen Krieg einen Bauernaufstand auf der Schwäbischen Alb anführte: Der Elenhans! Fasziniert von dessen dramatischem Leben begann er zu recherchieren und zu schreiben. Sein Debütroman »Das Esslinger Mädchen« erschien 2015 im Gmeiner-Verlag.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Das Geheimnis der Silberkinder (2017)
Elenhans (E-Book Only, 2016)
Genophea (E-Book Only, 2016)
Das Esslinger Mädchen (2015)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Neher_001.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Riley_-_Frances_Hales_-_Google_Art_Project.jpg
und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucrezia_Panciatichi_by_Angelo_Bronzino.jpg
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6190-3
Zitat
Es ist etwas hinter dem Thron, das größer als der König selbst ist.
Sir William Pitt, House of Lords, 1770
ERSTES BUCH
1715
Die Armut ist der Welt so nötig, daß ohne sie, die Welt nicht Städte
Nicht Ordnung, nicht Bequemlichkeit, Gesetze, noch was Gutes, hätte.
Wär’ Armut nicht; wär’ alles arm. Ein jeder würde nicht allein
Sein eigner Diener werden müssen; wir würden, auf trocknen Lande
Nicht anderes, als durch Sturm verschlagenes schiffbrüchigs Volk auf ödem Strande,
In einem Meer von Elend wühlen, und sonder Schutz und Hülfe sein.
Barthold Hinrich Brockes
Prolog
»Man spint, man webt, man färbt alda, so schön als nirgends anderswa«
Wie von Gott und der Welt vergessen, lag die Amtsstadt, von dichten Wäldern umgeben, im Tal, wo die Nagold unablässig ihr geschwätziges Lied plätscherte. Für Calw war dieser Umstand Fluch und Segen zugleich. Dem Wachstum der Stadt waren dadurch enge Grenzen gesetzt, nicht aber den Träumen und der Kreativität seiner Bürger, die manchmal höher erwuchsen als so mancher Baum, der sie umschloss.
Georg Friedrich, der junge Baron von Bouwinghausen, genoss die Fahrt in der offenen Chaise am Fluss entlang sichtlich entspannt und in vollen Zügen. Er ließ das Pferd gemütlich dahintraben. Nach den körperlichen Anstrengungen, die er vor gut einer Stunde in den Ruinen von Hirsau vollbracht hatte, war das auch kein Wunder, dass er die Muße vorzog und die Schönheit der Natur in sich wirken ließ. Verwegen lächelte er zu seiner Begleiterin, der ebenso blutjungen wie entzückenden Josephine von Gaisberg. Nur sie alleine wusste, was der brennende Blick des Jünglings zu bedeuten hatte. Noch immer glühten ihre Wangen verräterisch, voller Scham und Begierde. Dieser gutaussehende Kavalier hatte der Tochter des württembergischen Kammerherrn in einem rauschenden Liebesspiel bei den Klosterruinen vor knapp einer Stunde tatsächlich die Unschuld geraubt.
Der Fahrtwind kühlte.
»Wir haben die Romantik dem Mordbrenner zu verdanken«, durchbrach der Baron die glückselige Stille und wies in einer fast philosophischen Sprache auf den Umstand hin, warum das einstmals so prächtige Kloster heuer in Trümmern lag. »Mordbrenner – so nennt ihn der Volksmund. Er war General in der Armee des Duc de Lorges, der bei Ötisheim Herzog Friedrich Karl gefangen nahm und nach Versailles verschleppte. Dafür, dass er diesen verzauberten Ort schuf, die Klosterschüler verjagte, müsste ich ihm eigentlich nachsehen, dass er ferner meines Vaters Schloss in Zavelstein zerstörte.«
Er lächelte bitter in sich hinein.
»Hat es denn einen Namen, dieses Scheusal?«, plapperte Josephine unwissend daher. Sie war dem Inhalt der Geschichte nur beiläufig gefolgt und weilte gedanklich noch immer in den Sphären der Lüste. Ihr Gesicht verriet keinerlei Regung angesichts des Schauermärchens, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Ganz im Gegenteil: Verzückt schielte sie in die Ferne. Ihre großen, mandelförmigen Augen schienen leise zu triumphieren. Sie hatte den begehrtesten Heiratskandidaten zwischen Neckar, Enz und Nagold gekonnt umgarnt und im Netz ihrer Weiblichkeit eingesponnen.
Jetzt gehörte er alleine ihr!
»Mélac!«, war die knappe Antwort.
Einhelliges Schweigen folgte, bis der Baron einen neuerlichen Vorstoß wagte. Er hörte sich selbst gerne reden und blies sich wie ein Pfau auf. »Wenn Ihr mögt, verehrtestes Fräulein, zeige ich …«
Genant räusperte sich die Tochter des Ritters von Gaisberg in die zierliche Faust und unterbrach den Versuch. »In Anbetracht gegenwärtiger Ereignisse«, näselte sie, »dürft Ihr mich, lieber Baron, im Vertrauen der Zweisamkeit, natürlich beim Vornamen nennen.« Kokett winkte sie den Fächer vor das Gesicht und entfloh so seinem Stieren. Ihr Blick entglitt und flog über die Baumkronen hinweg, wo er sich in dem Licht der Büsche verirrte. Wann sie wohl endlich seine Stadt sehen würde?
»Nun … Fifi«, flattierte der Baron in aufgesetzt französischem Akzent, um dann doch drängender zu werden. Er lechzte danach, ihr endlich auch in weltlichen Dingen seine Größe und Standhaftigkeit unter Beweis zu stellen. Wie ein Diplomat, der die Kunst der Dialektik und der Rhetorik perfekt beherrschte, setzte er meisterhafte Sprechpausen und verlieh so seinen Worten den gebührenden Stellenwert: »Wenn Ihr mögt, zeige ich Euch das Kaufhaus der Compagnie. Dort kann ich Euch die neusten Wollzeuge präsentieren, welche, durch fleißigen Unternehmergeist inspiriert, auf den Märkten Europas feilgeboten werden und die hiesige Gemeine ebenso vortrefflich kleiden wie katholische Geistliche im Vatikan.«
»Ganz Europa?«, rief Fifi in mädchenhafter Verzückung und klappte in die Hände. Naseweis bohrte sie weiter: »In Paris, London und Amsterdam?«
»Nein, leider nicht«, musste der Baron eingestehen. »Das Wirtschaftssystem dieser Länder verbietet gegenwärtig den Export. Sie wollen die Wertschöpfung im eigenen Lande behalten und führen keinerlei Fertigprodukte ein. Aber in Italien, Polen und der Eidgenossenschaft, da haben wir große Märkte.«
»Die Pariserinnen tragen also ausschließlich Samt und Seide – und keine Calwer Produkte?«, fragte das Fräulein von Gaisberg verblüfft und machte ein langes Gesicht.
Auf diese naive Frage wusste der Baron auf Anhieb keine Antwort. Er kam ganz nahe an ihr Ohr und Josephine spürte den warmen, kitzelnden Atem und ergötzte sich daran. »Selbstverständlich sind diese einfachen, wenn auch meisterhaft gewobenen Stoffe Eurer zarten Haut in keinster Weise würdig. Aber wenn Ihr mir gesteht zu betonen …«
»Was kann das schon sein?«, kicherte sie.
Er flüsterte: »Am allerschönsten seid Ihr immer noch nackt.«
Das brachte das Fräulein gehörig aus der Fassung. »Hups«, gluckste sie und warf einen anzüglichen Blick zwischen seine Beinlinge. Neckisch biss sie die Vorderzähne auf die Unterlippe und es war ein Leichtes, zu erraten, welch sündige Gedanken durch das Köpfchen spuckten. »Oh, ich wäre enchanté, hocherfreut, wenn Ihr mich endlich entführtet …, ich meinte, wenn Ihr mir die Besonderheiten Eures Herrschaftsgebiets dartätet!«
Josephine interessierte alles! Neben den Vorzügen seines Aussehens gehörte auch der Einfluss und die Macht der Familie Bouwinghausen dazu, die durch den Vater, den Obervogt von Calw, noch im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte, exzellent repräsentiert wurden. Doch selbst ein zäher Mann wie er würde sich einmal der irdischen Vergänglichkeit beugen müssen und Besitz, Amt und Würden aus der Hand geben. Wie das einmal für sie werden würde, als Baronesse, Herrin von Zavelstein und Altburg, darüber ließ es sich wunderbar in der Zukunft schwelgen.
Endlich zeigte sich die Silhouette der Stadt Calw. Gekonnt lenkte Bouwinghausen den Einspänner über die Untere Brücke, die sich zur unteren Vorstadt hin auf die andere Nagoldseite schwang. Die Insel an dieser Stelle, wo sich der Fluss in zwei Arme teilte, war eine Zierde Calws. Hier, hinter der Sebastianskapelle, befand sich ein freier Platz, der mit drei Reihen Linden bepflanzt war. Sonntags, nach dem Kirchgang, lud er zum Verweilen ein. Hinter grünenden Bäumen konnten sie spielende Kinder ausmachen, worunter sich auch ein auffällig hübsches Mädchen befand. Georg Friedrich bremste die Karosse und spähte hinüber. Seine Begleitung berauschte sich noch an den Aussichten, die eine mögliche Heirat einbrachte, und schloss die Augen.
»Sie spielen Jeu de Paume1!«, erklärte der Baron verzückt.
»So? Wie schön für sie …«, antwortete Josephine arglos und seufzte zufrieden, so dass sich ihre Brust anhob.
»Mein Gott, das Ding schlägt ein vorzügliches Volley«, schwärmte er und konnte seinen Blick nicht mehr abwenden.
In Josephines selbstgezimmerter Welt, voller wunderbarer Erwartungen, gab es keinen Raum für Zweifel. Nie und nimmer wäre sie auf den Gedanken gekommen, dass sich der Baron auf Abwegen befand und das Mädchen auf eine Weise anstarrte, wie sie es nur für sich selbst beanspruchte. Auch glaubte sie, es handele sich bei dem erwähnten »Ding« um ein schmutziges Kind, nicht eben um die Kaufmannstochter Sarah Gfrörer. In Josephines Vorstellungen besaßen die Untertanen nämlich keine Zeit, um Tage mit Spielen zu verbringen oder dem Müßiggang zu frönen.
»Welch Anmut, Agilität und technische Finesse«, murmelte der Baron mit rauer Stimme und bemerkte nicht, wie ihm der Speichel im Mund zusammenlief. »Es zelebriert das Spiel. Seine Dynamik, diese Präzision – impressionnante.«
Die Fängerin auf dem Feld war mit einer gewöhnlichen Bluse bekleidet, die knapp oberhalb am Knie aufhörte. Kein lästiges Gewand zwängte ihren unbändigen Bewegungsdrang ein. Das Spiel ihres grazilen Körpers, diese unbekümmerte Wildheit, die sich unter dem Kleid andeutete, las sich wie eine Aufforderung – wie ein Befehl!
Es berührte sein Herz und ließ Fantasien reifen, die er nicht aussprach.
Im Stillen fasste der Baron einen für Sarah verhängnisvollen Plan. Dem harmonischen Kontrast zwischen Kampfgeist – der das Mädchen unentwegt anspornte, das Tor zu verteidigen oder das nächste Schasse zu gewinnen – und der unschuldigen, fast kindlichen Leichtigkeit, dem wollte er begegnen.
1 Jeu de Paume war eine Frühform des heutigen Tennisspiels.
Kapitel 1
Am anderen Ende der Welt
Die Glocken von Sankt Michaelis verkündeten die zehnte Stunde. Auf den Straßen machte sich Unruhe breit. Kein Wunder, dass die Bewohner der Hamburger Neustadt zusammenliefen und dem Gejagten unbeabsichtigt den Weg verstellten. Der Mantel des jugendlichen Verfolgten schleifte am Boden. Der Stoff war abgewetzt und der Umstand, dass sein Gewand im Verhältnis zur Körperfülle viel zu weit war, machte diesen Kerl verdächtig – mehr als verdächtig! Eine breite Hutkrempe legte das Gesicht in den Schatten. Wache, wild aufgerissene Augen lugten darunter hervor und ließen Obacht walten. Sie suchten nach einem Ausweg. Nein, umkehren konnte er nicht: Die Häscher waren ihm auf den Fersen.
So war er also völlig unvermutet in diese missliche Situation geraten, eine, die Fynn in der ganzen Ausweglosigkeit, die sich offenbarte, nicht kannte! Natürlich hatte er nie die Gelegenheit ausgelassen, die Stadtgarde zu narren und hinters Licht zu führen. Dabei war er stets als strahlender Sieger hervorgegangen. Hätte er das Dilemma beim Aufstehen vorausgeahnt, wäre er sicher im Bett geblieben. So war er wie jeden Morgen, seit sie das Millerntor wieder geöffnet hatten, mit einer riesigen Portion Übermut im Gepäck aufgebrochen. Altona, die freie Stadt, vom dänischen König mit vielen Privilegien beschenkt, war seine Heimat. Dort war er aufgewachsen, dort fühlte er sich wohl. Die Eltern bewohnten auf der Freiheit, zwischen der mennonitischen und der katholischen Kirche, eine ärmliche Bude. Geschwister hatte er keine und außer Onkel Hansgeorg, dem blinden Fischer, keine Verwandten. Einst hatten sie ein kleines Haus besessen, aber das war vor zwei Jahren, zusammen mit den umliegenden Gebäuden und zwei Dritteln der Stadt, in Schutt und Asche gesunken. Stenbock, dieser schwedische Lump, hatte den Befehl zur Verbrennung Altonas gegeben, angestiftet durch den Gesandten Vellingk, der – wie konnte es anders gewesen sein – sich in Hamburg aufhielt. Brennende Fackeln und Pechkränze hatten sie durch die Fenster im Rathaus geworfen und die Bewohner mit Waffengewalt am Löschen des sich ausbreitenden Feuers gehindert. Einen Tag und eine Nacht lang fraßen sich die Flammen durch Altona. Da die Hamburger die Tore versperrten, aus Angst vor der Pest, die damals grassierte, gruben sich die Obdachlosen auf dem Hamburger Berg in Sandgruben ein, so dass man es ein wenig warm hatte. Mit Grauen erinnerte sich Fynn an die Eiseskälte bei dichtem Schneegestöber und spürte wieder die Wut auf Schweden und Hanseaten aufwallen. Zum Glück hatte der Wiederaufbau schnell begonnen. Selbst Hamburg ließ es an Hilfe nicht fehlen und unterstützte die hungernden und frierenden Nachbarn mit Lebensmitteln, Decken und Holz. Trotz des Entgegenkommens dachte Fynn im Traum nicht daran, Durchfahrtzölle zu bezahlen, auch wenn die Hamburger das Wegegeld infolge der Not, speziell für die Altonaer, gesenkt hatten. Sein Mantel wölbte sich schließlich nicht umsonst so ausladend um seinen Bauch und das lag sicher nicht am vielen Essen – oh nein! Fynn war rank und schlank. Die Melasse-Krüge und Flaschen, die er, in Taschen verwahrt, um den Leib gebunden hatte, benötigten Platz, genauso wie die Beutel voller Kaffee, Tabak, Kakao oder Tee, die am Innenfutter angestickt waren. Es glich bislang einem Wunder, dass sie ihm das Unschuldslamm all die Monate abgekauft hatten. Auf dem Fußmarsch über die Erlenallee des Hamburger Bergs, der ihn oberhalb der Tranküchen am Elbstrand und unterhalb der Reeperbahn entlangführte, hinab zum Millerntor – die ganze Zeit hatte er sein Lied geträllert. So konnte er das Geschepper wenigstens einigermaßen übertönen.
Altona!
Durch Fischer des Nordens einst geboren,
ragtest ärmlich, ein Knosp, ein Völkchen im Wind.
Wuchst heran und gediehst im Gezeitenwechsel,
durch schauenburgische Grafen, wie das eigene Kind.
Vom König der Dänen zu Stadt erhoben,
Palmaille, lang blühte die Freiheit, die Pracht.
Doch der Wind trug dunkle und stürmische Zeiten,
Vellingk schwang die Klinge des kalten Verrats.
Die Stimme aus Hamburg erhört von den Schweden,
Steinbock legte Flammen in eisiger Nacht.
Das Feuer jagte gierig die Seelen,
prasselnd fraß es sich durch die freie Stadt2.
Die Wachmannschaft runzelte geschlossen die Stirn, wenn der singende Dickwanst zur ständig selben Tages- und Abendzeit auftauchte und die Hellebardenträger, sie schelmisch angrinsend, passierte. Aber das war die Vergangenheit. Heute spürte Fynn zum ersten Mal die geballte Macht des Hamburger Magistrats. Es war kein Spiel, nicht wie sonst. Diesmal würde er nicht ungestraft davonkommen, das war zu befürchten. Drum sah er die Felle davonschwimmen. Geschlagen ließ er die Schultern hängen.
Unglaublich! Sie hatten ihn, den pfiffigsten Schmuggler zwischen Ritzebüttel und Altland, in die Enge getrieben und er war leichtsinnig und dumm genug gewesen, in die Falle zu tappen! Die Menge auf der Straße hatte ihn längst umzingelt und die Menschenkette schloss sich langsam zu einem undurchlässigen Band. Man begaffte ihn wie ein seltenes Tier, das vom Aussterben bedroht war. Nein, fehlendes Pflichtbewusstsein konnte man den Ordnungshütern bislang nicht vorwerfen. Als Uhlen wurden die nämlich verspottet, weil sie vor allem nachts auf Verbrecherjagd gingen. Die Tagblinden mühten sich nach Kräften! Doch auf den Straßen der größten Stadt des Reichs, mit den vielen Brennpunkten, waren sie einfach überfordert. Es war schlichtweg unmöglich, überall gleichzeitig für Recht und Ordnung zu sorgen, zumal den 72.000 Einwohnern Hamburgs nicht mehr und nicht weniger als 50 »Eulen« gegenüberstanden. Fynns Husarenstücke, die er in der Vergangenheit vollbracht hatte, rasten durch seine Erinnerungen. Nein, Kapitulation passte nicht zu einem gerissenen Altonaer Jungen! Das Licht der Zuversicht glomm noch einmal auf. Es weigerte sich zu erlöschen. Ja, einen Versuch war es allemal wert. Er wusste, was ihm blühen würde, wenn sie ihn einfingen. Fynn zog das Genick ein, ging seitwärts, um dann plötzlich wie ein Rammbock loszustürmen.
Aber was war das?
Es gab keinen Widerstand! Die Kette zerriss einfach, als wäre sie ein zarter Faden aus Seide und eben nicht die Eisenfesseln, wie befürchtet. Die Leute boten ihm bereitwillig eine Gasse zur Flucht an. Fynn stoppte verdutzt und sah sich um. Sie wirkten jetzt überhaupt nicht mehr so bedrohlich, sondern im Gegenteil: Ihre Gesten munterten ihn auf, endlich Fersengeld zu geben. Und jetzt, da die Uhlen »Haltet ihn« brüllten und um die Ecke bogen, reckten sie die Fäuste in den Himmel und johlten ihm zu. Den Ordnungshütern machten sie es nicht gerade leicht, durch das Gedränge zu gelangen. Fremde Menschen, die ihm noch nie begegnet waren, ergriffen Partei für ihn!
Aber wie war das möglich?
Die Gesellschaft der Hansestadt war zwiegespalten. Während die Reichen und Vornehmen jenseits des Alsterflets in prachtvollen Gebäuden residierten, hausten die Armen in Schmutzwinkeln am Hafen und in der Neustadt. Hier mochte man die Pfeffersäcke, wie man die Mitglieder der Kaufmannsgilden nannte, nicht leiden. Man verachtete ihre Dekadenz, die sündhaft teuren Gewänder und die herablassenden, oberschlauen Sprüche, die für sie, die Armen, weder Fisch noch Fleisch waren. Man sympathisierte deshalb heimlich mit den Illegalen, den Schmugglern und Bönhasen.
Beinahe jeder Bürger aus den Spelunken galt als ein solcher Bönhase und er musste es sein, wenn er nicht verhungern wollte. Die Bön diente den unzünftigen Arbeitern nämlich als Produktionsstätte und sobald die Staatsgewalt einem solchen illegalen Handwerker auf die Spur kam, jagte man ihn durch die Gassen, um ihn dingfest zu machen. Für die Leute war die Bönhasenjagd ein Heidenspektakel. Viele Bönhasen waren inzwischen nach Altona übergesiedelt, wo sie ihr Handwerk auch unzünftig und völlig legal verrichten durften. Eigentlich sollten die Wächter an den Toren die Schmuggler aus Altona in Schach halten.
Aber die hatten wohl Fische auf den Augen.
Besonders gewitzte Bönhasen wurden gerne frenetisch bejubelt, die erfolglosen Jäger hingegen schadenfroh verhöhnt. Und so war es auch diesmal. Fynn hatte begriffen, dass sich hier eine waschechte Bönhasenjagd zusammenbraute. Er rannte los, machte seiner Rolle als Hase alle Ehre und schlug Haken übers Straßenpflaster. Damit der Schlapphut nicht wegwehte, musste Fynn ihn gut festhalten. Die Uhlen hingen noch im Gedränge fest, ein Umstand, der ihm einen komfortablen Vorsprung verschaffte. Als Mümmelmann hetzte er über den Krayenkamp, um den Michel, die Hauptkirche des Sank-Michaelis-Kirchspiels. Immer wieder wechselte Fynn die Straßenseite und dann erreichte er schließlich den Ausgangspunkt seiner Flucht: den Zeughausplatz, wo die Kamine der Waffenschmieden den Himmel vernebelten und sich Soldatenhütten bis hin zur Joachimus-Bastion aneinanderreihten. Leider waren die Jäger auch schon da. Wie sie das wohl so schnell schaffen konnten? »Ergreift ihn!«, brüllten sie und waren zum Zugriff bereit. Von allen Seiten kamen sie angerannt. Vom Hörensagen wusste Fynn, was ihm nun blühte: Er durfte nach Herzenslust malträtiert werden. Keiner der Stadtoberen machte einen Finger krumm, ganz egal, ob ein Delinquent zum Krüppel geschlagen oder gar zu Tode geprügelt wurde. Die Meisterjäger ahnten wohl, welch dicker Fisch am Haken hing – einer nämlich, der ihnen mit Ramsch die Geschäfte vermasselte und die Stadtkasse schröpfte, Zölle und Zinsen prellte, wie es ihm gerade gefiel. Die Zuschauer erkannten, dass es mit dem Hasen jäh zu Ende ging, und buhten die Staatsgewalt aus. In seiner Verzweiflung warf Fynn mit Kaffee- und Teesäcken wild um sich und siehe da, die armen Schlucker bückten sich und stritten sich wie Bluthunde darum. Einige Jäger stolperten tollpatschig über sie hinweg. Der Fluchtweg stand Fynn plötzlich wieder sperrangelweit offen. Nur noch ein beherzter Spurt durch die Schmiede und es wäre geschafft. Fynn ließ das Ziel nicht mehr aus den Augen. Auch wenn dabei das wertvollste Schmuggelgut verloren ging, schleuderte er den guten Baltimore-Tabak von sich und traf unglücklicherweise in die Esse, wo das Kraut sogleich Feuer fing. Der Schmied, der erst nicht kapierte, sog den blauen Dunst genüsslich durch die Lunge. Erst grinste er benommen, doch als er begriff, welch Kostbarkeit da in seinem Feuer verschmorte, trieb es ihm die Tränen in die Augen.
Fynn trug den Sieg davon.
Er machte sich aus dem Staub, während der Qualm den Häschern die Sicht vernebelte.
*
In den Gerkenshof traute sich normalerweise keiner. Der Gang galt als schlimmster Schmutzwinkel der Stadt, als Brutstätte von Seuchen – der Pest. Im November 1712 war das Quartier vernagelt und in der Folge unter Quarantäne gestellt worden. Einige Bretter der ehemaligen Straßensperre fehlten oder baumelten lose an verrosteten Nägeln herunter. Gelenk schlüpfte Fynn durch die Lücke. Er vernahm ohrenbetäubenden Jubel auf der Straße, das Volk feierte den Sieger – ihn! Doch dann verschwammen die fernen Eindrücke und wurden eins mit dieser unwirtlichen Welt, wo der Tod dunkle Schatten auswarf.
Erschöpft beugte sich Fynn über die Knie und schnaufte erleichtert durch. Unbehagen beschlich ihn, diesmal von ganz anderer Sorte. Andächtig, wie zum Kirchgang, lüftete er den Hut und blickte an den versifften Backsteinwänden hinauf. Kein Luftzug, kein Sonnenstrahl verirrte sich in diesen gottverlassenen, verrotteten Innenhof. Es stank nach Fäule, Urin und anderen unaussprechlichen Hinterlassenschaften. Dass alle Bewohner aus diesem Dreckloch von der Epidemie infiziert worden waren, die seit März letzten Jahres zwar offiziell als eingedämmt galt, verwunderte Fynn überhaupt nicht. Er rümpfte die Nase und sah sich um. Waren sie wirklich alle verstorben? Seltsam. Etwas rührte sich. Es raschelte, als seien Mäuse oder Ratten in Löchern oder zwischen dem Unrat zu Gange. In den Fleeten und Kanälen dieser Stadt wimmelte es zu Abertausenden davon. Allein schon der Gedanke ließ Fynn sämtlich Nackenhaare zu Berge stehen. Was war das? Wie unheimlich! Der Schatten, der phantomgleich aus dem Eingangsflur ragte, ängstigte ihn. Und dann stand sie plötzlich vor ihm, diese Kreatur, die furchterregender hätte nicht sein können:
Das Gesicht des Mädchens war mit Sommersprossen reich übersät, und im Moment wirkte es, wie wenn ein Schwarm Mücken sich über einen stinkenden Kadaver hermachten. Das Kind zeigte keine Angst. Im Gegensatz zu Fynn wirkte es angriffslustig, stemmte wütend die schmächtigen Arme in die Hüften. Zornig nahm es den Eindringling ins Visier. Die Kröte konnte kaum größer geraten sein als eineinhalb Ellen hoch, obendrein war sie ziemlich verwahrlost, mit Haaren so verfilzt, denen eines ausgefransten Wischmopps ebenbürtig. Mal ehrlich: Etwas anderes hatte Fynn auch nicht erwartet, und doch sank ihm das Herz in die Hosen. Breitbeinig, wie ein Riese, baute sich die halbe Portion auf und neigte keck den Kopf zur Seite.
»Ähm, wo … wo find ich hier bitte den Ausgang?«, erkundigte sich Fynn sichtlich verstört und wollte rasch vorübergehen, doch das Kind stellte sich ihm forsch in den Weg. Es riss ein zahnloses Grinsen quer über das ganze Gesicht. »Stehengeblieben!«, befahl es mit einer keifenden Stimme, die Fynn in den Gehörgängen klingelte.
Es war zu komisch, um wahr zu sein, und Fynn musste sich das Lachen verkneifen. »Was hast du Puup mir schon zu sagen?«, feuerte er eine erste warnende Salve ab.
Viel! Denn es knurrte wie eine wütende Katze und zeigte seine Krallen, das waren rabenschwarze Fingernägel. Weiß der Teufel, was es damit alles angefasst hatte? »Du bist ein Schmuggler, stimmt’s?«, blubberte es wie ein unschuldiges Kind drauflos. Ah, es konnte sogar ganze Sätze bilden. Gierig hielt es Fynn die kleine Hand auf. »Wenn du mir alles dalässt, was du unter dem Mantel versteckst, zeige ich dir den Weg. Falls nicht, werden die Uhlen dir den Hintern versohlen. Nu? Du hast die Wahl.« Es beobachtete ihn heimtückisch.
Fynn versuchte sich zu sammeln und deutete mit dem Zeigefinger von ihr auf sich. »Eine Snappelsnuut will mich ausrauben? Ha, dass ich nicht lache. Kneif mich mal!«
»Nenn mich nicht so, duuu – Tüderbüdel.«
»Was sagst du? Ich wäre ein Trottel?«
Das Kind antwortete mit dem schon bekannten breiten Grinsen, was Fynn ziemlich wurmte.
Fynn konnte im Stegreif aus alten Schelmengeschichten zitieren, vor allem, wenn er wütend wurde. Er liebte Grimmelshausens Simplicissimus genauso wie Til Eulenspiegel, die Schildbürger und natürlich die Vitalienbrüder, die den Hamburgern allzu oft eine lange Nase zeigten. »Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt«, schimpfte er und wollte sich die Frechheit nicht bieten lassen. »Was schnackst du für einen Schietkram? Dat Tüütje –? Ein Drummel wie dich zerquetsche ich sonst mit bloßen Händen. Und merk dir eins, ich teile nicht, da müssten schon andere Kaliber kommen. Zeig mir also sofort den verdammten Weg aus diesem Rattenloch, oder ich versohle dir den Hintern.«
Schon holte Fynns Arm zur Ohrfeige aus. Doch das Mädchen rotzte unbeeindruckt die Nase und hielt den großen Jungen mit ausgestreckter Hand auf Distanz. »Das wirst du nicht wagen!«, knurrte es. »Meine Brüder – und es gibt drei, jeder einzelne so stark wie ein Ochse – würden dich vermöbeln und dir Arme und Beine verknoten!« Sie zeichnete riesige Kreise in die Luft und machte deutlich, wie furchterregend diese Kerle sein mussten. Fynns Kinnlade fiel, was dem Mädchen nicht entging. »Ha, ha, das wäre ein Spaß! Sie mögen es nämlich überhaupt nicht, wenn jemand ihre kleine Schwester auch nur ärgert.« Siegesgewiss schnitt sie eine gehässige Fratze nach der anderen und verschränkte die Arme. Da Fynn zögerte, half sie ihm auf die Sprünge: »Nu los! Schütt den Tütelkraam aus deinem Grabbelbüdel unterm Mantel schön aufn Boden. Aber gaaanz sachte.«
Fynn ließ seinen Blick über die Fensterreihen des Karrees huschen. Kein Mensch war zu sehen. Er musste sich eingestehen: Heute lag das Unglück wie Hundehaufen auf der Straße und er ließ wirklich keine Gelegenheit aus, hineinzutreten. Keinesfalls hatte er die Absicht, den nordischen Hünen in die Hände zu fallen, ebenso wenig den Uhlen, die ihm hinter der Absperrung sicher noch auflauerten. Er verspürte wenig Lust auf blaue Flecken oder ausgeschlagene Zähne, Kerkerhaft, Prangerstehen und dergleichen. Schweren Herzens gab er klein bei, schlug stöhnend die Seitenteile seines Mantels auf und gewährte erste Einblicke in sein Sortiment.
»Huhu!«, entwich es der Rotznase und die trüben Äugelein leuchteten wie zwei helle Sterne.
»Es gibt noch Surinam-Kakao, Mocca-Kaffee, Ostindischen Tee und Melasse aus Saint Thomas«, erklärte Fynn nicht ohne Stolz. »Den Wein aus der Gironde wirst du sicher nicht wollen …«
Sie unterbrach ihn vorlaut. »Damit kannst du dich selbst bedudeln, nachher, sobald du das alles los bist. Die Melasse kannst’ stecken lassen. Zuckerbäcker gibt’s in Hamburg haufenweis, wo ich mir mausen kann. Ich möchte diesen dänischen Süßkram eh nicht haben, wie gesagt, den Rest lässt du schön da. Denk an meine Brüder! Die reißen Dänen, so wie dir, gerne Köpfe ab.« Das Tüütje streckte die Zunge heraus und deutete mit einer schneidenden Handbewegung um den Hals an, wie bitterernst es ihm war. Fynn sprangen schier die Pupillen heraus.
»Igitt, du hast grüne Gluupogen!«, staunte es und zeigte Ekel.
»Hab ich nicht! Schau doch genau hin, die sind blau wie der Ozean, wie Mutter sagt.« Mit gespreizten Fingern deutete Fynn auf sein Augenpaar und mahnte, besser hinzusehen und nicht einfach nur dahinzusabbeln. »Und woher willst du eigentlich wissen, dass ich ein Däne bin?«
Jetzt war es Fynn, der die Ellenbogen ausstellte.
»Alle Schmuggler sind von Altona, der Stadt, die all to nah neben Hamburg gebaut ist. Ihr habt einen Freihafen. Das stört die Nachbarschaft, verstehst du?« Traurig senkte es den Kopf. Es war das erste Mal, dass es wirkliche Gefühle zeigte. Fast hätte Fynn Mitleid empfunden, wäre da nicht die nächste Anmaßung aus dem vorlauten Plappermaul gewichen: »Der Schwedenbrand geschieht euch übrigens recht.«
Das hatte gesessen!
Na gut, Fynn nahm es locker, diesmal. Die erste Bataille ging an sie. Die verdiente Ohrfeige verschob er auf die nächste Begegnung, die sicher kommen würde. Tapfer ließ er das Geplapper über sich ergehen, auch wenn es wehtat. Ein Säcklein ums andere warf er ihr vor die nackten Füße. Sie konnte von Glück sagen, dass er die Krüge und die Flaschen im Mantel stecken ließ. Wenigstens hielt das Mädchen Wort, und nachdem es ihn ausgeplündert hatte, zeigte es Fynn den Ausgang durch den Keller. Ein Labyrinth von Gängen beförderte ihn schließlich wieder ans Tageslicht.
Als er die Falltür am Schaarmarkt aufschlug, war es inzwischen Mittagszeit geworden, aber das Unglück schwebte wie ein Damoklesschwert weiterhin über ihm. In der ganzen Aufregung bemerkte er nämlich nicht, wie ein ziemlich abgegriffenes Buch, Fynns ganzer Stolz und persönlicher Schatz, aus der Manteltasche rutschte und in der feuchten Hamburger Unterwelt liegen blieb.
*
Eine frische Brise wehte über den Kai und machte den schwer schuftenden Packern und Trägern die Arbeit halbwegs erträglich. Der April zeigte sich von seiner Sonnenseite. Das steil einbrechende Licht spiegelte sich auf der Elbe wider und die Wassertropfen glitzerten wie Silber. Zweifellos hatte der Herrgott den Hamburgern einen herrlichen Frühlingstag geschenkt. Ob das die schwitzenden Männer, die unter der Plagerei ächzten, ebenso sahen, so wie Fynn, der entspannt an den Schiffen vorüberschlenderte und naseweis beobachtete, wie die Ladungen gelöscht und das hanseatische Handelsgold Zucker, Bier oder Tuch gebunkert wurde? Obwohl doch so gebeutelt, konnte er die Freiheit noch spüren und die Umtriebe am Hafen genießen. Oft legten bis zu zehn, zwölf Schiffe pro Tag an. Es war ein Kommen und Gehen, voller Leben und Veränderungen. Wegen des Seekriegs zwischen Russen, Dänen und Schweden um die Vorherrschaft zu Wasser war der Schiffsverkehr in den Ostseeraum nahezu zusammengebrochen. Die Lastenesel der nordischen Gewässer, die unbewaffneten, wendigen Fleuten, sah man dieser Tage weniger. Dafür schifften seit kurzem vermehrt Pinaßschiffe aus Südeuropa ein. Was für ein Bild, wenn die Ostindienfahrer im Konvoi mit den hanseatischen Fregatten, die ihnen aus den Häfen des Mittelmeers über den Atlantik Geleitschutz gaben, unter großem Jubel die Anker auswarfen. Ob sie heute schon eingelaufen war, die »Wapen von Hamburg«, der ganze Stolz der Admiralität? Sie und ihre Schwesternschiffe hatten allen Anteil daran, dass die räuberischen Barbaresken keine städtischen Fahrzeuge mehr kaperten. Nun ja, es lag nicht alleine an der Feuerkraft der Hamburger Kanonen, die im Vergleich zu den Großmächten eher gering ausfiel, als vielmehr daran, dass die Piraten es zuletzt auf die Niederländer abgesehen hatten, die, wie man hörte, große Verluste gegen Korsaren erlitten.
Die unergründliche Weite der See, das Unbekannte, das sich hinter dem Horizont verschloss, all das faszinierte den Jungen schon seit Kindesbeinen. In seiner Fantasie war das Nordmeer ein ruhiges, blauschimmerndes Gewässer mit Eisbergen, worin die Sonne ihr gesamtes Farbspektrum entfaltete. Pottwale glitten majestätisch dahin, peitschten mit den mächtigen Schwanzflossen und verspritzten Gischt. Die Südsee hingegen war bunt, farbenprächtig, laut, fröhlich und ihre Inseln der Unterschlupf finsterer Piraten wie Henry Morgan, Anne Bonny oder Blackbeard.
Manchmal, wenn Fynn am Elbufer spazieren ging und den Blick über den Fluss schweifen ließ, spielte er mit dem Gedanken, irgendwann einmal selbst als Schiffsjunge anzuheuern, um die Fantasie wahrhaftig entstehen zu lassen. Hier, an der Vorsetzen, der neusten Hafenerweiterung vor dem Johannisbollwerk, wäre es kinderleicht gewesen, an Bord zu gehen. Großsegler, die wegen ihres Tiefgangs nicht in den Binnenhafen einfahren konnten, ankerten nahe an den Kaibohlen. Ihre Fracht wurde in Fässern von Bord gerollt und an Ort und Stelle sogleich auf die wartenden Fuhrwerke verladen. Andere Güter hievte man umständlich auf Schuten, die man dann über die Fleete in die Kontore der Kaufleute ruderte. Heute ging Fynn, ohne zu zögern, vorbei. Noch fühlte er den Drang für das Seemannsleben nicht tief genug in seiner Brust, zumal es am Nachmittag für ihn noch Wichtigeres zu erledigen galt. Was wohl seine erlauchte Kundschaft zu dem Missgeschick des Tages erwidern würde? Fynn trödelte über die Schaartorbrücke hinweg, die das Alsterfleet überspannte und damit Niederhafen mit Binnenhafen verband. Man hatte den Eindruck, als hätte der Herrgott die Zeit alleine für die Arbeiter gemacht, nicht aber für Fynn. Der beobachtete einmastige Ewer und leichte Küstensegler in der Ferne, die, schwer beladen, lebensnotwendige Erzeugnisse aus den Vierlanden herbeischipperten und mit der Strömung aber gegen den Wind segelten.
Duzende Fischerboote und Schuten kreuzten den Fluss, der heute ziemlich unruhige Wellen schlug. Natürlich wimmelte es beim Baumhaus, dem weithin berühmten Gebäude am Hafen mit der umlaufenden Galerie und dem Walmdach, von Arbeitern, Quartiersleuten, Spekulanten und Händlern. Wen wunderte das? Fynn nicht! Während sich hier an gleicher Stelle einst die Amtsstube des Hafenaufsehers befunden hatte, der alleine die Aufgabe hatte, abends die Zufahrt in den Binnenhafen mit einem mächtigen Baumstamm zu verschließen, waren in dem heutigen, 1662 errichteten Bauwerk Hafenbörse und Zollamt untergebracht. Jeden Tag steigerten diese Institutionen den ohnehin schon vorhandenen immensen Reichtum einiger weniger Bürger, den sogenannten Noblen, in nahezu astronomische Höhen. Die einfachen Arbeiter und Produzenten bekamen vom gewonnenen Profit nur einen Bruchteil. Es wurde geschachert, was das Zeug hielt, und auch nicht davor zurückgeschreckt, selbst verdorbene Waren bestmöglichst an den Mann zu bringen. Es herrschte ein Stimmengewirr und ein Geschrei, das Fynn in den Ohren wehtat. Jeder wollte dabei sein, wenn es darum ging, den großen Reibach zu machen.
Angewidert rotzte er die Nase.
Fynn trieb anderes um, nämlich das, was sich hinter den Fenstern im ersten Obergeschoss abspielte. Die schönen Künste waren dort zu Hause. Im Festsaal spielten sie Kammermusik und gaben zuweilen rauschende Konzerte. Fynn war oft hier gestanden, wenn Johann Matthesons oder Reinhard Keisers pompöse Kompositionen durch den Raum hallten und die Butzenscheiben vibrierten. Die Alten hatten ihm erzählt, ein gewisser Georg Friedrich Händel habe dort oben die Violine und das Cembalo nicht bloß gespielt, nein, er habe sie zelebriert! Angeblich sei dieser grandiose Musikus mittlerweile zum Hofkomponisten des – man höre und staune – englischen Königs Georg aufgestiegen.
Fürwahr, keine schlechte Karriere!
Eines stand hingegen fest: Hammonias ureigene Stadt wusste sich zu inszenieren und vergaß auch nicht, der glorreichen Admiralität zu gedenken. Fynn sang die Hymne im Geiste nach:
Hamburg!
Du Ehre des Sächsischen Strandes.
Handlung!
Du Kleinod und Seele des Landes;
Blühe,
Bis Land und Strand vergeht!
Wachse,
Bis Alster und Elbe versiegen!
Ewig!
Bestehe dein kluges Verfügen!
Die Admiralität!
Hammonia, die Schutzgöttin Hamburgs, war eine Schöpfung des Dichters Barthold Hinrich Brockes, Spross einer alten Kaufmannsdynastie, der zu Fynns »Kundschaft« zählte. Der Altonaer Jung’ konnte – obwohl doch Ausländer – sich der pompösen hanseatischen Selbstdarstellung kaum entziehen. Offen gab er das nicht zu: Schließlich hatte die gefeierte Admiralität vor knapp 30 Jahren noch seine Heimatstadt bombardiert. Aber das war lange her, und in einer Zeit geschehen, in der die Eltern noch irgendwo im Süden am Rande der Existenz krebsten und, mit dem Gesetz in Konflikt, ein karges Dasein fristeten. Ihre Geschichte stand in dem Buch geschrieben, das er in seiner Manteltasche zu haben glaubte.
Wie wohl die Aussicht von der Galerie auf den Hafen und die Stadt wirkte? Wehte den Herrschaften dort auch, so wie ihm auf der Hafenkante, die Seeluft um die Nase, wenn sie beim Kaffee- oder Teekredenzen über die Welt philosophierten? Fynn seufzte. Ob er das jemals erfahren würde, er, der Geringe, wo doch alleine die Noblen das Privileg dafür besaßen?
»Hei, du da, Döskopp!«, schrie wer von hinten.
Fynn riss erschrocken den Kopf herum. Die Verfolger vom Morgen kamen ihm in den Sinn. Hatte er sie etwa doch nicht abschütteln können? Das Blut in seinen Adern köchelte schon, während er gebannt den Scheltworten lauschte: »Aus der Bahn, oder du bist platt wie ›ne Flunder.«
Jemand wuchtete eine Sackkarre auf ihn zu und wollte unbedingt vorbei. Fynn atmete erleichtert durch und sprang folgsam zur Seite. »Aber natürlich, Mienherr«, gab er sich freundlich und lüftete sogar seinen Hut. Sogleich machte er sich wieder auf die Socken. Er rannte los, um das Waisenhaus herum, zur Hohen Brücke, über das Nikolaifleet und dankte Hammonia, dass er noch Eltern hatte, was, wie man ja sah, nicht selbstverständlich war. Die Zukunft jener bedauernswerten Geschöpfe, die mit großen Augen hinterm Eisenzaun hervorlugten, war schon jetzt vorbestimmt und verhieß nichts Gutes. Sie würden entweder auf der Straße enden oder in den Besserungsanstalten, die Mädchen im Spinnhaus, die Jungen im Armenkontor oder dem Zuchthaus, wo sie für einen Hungerlohn für die Pfeffersäcke schuften mussten.
Bei der Neuen Waage besann sich Fynn eines Besseren. Er begriff, dass er sich nur verdächtig machte, wenn er weiterhin so rannte. Er benahm sich ja geradezu, als trüge sein Kerbstock haufenweise Ritzen. Am Hafen hatte er sich nichts zuschulden kommen lassen, bisher. Schlurfend ging er seiner Wege und tat so anständig und lammfromm wie nur möglich. Der Neue Kran hievte in seinem Netz ein Bündel Fässer an Land. Fynn hielt inne, da ein verdächtiger Herr mit weißer Perücke und braunem Frack näher kam. Von Kopf bis Fuß nahm der Mann den schmutzigen Bengel ins Visier und Fynn bekam es mit der Angst zu tun. Unschuldig verbarg er das Gesicht hinter dem Kragen und hantierte an den abgestellten Fässern herum. Welch ein Jubel plötzlich aufbrandete. Fynn spähte übers Wasser und konnte dort die »Wapen von Hamburg« sehen, die imposant an den Duckdalben festmachte. Was für ein grandioser Moment! Sie feierten die unversehrte Rückkehr des dreimastigen Konvoischiffs, mit seinen 54 Kanonen, dem prächtig gestalteten Heckspiegel, welcher das Staatswappen mit den schildhaltenden Löwen in goldenen Farben zierte. Das Hafenleben, das gerade noch so ächzte und stöhnte, schien einen Moment stillzustehen. Man konnte sogar Kapitän Martin Tamms Kommandos vernehmen. Alles blickte hinüber, winkte den Matrosen, die in den Wanten hingen oder den Lotsen Taue zuwarfen. Fynn spürte, dass es die letzte Gelegenheit war, sich seiner Waren zu entledigen, wollte er nicht doch noch riskieren, von der Hamburger Justiz aufgegriffen zu werden. Dieser Herr, der sich am Kai so verdächtig umsah, konnte ein Richter sein, ein verdeckter Ermittler vielleicht oder sogar ein Spion. Fynn bückte sich nach dem Hebeleisen am Boden und brach schließlich den Fassdeckel auf. Hunderte glitschige Heringe glotzten ihn an. Sie rochen nicht gerade fangfrisch. Fynn hielt die Luft an und kippte den guten Wein aus der Gironde darüber. Die geleerten Flaschen warf er mitsamt den Melasse-Krügen flugs ins Hafenbecken. Die gesamte Anspannung fiel von ihm ab, wie die Schuppen von den Haaren. Er barg die Hände in die Hosentaschen, nahm die Rolle des Kerls ein, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, und spazierte wie die Unschuld vom Lande leise pfeifend an der Herrschaft vorüber.
Diese interessierte sich indes überhaupt nicht für den Herumtreiber, sondern viel mehr für den Inhalt der Fässer. Prüften Bönhasenjäger neuerdings den Fang lübischer Fischer, die kriegsbedingt tagelang auf See unterwegs waren? Nein, das taten eigentlich nur die Kaufleute, so wie dieser hier, der jetzt mit einem euphorischen Handschlag und freudestrahlend das Geschäft seines Lebens zu machen glaubte.
Fynn hätte sich in den Hintern beißen können.
Der gute Wein!
Verärgert über sich selbst, hadernd über den verfluchten Tag, sah er die Krüge und Flaschen im Sog des Hafenbeckens davontreiben.
2 »Altona«. Gedicht von Carola Abele. 2017. Erster Teil.
Kapitel 2
Dichter, Poeten und Patrioten
Der Abend barg sein mattes Kleid über die Perle des Nordens, der prächtigen Hansestadt, die von wehrhaften Wällen umgeben war und die für Feinde als uneinnehmbar galt. Dass nicht alles so glänzte, wie es der äußere Schein versprach, beziehungsweise nur das, was in den Wohngegenden der Privilegierten sich befand, das wusste Fynn. Er kannte jeden Schmutzwinkel, ja, das konnte er von sich wahrlich behaupten, jetzt, da er den schlimmsten kennengelernt hatte. Doch genauso wie in den Armenvierteln wusste sich Fynn in Sankt Katharinen, Sankt Petri und Sankt Nikolai zu bewegen. Da es dunkel wurde, machte er sich in Richtung Reichenstraße auf die Beine. Den ganzen Mittag hatte er am Hafen verbracht und nachgesonnen, wie er es beim nächsten Mal besser anstellen konnte. Die »Geschäfte« mussten schließlich weitergehen, aber da die Wächter am Millerntor nun wussten, wer hinter dem singenden Unschuldslamm steckte, würde wohl eine neue Verkleidung herhalten müssen. Aber welche? Vielleicht die eines buckligen Mütterleins?
Fynn passierte hängenden Kopfes die Kirche der Seeleute und blickte zum strahlenden Turmhelm hoch. Die Spitze trug die Krone der Heiligen Katharina. Fynn wusste es genau: Sie war aus purem Gold gefertigt und aus dem Schatz des Klaus Störtebeker entstanden. Draußen, auf dem Grasbrook, hatte einst seine letzte Stunde geschlagen, vor zwei-, dreihundert Jahren oder so. Obwohl bereits einen Kopf kürzer gemacht, soll er aufrecht an elf oder zwölf seiner Getreuen vorbeigestolpert sein, denen er somit – gemäß dem Versprechen – das Leben schenkte. Der Henker musste dem kopflosen Piraten schon ein Bein stellen, damit er endlich tot zusammensackte. Fynn blickte noch lange zurück, sah die Goldkrone im Licht der untergehenden Sonne ein letztes Mal aufleuchten. In Gedanken tauchte er noch einmal in die alte Legende ein.
Vor der Zollbrücke, wohinter sich das Rathaus und die Wechselbörse erhoben, bog er schließlich in die Gröningstraße ein. Dort wohnte in einem älteren, jedoch sehr ansehnlichen Kaufmannshaus Barthold Hinrich Brockes. Der Dichter gehörte nicht zu den Unglücksraben dieser Welt so wie Fynn und seine Familie, die in Schwaben Geächtete waren und die im liberalen, weil weltoffenen Altona, neben Glaubensflüchtlingen und Außenseitern aus allen Teilen des Reiches, eine Zuflucht fanden. Trotz allem Übel war Mutter eine stolze Frau und noch viel mehr wäre sie es geworden, hätten die schwachen Beine ihren Körper tragen können. Ja, Mutter war eine Lahme – von Geburt an. Den Vater hatte Fynn niemals wirklich lachen sehen. Aber das störte ihre Beziehung kein bisschen, da sie das Band des Philosophierens zusammenhielt. Das sonnige Gemüt hatte Fynn zweifellos von Mutter, genauso wie ihren Schalk und die Fähigkeit, über den Dingen zu stehen. Durch sie hatte er gelernt, dass im Grunde alle Menschen gleich waren, ob reich oder arm, König oder Bettler. Fynn begegnete jedem auf Augenhöhe, ohne jedwede Vorbehalte, mit Respekt oder Missachtung, ganz wie er es eben verdiente.
Dagegen war die Familiengeschichte der Brockes eine vollkommene, ohne größere Schrammen, voller Glanz und Glorie – bisher zumindest. Umso wunderlicher war es daher, dass ausgerechnet diese beiden ungleichen Menschen eine Freundschaft verband. Nein, der beliebte Brockes, der einem Titanen glich, hatte es eigentlich nicht nötig, Spottpreise für Luxusgegenstände zu bezahlen. Die Mittel dazu besaß er allemal und weit darüber hinaus. Die Brockes waren immer angesehene Kaufleute gewesen, steinreich, und logierten standesgemäß in der Hamburger Reichenstraße, im Gulischen Haus. Einige Vorfahren hatten es sogar zu Bürgermeistern von Lübeck gebracht, der Stadt, die jahrhundertelang als die »Königin« oder »Mutter der Hanse« galt. Eine solche Biographie hatte Fynn beileibe nicht vorzuweisen, doch dass die Brockes im Grunde auch nur einfache Sterbliche waren, Menschen aus Fleisch und Blut, hatte sich kürzlich in tragischer Weise offenbart. Der 8. März gehörte zu den schwärzesten Tagen im Leben des Herrn Brockes. Ein harter Schlag für jemanden, der sonst auf der Sonnenseite stand, und der sich für Geld fast alles kaufen konnte.
Der Tod aber ließ sich nicht bestechen …
Fynn erreichte das sechsgeschossige Bürgerhaus. Die rechte Fensterhälfte im dritten Stock war hell erleuchtet. Das Gebäude unterschied sich von den umliegenden ausschließlich darin, dass es einer dringenden Renovierung bedurft hätte. Manchenteils platzte der Putz ab und die Holzpaneele verblichen zusehends. Fynn riss am Klingelseil und war gespannt, was der hochangesehene Dichter dazu sagen würde, wenn er der Gesellschaft der Deutschübenden, die heute hier tagte, eben nicht den besten Wein aufwarten konnte …
*
Etwa eine Stunde zuvor im Haus der Familie Brockes …
Mit einer wallenden Allongeperücke auf dem Haupt betrat der letzte Gast den Salon: Es war kein Geringerer als der Schriftsteller und Librettist Johann Ulrich König, der lärmend die Tür hinter sich schloss. Die vier Gelehrten, die an der runden Tafel ausharrten, lugten alle gleichzeitig auf die Pendule mit hölzernem Uhrenkasten, die synchron mit dem lauten Knall der Tür die volle Stunde verkündete. Es herrschte dicke Luft. Ilsabe Brockes hob die Hände vom Cembalo und die sanfte Melodie, die den Deutschübenden die Wartezeit versüßen sollte, verstummte mit einem Mal. Die Hausherrin war eine überaus graziöse Erscheinung mit weißblonden Haaren, hellem Teint und türkisblauen Augen. Im Geiste zählte sie die Schläge des Pendels nach.
»Fünf Uhr, lieber Freund!«, klärte Lehrer Hübner auf und schnellte ungehalten vom Stuhl.
Ilsabe schloss die Lider. Sie mochte die lauten Worte nicht. Nicht heute.
Monsieur König behielt die Ruhe und grüßte die Dame des Hauses, die im Trauerkleid auf dem Klavierstuhl Platz behielt und kraftlos den rechten Arm ausstreckte. »Mein herzliches Beileid, Gnädigste.« Es klang wie die übliche Floskel, die man in solchen Angelegenheiten dahinsagte, ohne wirkliches Mitgefühl. Flüchtig deutete er einen Handkuss an und verneigte sich dann vor dem Hausherrn, dessen stehende Präsenz den Raum ausfüllte. Schließlich trollte er sich in die Runde der Dichter und Poeten. Sie durften bei ihrer ersten Sitzung nach dem Trauerfall und sechswöchiger Abstinenz keine Zeit mehr verlieren.
Brockes nahm die hastige Anteilnahme regungslos zur Kenntnis. Er hatte Königs Beileidsbekundung bereits schriftlich erhalten. Natürlich sah man es ihm an, wie sehr der Seelenschmerz an ihm nagte. Er ging gebückt und sein sonst so scharfer Geist wirkte vergleichsweise stumpf, ganz so, als wäre er vom Gewölk des Kummers umnachtet. Professor Fabricius brummte muffig, während König sich endlich, jedoch laut Stühle rückend, auf seinen Polstersitz bequemte. Die Einhaltung der Gepflogenheiten war ihm oberstes Gebot, ganz gleich, welche höheren oder niederen Mächte das Leben einschränkten oder heimsuchten. Jeder kannte die Satzung und wusste, dass ein zu spätes Erscheinen oder gar unentschuldigtes Fehlen nicht geduldet und mit Strafen laut drittem und viertem Paragraphen der Ordnung geahndet werden konnte.
Allmählich beruhigten sich die Gemüter. Brockes, ein Mann mit der Konstitution eines starken Baumes, bewegte sich wie ein zerbrechliches Gänseblümchen. Er war der Einzige, der keine Perücke trug und stattdessen eine Biberfellkappe aufhatte. Nachdem das Flüstern verstummt war, zog er ein versiegeltes Papier aus dem Frack und faltete es vorsichtig auf. »Samuel von Triewald lässt sich entschuldigen«, begann er gedämpft und sein Blick verschwamm mit den schwungvollen Lettern des Briefs. Er hob die Stimme an: »Unser Freund, der schwedische Gesandte im Norddeutschen Kreis, hat auch einen triftigen Grund dafür. Vor wenigen Wochen nämlich ward er aus der Stadt abberufen und nach Stockholm beordert. Er übermittelte mir heute Morgen wundervolle und tröstende Zeilen, die ich nun gerne vortragen möchte.« Brockes starrte in die Runde, wobei sein Blick etwas länger als unbedingt nötig auf König verweilte und ihm das beinahe Zuspätkommen noch einmal in Erinnerung rief. Dann rezitierte er Triewalds Vers:
»Sein zartes Kind, an dem mit Lust zu lesen.
Ein lebend Abbild der Mutter Schönheit-Pracht,
Sieht mit dem Morgenrot die Dämmerung der Nacht,
Und höret auf zu sein, kaum da es was gewesen.
Wie? Gleicht dem schnellen Blitz solch anmutsvoller Schein,
Und muss, was angenehm, zugleich hinfällig sein?
Ja! Diesen Schmuck missgönnt der Himmel unser Erden.
Drum musst ein Engelbild so früh ein Engel werden.
Von Triewald«
Ilsabe stieß schluchzende Klagelaute aus und trompetete in ihr Taschentuch. Was für eine leidvolle Erfahrung für eine Mutter, ihr eigenes Kind zu Grabe tragen zu müssen! Die kleine Katharina Margaretha Brockes durfte nur ein halbes Jahr alt werden. Das Leid der Mutter rührte nun selbst die hartgesottenen Gelehrten. Richter Hoefft sog stöhnend an seiner Tonpfeife und Professor Fabricius schüttelte die aufwallende Traurigkeit von sich wie eine alte Eiche die Blätter im Herbst. Brockes faltete das Blatt wieder zusammen, als wollte er damit den Schmerz endgültig tilgen. Lehrer Hübner machte Anstalten, das Wort zu erheben, doch Brockes kam ihm zuvor: »Lerne schweigen, oh Freund. Dem Silber gleichet die Rede, aber zu rechter Zeit Schweigen ist lauteres Gold«, flüsterte er kummervoll und steckte das Schreiben zurück in die Westentasche. Dann gab er seiner Frau das Zeichen, die sich daraufhin schwerfällig, wie ein zerbrechliches Weib, vom Cembalohocker erhob. »Ich habe Triewald bereits meinen Dank ausgesprochen«, erklärte Brockes, währenddessen Ilsabe sich wie auf Wolken schwebend neben ihn gesellte. »Messieurs – meine geliebte Ehefrau möchte die Zeilen meines Antwortschreibens gerne vortragen.« Dann schloss er die Augen und spürte, wie sich ihre geschwächte Hand zart in seine Armbeuge legte. Ilsabe holte Luft und schien die Kraft ihrer Stimme aus den Tiefen ihres Herzens zu schöpfen:
»Dein sinnreich Trostgedicht habe ich mit Lust gelesen
Dein aufgeweckter Geist, der Wörter schöne Pracht,
Sind mir ein heller Strahl in meiner Trauernacht,
Und für mein Leid ein Trunk aus Lethe3-Fluss gewesen
Und wer dein Gaben kennt und ihren Wunderschein
Und nicht darob erstaunt, kann nicht vernünftig sein.
Ganz Schweden wünscht nebst uns, Du mögst zum Nutz der Erden,
So spät als möglich ist, ein Himmelsbürger werden.
Zögernd klatschte der grimmige Fabricius in die Hände. Man sah es dem Professor an, dass es um seine Gesundheit zurzeit nicht zum Besten stand. Mit müdem Augenaufschlag warb er um Zustimmung. Auch er hatte, wie es sich für einen echten Poeten gehörte, seinen Trost in Versform zum Ausdruck gebracht. Lehrer Hübner pflichtete ihm bei und klopfte mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. Michael Richey, der stille Philosoph, hielt sich indes zurück. Er ließ lieber die Feder sprechen und führte das Protokoll. Akribisch genau notierte er den gehörten Vortrag. Man spürte es förmlich, wie schwer es allen fiel, zur Tagesordnung überzugehen. Hübner und Fabricius blinzelten durstig auf das Weingedeck, das immer noch leer war. Hannah, das sonst so eifrige Hausmädchen, war heute nicht auf der Höhe und passte sich wohl ihrem phlegmatischen Dienstherrn an. König zog gelangweilt die goldene Taschenuhr aus der Rocktasche und schielte aufs Ziffernblatt.
Hübner räusperte sich und hob erneut zu sprechen an. Diesmal drang er durch: »Werte Dame – meine Herren«, sagte er empathisch. »Im Namen aller möchte ich mich für die freundliche Einladung bedanken …, trotz schwerer Stunde. Doch sollten wir – nach einer kurzen und stillen Einkehr – unsere so bedeutende Tätigkeit fortsetzen. Die Zeit schreitet unaufhaltsam fort und die Arbeitsmühe wird dich, mein lieber Freund, gewiss auf andere Gedanken bringen.«
Einvernehmliches Nicken folgte.
Auch Brockes schien einverstanden.
Ilsabe begab sich erneut ans Cembalo und griff in die Klaviatur. Dem italienischen Instrument entlockte sie überaus gefühlvolle und inspirierende Klänge, die halfen, die wichtigen Geschäfte der Sprachgesellschaft wieder aufzunehmen.
*
Nervös blies Richter Hoefft den blauen Dunst seines Glimmstängels Fabricius mitten ins Gesicht und sprach in die Runde: »Nach den Regeln der Satzung gebührt mir das nächste Wort. Dies ist auch bitternötig, denn es gibt besorgniserregende Neuigkeiten, die die herrschende Moral in der Stadt betreffen.«
Librettist König ließ entnervt den Kopf in die Handfläche fallen. Voller Tatendrang hatte er das Skript seiner »Fredegunda« aufgeschlagen und im Sinne gehabt, umgehend mit der Besprechung zu beginnen. Die Premiere der neuen Keiser-Oper stand in einer Woche an und die abschließende Beurteilung duldete keinen Aufschub mehr. »Haben Sie doch Einsicht«, bettelte er, der ständigen Störungen der Tagesordnung überdrüssig. »Wir haben drei Stunden, in denen einzig literarische Themen vorgetragen und beleuchtet werden, wie es in der Satzung geschrieben steht.«
Sogar Richey, den eigentlich nichts so schnell aus der Ruhe brachte, hob, hellhörig geworden, den Gänsekiel an und nahm den wortführenden Kollegen mit dem Monokel kritisch unter die Lupe.
»Es ist wichtig«, rechtfertigte Hoefft paffend und blickte beschwörend in die Runde.
»Dann lasst hören, aber fasst Euch kurz«, gewährte Brockes dem Schwager themenabweichend eine kurze Sprechzeit, aber gab mit wedelnden Handbewegungen sogleich das geforderte Tempo kund. Da aus dem Kreis der Deutschübenden kein Widerspruch kam, eröffnete der Richter seine flammende Rede:
»Als ich am Nachmittag die Rathauskanzlei verließ, kam mir zu Ohren, dass den Meisterjägern ein Bönhase entwischt sei. Dem Bericht zufolge ist diesmal ein äußerst hinterhältiger und gemeiner Halunke am Werk.«
»Oh, ein Halunke, ein äußerst hinterhältiger gar?«, lästerte Hübner, dem die Problematik der künstlich verknappten Konkurrenzen in der Hansestadt bestens vertraut war. Dass die Illegalen überhandnahmen und nach jedem weiteren Strohhalm griffen, das war nichts Neues und lag angesichts der strukturellen Schwierigkeiten auf der Hand.
Fabricius, der Hübners Vorgänger im Rektorat des Johanneums war, konnte ein Lied davon singen. Ironisch lächelnd gab er dem Professorenkollegen recht. Bereits in der Jugendunterweisung mussten die staatlichen Mechanismen greifen, und wenn sie versagten, was gegenwärtig offensichtlich der Fall war, dann musste man sich nicht über schlechte Manieren wundern. Schon zu seiner Zeit reichten die Mittel hinten und vorne nicht. Nicht einmal für die bitternötigen Atlanten hatte das Scholarchat Geld übrig.
»Nein, es sind nicht die eigenen Leute, die Ärger machen. Es sind die aus Altona: Schmuggler, Katholiken …«, erklärte der Richter und döste in seinen gähnend leeren Murano-Glas-Pokal. Hannah war immer noch nicht erschienen, dabei hätte ein kräftiger Schluck gerade jetzt gutgetan.
Ilsabe spielte eine falsche Note. Schmuggler?
Richey biss sich auf die Zähne, da es dem Feingeist in den Ohren schmerzte. Schließlich kam die Dame des Hauses völlig aus dem Konzept und die Musik verklang. Brockes sah prüfend zu seiner Frau hinüber, die schuldbewusst den Kopf senkte. Er wusste, dass er nun einschreiten musste. »Stellen Sie sich einmal die Frage, die Herren, jeder Einzelne für sich selbst«, diktierte er mit dem Zeigefinger und hielt einen Moment inne. »Was treibt diese Leute dazu, so etwas zu tun?«
»Einsperren, diese Subjekte!«, riet König entrüstet und schlug das Buch der »Fredegunda« wieder zu.
»Bestrafung allein ist keine kluge Lösung«, erläuterte Brockes, »das wisst Ihr doch! Grundsätzlich fehlt es an der gerechten Verteilung. Beseitigen wir den Mangel, wird das Unrecht weniger. Begabung muss gefördert werden, Fleiß belohnt. Nicht alle Armen sind Arbeitsscheue. Ich bleibe dabei: Die Bildung muss jedermann offenstehen, auch der Frau, die in der Küche nicht mit ihren Sorgen allein stehen soll. Ferner muss die unmenschliche Zwangsarbeit in den Arbeitshäusern endlich aufhören und an ihre Stelle eine staatliche Institution treten. Der Mensch ist nicht bloß Sklave seiner Arbeit, und das Volk nicht für den Fürsten, sondern jeder Fürst für das Wohl seiner Untertanen verantwortlich. Sollten die Herrschenden die Klagen ignorieren, werden sie eines Tages vom selben Mopp erschlagen, den sie heute unterdrücken.« Brockes’ Augen leuchteten hell und siehe da, zum ersten Mal blitzte wieder dieses verschmitzte Grinsen auf, mit dem er seine klugen Einfälle stets abzurunden verstand.
Seit dem Trauerfall war es erloschen.
Fabricius hielt sich gelangweilt die Stirn und König lauerte darauf, endlich das Wort ergreifen zu können. Doch der Richter hatte sein Herz noch lange nicht ausgeschüttet. »Auch die Katholiken aus Altona werden zur Plage«, jammerte er. »Draußen am Krayenkamp, im Palais des Kaiserlichen Abgesandten Graf Adolf von Metsch, halten sie Heilige Messen ab. Ihre Kirche ist ja noch nicht wieder aufgebaut worden. Wer kann es unseren Bürgern daher verübeln, wenn sie drohen, alles kurz und klein schlagen zu wollen, zumal sogar die Pastoren gegen die verbotenen papistischen Umtriebe hetzen?«
»Nicht umsonst sitzen hier die klügsten Köpfe zu Rate«, machte Brockes seinem Schwager Mut und kramte die alte Idee wieder hervor. »Lassen Sie uns also beginnen – zögern wir das Unvermeidbare nicht länger hinaus. Wir müssen aufklären, in die Öffentlichkeit gehen! London und sein Verleger Richard Steele lehren uns, wie es geht. ›The Spectator‹, eine Tageszeitung für Moral, Lebensberatung und Unterhaltung, ist ein Erfolg.« Brockes schritt zur Tafel und leitete einen Trinkspruch ein: »Messieurs. Hiermit rege ich die Gründung der Patriotischen Gesellschaft an und, damit verbunden, die Herausgabe einer erzieherischen Wochenzeitung: ›Der Patriot‹. Die Umerziehung und Lenkung ist elementar für eine bürgerliche Gesellschaft. Lassen Sie uns also die Gläser erheben, meine Herren! Auf Hammonia und dass sie der Welt ein neues Gesicht gibt. Nach dem Vorbild der Athener soll in Zukunft nur noch ein Senat aus gelehrten Häuptern den Regentenstab schwingen.«
Die Liebhaber der deutschen Sprache, Redekunst und Poesie erhoben sich rauschend von ihren Stühlen. Dann sahen sie einander unschlüssig an. Die kunstvoll verzierten Murano-Pokale waren leer. Erst jetzt bemerkte Brockes sein Versäumnis und rief umgehend: »Hanni!« Doch anstatt des Mädchens buckelte der Leibdiener Sebastian herein. Er wirkte aufgeregt. Brockes sah unruhig zur Standuhr, wo sich der Stundenzeiger bereits über die Sechs quälte. Himmel! Fast hätte er den Ehrengast vergessen!