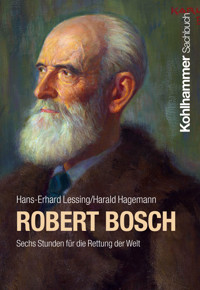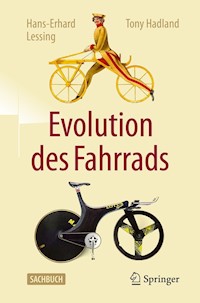9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine Kulturgeschichte des Glücks auf zwei Rädern und einer genialen Technik Hans-Erhard Lessing erläutert und erzählt, wie das Fahrrad vor 200 Jahren weltweit eine nie gekannte Euphorie auslöste. Zum ersten Mal konnten sich alle individuell bewegen und sich das »Glück auf zwei Rädern « leisten. Eine Kulturgeschichte des Zweirads voller Überraschungen – vom Ausbruch eines Vulkans am Beginn bis zur "Fliegenden Taube" in fast jedem Haushalt Chinas. Kein Verkehrsmittel ist auf der ganzen Welt so weit verbreitet. Keines ist so zahlreich vorhanden. Keines hat eine solche rasante Entwicklung durchgemacht: Von der Laufmaschine über das Hoch- und Niederrad, vom Tret- zum Rennrad und Elektrobike hat sich das Fahrrad gegen alle Konkurrenten durchgesetzt und ist das weitverbreitetste Verkehrsmittel. Etwa 12–14 Milliarden Fahrräder wurden seit seiner Erfindung gebaut und 72 Millionen werden allein in Deutschland bewegt. Das Fahrrad ist für jedermann erschwinglich, wie gerade seine Verbreitung in Indien oder China heute oder in Europa und Nordamerika im 19. Jahrhundert belegt. Auch die gesellschaftliche, ja kulturelle Veränderung, die das Fahrrad ermöglichte, ist beeindruckend. Die anstehende E-Bike-Revolution lässt heute schon erahnen: Bald werden Jung und Alt mobil wie noch nie sein, und der individuelle Verkehr in den Städten wird sich von Grund auf verändern – dank des Fahrrads, das seit seiner Erfindung keinen Tag gealtert ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Das Fahrrad
Eine Kulturgeschichte
Hans-Erhard Lessing
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Grafik von Roma Nekrashevich/gallery/Shutterstock
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-91342-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10869-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Von Eisläufern und Draisinenreitern
Das Leben im Zeichen des Pferdes
Nischen der Muskelkraft
Forstlehrer Drais und seine Fahrmaschine
Ein Vulkanausbruch und seine spektakulären Folgen
Die Laufmaschine
Die Draisinenreiter
Erste Erfolge
Das Ende der Laufmaschinen
Von Rollschuhfahrern und einem neuen Boom
Das Abendland lernt Rollschuh fahren
Die verworrene Prioritätsfrage
Von Paris nach Deutschland
Compagnie Parisienne – die erste Fahrradfabrik
Das Kurbelveloziped
Der Boom in den USA
Coventrys Chance
Das Rad wird neu erfunden
Das bahnbrechende Drahtspeichenrad
Englands führender Kopf: James Starley
Hochrad für Jung, Dreirad für Alt
Bicycles im Deutschen Reich
Die Motorisierung
Vom Hochrad zum Niederrad
Das revolutionäre Design aus Coventry
Sozialer Hoffnungsträger Fahrrad
Das Fahrrad im Zeichen des Gesetzes
Die Öffnung des Marktes
Die wirtschaftlichen Folgen
Das Verschwinden der Pferde
Weitere Verlierer
Profiteure des Fahrradbooms
Die Neue Frau, Religion und Gesundheit
Die Möglichkeiten der Radlerin
Der Einfluss des Fahrrads auf die Kleidung
Die Kirche und das Rad
Die Medizin und das Rad
Das 20. Jahrhundert
Bis zum Ersten Weltkrieg
Bis zum Zweiten Weltkrieg
Die Nachkriegszeit
Das Fahrrad erobert Asien
Ausgewählte Literatur
Die bekannten Prioritätsfälschungen
Bildnachweis
Tafelteil
Wenige Artikel, die der Mensch je benutzte,
haben eine derartige Revolution in der
Gesellschaft hervorgerufen wie das Fahrrad.
USA-Volkszählungsbericht 1900
Vorwort
Zweihundert Jahre ist nun das Fahrrad in der Welt, und doch erscheint uns heute seine Geschichte seltsam entrückt. Das war nicht immer so. In den 1890er Jahren, als das Auto noch ein Fahrrad war, gab es ein historisches Interesse, nicht zuletzt um den lokalen Straßenkorso der Radvereine mit historischen Fahrrädern spektakulär zu gestalten. Die westlichen Nationen standen damals im Wirtschaftskrieg miteinander und versuchten, mit zweifelhaften Legenden die historische Priorität in der Fahrradtechnik, der damaligen High-Tech, für sich zu beanspruchen.
Doch dann kam mit dem Preisverfall der Prestigeverlust der Fahrräder, und die Avantgarde stieg auf Motorräder und Automobile um. Die Modellvielfalt fiel der rationellen Massenfertigung zum Opfer und schrumpfte auf ein entfeinertes Rennrad zusammen. Denn weil der Rennsport Vergleichbarkeit der sportlichen Leistung verlangte, hatten die Funktionäre das »Material«, wie sie das Fahrrad nannten, zum Einheitslook normiert. Abweichende Konstruktionen waren von den Rennen ausgeschlossen. Biographische Erinnerungen sind zwar voller dankbarer Erwähnungen des neue Freiheiten verheißenden Fahrrads in der Jugend, aber historische Markenclubs wie bei den Motorrädern und Automobilen sind daraus nicht entstanden. Also fängt die populäre Mobilitätsgeschichte nach wie vor erst mit der Motorisierung an.
Mit dem neuen Fahrradkult in Groß- und Universitätsstädten könnte sich das bald ändern. Designfahrräder gewinnen eine neue Individualität, und neue Geschäftszweige bieten das nach individuellem Geschmack gestaltete Wunschfahrrad an. Zudem ist seit der Ölkrise das historische Interesse am Fahrrad wiedererwacht. Fahrradveteranenclubs wie der Veteran-Cycle Club in Großbritannien, The Wheelmen in den USA und Historische Fahrräder e. V. in der Bundesrepublik haben sich mit eigenen Clubzeitschriften etabliert. Seit 1990 tagt zudem die International Cycling History Conference jedes Jahr in einem anderen Land.
Doch der aufzuholende Rückstand ist enorm. Während eine revidierte Technikgeschichte bereits Gestalt angenommen hat, mangelt es für eine umfassende Kulturgeschichte weltweit noch an Untersuchungen, welche die damaligen Fahrradzeitungen und anderen Zeitungen als Quellen auswerten. So ist aus den Vereinigten Staaten mehr zur Sozialgeschichte bekannt geworden als aus dem deutschen Sprachraum. Historische Zeitungen werden nach und nach digitalisiert; die Fahrradkultur könnte dann zum bevorzugten Thema vieler historischer Studien-, Magister- und Doktorarbeiten werden. Zum 200jährigen Jubiläum gibt dieses Buch einen pointierten Ein- und Überblick, wie viel bereits von der Geschichte des Fahrrads bekannt sein könnte und sollte. Das Fahrrad hätte es mehr als jedes andere Verkehrsmittel verdient.
Aber mit welch einer Begeisterung schilderte 1893 der italienische Anthropologe Paolo Mantegazza die »freedom machine«:
Der Radfahrsport ist der Triumph des menschlichen Gedankens über die Trägheit der Materie: Zwei Räder, welche kaum den Boden berühren, die wie auf Flügeln dich weit forttragen mit einer schwindelerregenden, trunken machenden Geschwindigkeit, ohne den grausamen Schweiß gepeitschter Zugthiere, ohne das verhaßte Geräusch rauchender Maschinen – ein Wunder von Gleichgewicht, von Leichtigkeit, von Einfachheit – ein Maximum von Kraft und ein Minimum von Reibung – ein Wunder von Schnelligkeit und Eleganz – der Mensch, der ein Engel werden will und nicht mehr die Erde berührt – Merkur, der aus seinem alten hellenischen Grabe erstanden ist und lebendig vor uns erscheint – das ist der moderne Radler.
Koblenz, im Januar 2017
Hans-Erhard Lessing
Von Eisläufern und Draisinenreitern
Schon früh banden sich die nordischen Völker geeignete Tierknochen als Schlittschuhe unter, zum Beispiel vom Schwein die Elle, was der geschmorten Schweinshaxe die treffende Bezeichnung »Eisbein« verlieh. Eine kleine Eiszeit sorgte in der neueren Geschichte Europas für lange Winter und ließ vor allem in den Niederlanden den Eislauf zum Volkssport werden, wie die stimmungsvollen Wintergemälde holländischer Meister bezeugen. Dort in den Niederlanden durfte sogar die weibliche Bevölkerung am schnellen Gleiten teilhaben, während dies den Frauen in Deutschland oder Frankreich der Schicklichkeit halber verwehrt blieb.
Aber wie betrieben die Holländer dieses schnelle Vergnügen? In den holländischen Zeitungen des 18. Jahrhunderts findet man darüber leider kaum etwas. Doch dafür bietet uns der Gothaische Hofkalender für 1788 einen besonderen Einblick in die Welt des niederländischen Eislaufs:
Noch in der Mitte dieses Jahrhunderts waren selbst die vornehmsten Damen sehr geschickte Schrittschuhläuferinnen. Das Eis war mit Personen von beiderlei Geschlecht bedeckt. Man sah oft eine Dame von erstem Range die unter Wasser gesetzten und mit einer dicken Eiskruste bedeckten Wiesen in der Mitte von zwei Bauern durchlaufen oder einen jungen Herrn von Stande einer Bäuerin den Arm geben. Es war eine gar vorzügliche Gunstbezeugung, wenn man einer Dame die Schrittschuhe anschnallen durfte, und sie belohnte diese Mühe auf der Stelle durch einen Kuß. Allein diese Familiarität hat aufgehört, und der holländische Adel hat angefangen, dieser alten Sitte untreu zu werden. Doch gibt es noch immer viele Damen, welche dieses Vergnügen lieben; auch alle Bäuerinnen und Bewohnerinnen des Landes fahren auf Schrittschuhen,
wie die Schlittschuhe damals noch hießen. Wenn die Gewässer winters zufrieren, schafft also die Natur topfebene Flächen, wie sie der damalige Straßenbau nicht liefern konnte. Eine physikalische Eigenheit des Wassers macht dies möglich: Eis ist spezifisch leichter als das flüssige Wasser und schwimmt daher immer obenauf.
Ganz anders verhielte sich etwa ein Naphthalin-Teich auf einem fernen Planeten. Das gefrorene Naphthalin sänke unter, und die Außerirdischen müssten sodann brusthoch eingetaucht in die Flüssigkeit Schlittschuh fahren – gegen Widerstand.
Das dichte Netz von Bewässerungsgräben und Kanälen in den Niederlanden gestattete zudem einen nützlichen Geschäftsverkehr inzwischen auf stählernen Kufen:
Man sieht in Holland und in andern kalten Ländern unter anderem sogar eine große Anzahl von Milchweibern, die mit Milch gefüllten Gefäße auf dem Kopfe und Schlittschuhe an den Füßen, mit großer Schnelligkeit und Leichtigkeit – sie stricken gewöhnlich auf dem Wege – in die benachbarten Städte eilen, um ihre Waare zu Markte zu bringen. Nach vollendetem Geschäfte kehren sie auf dieselbe Weise in ihre Heimath zurück, nicht selten in Entfernungen von mehreren Meilen.
Dieser Beleg für weibliches Multitasking zeigt, dass die Niederlande bereits vergleichsweise früh über einen mechanisierten Individualverkehr ohne Pferd verfügten.
Ende des 18. Jahrhunderts erreichte diese neue Eis-Euphorie Deutschland. Briefe hatten die unerhörte Neuheit schnell zum Thema – so schrieb der Revolutionär Carl Friedrich Cramer aus Kiel:
Man zeigt sich die Stelle, wo neulich – ach! – ein Unvorsichtiger ertrank, man läuft, wetteifert, spricht von allem, was zum Eise gehört. Klopstock erzählt von seinen Reisen, wie’s in der Schweiz damit ist? Wie in Holland? Da laufen die Weiber mit!
Friedrich Gottlieb Klopstock war der deutsche Dichter des Eislaufs schlechthin, aber auch der junge Goethe war ein Anhänger und berichtet in seinen Lebenserinnerungen über einen etymologischen Streit mit Klopstock:
Wir sprachen nämlich auf gut oberdeutsch von Schlittschuhen, welches er durchaus nicht wollte gelten lassen: denn das Wort komme keineswegs von Schlitten, als wenn man auf kleinen Kufen dahinführe, sondern von Schreiten, indem man, den homerischen Göttern gleich, auf diesen geflügelten Sohlen über das zum Boden gewordene Meer hinschreite.
Turnvater Jahn und GutsMuths, die Pioniere der Leibesübungen, befürworteten den Eislauf trotz der Gefahr einzubrechen aufs Wärmste. Aber die jungen Frauen in Deutschland und Frankreich wagten es nicht, selbst Schlittschuh zu fahren – wie gesagt wohl aus Gründen der Schicklichkeit. Man könnte ja aus Versehen bei einem Sturz trotz der langen Röcke die Fesseln, also die Fußknöchel, entblößen … Für sie wurden eigens Stuhlschlitten gebaut, auf denen sie sitzend von dem Galan ihrer Wahl auf dem Eis herumgeschoben werden konnten. Hierzu ein Bericht aus Paris:
Jetzt kommt ein Schrittschuhläufer in großem Costüm mit einem eleganten Stuhlschlitten von Mahagony und vergoldeter Bronze-Arbeit, mit sammetnem Kissen und goldenen Fransen daran. Er ladet die Damen zum Einsteigen ein. Man acceptirt, es geht wie ein Pfeil davon, doch keine hundert Schritte sind gemacht, und ein anderer Schlitten carambolirt fürchterlich mit dem unseres Elegants, beide Damen fallen auf die Nase, die umgestürzten Schlitten sind zerbrochen, einige Schrittschuhläufer fallen ebenfalls darüber hinaus; in einem Nu ist eine gaffende Masse versammelt, die jeden Augenblick größer wird, und ganz verschämt lassen sich die zierlichen Pariser Damen, nicht ohne Mühe, durch das Gedränge bringen, en jurant que c’était pour la dernière fois, qu’elles se sont laissées trainer [schwörend, dies sei das letzte Mal gewesen, dass sie sich schieben ließen], und eine Viertelstunde darauf segeln sie abermals vorbei, denn man hat ihnen versprochen, sie gewiss nicht mehr umzuwerfen, aber in der andern viertel Stunde liegen sie wieder auf dem Eise, mais ça ne fait rien, on s’accoutume à tout [aber das macht nichts, man gewöhnt sich an alles].
Die plane, glatte Eisfläche ermöglichte zudem ein weiteres Vergnügen, eine Art Schlittenkarussell. Ein Pfosten wurde senkrecht ins Eis getrieben und ein Drehkreuz darauf gelagert, von dessen vier Enden lange Seile zu je einem der üblichen Rodelschlitten verliefen. Für einen Groschen drehten Arbeiter das Drehkreuz, bis die Schlitten mit den darauf Sitzenden rasant im Kreis herumgewirbelt wurden. Das Ganze wurde dann als »Radfahren« bezeichnet. Dieses Wort, das deutsche Sprachschützer 1885 für das britische »cycling« einführten, existierte also schon fast hundert Jahre zuvor, allerdings mit einer völlig anderen Bedeutung. Auf der Suche nach dem Missing Link stößt man auf die Veloziped-Karusselle der 1870er Jahre, die wohl unterschwellig die neue Namensfindung ermöglichten.
Natürlich wollte man den fashionablen Zeitvertreib des Schlittschuhfahrens auch auf der Theaterbühne simulieren, die damals noch die Funktion der Wochenschau im Kino und der heutigen Tagessschau wahrnahm. Das war die Geburtsstunde der Rollschuhe, indem man nämlich an den Schlittschuhen ganz einfach Rollen anbrachte. Dies funktionierte auf dem glatten Bretterboden der Bühne wunderbar, nicht so aber draußen im Freien. Zumindest damals noch nicht. Dass aus dem 18. Jahrhundert nur vier Quellen dafür bekannt sind, zeigt, wie neu das alles noch war: Im Londoner Drury-Lane-Theater soll es 1743 ein solches Theaterstück mit simuliertem Schlittschuhfahren gegeben haben. Der Londoner Mechanikus John Joseph Merlin soll Rollschuhe gebaut und in seinem Kuriositätenmuseum ausgestellt haben. Und laut dem Gothaischen Hofkalender von 1790 soll der Bildhauer und Medaillenschneider Maximiliaan Lodewijk van Lede bei einer Vorführung in London auf seinen Rollschuhen ungebremst in einen teuren Wandspiegel gekracht sein. Die einzige bildliche Darstellung ist auf dem Ankündigungszettel eines Soldaten der Schweizergarde erhalten, der 1791 auf seinen Rollschuhen heroisch von Den Haag nach Scheveningen fahren wollte. Sie waren gebaut wie moderne Inline-Skates, nur mit zwei Rollen und noch ohne Stopper, doch die Verwandtschaft ist augenscheinlich. Über einen Erfolg des soldatischen Manövers ist nichts bekannt, und Eingang in die Technologieliteratur der Zeit fand sein Fortbewegungsmittel offenbar auch nicht.
Das Leben im Zeichen des Pferdes
Über Jahrhunderte waren Zufußgehen oder Reiten die Mittel der Wahl, um sich zu Lande fortzubewegen. Wollte man irgendwohin fahren, bedeutete auch das den Einsatz von Pferden, die das jeweilige Fahrzeug zogen, auf dem man saß und für das es tunlichst einen Weg oder eine Straße geben sollte. Das Wort Fahrzeug stammt vom holländischen »vaartuig« ab, was dort »Schiff« bedeutet. Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm beschreibt im Band E-Forsche von 1862 den Begriff »fahren« in seiner charakteristischen Kleinschreibung schön prägnant:
der mensch geht zu fusze, fährt wagen, karre, nachen, schiffe, auf dem schlitten etc., auf der eisenbahn. die mechanische vorrichtung fördert ihn schneller.
Die Eisenbahn gab es da ja bereits. Doch vermutlich schon in der Jungsteinzeit entwickelte sich jene Renommiersucht, sich untätig auf dem Pferd oder Wagen sitzend über die bedauerlichen Mitmenschen zu erheben, die sichtbar für ihre Fortbewegung arbeiten müssen, – und selbst derart untätig vor ihnen zu paradieren. Bis zum 20. Jahrhundert war Pferdezucht und alles, was damit in Verbindung stand, ein wichtiger Faktor und Wirtschaftszweig. Auch abseits der Landwirtschaft kümmerten sich ganze Berufsgruppen um die Pferde: Kutscher, Fuhrleute, Postillons, Kürassiere, Husaren, Pferdehändler, Sattler, Reitlehrer, Reitknechte, Stallmeister, Hufschmiede, Tierärzte, Pferdemetzger und Abdecker. Dazu kam der Wagenbau mit bald schon jährlichen Modellwechseln: Stellmacher, Schmiede, Gürtler, Sattler, Stuhlbauer, Posamentierer und Vergolder.
Für Städter war die Pferdehaltung eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Der Mathematikdozent Thomas Stephens Davies der Royal Military Academy rechnete in den 1840ern einmal die Kosten vor:
Ein Reitpferd kostet vielleicht 40 Pfund Sterling und anschließend günstigenfalls 30 oder 40 Pfund im Jahr für die Haltung, sodann mit den Ausgaben für einen Stall und für einen Mann, der nach ihm schaut, oft mehr als das Doppelte dieser Summe. Wenn es dreißig Jahre lebt, belaufen sich diese Ausgaben zusammen mit den Anschaffungskosten auf mehr als 1700 Pfund: So viel kostet ein Pferd von Anfang bis Ende.
Dafür konnte man damals in London ein ganzes Haus kaufen. Fürstbeamte erhielten für ihr Dienstpferd Futter und Streu bei den fürstlichen Domänen in Naturalien. Ein Forstinspektor in Baden bekam beispielsweise jährlich 15 Malter Hafer, 36 Zentner Heu und hundert Bund Stroh sowie 75 Gulden obendrauf. Als fester Bestandteil des Gehalts wurde dies bei der Pensionierung in Geld umgerechnet. Handwerker und andere Geringverdiener konnten sich dagegen kein Pferd leisten und wichen auf Rinder, Esel, Ziegen oder Hunde als Zugtiere ihrer Wägelchen aus. Oder man nutzte die Dienste eines Lohnkutschers oder Fiakers, der dem heutigen Taxi entsprach.
Die Versorgung der Pferde beim Militär war schon immer ein logistisches Problem. Im Freundesland kaufte man unterwegs das Futter den Bauern ab oder requirierte es im Feindesland gleich ganz ohne Bezahlung. Dies konnte jedoch auch zum Nachteil gereichen. Beim verlustreichen Rückzug Napoleons im Russlandfeldzug 1812/13 plante die russische Strategie ein Pferdesterben ein, indem sie die Franzosen auf ungefähr denselben Rückweg wie beim Einmarsch zwang. Denn dort waren die Futtervorräte der Bauern bereits restlos geplündert.
Nischen der Muskelkraft
Dass wie im Abendland große Flächen dem Haferanbau und der Heugewinnung für Pferde dienten und damit der menschlichen Ernährung entzogen waren, wäre im volkreichen China nicht vorstellbar gewesen. Dort musste ohne Pferde Krieg geführt werden, und deshalb wurde die Muskelkraft der Soldaten genutzt. Seit dem 3. Jahrhundert schob jeder Soldat einen »Mu Niu« (»hölzerner Ochse«) vor sich her, einen einrädrigen Schubkarren, erfunden von Chuko Liang: »In der Zeit, in der ein Mann sechs Fuß geht, geht der hölzerne Ochs zwanzig. Er trägt den Proviant (eines Mannes) für ein ganzes Jahr.« Anders als die abendländische Variante besaß dieser Schubkarren das Rad in der Mitte unter der Last und belastete so die Arme des Schiebenden nicht mit der Hälfte der Ladung. Im Abendland wurde der Schubkarren erst im 12. Jahrhundert bekannt und galt als willkommene Verbesserung der Lade (ähnlich einer Tragbahre), die auf Baustellen von je einem Mann vorn und hinten getragen wurde. Zwar ersetzte das Rad nun den Vordermann, aber der Hintermann musste immer noch die halbe Last tragen. Nach wie vor keine leichte Übung. Dagegen wurde der chinesische Soldat kaum belastet und musste lediglich die Balance durch ein wenig Muskelkraft sicherstellen. Erst Ende des 18. Jahrhunderts tauchten Schubkarren mit Mittelrad auch in der englischen Landwirtschaft auf. Immerhin gab es somit schon ein gewisses Einspurfahrzeug, wenn auch nicht, um selbst allein darauf sitzend zu fahren. In China entstand aus dem Schubkarren des Militärs gar ein weitverbreitetes Transportmittel für Passagiere, Schweine und Güter, das bis ins 20. Jahrhundert hinein seine Bedeutung nicht verlor. Diese Karren waren oft sogar zusätzlich mit einem Segel ausgestattet. China besaß also schon lange vor den niederländischen Schlittschuhläufern eine mechanisierte Lösung für den Transport. Ganz ohne Pferd.
Im Abendland gab es seit dem Mittelalter Versuche, einen Muskelkraftwagen zu bauen, wenn auch nur als Einzelstücke, etwa zur Glorifizierung der Herrscher bei Paraden. Ein Problem war das Antreiben über die Räder, die bislang an den Fuhrwerken nur passiv mitgedreht wurden. Für reibungsarme Antriebe wäre nahezu feinmechanische Präzision erforderlich gewesen, welche die Schmiede nicht leisten konnten. Nicht zu Unrecht hießen sie damals ja Grobschmiede. Bei den Prunkwagen im Triumphzug Kaiser Maximilians 1508, dargestellt auf den Holzschnitten Hans Burgkmairs, nahm man die ineffiziente Tretarbeit dennoch in Kauf, um bei den Zuschauern eine gehörige Verblüffung auszulösen, da vor diesen Wagen wider Erwarten keine Pferde zuckelten. Für den Alltagsgebrauch waren sie jedoch nicht gedacht.
Tatsächlich gab es aber doch zwei kleine Nischen, in denen die Muskelkraft sich Bahn brach. Das waren einmal spezielle Invalidenrollstühle, die etwa mit Handkurbelantrieb funktionierten, weil die Beine unbeweglich waren – wie beim Dreirad des gelähmten Uhrmachers Stephan Farffler aus Altdorf. Den heute üblichen Rollstuhl mit Handläufen an den Speichenrädern hatte schon 1725 ein Kursachse namens Andreas Gärthner erfunden. Die zweite Nische waren die Gartenphaetons mit »Lakaienantrieb«, dank derer auf herrschaftlichen Gartenwegen die Verschmutzung durch Pferdeexkremente vermieden werden konnte. Solche Gartenphaetons waren vor allem in englischen Adelshäusern beliebt, und ein schönes Exemplar hat der Architekt des pfälzischen Kurfürsten Carl Theodor 1775 in London für dessen Schwetzinger Schlossgarten erworben. Dort stand es kaum benutzt bis 1803, als die Pfalz an Baden fiel und das bewegliche Inventar der Sommerresidenz nach München verfrachtet wurde, denn Carl Theodor war schon zuvor zum Oberhaupt der Bayern geworden. Der Gartenphaeton steht heute noch im Deutschen Museum zu München, ein geflochtener Stuhl für den Fahrzeuglenker, hinter dem ein Lakai stehend in zwei Hebel trat. Diese wickelten abwechselnd Lederriemen von Scheibenrädern ab, die über Freiläufe mit der Hinterradwelle verbunden waren. Klingt kompliziert, hat aber doch funktioniert. Und inspiriert. Denn eines sei jetzt schon verraten: Einst wird ein Student namens Karl Drais seinen Onkel im Forstamt Schwetzingen beim Schloss besuchen und dort den Gartenphaeton sehen, vielleicht sogar ausprobieren können. Dies war offenbar ein Schlüsselerlebnis, das den erfinderischen Studenten und späteren Forstinspektor dann als Forstlehrer beim privaten Forstlehrinstitut des Onkels auf den Landverkehr aufmerksam machte. Nicht auszudenken, wenn es dazu nicht gekommen wäre. Vielleicht würden wir noch heute den Bahnhof auf oder hinter einem Pferd verlassen – womöglich elektronisch gesteuert, aber eben mithilfe eines Pferdes. Die gängige Floskel, das Auto wäre sowieso irgendwann erfunden worden, ist leicht zu widerlegen. Nehmen wir nur einmal an, die Religion der Amischen-Sekte von Pennsylvania und Ontario wäre zur Staatsreligion des Abendlands gediehen, dann hätten wir mit Sicherheit keine Autos. Der junge Amische erhält mit 16 Jahren ein Pferd nebst überdachtem Buggy, um auf Brautschau in die Nachbardörfer zu fahren. Zeitlebens wird er sich von diesem Gespann nicht mehr trennen. Rollschuhe sind den Kindern der Amischen übrigens neuerdings erlaubt, aber noch nicht überall Fahrräder, die ihnen viel zu technisch sind.
Doch noch einmal zurück ins 18. Jahrhundert, nach Japan. Dort bewässerte man durch Treten von Wasserrädern oder Archimedischen Schrauben die Reisfelder und hatte es dabei zu hoher Perfektion gebracht. Der Gelehrte Kuheiji-Tokimitu Hisaishi beschrieb in einem erhaltenen Manuskript das »Riku-Hon-Sesya«, zu Deutsch: das »impulsive Landboot«. Die Zeichnungen zeigen ein bootförmiges Holzfahrzeug auf drei Rädern, dessen Hinterräder mit einer Art Kurbelwelle verbundenen waren, in die der Fahrer stehend trat, wobei er das Vorderrad mittels Lenker und Seilzug lenkte. Zwei Erfinder, Monya Shoda und Takeda, sollen ab 1729 ähnlich aufgebaute Vierräder hergestellt haben, und die Einheimischen sollen Ersteren als »Langstrecken-Mann« bezeichnet haben. Hisaishi schreibt jedoch, sein Dreirad sei besser. An einer Steigung angekommen, müsse man die Vierräder hinauftragen, während das Dreirad hinauffahren könne. Hisaishis Titelblatt ziert ein Gedicht, das die Möglichkeit preist, auf der Maschine mit tänzerischen Bewegungen überallhin zu gelangen und die Freuden solcher Freiheit zu genießen – das früheste Lob auf die »freedom machine«, wie das Fahrrad im englischen Sprachraum noch heute genannt wird. Freiheit war seit der Französischen Revolution auch der politische Traum der Untertanen. Die Pariserinnen und Pariser eroberten in ihrem Freiheitsdrang sogar die Ballhäuser des Adels, wo zuvor als »jeu de paume« eine Art Tennis mit schweren Bällen gespielt wurde. Deshalb bezeichnen wir ein festliches Tanzvergnügen bis heute als »Ball«. Und auch im Eislauf manifestierte sich ein solcher Eroberungsdrang für neue Räume und Vergnügungen.
Forstlehrer Drais und seine Fahrmaschine
Für Leser von Auto-Magazinen ist das Wort »Fahrmaschine« ein durchaus geläufiger Begriff, in der Regel gepaart mit der Bewunderung für einen viel zu schnellen, röhrenden Sportwagen. Und Italienreisende erinnern sich, dass das Auto dort seit jeher »la machina« heißt. Allein ins Wörterbuch der Gebrüder Grimm hat das Wort keinen Eingang gefunden. Dabei ist es so alt wie die Völkerschlacht bei Leipzig von 1813.
Jedenfalls schrieb elf Tage danach ein gewisser badischer Forstlehrer namens Karl Drais seinem Großherzog Carl I., der mit 27 um ein Jahr jünger als Drais war, er hätte nun gern für seinen jüngsten Geistesblitz ein Privileg (Patente gab es in Baden noch nicht). Der Großherzog kenne die Fahrmaschine ohne Pferd ja bereits von der Vorführung durch den Erfinder. Damit war die Fahrmaschine aktenkundig, und das Wort hatte der Forstlehrer gar selbst geprägt. Übrigens hatte er zuvor die »Musikmaschine« (eine Art Klavier-Rekorder auf Papier), und etwas später die »Verwandlungsmaschine« zur Flächenberechnung durch Geometer entwickelt, viel später kam die erste »Schreibmaschine« mit Tastatur hinzu.
Den Antrieb seiner Fahrmaschine bildete noch keine Dampfmaschine, sondern ein Mensch, der so zum homo automobilis wurde. Tatsächlich waren die beiden Versionen der Fahrmaschine nur erste Fingerübungen des Erfinders. Doch ihre Genese passt schon in das Innovationsmodell des Wirtschaftshistorikers Joseph Schumpeter, wonach Innovationen immer die Antwort auf einen Bedarf sind. Denn mit der schlechten Ernte 1812 begann eine Serie von Missernten, wodurch der den Pferdeverkehr bestimmende Haferpreis stieg, zumal die durchziehenden Armeen der Napoleonischen Kriege die Vorräte der Bauern erschöpft hatten. Ein pferdeloser Transport erschien Drais deshalb als überaus wünschenswerte Alternative. Er hatte zu Beginn seines Heidelberger Studiums mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jenen Gartenphaeton im Schwetzinger Schlossgarten analysiert. Mit dem Ergebnis, dass dessen Mechanik viel zu kompliziert und kräftezehrend sei. Also reduzierte er die Mechanik auf ein Minimum, indem er eine Tretmühle direkt zwischen den Hinterrädern vorsah. Der menschliche Motor saß auf einem Schwebesattel, trat diese Mühle mit den Füßen und bewegte dadurch die Hinterräder. Ein weiterer Insasse durfte die Lenkung übernehmen – ganz wie im Gartenphaeton der Fürst. Weil aber der Tretende nur rückwärts blicken konnte, versah Drais die Fahrmaschine bald mit einer Kurbelwelle zwischen den Hinterrädern. Nun konnte auch der Tretende in Fahrtrichtung blicken und bescheidene sechs Kilometer pro Stunde erreichen. Leider gibt es kein Bild von diesem vierrädrigen Tretauto, wie man heute sagen würde, nur Drais’ Beschreibung in einem Fachmagazin der Zeit. Zar Alexander, nach dem Sieg bei der Schwiegermutter Amalie in Karlsruhe zu Besuch, erhielt eine Vorführung und äußerte dazu beeindruckt: »Das ist ja genial.« Zudem schenkte er Drais einen Brillantring. Als weniger genial erwies sich der Ratschlag des Zaren, die Erfindung beim Wiener Kongress vorzuführen, wohin Drais 1814 nebst Fahrmaschine wohl auf der Donau und mit Vaters finanzieller Unterstützung reiste. Doch die um Europas Länder schachernden Fürsten hatten ihre sachkundigen Feldzeugmeister nicht dabei und zahlten ihre Benzin-, pardon Haferkosten aus der Portokasse. Der Haferpreis erschien ihnen daher nicht bedrohlich genug, um an Alternativen denken zu müssen. Dabei hatte Drais in seinem Flugblatt für Interessenten in Wien die Motive seiner Entwicklung mehr als deutlich gemacht: »In Kriegszeiten, wo die Pferde und ihr Futter oft selten werden, könnte ein solcher Wagen wichtig seyn.« Und jetzt gab es zwar keinen Krieg mehr, stattdessen aber Missernte auf Missernte.
Nachdem Drais bei den hohen Herren abgeblitzt war, wandte er sich frustriert anderen Erfindungen zu, die für Geometer und für Treidelschiffer nützlich waren. Doch wie kommt ein Freiherr Drais von Sauerbronn, so sein kompletter Name, überhaupt zum Erfinden? Bei dieser Überlegung sollte man nicht verkennen, dass die Draisens zum Beamtenadel ohne Grundbesitz gehörten, und dieser musste für den Lebensunterhalt eine Anstellung suchen. Wer nicht in die Dienste eines Fürsten gelangte, musste ein Leben als Hauslehrer, damals Hofmeister genannt, ins Auge fassen – und wurde manchmal zum Literaten, nachdem er sich unsterblich in die Hausherrin verliebt hatte. Den Beruf bestimmte in Karl Drais’ Fall der Pate und regierende Markgraf Karl Friedrich: Forstdienst.
Ein Bildungs- und Lebensziel der Aufklärung war gemäß dem Enzyklopädisten Diderot, »dass wir nicht sterben, ohne uns um das menschliche Geschlecht verdient gemacht zu haben«. Und dies fand im frankophilen Hause Drais wohl einen jungen Nacheiferer. Damals machten auch Kirchenmänner Erfindungen, um den armen Leuten etwas zum Produzieren an die Hand zu geben. Womöglich war der vielseitige Graf Rumford eines seiner Idole, denn Vater Drais ließ für die Bedürftigen Karlsruhes eine moderne Rumfordsche Suppenküche bauen. Rumford konnte jedoch seine Wissenschaft stets finanzieren, unter anderem zweimal durch die Heirat steinreicher Witwen, ein Weg, der dem jungen Drais offenbar verschlossen blieb, seit die ehehinderliche, weil vererbliche Epilepsie des Vaters bekannt geworden war. Ansonsten machten Handwerker ihre Erfindungen anonym und produzierten sie in der Werkstatt selbst. Nach allem, was man weiß, besaß Drais keine eigene Werkstatt, sondern ließ seine Prototypen stets bei anderen Handwerkern fertigen. Er war ein Weißer-Kragen-Erfinder. Doch davon konnte man in vorindustriellen Zeiten nicht leben.
Ein Vulkanausbruch und seine spektakulären Folgen
Im Jahr 1816 wurde die Situation wirklich dramatisch, der Historiker John D. Post spricht von der letzten großen Überlebenskrise der Menschheit: Dauerregen, in Amerika und Kanada sowie auf der Schwäbischen Alb sogar Schnee im Sommer verursachten einen kompletten Ernteausfall. Es folgte eine Hungersnot. All dies wurde – wie wir heute wissen – durch die kolossale Stauberuption des Vulkans Tambora östlich von Bali im Jahr 1815 ausgelöst. Flüsse, Bäche und der Bodensee traten über die Ufer. Getreide und Kartoffeln verschimmelten auf den Feldern. Die Ärmsten in Süddeutschland und der Schweiz aßen Lehm, kochten Blätter und schlachteten Katzen. Aus Futtermangel verendeten die Nutztiere oder wurden notgeschlachtet. Im Folgejahr 1817 wurde die Hungersnot noch dramatischer. Der Finanzbericht der französischen Abgeordnetenkammer an den König sprach von einem regelrechten Pferdesterben. Rahel von Varnhagen, die Frau des preußischen Gesandten am badischen Hof zu Karlsruhe, schrieb in einem Brief:
Hungersnoth vor der Thür: Theurung, die jeden geniert; solche Noth, dass man gar nichts anders hört, und es ein jeder hört; man es von einem jeden hört; im Oberland [Süden Badens], einige Meilen von hier, ißt man Brot aus Baumrinde, und gräbt todte Pferde aus; Man sieht allen Gräueln entgegen.
Der großherzoglich-badische Hoftierarzt in Karlsruhe berichtete retrospektiv von einem zumeist tödlichen Muskelfieber, das 1817 unter den unterernährten Pferden der Gegend grassierte, und nannte als amtliche Maßregel dagegen schlicht: Nicht mit verdorbenem Futter füttern. Eigenartigerweise wurde die Hungersnot in der Tagespresse und in Büchern nicht thematisiert; offenkundig verhinderte die Zensur jede Berichterstattung. Die französischen Brotunruhen mit Plünderungen von Bäckereien und Mühlen sollten nicht zur Nachahmung anstiften. Neben der menschlichen Verdrängungsbereitschaft dürfte also die staatliche Zensur dafür verantwortlich gewesen sein, dass diese Hungerkatastrophe so bald schon wieder vergessen war.
Ab Juli 1817 steht Forstlehrer Drais in allen Zeitungen des Abendlands. Mit einem minimalistischen Fuhrwerk auf zwei hintereinander montierten Rädern war er am 12. Juni auf der besten Straße aus der Stadt Mannheim hinausgefahren, hatte beim Relaishaus halbwegs vor Schwetzingen gewendet und bis nach Hause insgesamt vier Poststunden Wegs zurückgelegt. Dazu benötigte er eine knappe Stunde, während die Postkutsche dafür ganze vier brauchte, wie das altertümliche Streckenmaß besagt, welches umgerechnet acht englische Meilen oder 12,8 Kilometer bedeutet. Die erste Nachricht stand nicht im Mannheimer Intelligenzblatt, das dieses historische Ereignis offenbar gar nicht mitbekam, sondern im Badwochenblatt der Stadt Baden-Baden, wohin Drais von Gernsbach aus eine Bergfahrt unternommen hatte, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von sechs Kilometern je Stunde statt der 14 bis 15 Stundenkilometer bei der ebenen Mannheimer Rundfahrt. Drais hat die Nachricht mit Sicherheit selbst in das Blatt gesetzt, zitierte frühere Erfolgsmeldungen zur vierrädrigen Fahrmaschine und nannte seine neue Erfindung »LODA«, wohl zusammengezogen aus französisch »locomotion« (»Fortbewegung«) und »dada« (»Steckenpferd«). Im Herbst taufte er sein Zweirad dann »Laufmaschine«, um es von der vorherigen vierrädrigen Fahrmaschine zu unterscheiden. Die Zeitungen nannten es bald »Draisine«, nachdem die französischen Blätter es als »la draisienne« beschrieben hatten.
Anders als bei seiner Fahrmaschine vier Jahre zuvor ist dieses Mal die Resonanz enorm. Drais schreibt einen Artikel für den Allgemeinen Anzeiger der Deutschen,
da ich seit meiner neuesten Erfindung einer möglichst einfachen Fahrmaschine ohne Pferd [des Zweirads] oder eines Wagens zu Fuß so viele Briefe mit weiteren Nachfragen, teils mit Besorgungsersuchungen, erhalten habe, daß mir neben der übernommenen Obsorge für die letzteren die Beantwortung aller Briefe für jetzt zur Unmöglichkeit wird.
Ebendort hatte ein Anonymus aus Jena ein Inserat platziert:
Könnte man nicht baldigst durch diese Blätter erfahren, ob, wo und wie theuer man die kürzlich vom Forstmeister Freyhrn. Karl von Drais in Carlsruhe erfundene Fahrmaschine [das Zweirad] schon fertig erhalten oder wenigstens den Riß oder ein Modell dazu gegen Vergütung bekommen könne?