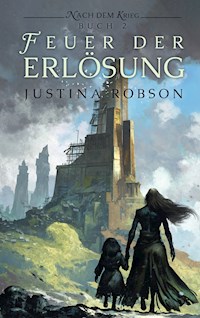
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nach dem Krieg
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Nekromanten der Tzarkomanen opferten dereinst tausend Frauen, um eine Braut für den Blutschlächter zu erschaffen. Doch der Blutschlächter ist tot, und so darbte die Kreatur, die seine ewige Herrschaft sichern sollte, verlassen von ihren Schöpfern an einem längst vergessenen Ort. Bis heute … Wird die Braut des Schlächters die Götter nun wieder zurückholen oder wird sie das Ende aller Tage herbeiführen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 666
Ähnliche
Ins Deutsche übertragen von Kerstin Fricke
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright © 2022 Justina Robson
Cover art by Tomasz Jedruszek
Titel der englischen Originalausgabe: »After the War – Book 2 – Salvation’s Fire« by Justina Robson, published 2018 by Solaris an imprint of Rebellion Publishing Ltd., Oxford, UK.
Deutsche Ausgabe 2022 Panini Verlags GmbH, Schloßstraße 76, 70176 Stuttgart.
Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Kerstin Fricke
Lektorat: Mona Gabriel
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDAFTER002E
ISBN 978-3-7367-9845-8
Gedruckte Ausgabe:
1. Auflage, März2022, ISBN 978-3-8332-4176-5
Findet uns im Netz:
www.paninicomics.de
PaniniComicsDE
Nach dem Krieg
Vor einer Dekade kehrte der schreckliche Halbgott, Blutschlächter genannt, aus seinem langen Exil in der Dunkelheit zurück und vernichtete zusammen mit seiner Monsterarmee alles, was sich ihnen in den Weg stellte.
Die Nationen der Welt sammelten sich, schlossen sich rasch zu Allianzen zusammen und vermochten so, den Feind zurückzuschlagen.
Eine kleine Heldengruppe unter der Führung des rätselhaften Wanderers brach in den Palast des Blutschlächters ein und tötete ihn.
Aber was geschieht, wenn die Kämpfe ausgefochten sind?
Wenn die alten Rivalitäten wieder aufbrechen, wenn sich all die Hungernden und Gebrochenen in ihrer Not gegen ihre Nachbarn wenden?
Dies ist die Geschichte all dieser Auswirkungen.
Für Daniel Danke, dass du mir bis dato unbekannte Worte gezeigt hast :-)
Prolog
Das Mädchen war verloren. Im Lager war jeder verloren. Es war ein Ort für Verlorenes: Personen, Hunde, getragene und geliebte Dinge, getragene und verhasste Dinge, Dinge ohne Heimat oder Namen. Sie wurden dort abgeladen, weil es keinen anderen Ort gab, an dem sie einen Platz fanden, in einem Land, das niemanden genug interessierte, um es zu bearbeiten oder zu umzäunen. Es war kein schlechtes Land, aber auch kein besonders gutes. Das Wasser war weit entfernt und es gab kaum Bäume. Das Gras war hart und unansehnlich. Überall wucherten Kräuter und Dornenbüsche und verbargen kleine Tiere. Selbst der Himmel war karg, zog sich über die Hügel wie ein zu stramm gespanntes Fell, das im Regen bald hart werden würde, um irgendwann zu reißen und die Flüssigkeit durchzulassen.
Das Mädchen teilte sich ein Zelt mit zwei wütenden Frauen. Diese waren keine Blutsverwandten, sondern dadurch miteinander verbunden, dass sie beide zu den Babohendra gehörten, den Pferdeleuten. Demzufolge waren sie noch weiter entfernt von zu Hause als das Mädchen, und ihre halbrunden Hufe, angewinkelten Beine und ihr kastanienbraunes beziehungsweise schwarzes Fell sahen fremdartig genug aus, um furchterregend zu wirken, obwohl keine von ihnen die Energie besaß, anderen Furcht einzuflößen. Die Armeen des Blutschlächters hatten schon dafür gesorgt. Sie waren alle erschöpft, vom Laufen völlig ermattet. Selbst nach drei Jahreszeiten hatten sie nur einen leichten Schlaf und waren stets bereit aufzubrechen, weil sie nicht glauben konnten, dass es vorbei war.
Möglicherweise war es auch gar nicht vorbei. Das Mädchen war sich nicht sicher, hatte aber seinen Tod gespürt. Ein solches Leben war unverwechselbar, selbst auf große Distanz. Es hatte eine Art von Schweigen zurückgelassen, das von allem widerhallte, was er zu Lebzeiten berührt hatte. Sie wusste, dass er ein Monster gewesen war, ein Todesbringer, der ein unvergleichliches Gemetzel angerichtet hatte, selbst unter seinesgleichen, aber sie hatte ihn bis zu den letzten Augenblicken seines Wirkens als strahlende, pulsierende Feier des Daseins gesehen. Im Leben war er außergewöhnlich gewesen und ohne ihn erklang die Musik der Welt nur noch gedämpft. Doch ohne seine erdrückende Präsenz konnte sie auch andere Melodien wahrnehmen – die grandiosen Gestalten der immer noch aktiven Wächter –, daher war sie in diesem ganzen traurigen Gesindel als Einzige vollkommen davon überzeugt, dass er fort war, seine Armeen zerstreut, seine Pläne vereitelt, sein Schicksal vollendet und seine Geschichte abgeschlossen.
Er hätte gewollt, dass ihre Geschichte ebenfalls zu Ende ging, doch dabei versagt. Wann immer sie daran dachte, musste sie lächeln. Das war ihre heimliche Freude, und sie schenkte ihr die Macht, den Hunger, den Durst, die Kälte und die Sehnsucht nach Liebe zu ertragen. Er hatte verloren und sie war noch immer am Leben. Aber sie war allein. Da verblasste ihr Lächeln jedes Mal, weil es ihr bewusst war. Keiner dieser Leute gehörte zu ihrem Volk. Ihre Art existierte auf dem Antlitz der Erde nicht länger.
Dieser Tag, grau und feucht, erfüllt mit dem Gejammer aus einem Quartier, der bedrückten Verzweiflung aus vielen anderen, unterschied sich in nichts von einhundert anderen Tagen. Die Sonne war aufgegangen, jene, die dazu in der Lage waren, gingen auf die Jagd oder auf Nahrungssuche, alle anderen blieben bei den rauchenden kleinen Feuerstellen und kochten Tee aus Zweigen. Eine Gruppe zog los, um das Schicksal einer anderen Gruppe zu ergründen, die zu einem dreißig Kilometer entfernten Dorf aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt war. Sie waren mit angespitzten Stöcken bewaffnet, zögerlich und hofften, den anderen auf dem Weg zu begegnen. Ohne irgendeine Art von Handel würden sie alle bald in diesem Nichts von einem Tal sterben, umgeben von gleichgültigen Wäldern, so sicher wie die Hasen in einer Falle. Sie hatten nichts anzubieten außer sich selbst und ihren wenigen Habseligkeiten, durchaus kostbar, für einen Fremden jedoch wertlos. Dagegen ließ sich nichts unternehmen.
Sie verließ das Zelt, stand im Schlamm und beobachtete die anderen Kinder, die trübsinnig herumsaßen oder mit Ästen spielten. Sie mochten sie nicht und sie konnte sie ebenfalls nicht leiden. Das war nichts Persönliches. Sie starrten sie an mit eingesunkenen Augen, die boshaft gewesen wären, jedoch längst Interesse eingebüßt hatten und bald gar keins mehr haben würden. Die Erwachsenen liefen so träge herum, als befänden sie sich unter Wasser. Sie nahmen sie nicht zur Kenntnis. Sie gehörte nicht zu ihnen. Kurz nachdem sie sich von ihnen abgewandt hatte, traf sie ein kleiner Stein am Kopf. Vielleicht lachten sie über sie, vielleicht auch nicht. Sie wusste es nicht und würde ihnen auch nicht die Befriedigung verschaffen, sich umzudrehen, um es herauszufinden. Damit war die Angelegenheit erledigt.
Nachdem sie ins Zelt zurückgekehrt war, hob sie das Lumpenbündel auf, mit dem sie Blätter und Beeren sammelte. Sie ging an den wenigen Holzhütten vorbei und über den Weg zu dem dichteren Wald, der dahinter anfing. Auf diesem Pfad waren sie auch hergekommen, und sie erinnerte sich daran, dort Straßen gesehen zu haben.
Ein heftiges Zerren am Ärmel ließ sie innehalten. Sie blickte auf. Die jüngere der beiden Frauen, mit denen sie das Zelt teilte, blickte sie an, bewegte den Mund und setzte eine fragende, verärgerte Miene auf. Ihr Hufstampfen verriet ihre Nervosität.
Das Mädchen deutete in Richtung Wald. Machte eine Bewegung, als würde es etwas pflücken und essen.
Eine Mischung aus Missmut, Traurigkeit und Sorge zeichnete sich auf dem lang gezogenen Gesicht der Frau ab. Ihre braunen Augen wirkten geduldig, weitaus mehr als ihre Hände, die sie gefaltet hatte, um dem Drang zu widerstehen, das Mädchen zu packen und festzuhalten. In ihnen lag eine Leere, der Geist von jemandem, der zurückgelassen worden war. Das Mädchen wusste das und wartete, bis die Frau nickte und sagte, dass sie gehen könne. Das war alles, was sie jemandem, der versucht hatte, ihr zu helfen, zum Abschied schenken konnte, dieser Augenblick der Freundlichkeit. Es hätte sehr viel mehr geben sollen, doch das tat es nicht.
Sie verließ das Lager und bewegte sich an den Dornensträuchern und den Feldern mit wildem Knoblauch vorbei, an den umgefallenen Baumstämmen, aus denen Pilze wuchsen, und den Stämmen vertrauter Bäume, auf die man klettern konnte und in denen es vielleicht Vogelnester und Insekten gab, die jemand Kleines, Leichtes zu erreichen vermochte. Sie kannte sie alle. Sie berührte sie im Vorbeigehen, diese langsamen Leben, und spürte durch ihre Wurzeln das riesige Land, in dem es andere helle Flecken, Personen und ihre Tiere gab. Sie würde einen Weg finden.
Irgendwann, bevor es dunkel wurde, ließ sie die Lumpen fallen. Sie trank an einem Bach und tunkte die Finger hinein, bis sie ganz kalt waren, weil dort Fische herumschwammen, lebhaft und strahlend, die ihr etwas Freude schenkten. Einmal schaute sie sich um und blickte zurück, dann schlug sie einen Weg durch die Dornenbüsche ein, auf dem ihr keine größere Person folgen konnte, nur um ganz sicher zu sein.
Sie bahnte sich, ohne zu zögern, den Weg, geleitet von den schlagenden Herzen winziger Tiere, den flink herumsausenden Fliegen. Menschen mied sie. Sie orientierte sich an dem Pfad der Bäume und hielt auf einen Flecken weit entfernt im Westen zu, auf dem sich ein strahlender Schatten bewegte, dunkles Kerzenlicht, die ewig flackernden grauen Silberstrahlen des Wanderers.
1
Fass fest den Saum, frei bleibt mein Traum, halt die Katz im Zaum und den Vogel im Baum!« Viele Stimmen, der Großteil davon entweder beschwipst oder begeistert, die Besitzer vollgestopft mit süßen Pasteten, verbanden sich und grölten die Worte des alten Kinderreims derart enthusiastisch, dass der Klang über die verstreut herumstehenden Bänke und geplünderten Banketttische bis in den hintersten Winkel des Geländes hallte. Kinder tobten herum, Hunde bellten, mehrere Familienangehörige stritten sich, unzüchtige und allerlei andere Geräusche der laufenden Feierlichkeiten waren noch weit auf den grünen Weiden und jenseits der Hecken zu hören.
Celestaine hatte schon immer darüber gestaunt, wie viele Lieder im Haus ihrer Familie bekannt waren und lauthals gesungen wurden, ohne dass man Wert auf den Sinn der Worte oder die Melodie legte – wobei es sich vor allem um fröhliche Weisen handelte. Aber heute war sie einfach nur dankbar dafür, dass es sich nicht erneut um »Die Klinge vom Trauerschloss« handelte, in dem sie die Hauptrolle spielte – als die Kriegerin, die einen Drachen erlegt, dem Blutschlächter die Hand abgehackt und der Menschheit den Weg zu ihrer Errettung bereitet hatte. Es wäre unschicklich gewesen, in trunkener Wonne unter den blütenschweren Zweigen der Kirschbäume zu liegen und sich von ahnungslosen Verwandten in den Armen des »Feindes« ertappen zu lassen, während sie sich den Met mit einem anderen »Feind« teilte. Wahrscheinlich hätte sie dann einiges erklären und sich erboste Beschimpfungen des Yorughan-Abschaums anhören müssen. Was vielleicht trotzdem noch passieren würde. Es könnte sogar zu einer Schlägerei kommen, was sehr bedauerlich wäre, weil sie einen guten Kampf immer zu schätzen wusste, jetzt jedoch zu betrunken war, um noch viel ausrichten zu können. Der einzige Trost an diesem durch und durch anstrengenden Tag war die Tatsache, dass er nun endlich vorbei war und dass sie wieder aufbrechen konnte, wie sie es schon vor drei Tagen hatte tun wollen, was jedoch von Caradwyn vereitelt worden war. Sie hatte nach ihrem Pferd und ihrer Rüstung geschickt und war bereit gewesen, loszureiten und herauszufinden, was dieser durch und durch närrische Deffo, der am wenigsten nützliche Wächter, jetzt schon wieder anstellte (wobei sie eigentlich heilfroh über Deffo war, falls sich so etwas denn überhaupt behaupten ließ, denn die Langeweile und all die Probleme, die der Aufenthalt zu Hause mit sich brachte, schienen sie bereits zu erdrücken und zu ersticken). Doch genau da war ihre Cousine aufgetaucht, ein schillernder Geist aus orangefarbener und rosafarbener Seide, blonden Zöpfen und Rosenwasser.
Caradwyn war die Schönheit der Familie. Sie besaß dieselbe Größe wie die »silberne Schönheit« Celestaine und auch ihr nahezu weißes Haar, die blauen Augen und die milchweiße Haut, allerdings waren das auch schon die Gemeinsamkeiten. Denn wo Celestaine breitschultrig, aufrecht und kräftig war, da war Caradwyn in der Leibesmitte gertenschlank und an den entscheidenden Stellen kurvig. Zwar hatte sie in ihrer Kindheit die freie Natur geliebt, betrachtete das Herumlaufen nun jedoch als anstrengend und ärgerte sich über alles, was ihrem Ordnungssinn widersprach. Trotz dieser wenig verheißungsvollen Entwicklung teilte Celestaine mit ihr schöne Kindheitserinnerungen, die Ausritte und Bootsfahrten auf den Zuläufen des Flusses beinhalteten. Was es Caradwyn an Begeisterung mangelte, machte sie mit ihrer überbordenden Fantasie wieder wett. Sie war die Geschichtenerzählerin, die Celestaine mit all den Leben, die sie für sie erfand, faszinierte: Sie waren Troubadoure auf der Flucht, sie waren Wächterinnen, die den Armen halfen und das grausame Böse der Völker unter die Erde zurücktrieben (Celestaine war sich der Ironie dabei durchaus bewusst), und sie waren heldenhafte Prinzessinnen, die auf fliegenden Pferden vor bösen Zauberern flohen, magische Bestien aus dunklen Teichen unter Trauerweiden fischten und von den geflügelten Dämonen aus dem fernen Norden träumten, die auf Flügeln aus Stahlfedern zwischen den eisigen Bergen dahinschwebten.
Seitdem hatten sie einander selten gesehen. Celestaine hatte für den Kampf trainiert und sich um den harten Alltag des Anwesens gekümmert, während Caradwyn als Gelehrte mit ihren Büchern und Schriftrollen nach Ilkand gereist war, um die Verwaltung und Buchhaltung zu lernen, die sie mit der Liebe einer Cheriveni für Zahlen und Vorschriften anging.
Bei Celestaines Rückkehr als Heldin hoch zu Ross, die bereits in Liedern verewigt worden war, standen sie sich längst nicht mehr nahe. Sie hatte bei ihrer Ankunft noch nicht einmal mit Caradwyn oder jemand anders gesprochen. Es war kaum zu entscheiden, was sich schwerer ertragen ließ – Bewunderung und Staunen oder Entsetzen und Abscheu –, doch alles in allem war es der Abscheu, der ihr den Rest gab, nachdem sie Heno und Nedlam als ihre Gefährten vorgestellt hatte. Über so etwas hatte sich Caradwyn in den guten alten Zeiten keine Geschichten ausgedacht.
Als Yorughan hatten Heno und Nedlam zur Vorhut und Hauptschlagkraft der Elitetruppen des Blutschlächters gehört und somit zum bösen Feind aus der Tiefe. Heno war der Allerschlimmste, ein Herzfresser, bemalt wie ein Teufel, eine hauerbewehrte Bestie voller unheimlicher Magie. Nedlam gehörte eher zu der Sorte riesiger Monsterfrauen, die Babys fraßen. Man tötete solche wie diese beiden und ließ die Leichen für die Vögel liegen. Man ließ sie langsam sterben als Rache für die vielen Tausend, die sie umgebracht hatten. Aber man nahm sie nicht mit zu sich nach Hause. Man ging nicht mit ihnen ins Bett. Man bot ihnen nicht Heim, Herd und Herz an und gab ihnen nicht das Gefühl, dass man sie von allen auf der Welt als engste Freunde ansah. Enger gar noch als alle, die man vor dem Krieg gekannt hatte.
Darum war Celestaine Caradwyn aus dem Weg gegangen – was aufgrund von Caradwyns Pflichten als Buchhalterin und Verwalterin des Fernreame-Anwesens nicht weiter schwierig war –, und dann, gerade als die Freiheit Celestaine mit ihrem gekrümmten Finger zu locken schien, stand sie da, in voller Lebensgröße und doppelt so süß, die großen grauen Augen voller Tränen, weil sie einen Verrat befürchtete, die vollen geschwungenen Lippen zu einem perfekten Schmollmund verzogen, weil sie sich zu Recht beleidigt fühlte.
»Du kannst doch nicht vor der Hochzeit abreisen!«
Celestaine hatte den Mund aufgemacht, aber keinen Ton herausgebracht. Rein gar nichts.
Sie konnte die Diener auf dem Hof hören, die Bänke und Tische für die Hochzeit zwischen Caradwyn und einem anderen frisch zurückgekehrten Kriegshelden, Starich, dem Wolf, aufstellten. Er war der Erbe von Thistledown mit den damit verbundenen Titeln und Privilegien und gehörte somit einem angesehenen Clan an. Darüber hinaus stand er auch noch recht weit oben auf der Liste der Krieger-Barone, die Anspruch auf den Thron von Arven hatten, sodass er sich durchaus Hoffnungen machen konnte, erst recht, wenn er eine erfolgreiche Vereinigung mit Straußenfarn vollzog, dem Clan, dem Fernreame angehörte. Das machte ihn zu einem hervorragenden Fang, jedenfalls den Worten von Celestaines Tante zufolge, und laut ihrem Onkel war er ein feiner Kerl, der momentane Anführer des Clans, der es kaum abwarten konnte, das Vermögen beider Häuser zusammenzuführen und jemand anders zu übergeben, damit er endlich genug Zeit zum Angeln hatte.
Celest konnte es kaum erwarten, dass Starich endlich eintraf, damit sich die Aufmerksamkeit jemandem zuwenden konnte, dem alle von ganzem Herzen beipflichteten – und der keine seltsamen Freundfeinde im Schlepptau hatte, bei denen man lernen musste, freundlich zu sein, statt sie zu enthaupten. Starich konnte die Rolle des heimgekehrten Kriegers viel besser spielen als sie, lautstark alle Geschichten über die vielen Schlachten zum Besten geben, Feste feiern, mit seinen Gefährten trainieren und zur Belustigung all jener, die zu alt oder zu jung gewesen waren, um am Kampfgeschehen teilzunehmen, Heldentaten nachstellen. Er würde sich nicht seinen Mantel überstreifen und zu den Hügeln aufbrechen, es sei denn, sie bäten ihn darum – nicht bei all der Verantwortung, die auf seinen Schultern lastete. Sie konnten ihn anhimmeln und ein großes Getue um Caradwyn und ihre Pläne für eine rosige Zukunft voller wilder Kinder machen, damit es Celestaine endlich möglich war, sich aus dem Staub zu machen.
»Ich …«, sagte sie, doch mehr kam nicht. Sie blickte Caradwyn ins Gesicht, die jetzt älter aussah, blass, weil sie kaum in die Sonne kam, und sommersprossig, und die sie mit einer unverhohlenen Sehnsucht ansah – nur noch wenige Tage der Freiheit, in der sie einfach sie selbst sein konnte, bevor die Pflichten und die Mutterschaft ihre Zeit in Anspruch nehmen würden. Sie sah genauso aus wie bei Celestaines Besuch Jahre zuvor, bei dem sie Celest aufgesucht und verlangt hatte, dass sie die Abenteuer früherer Sommer fortsetzten. Doch nun war es damit vorbei. Celest war losgezogen und hatte eines ohne sie erlebt. Und nun war sie drauf und dran, sie für immer zu verlassen.
»Ich … würde mir das doch niemals entgehen lassen«, fuhr sie fort. »Ich habe nur einige Vorbereitungen getroffen. Für später.«
Caradwyns Verzweiflung ließ ein wenig nach, und sie umklammerte fest Celestaines Arm, deren Lüge derart durchschaubar war, wie ihr Kettenhemd frisch geölt und bereit war. »Gut. Wir müssen zusammen ausreiten. Es gibt da etwas, das ich dir erzählen muss, und du musst mir die Wahrheit über alles sagen. Ich will die ganze Geschichte hören.« Als sie merkte, dass Celestaine unschlüssig wirkte, schüttelte sie sie. »Nein! Du wirst es nicht wagen, mir das vorzuenthalten! Celest. Morgen. Morgen bei Sonnenaufgang reiten wir los. Wir treffen uns vor dem Stall.«
Dieser Enthusiasmus, diese Energie, dieses Gefühl, wie sehr Caradwyn sie stets gemocht hatte – was nicht immer auf Gegenseitigkeit beruht hatte. »Ja«, erwiderte Celestaine. »In Ordnung. Bei Sonnenaufgang.«
»Allein.« Caradwyn wedelte mit einem Finger vor Celestaines Nase herum. »Ohne Begleitung. Ich will dich ganz für mich haben.«
»Allein.« Celestaine rang sich ein Lächeln ab.
»Ich muss mich um den Hühnermann und sein Geld kümmern.« Caradwyn seufzte und rasselte mit den Silberschlüsseln, die zusammen mit allerlei Tand an ihrem Gürtel baumelten und sie als Haushaltsvorstand des Clans auswiesen. »Du hast mir gefehlt. Und jetzt bist du wieder da. Genauso wie ich es mir immer vorgestellt habe.«
»Ich bin ganz und gar nicht so wie in deiner Fantasie«, erklärte Celest und verglich Heno mit Caradwyns Freier, um im selben Augenblick zu begreifen, dass sie hier nicht zu Hause war und es niemals sein würde.
»Doch, das bist du.« Ohne auch nur etwas von Celests Gedanken zu ahnen, machte Caradwyn eine Geste, als wollte sie Celestaine den Mund verschließen.
Celest schüttelte beharrlich den Kopf und kam sich dabei wie ein Miesepeter vor.
»Du hast getan, wovon wir immer geträumt haben.« Caradwyn ermahnte Celest noch deutlicher zu schweigen und zeigte auf sie, um dann eilig die Röcke zu raffen und fortzueilen, nicht ohne ihr einem Sonnenstrahl gleich noch ein letztes Lächeln über die Schulter zuzuwerfen.
Celest stand mit dem Sattel auf dem Arm allein im Flur und fühlte sich, als wäre sie eintausend Jahre alt. Neben ihr hing das alte Portrait ihres toten Vaters, das schon auf die beiden Mädchen herabgeblickt hatte, als sie Pläne schmiedeten, die Welt zu lenken. Nun war sie mit ihm auf Augenhöhe. Er sah Celest direkt an, und sie erwiderte seinen Blick und hatte das Gefühl, in einen Spiegel zu sehen. Neben ihm kämpfte der trockene Humor ihrer Mutter mit ihrem strengen Pflichtbewusstsein. Celest war froh, dass die beiden schon gestorben waren und sie jetzt nicht mehr sehen konnten. Das machte ihr vieles leichter.
Früher hatte sie die Portraits der Erwachsenen gehasst, die so streng und enttäuscht aussahen.
Und das tat sie noch immer.
Seufzend zog sie los, um den anderen mitzuteilen, dass sie noch etwas länger bleiben würden.
2
Es war zwei Tage her, dass Deffo Nachrichten über seinen Wächtergefährten Wanderer überbracht hatte.
Celestaine begann zögerlich Vertrauen gegenüber dem Wanderer zu empfinden, das sich jedoch nicht auf jeden der anderen Halbgötter erstreckte, die von den Göttern damit betraut worden waren, für die Menschen zu sorgen, und dann sich selbst überlassen worden waren. Die Verwandlung des Rächers in den Blutschlächter hatte nicht gerade dafür gesorgt, dass man ihnen noch großes Vertrauen schenkte. Aber Wanderer hatte Celestaine ein Schwert gegeben, das alles zu zertrennen vermochte. Sie hatte dem Blutschlächter damit die Hand abgetrennt und einen Drachen getötet. Es hatte ihr ermöglicht, ihn zu bezwingen und auch noch andere, doch nun war es weg, hatte sich tief in einen Stein gebohrt, nachdem es an Walls Hammer zerbrochen und fortgeflogen war. Schicksal oder göttliche Intervention? Ihr war es gleich. Doch Deffos Worte klangen eindringlich.
»Wanderer ist in der Nähe! Er weiß, wo die Götter sind!«
Der Blutschlächter hatte die Verbindung zwischen den Göttern und der Welt gekappt. Ihre Tempel und ihre Anhänger waren ihrer überall beraubt worden. Es gab nur noch die Wächter. Celest war in Bezug auf die Götter hin- und hergerissen. Ein Gott hätte den Aethani die Flügel zurückgeben können, statt es ihr zu überlassen, die Reise als Geste der Wiedergutmachung auf sich zu nehmen, die sie nicht aus vollem Herzen, sondern eher aus Pflichtgefühl angestrebt hatte. Diese Reise war nicht so zu Ende gegangen, wie sie gehofft hatte. Einige Dinge ließen sich nicht rückgängig machen. Vielleicht waren die Götter für diesen Impuls, zu verbessern und wiederherzustellen, verantwortlich, der sie mit jenem Tatendrang erfüllte, den sie auch jetzt wieder spürte. So viel war zerstört worden, und die Alternative bestand darin, in trunkener Benommenheit in einem Kirschgarten zu liegen, anderen aus dem Weg zu gehen und mit anzusehen, wie die Tage unverändert vergingen. Dafür konnte sie jedoch nicht genug Selbstmitleid aufbringen.
»Aber du gehst«, sagte Deffo, der halb verborgen an der Stalltür hing. »Wenn das hier vorbei ist.«
Heno und Nedlam hatten sich dort unter dem Vorwand, nach den Pferden sehen zu wollen, zusammengefunden und warfen ihr bedeutungsvolle Blicke zu. Sie bildete sich ein, einen Hauch von Schwermut in Henos Miene wahrzunehmen. Allerdings war er immer schwer zu durchschauen. Ihrer Meinung nach wurde er immer besser im Umgang mit Gefühlen, ließ sie sich nur nicht anmerken.
»Wir gehen auch. Nach der Hochzeit. Sobald sie vorbei ist.« Sie nickte entschieden.
»Heißt das, ich darf singen?«, fragte Ralas. Er saß auf einem Heuballen und zupfte mit einem Eisenkamm Haare aus der Pferdebürste. Seine Bewegungen waren langsam und schmerzerfüllt, wurden jedoch mit großer Entschlossenheit und Anmut ausgeführt. Ein großer Ball aus Pferdehaar türmte sich neben ihm. »Mir sind hier einige sehr schöne Instrumente ins Auge gefallen. In den Fluren. Wo sie einstauben.«
»Du kannst sie haben. Und ja, wir brauchen Musiker. Wenn du gern spielen möchtest, dann tu das. Allerdings musst du ›In Schwarz- und Silberfeuer gehüllt er kam‹ nicht unbedingt vortragen.« Damit meinte sie das Lied, an dem er arbeitete, um Deffos wieselartigen Heldenmut beim Sieg über Wall zu preisen – ein Lied voller aufgeblähter Texte und melodramatischer Akkorde sowie wagemutiger Taten, die die Vorstellungskraft fast an ihre Grenzen brachten. Sie beäugte Ralas misstrauisch. Er war zuweilen derart selbstkritisch und sarkastisch, dass sie nicht wusste, ob er beim Wort genommen werden wollte, aber er wirkte fröhlich. »Und kein ›Trauerschloss‹«, fügte sie hinzu.
»Ach, ich glaube, ich werde spielen müssen, was immer die Braut verlangt«, entgegnete er feixend und dehnte die rechte Hand, wobei er seine langen, blassen und schwachen Finger kritisch in Augenschein nahm. Sie waren schmutzig, die Nägel schwarz vom Striegelfett. »Vielleicht könnte ich auch einige neue Kleidungsstücke bekommen? Ein Barde sollte nicht wie ein Landstreicher herumlaufen.« Er deutete auf seine grobe Reisekleidung, die zum größten Teil wochenlang nicht gewaschen worden war. »Tatsächlich würde ich behaupten, dass einige von uns ein Bad und etwas Körperpflege nötig hätten.« Er warf den Yoggs einen vielsagenden Blick zu.
Nedlam bleckte grinsend die riesigen Zähne und tätschelte Celestaines Pferd, dessen Fell leicht im Sonnenlicht glänzte, das durch die Tür hereinfiel. Sie klopfte dem Tier sanft auf den Hals und legte ihm die Hand auf den Widerrist, wobei es klein wirkte, dabei war es ein Schlachtross, noch dazu ein recht großes. »Wir sind hier fertig. Schimmerndes kleines Pferdchen. Sehr gute Arbeit.«
»Sie meint uns«, knurrte Heno kopfschüttelnd und sah Celestaine an, weil er herausfinden wollte, wie schlimm es für ihn werden würde. Um seine Augen herum zeichnete sich eine seltsame Anspannung ab, eine finstere Resignation, die nicht mehr lange auf sich warten lassen würde.
Sie hatte offen gesagt bisher noch keinen Gedanken daran verschwendet, dass sie mit ihm an ihrer Seite auf einer Clanversammlung erscheinen würde. Als die anderen sie nun ansahen, war offensichtlich, dass sie es sich gerade alle vorstellten, mit Ausnahme von Nedlam, die damit beschäftigt war, sich einen Finger abzulecken, um einen Schlammfleck von ihrem kniehohen Stiefel zu beseitigen. Celest musterte Heno, ihren Liebhaber und treuesten Gefährten. Blaugraue Haut, weißes Haar, Hauer, Schnurrbart, gute dreißig Zentimeter größer als jeder Mensch, dem sie je begegnet war. Und dazu Nedlam mit ihren knapp zwei Meter fünfzig unbändiger Muskelkraft, gekrönt von einem stachligen schwarzen Hahnenkamm. Kurz sah sie Nedlam in einem Kleid vor sich, wie sie Walls riesigen Hammer mit dem geriffelten Griff in der einen Hand hielt, den blutigen Handabdruck eines Menschenkindes auf einem Mieder, das mit den Eingeweiden ihrer Feinde geschnürt worden war und die ebenso traditionelle wie formelle Kleidung der Menschen und Yorughan ergänzte. Sie musste blinzeln, um dieses Bild wieder zu vertreiben.
Selbst ohne das wäre irgendeine Erklärung vonnöten. Aber welche sollte sie denn nur vorbringen?
Hallo, Leute! Ja, ich bin’s, Celestaine die Schöne aus Fernreame. Zwar behauptet das Lied, ich hätte den Blutschlächter getötet, aber genau genommen war es eine Gemeinschaftsaktion, und diejenigen, denen ihr danken solltet, sind diese beiden hier. Er hat sie in einer Grube unter der Erde gezüchtet, allein zu dem Zweck, seine Macht zu kanalisieren und die ganze Menschheit auszulöschen, nur dass sie sich in einer bemerkenswerten Wendung des Schicksals plötzlich dafür entschieden haben, ihm das Messer in den Rücken zu stoßen. Mir ist durchaus bewusst, dass sie aussehen, als wären sie einem eurer Albträume der letzten Jahre entsprungen, doch hätten sie mich nach meiner Gefangennahme nicht freigelassen und uns allen geholfen, das innere Heiligtum in Nydarrow zu erreichen, wäre all das nicht geschehen, und ihr alle würdet euch jetzt die Radieschen von unten angucken! Ist das nicht unglaublich? Und ja, der hier, der zu Todesblitzen fähig ist, ist mein Begleiter. Er ist mit mir hier. Wir beide sind zusammen. Bitte schließt euch uns an, um einen Toast auf die Braut und den Bräutigam auszusprechen …
»Vielleicht wäre es schlauer, wenn wir nicht hingehen«, meinte Heno. Sein Tonfall machte deutlich, dass er sich darauf eingestellt hatte, in diesem Szenario als Abschaum angesehen zu werden, und sich zwar darüber ärgerte, es jedoch akzeptierte – was sie umso mehr grämte, da sie jetzt erst realisierte, dass sie hingegen davon ausgegangen war, sie würden dort willkommen sein und alle zusammen feiern. Denn das wäre nur fair nach allem, was passiert war. Aber sie wusste, dass ihre Sicht auf die Geschichte und die Vorstellung, die dank der Minnesänger und Kuriere bereits die Runde machte, stark voneinander abwichen.
»Ich regle das«, versprach sie dennoch. »Ich bringe es in Ordnung. Aber sorgt vorsichtshalber schon mal dafür, dass alles bereit ist und wir jederzeit unverzüglich aufbrechen können.« Sie legte ihren Sattel neben Ralas auf den Heuballen.
»Was ist eine Hochzeit?«, fragte Nedlam auf einmal und blickte stirnrunzelnd auf Celestaine hinab, als wäre das, was vor zehn Minuten gesagt worden war, nun auch bei ihr angekommen.
* * *
Am nächsten Tag ritt sie nach viel zu wenig Schlaf mit Caradwyn aus und wusste nicht, wie sie das Thema zur Sprache bringen sollte. Sie nahmen ihren üblichen Weg und entfernten sich am Flussufer entlang vom Anwesen, um gelassen durch die grüne Senke zu traben. Die Pferde zertrampelten Fliegenkraut und Petersilie unter ihren Hufen, sodass ein stechender Kräutergeruch in der frischen Morgenluft hing. Diese Stunde und die vor dem Sonnenaufgang hatten schon immer am magischsten auf sie gewirkt, so voller dräuendem Verlangen und der Möglichkeit, dass hinter jeder Ecke etwas lauern konnte. Sie drosselten das Tempo, als sie zu der steinigen Furt gelangten, und Celestaine holte bereits Luft, doch bevor sie etwas sagen konnte, drehte sich Caradwyn zu ihr um, stand in den Steigbügeln und zügelte ihren lebhaften grauen Hengst, um ihn geschickt unterwürfig tänzeln zu lassen, wobei ihr die weißgoldenen Zöpfe über die Schultern flogen.
»Warum hast du mir nicht erzählt, dass du in diesen Yorughan verliebt bist? Wie lange wolltest du damit warten? Wolltest du es überhaupt ansprechen? Hältst du denn so wenig von mir, Celest?« Sie verdrehte die Augen. »Und nun machst du wieder dieses Gesicht, als könntest du es nicht fassen, dass ich davon weiß. Begreifst du denn nicht, dass das nicht schwer zu erraten ist? All dieses verstohlene Flüstern, diese Blicke und das Strammstehen, als wärst du eine aufgespießte Königsforelle! Und warum hättest du mir sonst die ganze Zeit aus dem Weg gehen sollen?«
Celest zügelte ihr Pferd, verlagerte das Gewicht und verharrte, wobei das Tier aufgrund der jahrelangen Vertrautheit und Kampferfahrung sofort reagierte. »Ich dachte, du würdest mich genauso anschauen wie all die anderen, die sehen, dass ich mit ihnen zusammen bin.« Mit ihnen, nicht mit ihm. Mehrzahl. Als wäre es ihre neue Familie.
Die Pferde bahnten sich einen Weg zwischen den Felsen und Steinen hindurch, die die flache Furt bedeckten. Sie ließen die Zügel locker.
»Ich kann keineswegs behaupten, dass ich nicht überrascht gewesen wäre, Cel, aber nicht so überrascht wie bei der Nachricht, dass du den Blutschlächter getötet hast.« Sie warf ihr einen Seitenblick zu.
»Das war ich nicht allein«, erwiderte Celestaine, der Caradwyns wissendes Lächeln nicht entgangen war. »Ich war am Ende dort, genau wie viele andere.«
»Mir gefällt meine Version besser.«
»Sie entspricht aber nicht der Wahrheit.«
»Ich finde nicht, dass es bei der Geschichte darum geht.«
»Doch, das ist sogar der ganze Sinn dahinter«, beharrte Celestaine ruhig, die genau wusste, dass dies nur das Vorgeplänkel zu dem war, was Caradwyn eigentlich sagen wollte.
»Und da Geschichte geschrieben wird und du eine der Hauptrollen darin spielst, denke ich, dass ich bei der Hochzeit einiges in deinem Sinne beeinflussen kann«, fuhr Caradwyn fort. »Ich kann den Frieden bewahren, bis sehr viel Alkohol geflossen ist. Danach bürge ich für nichts mehr, und ich kann nicht für Starich und seine Begleiter sprechen, habe allerdings gehört, dass zu ihnen viele Kriegsveteranen gehören sollen. Daher schlage ich vor, dass für deine Gruppe ein abgetrennter Bereich im Obstgarten eingerichtet wird. Du nimmst an den zeremoniellen Punkten teil und gesellst dich danach zu ihnen. Diesen Bereich kann man von den Hauptzelten oder den Gärten nicht einsehen und es gibt dort einen direkten Zugang zur Straße von Ilkand.«
»Ah, verstehe«, murmelte Celest und war dankbar, aber auch überraschend verletzt. Der Schmerz war jedoch eher gering und sie maß ihm nicht genug Bedeutung bei. »Danke! Das ist eine sehr pragmatische Herangehensweise.«
Sie hatten das Ende der Furt erreicht und gelangten auf den Weg, ein Pferd neben dem anderen, durch die Büsche derart dicht beieinander, dass sich die Steigbügel hin und wieder berührten.
»Ich wünschte, es wäre anders«, sagte Caradwyn. »Aber ich habe nicht viel Vertrauen in uns als Gruppe. Forinthi sind fortschrittlich und nachsichtig, aber dennoch keine Heiligen. Wären es nur du und ich, dann kann ich dir versichern, dass ich keinerlei Einwände gegen eine Doppelhochzeit hätte. Ich würde dich nie hintanstellen, nur weil du jemand Bestimmten liebst.« Sie drückte Celests Hand, die auf dem Sattelknauf ruhte. »Das Leben führt uns voneinander fort, doch es kann dich meinem Herzen niemals entreißen, Celest. Das beweist nur, dass du in vielerlei Hinsicht eine Heldin bist, und nicht nur, weil du einen verrückten Gott erschlagen hast. Und jetzt lass uns reiten wie der Wind! Lass uns Räuber sein! Nur noch ein letztes Mal!« Bevor Celestaine reagieren konnte, deren Herz unangenehm bis zum Hals schlug, hatte Caradwyn ihren Hengst bereits angespornt und galoppierte los, und Celest musste riesigen Matschklumpen ausweichen, die ihr fast ins Gesicht flogen, nachdem sie von den eisernen Hufeisen aufgewirbelt worden waren.
Sie donnerten an den Buchenhainen und den abfallenden Hängen der langen Schneise vorbei, die sich durch die Hügel des Anwesens zogen, den Wind im Gesicht, den aufgeschleuderten Schlamm und die peitschenden Zweige wie ein wirres Rauschen vor Augen, was Celestaine an so viele andere Galoppritte erinnerte; frühere hier im unschuldigen Morgengrauen und spätere über blutbefleckte Felder, auf denen die verworrenen Ranken des Blutkrauts aus den Leichen der gerade Gefallenen hervorsprangen, herbeigerufen von den tzarkomanischen Nekromanten, um jene zu vergiften, die vor dem Gemetzel des Blutschlächters flohen. Sie war heilfroh, dass Caradwyn niemals dort gewesen war, so dankbar dafür, dass ihr verträumter Verstand hier beschützt wurde, doch auf einmal sah sie zu ihrer Linken in der Dunkelheit des Waldes etwas Metallisches aufblitzen.
Automatisch griff sie nach ihrem Wächter-Schwert, doch ihre Hand fuhr ins Leere. Kurz sah sie abermals die zerbrochene, verlorene Klinge auf ihr Grab zeigen, ein schwarzer Schlitz im Stein, dann erinnerte sie sich an ihr gewöhnliches Langschwert, das sie vor dem Ausritt nicht angelegt hatte. Ihre Hand verharrte nicht, sondern wanderte zu ihrem im Stiefel verborgenen Dolch, ohne dass sie auch nur darüber nachdenken musste. Er ruhte in ihrer Hand, als sie sich aufrichtete und ihr Pferd antrieb, um den grauen Hengst einzuholen und sich zwischen Caradwyn und demjenigen, der sich zwischen den Bäumen verbarg, zu setzen.
Das Geräusch eines Pfeils, der an Blättern vorbeisauste, drang an ihr Ohr, und sie unterdrückte den Impuls, sich zu ducken, und stieß stattdessen laut ihren Kriegsschrei aus, der nicht einmal ein Wort war. Der Pfeil flog mit leisem Zischen an ihnen vorbei und verschwand lautlos in der Hecke auf der anderen Seite des Weges. Caradwyn drehte sich eben im Sattel nach Celest um, die mit den Zügeln auf den Rumpf des Hengstes einschlug.
»Los, los!«, schrie sie, lehnte sich zurück, setzte sich aufrecht hin und wandte sich ganz dem Angriff zu. Sie lenkte ihr Pferd bei der nächstbesten Gelegenheit in den Wald und konnte in der plötzlichen Dunkelheit zuerst kaum etwas sehen, hatte aber noch immer das Aufblitzen des Metalls vor Augen. Ein weiterer Pfeil verfehlte sie nur um Haaresbreite, und als sie die schwarze Befiederung erkannte, zog sich ihr Magen zusammen; dann entdeckte sie auch schon die drei Yorughan, die sich ihr entgegenstellten, einer mit gezücktem Bogen, ein Speerkämpfer, eine mit einer Keule. Das Gesindel der Blutschlächterarmeen war abtrünnig geworden und hatte sich zu kleinen Kriegstrupps zusammengefunden, die mit dem einzigen Ziel, ihr Überleben zu sichern, durch die Lande streiften. Sie waren Splittergruppen und völlig frei, aber ohne Wurzeln oder Befehlshaber liefen sie nach den vielen Jahren, in denen sie nur Schwert und Gemetzel gekannt hatten, weiterhin Amok. Celestaine vermutete, dass sie nur eine zufällig zusammengewürfelte Schar vor sich hatte, die ihr Glück auf dem reichen Ackerland des Fernreame-Anwesens versuchte. In diesen Randwäldern konnten sie über mehrere Jahreszeiten, wenn nicht gar Jahre leben und sich tagaus, tagein unbemerkt durch die kilometerweit unerforschte Wildnis bewegen.
Ihr Pferd brach abwechselnd nach links und rechts aus und bewegte sich in indirekter Linie, um möglichst viel Deckung zu finden. Celestaine verlagerte den Griff um den Dolch, sodass sich die Klinge oberhalb der Hand befand, und riss ihr Pferd abrupt herum, als der Bogenschütze wieder feuerte, sie jedoch verfehlte, weil sie sich tief auf den Hals des Pferdes geduckt hatte. Danach trieb sie es noch mehr an, um die Gruppe niederzureiten. Der Speerkämpfer blieb bis zum letzten Moment stehen, wappnete sich und schien bereit zu sein, das Pferd auf seiner Stangenwaffe aufzuspießen, deren Klinge überaus scharf aussah – dieses glitzernde Objekt hatte sie verraten –, doch das Tier war gut trainiert und drehte sich in allerletzter Sekunde zur Seite, sodass sich Celestaine, zum Ausritt nur in ihrer Lederrüstung, auf sie stürzte, mit dem Dolch in der Hand und in der Hoffnung, einen guten Stoß anbringen zu können. Ihr Aufprall auf Schulterhöhe schleuderte zwei Yorughan zu Boden. Es war töricht und wäre auf dem Schlachtfeld einem Selbstmord gleichgekommen, aber hier war das Pferd nur hinderlich, und ohne bessere Waffen musste sie eben alles aufwenden, was sie zu bieten hatte.
Sie spürte, wie sie gegen ihre Gegner prallte, merkte, wie der Dolch traf und sich ins Fleisch bohrte, musste sich mit ganzer Kraft daran festhalten, um ihn nicht zu verlieren, was im nächsten Moment dennoch geschah, und schon rollte sie sich über den Boden ab und versuchte, wieder auf die Beine zu kommen und sich ihnen zu stellen. Ein Yorughan lag am Boden, stieß gurgelnd den letzten Atemzug aus, und ihr Dolch ragte aus einer Stelle in der Nähe des Schlüsselbeins. Der Bogenschütze legte den nächsten Pfeil an – der Abstand war gering, nur ein Tölpel konnte sie da noch verfehlen, denn es gab nicht die geringste Deckung. Die dritte, eine ergraute Kriegsmatrone mit einem gewaltigen Knüppel, erholte sich ebenfalls und griff nach ihrer Waffe, die nicht weit von Celestaines Kopf entfernt lag. Ihre Hauer waren blutig und ihr Grinsen erinnerte Celestaine an Nedlams Blutgier. Der Bogenschütze neben ihr stellte das geringere Problem dar.
Celestaine pfiff und schloss die Finger um Erde und Blätter. Sie schleuderte den Dreck, so fest sie konnte, sprang auf, als die Kriegsmatrone instinktiv blinzelte, verächtlich schnaubte und den Knüppel mit einer Hand hob, als würde er rein gar nichts wiegen. Celest blieb in geduckter Haltung und rammte den Bogenschützen brüllend mit einer Schulter, damit er nicht richtig zielen konnte. Es hätte eigentlich nicht funktioniert, wäre da nicht plötzlich das Erkennen in seinem Gesicht aufgeflackert.
»Blutschlächterschlächterin«, sagte er und zuckte zurück, schwankte gar; nur einen Moment lang, doch der reichte aus, um zu ihm zu gelangen und ihn zu attackieren. Er war riesig und robust, doch sie war schwer und zögerte nicht. Sie schlang ihm die Arme um die Beine und zerrte sie zur Seite. Er geriet aus dem Gleichgewicht, konnte sich nicht mehr halten und stürzte, wobei er den Bogen durch die Luft schleuderte, damit er nicht zerbrach, und gleichzeitig nach seinem Messer und seinem Schwert griff, um genau wie sie in der Luft suchend herumzufummeln, wobei sich ihre Hände trafen, bis er auf dem Boden landete und ihren Arm unter sich begrub.
»Was?« Die Yoggs hatte ihren Knüppel bereits erhoben und blickte auf Celestaine hinab, während die den Abstand zwischen ihnen zu überbrücken suchte. Ihr Stiefel ging hart auf Celestaines Wade nieder. Es schmerzte schrecklich, doch der Knochen brach nicht, die zähe Stiefelsohle rutschte an ihrem Bein entlang und zerdrückte den Muskel. »Blutschlächter?« Die Matrone richtete sich auf und stand kurz verblüfft da, als wüsste sie nicht, was dieses Wort bedeute, oder aus irgendeinem anderen Grund, den Celest nie erfahren würde, denn in diesem Augenblick preschte ihr Pferd aus den Büschen und bäumte sich auf, wobei ein Hufeisen auf den Schädel der Frau knallte und ein Geräusch hervorrief, als würde gerade eine Schüssel aus gehärtetem Holz zerbrechen.
Dann rappelte sich der Bogenschütze auf und wich vor Celest zurück, denn ihr Ruf samt dem Anblick seiner toten Gefährten hatte ihm fatalerweise seine Entschlossenheit geraubt. Ein Pfeil mit pfirsichfarbenen und weißen Federn ragte auf einmal aus seiner Schulter, dicht gefolgt von einem zweiten, dessen Spitze aus seiner Brust hervorkam und direkt auf Celestaine zeigte. Er machte ein überraschtes Gesicht und wirkte, als wolle er ihr etwas sagen. Dann hob er einen Arm, und ihm fiel das Messer aus der Hand, das er noch immer auf sie gerichtet hatte, und schon stürzte er tot vornüber.
»Celest! Celest!« Caradwyn kam mit dem Bogen in der Hand auf sie zugeritten, ein seltsamer Farbfleck im tristen grünen Licht. »Geht es dir gut?« Sie glitt vom Pferd und umarmte Celestaine fest, bevor sie einen Schritt zurücktrat und die Leichen betrachtete, die um sie herum auf der durch den Kampf entstandenen kleinen Lichtung lagen.
Celestaine blinzelte und versuchte, ihre Gedanken und Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. »Warum hast du mir nicht erzählt, dass ihr hier Ärger mit Kriegstrupps habt?«
Caradwyn errötete, in ihren Augen spiegelten sich Angst und Aufregung wider, und sie sah einfach wunderschön aus. Auf einmal beneidete Celestaine sie, dann blickte sie auf die Yorughan hinab. Es fühlte sich schrecklich an, sie getötet zu haben, obwohl sie zuerst versucht hatten, sie umzubringen. Vielleicht hätte es noch etwas gegeben, das sie hätte sagen können und das jetzt unausgesprochen bleiben würde, allerdings war sie noch nie eine begnadete Diplomatin gewesen. Sie schlang ihrer Cousine einen Arm um die Schultern und drückte sie an sich.
»Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst.« Caradwyn kicherte leise bei diesen Worten, woran man merkte, dass Adrenalin durch ihre Adern schoss. »Ich dachte, es könnte dich aufregen, vor allem wegen deines Henos.«
Celestaine nickte langsam. »Nur weil Dinge gleich aussehen, bedeutet das noch lange nicht, dass sie es auch sind. Ich werde schon damit fertig, dass hier Banditen ihr Unwesen treiben, Cara.«
Caradwyn nickte. »Ich werde es mir merken.«
»Ich dachte, du hättest den Bogen nur zum Angeben mitgenommen.«
»So war es auch.«
Celestaine sah sich um, doch es schien nichts mehr zu sagen zu geben. »Lass uns von hier verschwinden.« Mein Heno.
»Ich werde ein paar Männer herschicken, damit sie sich um die Leichen kümmern und sie hier tief vergraben.«
»Du hast so etwas schon öfter gemacht«, erkannte Celestaine.
»Ja. Und ich werde es wieder tun. Bis sie damit aufhören.«
Sie ritten schweigend zurück.
Als sie sich den Höfen näherten, konnten sie schon das Getöse vieler Stimmen hören. Sobald sie durch das Seitentor ritten, stellten sie fest, dass zahlreiche Wagen und Reiter eingetroffen waren. Inmitten des Wirrwarrs unterhielt sich ein Berittener mit jemandem, der neben seinen Steigbügeln stand. Er war groß und dunkel, hatte langes Haar und walnussfarbene Haut. Ein geflochtener Bart zierte sein Kinn, und von ihm ging die lässige Präsenz und Macht aus, die Celest schon bei vielen erfahrenen Kriegern bemerkt hatte, die nicht in unmittelbarer Gefahr schwebten. Er blickte auf, als Caradwyn durch das Tor kam, und Celest entging nicht, wie ihre Cousine vor Stolz den Rücken durchdrückte. Das war er also, Starich, der Wolf.
»Nicht so groß wie deiner«, raunte Caradwyn Celest zu und beugte sich zu ihr hinüber, um im Schatten der Pferdemähne leicht den kleinen Finger zu krümmen und sie mit schalkhaftem Funkeln in den Augen anzusehen, »aber kräftig und dickköpfig, wie ich sie mag.«
Celestaine musste unwillkürlich lachen, womit sie gar nicht gerechnet hatte. Nun machte sie sich weder um Caradwyns Glück noch um ihre Position länger Sorgen. Die anderen Krieger, die auf den Hof geritten waren, blickten ihren Anführer ehrfürchtig an, was sie als herzerfrischend empfand. Dann begriff Starich, wer sie war, und verbeugte sich tief, bis sein Kopf auf Schulterhöhe seines Pferdes war.
»Blutschlächterschlächterin!«, brüllte er, und alle drehten sich um und schienen sich zu fragen, ob sie lachen oder sich ihr zu Füßen werfen sollten. Starich richtete sich grinsend wieder auf, doch er hatte sie nicht verspottet, nur ein wenig herausgefordert, die Familienbande auf die Probe gestellt für den Fall, dass er unter Feinden leben würde.
Celestaine straffte sich. Dann bewegte sich sein Pferd, und sie sah, mit wem er sich unterhalten hatte – einem distinguierten älteren Mann mit zerzauster dunkler Haarmähne, die an den Schläfen silbrig geworden war. Er trug eine recht neue Tunika nebst Hose in den Fernreame-Farben und hatte selbstsicher eine Hand auf die Zügel des Pferdes gelegt, als wäre er mit einem Enkel in ein gutmütiges Wortgefecht verwickelt, wobei Starich jedoch keiner seiner Enkel war.
»Mist!«, fluchte sie leise. Es war der trockene und ernste Held von »In Schwarz- und Silberfeuer gehüllt er kam« höchstpersönlich, der sich wieder einmal neu erfunden hatte: Deffo.
* * *
Die Hochzeit verlief reibungslos, die Zeremonie gesittet, die Worte wurden ausgesprochen, die Gelübde geleistet und die Bänder verknüpft. Wächter, die sich als alte Männer ausgaben, wurden mit Liedern und einem schönen Platz an einem guten Tisch verwöhnt. Celestaine leistete ihren Beitrag, unterhielt sich sehr zivilisiert mit diversen Verwandten, versuchte über etwas anderes als den Tod des Blutschlächters und die Frage, ob Deffo tatsächlich den Gnadenstoß ausgeführt hatte, zu sprechen, was ihr jedoch misslang.
»Ich erinnere mich beim besten Willen nicht daran, ihn dort gesehen zu haben, doch es herrschte ein großes Durcheinander«, wiederholte sie unzählige Male, wunderte sich über ihre Barmherzigkeit und schwor sich innerlich, ihn dafür büßen zu lassen, denn das ganze Interesse und die schwärmerischen Gespräche beruhten ganz eindeutig darauf, dass er dieses besondere Feuer ständig erneut schürte.
Zwar war sie sich der vielen geflüsterten Gerüchte bewusst, die hier kursierten, aber erst viel später am Nachmittag wurde es unangenehm. Sobald es ihr möglich war, entschuldigte sie sich und schaute nach den anderen. Ralas saß noch immer neben dem Tisch des Bräutigams, spielte und sang, doch er sah vor Erschöpfung schon ganz grau aus. Deffo lehnte sich inmitten einer Traube älterer Frauen genüsslich zurück und ließ sich mit Senftörtchen und Fleisch füttern. Sie mochte sich gar nicht ausmalen, was für Geschichten er zum Besten gab, und musste sich zurückhalten, um nicht hinüberzugehen und seinen Tisch umzuwerfen, ihm und seinen Bewunderinnen alles an den Kopf zu schleudern und dabei zu brüllen: »Er hat Wall in den Knöchel gebissen!« Sie nahm den Weg, der an den Aborten vorbeiführte, und huschte dann zwischen den Ställen entlang und durch den Hinterhof in den Obstgarten.
Dort stieß sie auf Heno und Nedlam, die sich ein Festmahl aus gebratenem Fleisch und mehreren Weinkrügen teilten. Nedlam lag auf dem Rücken, hatte einen fettverschmierten Mund und kaute verdächtig lange auf etwas herum, das Celestaine schließlich anhand des Geruchs als eine Ora erkannte, eine Wurzel, die für Menschen ziemlich giftig war, von den Yorughan jedoch als Rauschmittel geschätzt wurde. Walls Hammer lag in ihrer Armbeuge, und um das Heft hatte sie die Brigantenruhmblüten gewickelt, als wollte sie einen Brautstab nachahmen.
»Halt dich am Saum …« Das Lied drang aus den Ställen zu ihnen herüber, und sie fragte sich schon, ob ihr jemand gefolgt war, aber dort wimmelte es von leicht beschwipsten Dienstboten, die ihren Pflichten nachgingen. Alle waren in die Feierlichkeiten eingebunden worden. Sie konnte gerade so eben die ersten Klänge von »Die Klinge vom Trauerschloss« vernehmen, das die Musiker der Krieger, die Starich begleiteten, in ihren Pavillons auf dem Lämmerfeld anstimmten. Celestaine schüttelte ihre Sorgen ab, als Heno aufstand, um sie zu begrüßen, und ihr den Weinkrug reichte, aus dem sie einige Schlucke trank.
»Sind deine beschwerlichen Pflichten hier erledigt?« Er war nicht so betrunken, wie er wirkte, und bereits für die Reise gekleidet, nur sein Mantel lag noch im Gras.
»Ja.« Sie umarmte ihn und blickte auf die träge grinsende Nedlam hinab, deren Augen von der Droge ganz dunkel geworden waren. »Kann sie sich überhaupt noch bewegen?«
»Verheiratet«, sagte Nedlam und tätschelte den Hammer liebevoll. »Wein, Fleisch, Feier! Siehst du, wir sind zivil… zivil… gut.«
»Wir müssen nur noch auf Ralas warten, dann können wir aufbrechen«, erklärte Celestaine erleichtert.
Doch Ralas kam noch eine ganze Weile nicht, und bis dahin war ihr der Wein zu Kopf gestiegen und hatte sie schläfrig gemacht. Sehr schläfrig. Nachdem sie eine Zeit lang herumgesessen hatte, kuschelte sie sich an Henos Brust und fuhr mit einem Zeigefinger über seine Hauer, bevor sie einige Strähnen seines silbrigen Barts darumwand und daran zupfte, während er leise schnarchte und sich die Kirschblüten nach und nach wie Schneeflocken auf sie legten. Erst da ging ihr auf, dass Ralas möglicherweise zu spät kam und sie weitaus müder war, als sie nach einigen Schlucken heimatlichen Weins eigentlich sein durfte.
Sie versuchte, sich aufzusetzen, was ihr jedoch sehr schwer fiel. Vor ihren Augen verschwamm alles. Ihre Gliedmaßen waren träge, und es kam ihr vor, als würde sie sich unter Wasser bewegen. Ihr Gleichgewichtssinn setzte aus. Sie rammte Heno unbeholfen einen Finger in die Brust. »Hey! Hey! Wach auf! Wir wurden vergiftet!«
»Meine Frau«, murmelte Nedlam und schaffte es beim zweiten Versuch, nach dem Hammer zu greifen.
»Heno!« Celestaine rammte ihm im Sitzen den Daumen gegen die Brust. Es schneite nun schneller, und da war ein Mann, zwei, nein, drei oder sechs oder drei, sie standen mit Äxten bewaffnet vor ihnen. Einer war der Priester, den Starichs Gefolge mitgebracht hatte, damit die Ehe vom Gnadenvollen, ihrer auserwählten Gottheit, gesegnet wurde. Er war jung und stürmisch, und er zitterte, glaubte sie, als er mit einem Finger auf sie zeigte.
»Da sind sie, genau wie ich gesagt habe! Seht ihr, dass die Ora-Wurzel bereits ihre Wirkung getan hat? Schlagt jetzt zu! Sie sind der Grund dafür, dass sich die Götter von uns abgewandt haben! Diese dreckigen Tiere aus den schwarzen Gruben unter Nydarrow sind überall in diesem Forinthi-Höllenloch! Sie haben sogar die Besten von uns verdorben …«
Celestaine hatte irgendwie das Gefühl, dass er damit sie meinte, als sie Henos Schnurrbart fest packte und beinahe abriss. Er wachte mit lautem Protestschrei auf und wankte kurz, während ein vierter – oder achter – Menschenmann auftauchte und laut sagte: »Zurück mit euch! Was hat das zu bedeuten? Wer wagt es, unsere Feier zu besudeln?«
Celestaine erkannte Starichs Stimme und sah ein Flattern von Pfirsichfarben und Weiß neben ihm sowie zwei Caradwyns, beide bleich und schockiert, deren Leichenblässe auf einmal schauerlich aussah, als ein weißblauer Blitz über ihren Kopf hinwegzuckte und in den nächsten Baum eindrang, einen Ast abtrennte und einen Schneesturm aus Blütenblättern auf sie herabregnen ließ.
»Nein!« Celestaine drückte Henos Hand herunter, als ein weiterer Ball aus sanftem weißem Licht in seiner gekrümmten Handfläche erschien. Die Magie versengte ihr die Finger. Sie blinzelte und versuchte, wieder einen klaren Blick zu bekommen, während der Priester weiterschimpfte.
»Diese Yoggs haben die Schlächterin verdorben. Ihretwegen haben sich die Götter von uns abgewandt. Sie müssen geopfert werden, um den Gnadenvollen zu besänftigen, hier, wo ist er, dieser Wächter, der Unbesiegte. Er soll unsere Tugend bezeugen! Er soll über unsere rechtschaffene Vergeltung Bericht erstatten und sie um ihre Rückkehr ersuchen!« Nach etwas Geraschel und Verwirrung fuhr er nicht mehr ganz so unheilvoll fort. »Aber wo ist er hin? Er hat es mir erzählt. Er sagte klar und deutlich, dass der Wanderer Kunde von den Göttern habe und wisse, wo sie sich aufhalten. Hier können wir ihre Aufmerksamkeit erregen und sie zu uns zurückholen. Es gibt so viel zu tun. So viel zu heilen und wiedergutzumachen. Das schaffen wir nicht allein. Sie müssen zurückkehren. Sie müssen einfach.«
»Haltet den Mund!«, fuhr Starich ihn an. »Habt Ihr Ora in das Essen getan und es ihnen gegeben?«
»Ich hielt es für sicherer«, antwortete der Priester. »Nun könnt Ihr sie problemlos für ihre Verbrechen richten. Sie sind benommen und die fehlgeleitete Schlächterin kann sie nicht beschützen.«
Caradwyn räusperte sich und kam Starich zuvor, der erneut das Wort ergreifen wollte. »Da es mein Hochzeitstag ist, verlange ich die sichere Passage für Celestaine und ihre Freunde über unser Land. Bis die Sonne untergeht.«
Niemand erwähnte, dass es gar keine Verbrechen gab, die es zu sühnen galt, oder wer was verbrochen hatte, wie Celestaine nicht entging, die plötzlich einen stechenden Schmerz hinter der Stirn verspürte, als es ihr endlich gelang, die Beine unter sich zu ziehen und aufzustehen, wo sie dann schwankend verharrte. Es folgte nur ohrenbetäubendes Schweigen und etwas Geraschel, während alle darauf warteten, ob Starich seine erste Entscheidung zugunsten seines Priesters oder seiner Frau treffen würde.
Ausgerechnet diesen Moment nutzte Nedlam, um sich aufzurappeln. Man konnte den Kriegern ansehen, dass sie am liebsten vor ihr zurückgewichen wären. Sie überragte sie alle, stemmte den Hammerkopf auf den Boden und stieß einmal sanft dagegen, sodass der Widerhall durch jede Stiefelsohle zu spüren war. Dann sah sie den Priester an. »Der Blutschlächter hat sie mitgenommen und sehr weit weggebracht.« Sie drehte sich zu Celestaine um, der es schwerfiel, auf den Beinen zu bleiben, und an deren Seite Heno stand, jetzt, wo er bei Bewusstsein war, durchaus ruhig, nur um seine Finger, die ihren Arm umfassten, zuckte noch etwas unterdrücktes Feuer.
Der Priester konnte nicht länger an sich halten. »Abscheulichkeiten! Verlogene, niederträchtige, dreckige Abscheulichkeiten! Seht sie euch an! Sie stehen direkt vor eurer Nase. Sie sind im Wald, in den Tälern, schleichen sich wie eine nie enden wollende Woge aus Tod und Blut an einen heran.« Er zeigte mit einem Finger auf Nedlam. »Und erst diese eine, sie, die Verhöhnung guter Frauen an diesem Tag, sie …«
Nedlam hob den Hammer hoch und schwang ihn leichthin, als wollte sie eine Wespe zerquetschen. Der Hammer traf ihn mit einem erstaunlich leisen Knirschen genau in der Mitte und dann segelte er durch die Luft zur Seite, bis er erst mit dem Rücken und dann mit dem Kopf gegen einen Baum prallte. Der Priester glitt ins Gras und sackte in sich zusammen.
»Für dich immer noch Herrin Wall, Junge«, sagte sie und hielt den Hammer fest in beiden kolossalen Händen. Danach beäugte sie Starich mit einem – für jemanden, der derart viel Ora intus hatte – erstaunlich scharfen Blick.
Celestaine bekam langsam wieder einen klareren Kopf, wurde jedoch nur durch Henos Hand am Ellbogen aufrecht gehalten. »Dann gehen wir jetzt besser.«
»Bis Sonnenuntergang«, stieß Starich mühsam mit tiefer Stimme hervor und gab seinen Axtkämpfern ein kurzes, knappes Handzeichen, die sich nur zu gern zurückzogen. Er warf Caradwyn einen unsicheren Blick zu, wobei sich widersprüchliche Gefühle auf seinem Gesicht abzeichneten. »Verabschiedet euch rasch, sonst schafft ihr es nicht mehr bis zur Grenze.« Mit einem Blick auf den Priester fügte er hinzu: »Er war der Sohn einer meiner Tanten zweiten Grades und nicht besonders beliebt, doch auch so wird dieser Vorfall nur … schwer zu erklären sein. Wie ich hörte, besitzt Ihr einen klugen Verstand. Dies wäre ein passender Moment, um ihn zu benutzen.«
Er beäugte Celestaine kopfschüttelnd, als hätte er sie aufgegeben. »Wir werden Euren guten Namen in den Sagen bewahren, ungeachtet dessen, was Ihr woanders treibt. Ihr seid hier stets willkommen, allerdings halte ich es für weise, einige Zeit ins Land streichen zu lassen, damit die Erinnerungen bei Eurer Rückkehr ein wenig freundlicher ausfallen.« Ohne auf eine Reaktion zu warten, drehte sich der neue Herr von Fernreame um und sagte leise etwas zu seinen Männern.
»Sprich mit Ralas«, nuschelte Celestaine Caradwyn zu, die erhitzt und erleichtert wirkte, Celest jedoch auf eine Art und Weise ansah, die ein Lebwohl beinhaltete, das sie nicht erst aussprechen musste. »Danke, Cara!«
»Gern geschehen«, erwiderte Caradwyn und berührte Heno kurz am Arm. »Passt auf meine Cousine auf. Sie ist sehr reizbar und vertraut niemandem.«
Heno schnaubte. »Ich habe mit ihr alle Hände voll zu tun.«
Nedlam kicherte. »Nehmen wir den Rest des Wurzelweins mit?«
»Lasst ihn besser hier. Vielleicht brauche ich ihn noch, um herauszufinden, was unserem Priester widerfahren ist. Ich, äh … muss möglicherweise gleich zwei Pfützen mit einem Mob aufwischen. Gewissermaßen.« Bei diesen Worten warf sie Celestaine einen vielsagenden Blick zu.
»Das heißt ›Nein‹«, knurrte Heno, damit Nedlam auch begriff, was die Worte zu bedeuten hatten. Celestaine beugte sich nach vorn und erbrach sich, wobei rotes, nach Wein stinkendes Erbrochenes auf den handbestickten Saum von Caradwyns Kleid spritzte. Sie blieb so stehen, sammelte sich und stellte fest, dass ihr jemand ein zartes Taschentuch reichte. Nachdem sie sich Mund und Nase abgetupft und sich geräuspert hatte, fühlte sie sich gut genug, um sich aufzurichten, wenngleich sich ihre Gedanken überschlugen. O ja. Die toten Yoggs im Wald. Wie passend! Aber das war Deffos Schuld. Er kann einfach nicht den Mund halten und bettelt um Ruhm, sehnt sich nach seinem großen Augenblick. Dann bekommt ein schwacher junger Mann mit berechtigten Sorgen Wind davon und singt dieses alberne Lied, hat vielleicht sogar vom gestrigen Zwischenfall gehört. Das würde zu gegebener Zeit noch eine Abrechnung mit Deffo nach sich ziehen.
»Lebt wohl, Celestaine, Heno. Herrin Wall.« Caradwyn ging vor Nedlam in einen tiefen Knicks und überreichte ihr aus einer Laune heraus das Brautsträußchen, das noch an einem Band um ihr Handgelenk baumelte.
Nedlam nahm es zwischen Daumen und Zeigefinger und begutachtete es aus mehreren Winkeln, bevor sie daran schnüffelte und es Celestaine in die Hand drückte. »Nimm du es. Du bist hier die Einzige, die noch nicht verheiratet ist.«
Als sich Celestaine wieder umdrehte, war Caradwyn nicht mehr da. »Lasst uns von hier verschwinden.«
Danach, sobald sie auf der Straße waren und der Abstand zum Anwesen immer größer wurde, suchte Celestaine nach dem Sträußchen, konnte es jedoch nicht finden und fragte sich seither, ob sie sich das nur eingebildet hatte. Das Taschentuch in ihrer Tasche blieb jedoch auf ewig befleckt, als hätte sich zumindest dieser Teil tatsächlich ereignet.
3
Hey, hey!« Bukham schaute sich nach etwas Leichtem um, das er werfen konnte, fand jedoch nur einen Apfel, den er dafür als zu hart erachtete. Somit musste er sich damit zufriedengeben, dem schlammbeschmierten kleinen Mädchen mit einer Faust zu drohen, das sich vom Rand seines Stands einige Bohnen stibitzt hatte. Ihm entging dabei nicht, dass sein Ruf über die letzten Wochen einiges eingebüßt hatte. Er stand auf und starrte sie über die farbenfrohen Stapel seiner Erzeugnisse hinweg an.
Sie huschte schnell weiter und versteckte sich auf der anderen Seite des Lattenzauns, der den Marktplatz umgab, und blieb seelenruhig zwischen den Stieren stehen, die in der Hitze von Fliegen umringt waren und ihre gewaltigen hornbewehrten Köpfe hin und her schwenkten. Jeder Kopf war fast so groß wie sie. Sie sah Bukham direkt in die Augen und machte sich daran, die Bohnenschoten mit den Daumen aufzuknacken und die Bohnen zu verspeisen, eine, zwei, drei, immer drei zugleich. Die langen grünen und lilafarbenen Schoten wanderten in die träge wiederkäuenden Mäuler des Viehs, eine, zwei, drei.
Bukham beobachtete sie so lange wie möglich und versuchte sich an einer finsteren Miene, bis es ihm zu albern wurde und der Drang zu lachen unerträglich geworden war. Dann musste er sich abwenden und einige Kürbisse auf der anderen Seite des Stands sortieren. In letzter Zeit war er ein guter Sortierer geworden, ging ihm auf, und die Art, wie er das Gemüse aufbaute, wurde immer ausgefeilter und eindrucksvoller, je mehr diebische Tage vergingen. Schon seltsam, welche Göttin herbeikam und einen etwas lehrte und welcher Instrumente sie sich dabei bediente, dachte er und blickte auf, als sein Onkel näher kam.
Ghurbat war ein großer, kräftiger Oerni, dessen Muskeln und Zeichnungen ihn als jemanden auswiesen, der eine Stufe über den Gewöhnlichen stand. Er sah an Bukham vorbei zum Viehgatter und hielt mit grimmiger Miene Ausschau nach der Bohnendiebin. »Es ist Zeit, sie zurückzuschicken. So kann das nicht weitergehen. Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn ständig Diebe in der Nähe sind.«
Bukham schaute sich um und kam sich so träge und dumm vor wie einer der Stiere – und auch ebenso unbeholfen, während er Zeit zu schinden versuchte. Im Pferch waren keine kleinen Mädchen. »Ich verjage sie doch. Aber sie ist ganz klein und klaut nicht viel.« Er drehte sich wieder um und schaute Ghurbat in die ausdruckslosen Augen, da er genau wusste, dass er nur sein Schicksal als letzter Neffe, der das Buch erben konnte, besiegelte. Traurig spähte er zu Ghurbats Taille, wo die in Leder gebundenen Zettelchen all ihrer familiären Handelsaufzeichnungen als dickes, wachsendes, vielversprechendes Bündel baumelten. Aber sie war doch ganz klein. Und hatte dieselbe Farbe wie Schlamm und Dung, weil sie mit Schlamm und Dung bedeckt war. Und sie war allein.
Es fiel ihm schwer, sich vorzustellen, wie das sein mochte. Bukham war der Letzte aus einer großen, traditionsreichen Familie, von der mehr als die Hälfte hier im Handelsposten lebte. Irgendjemand war immer in Rufweite. Bei irgendjemandem gab es zu Hause immer etwas zu essen, das Wasser schafften die Frauen herbei, abends wurde eine gute Mahlzeit serviert – eine zu gute sogar, denn Oerni konnten Verschwendung noch viel weniger leiden als Diebe, und es gab nicht genug Reisende vor Ort, die den ganzen Überschuss bekommen konnten, weshalb alle Familienmitglieder stämmig waren.
»Wir könnten …«, setzte er an und wollte schon vorschlagen, dass sie sie bei sich aufnahmen, doch Ghurbat roch den Braten sofort und hob eine Hand, um Bukham das Wort abzuschneiden.
»Deine Freundlichkeit spricht für dich, aber nein. Sie hat irgendwo jemanden. Sie muss in die Kommunen zurück. Dort wird man sich um sie kümmern. Blut und Handel, sie gehört zu ihnen.«
Bukham merkte durchaus, dass das





























