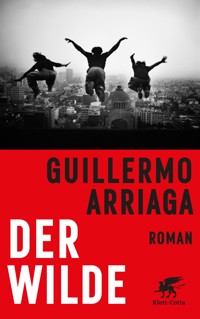21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Einer der kraftvollsten, intensivsten und originellsten Gegenwartsautoren, die in spanischer Sprache schreiben.« El Exprés Eine ekstatische Liebe und der Wille, alles aufs Spiel zu setzen, vereinen sich in diesem temporeichen Roman über die mexikanische Unterwelt zu einem Spiel auf Leben und Tod. Arriaga lässt die Milieus einer bürgerlichen Tänzerin und eines Kriminellen aufeinanderprallen. Marina Longines, Tänzerin und Choreografin mit eigener Kompagnie, lebt als verheiratete Frau und Mutter ein geregeltes Leben. Doch immer stärker regt sich der Wunsch, in ihrem tänzerischen Ausdruck aufs Ganze zu gehen und Grenzen zu überschreiten. Als sich die Möglichkeit bietet, in einem berüchtigten Gefängnis vor Straftätern aufzutreten, sagt sie zu. Und trifft im Gefängnis auf José Cuauhtémoc, einen gebildeten Indio und verurteilten Mörder. José Cuauhtémoc vereinigt in sich all das, was Mexiko zu dem gemacht hat, was es heute ist: die Gewalt, die Ungerechtigkeit und ungleiche Verteilung, die Unterdrückung der Ursprungskultur durch skrupellose Eroberer. Zwischen dem charismatischen Kriminellen, der allein den Gesetzen der Straße gehorcht, und der Tänzerin Marina Longines entbrennt eine Leidenschaft, die alle Grenzen niederreißt. "Das Feuer retten" ist ein existentieller Roman über die Frage, was ein Leben lebenswert macht. Und ein großer Roman über die Ungerechtigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1247
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Guillermo Arriaga
Das Feuer retten
Roman
Aus dem Spanischenvon Matthias Strobel
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Salvar el fuego«
im Verlag Alfaguara, Mexiko-Stadt.
© 2020 by Guillermo Arriaga
Für die deutsche Ausgabe
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von Ferdy Remijn, »Night meeting«
Zitatnachweise:
S. 5: Federico Garcia Lorca: »Bluthochzeit«. In: Die Stücke. Übersetzt von Rudolf Wittkopf. Frankfurt am Main, 2007.
S. 726: Henry David Thoreau: Vom Glück, durch die Natur zu gehen. Übersetzt von Meike Breitkreutz. München, 2010.
S. 737: Ernest Hemingway: In einem anderen Land. Übersetzt von Werner Schmitz. Reinbek, 2018.
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98440-8
E-Book ISBN 978-3-608-11835-3
Letztlich gilt in bürokratisierten und verbürgerlichten Gesellschaften derjenige als erwachsen, der sich damit abfindet, weniger zu leben, um nicht so viel sterben zu müssen. Das Geheimnis der Jugend jedoch ist: Man lebt nur dann, wenn man den Tod riskiert; und Leben hat nur dann Wucht, wenn man Schwierigkeiten überwinden muss.
EDGAR MORIN
Wenn das Feuer mein Haus niederbrennt, was würde ich retten? Ich würde das Feuer retten.
JEAN COCTEAU
Ich war eine Frau, die in Flammen stand, voll schwärender Wunden innen und außen, und dein Sohn war ein wenig Wasser, von dem ich Kinder, Land und Heilung erhoffte; der andere aber war ein dunkler Strom unter Zweigen, der mich das Rauschen seiner Binsen hören ließ, seinen leisen, heimlichen Gesang. Ich ging mit deinem Sohn, der wie ein kühles Bächlein war, aber der andere sandte mir Hunderte von Vögeln, sie ließen mich innehalten und bedeckten mit Rauhreif die Wunden einer armen verblühten Frau, des vom Feuer liebkosten Mädchens.
FEDERICO GARCÍA LORCA
Ich kann nicht nur halb lieben, ich kann nicht von Lügen leben.
CLARICE LISPECTOR
Für meine Eltern Carlos Arriaga Alarid und Amelia Jordán Susilla, die Urheber des Feuers.
Manifest
Dieses Land ist gespalten: in die, die Angst haben, und die, die wütend sind.
Ihr Bourgeois seid die, die Angst haben.
Angst davor, dass ihr euren Schmuck verliert, eure teuren Uhren, eure Handys.
Angst davor, dass man eure Töchter vergewaltigt.
Angst davor, dass man eure Söhne entführt.
Angst davor, dass man euch tötet.
Ihr lebt als Gefangene eurer Angst.
Eingesperrt in eure gepanzerten Autos, eure Restaurants, eure Bars, eure dämlichen Shoppingcenter.
Verschanzt.
Verängstigt.
Wir dagegen leben voller Wut.
Immer voller Wut.
Nichts besitzen wir.
Unsere Töchter sind schon von Geburt an vergewaltigt.
Unsere Söhne von Geburt an entführt.
Wir werden geboren ohne Leben, ohne Zukunft, ohne alles.
Aber wir sind frei, weil wir keine Angst haben.
Es macht uns nichts aus, im Dreck aufzuwachsen oder umerzogen zu werden in euren Gefängnissen oder als anonyme Tote zu enden in euren Leichenschauhäusern.
Wir sind frei.
Wir können uns von Müll ernähren und die faulige Luft der Abwässer atmen und Urin trinken und in schwarzen Kloaken tauchen und an Durchfall, Diphtherie, Ruhr, Typhus und Syphilis erkranken und auf Exkrementen schlafen und uns nicht waschen und nach Schweiß und Erde und Tod stinken, es macht uns nichts aus, wir lassen uns nicht unterkriegen.
Aber ihr mit eurem schlaffen Fleisch und euren weichen Gehirnen, ihr braucht eure Angst, um zu überleben.
Eure Polizei und eure Armeen können uns noch so sehr massakrieren, wir halten stand. Wir sind unbesiegbar. Wir vermehren uns wie die Ratten. Wenn ihr einen von uns killt, wachsen Tausende nach. Wir überleben im Schutt. Wir entschlüpfen durch Löcher.
Ihr verzehrt euch vor Schmerz, wenn ihr einen der euren verliert. Ihr macht euch in die Hosen vor Angst, wenn ihr das Wort Tod auch nur hört. Wir nicht. Wir sind frei. Frei von Angst. Voller Wut. Frei.
José Cuauhtémoc Huiztlic
Häftling Nr. 29846-8
Haftstrafe: fünfzig Jahre wegen mehrfachen Mordes
Die Frau rennt mit langen Schritten die Avenida entlang. Die Männer, die sie verfolgen, fallen zurück. Die Frau hat einen Revolver in der Hand. Eine Familie kommt ihr entgegen. Ohne ihr Tempo zu drosseln, versucht sie, die Waffe zu verstecken. Sie drückt sie eng an ihre Hüfte. Eine ältere Dame bemerkt sie nicht und macht einen Schritt nach rechts. Die Frau versucht, ihr auszuweichen, rennt sie aber um. Die ältere Dame fällt auf den Rücken. Die Frau murmelt »Entschuldigung« und rennt weiter. Ein junger Kerl aus der Gruppe schimpft. »Blöde Kuh«, schreit er ihr nach. Die Frau blickt zurück. Ihre Verfolger sind winzige Punkte. Sie können sie nicht einholen. Ihre Beine sind nicht so gut trainiert wie die der Frau. Sie behält ihr Tempo bei. Sie darf nicht stehen bleiben. Auf keinen Fall. »Wenn wir entdeckt werden, musst du in die Gassen flüchten«, hat er ihr eingeschärft. Dort würde sie sicher sein. Im engen Straßenlabyrinth. Die Frau rennt weiter. Sie hat die Schrittlänge einer groß gewachsenen, muskulösen Athletin. Da vorne sind die Gassen. Da muss sie hinein, dann ist sie gerettet. Sie keucht. Sie schwitzt. Ihre Verfolger sind hinter ihr her, um sie zu töten. Eben sind Kugeln an ihr vorbeigezischt. Zwei sind neben ihr in einem Auto eingeschlagen. Einige weitere über sie hinweggesirrt. Sie haben auf ihren Kopf gezielt. Sie wollten, dass sie tot zusammenbricht. So, wie der Mann zusammengebrochen ist, den sie getötet hat. Es ging blitzschnell. Der Typ stand plötzlich vor ihr, hob die Waffe. Sie hat schneller abgedrückt als er. Hat nicht mal gezielt. Einfach nur den Revolver gehoben und geschossen. Die Kugel hat den Typen am Hals getroffen. Blut ist auf die weiße Mauer gespritzt. Sie hat gesehen, wie er tot umfiel. Sie hatte keine Zeit, um zu erschrecken oder zu bereuen. Sie rennt weiter. Modelito, das Viertel, in dem er aufgewachsen ist, ist gleich erreicht. Wenn sie erst mal dort ist, wird sie ihre Verfolger abschütteln. Sie rennt schneller. Der Eingang der Gasse kommt in Sichtweite. Sie strebt darauf zu. Da ertönt ein Knall. Sie stürzt und überschlägt sich, bleibt auf dem Rücken liegen, vor einem Baum. Eine Kugel hat ihr Brustbein zertrümmert, steckt in ihrer Lunge fest. Sie betrachtet die Wunde. Ein Kreis aus Blut breitet sich auf ihrem Hemd aus. Sie versucht aufzustehen. Es geht nicht. Sie ergreift einen Ast und zieht daran, doch sie sackt zusammen. Ihre Lunge brennt. Sie hustet Blut. Ein Mann kommt auf sie zu, eine Pistole in der Hand. Er hält Ausschau nach ihrer Waffe. Sieht sie einige Schritte entfernt auf dem Boden liegen. Der Typ zielt auf ihre Augen. »Endstation, Bitch.«
Wenn ich den Moment bestimmen müsste, an dem mein Leben sich von Grund auf veränderte, dann würde ich sagen, es war der Tag, an dem Héctor uns in sein Haus in Tepoztlán einlud. »Marina, kommt doch am Samstag vorbei, die Arteagas, Mimí, Klaus, Laura und ihr Freund kommen auch, außerdem Aljure, Ruvalcaba, Ceci, Julio, plus die üblichen Schmarotzer.« Ich nahm die Einladung an, obwohl ich wusste, dass Claudio überhaupt keine Lust haben würde. Er konnte meine »Hippiefreunde« nicht ausstehen, nannte sie nur »aufgeblasene Möchtegernkünstler«. Sie langweilten ihn, er hatte nichts mit ihnen gemein. Für Claudio war ein Film dann gut, wenn er sich amüsierte, er mochte billige Mainstreamkomödien, »Hauptsache, ich kann nach der Arbeit abschalten«. Die Filme von Héctor, in denen kaum etwas passierte, fand er unerträglich. »Langweiliger geht’s nicht«, befand mein Mann, ungeachtet der Lobeshymen aus Cannes und Venedig. An jenem Samstag fuhren wir also nach Tepoztlán, und da, genau da, fing alles an. Hätte ich die Einladung ausgeschlagen, hätte Claudio darauf bestanden, wie jeden Samstag bei seinen Eltern zu essen, dann wäre mein Leben heute noch so wie immer, glücklich, geordnet und vorhersehbar, dann wäre das Uhrwerk des Desasters nicht in Gang gesetzt worden.
Der sonnige Tag im Verbund mit Héctors Versprechen, dass er sich das Vorrundenspiel der Champions League im Fernsehen anschauen konnte, hatten Claudio schließlich überzeugt. Außerdem wollten die Kinder unbedingt hin. Sie liebten es, mit den Tieren zu spielen, die Héctor und sein Lebensgefährte Pedro auf dem Grundstück hielten: elf Klammeraffen, zwei Waschbären, drei verspielte und aufdringliche Labradore, vier Katzen und sechs zahme Pferde, auf denen sie reiten konnten. »Bitte, bitte, lass uns hinfahren«, riefen meine drei Kinder begeistert. Sie hatten bei Héctor und Pedro immer jede Menge Spaß. Und hätte Claudio nicht so viele Vorurteile, hätte auch er viel Spaß gehabt, jede Wette. Seine »Abneigung« gegen meine Freunde war garantiert nur eine Pose, denn viele von ihnen kannte er von klein auf.
Wir trafen früh ein. Héctor und Pedro waren gerade erst aufgestanden und unrasiert. »Entschuldigt, wurde ziemlich spät gestern. Kommt rein, Luchita wird sich um euch kümmern, während wir kurz unter die Dusche springen. Sie kann euch Chilaquiles machen, und auf dem Tisch steht frisch gepresster Orangensaft. Macht es euch gemütlich, in dem Zimmer da könnt ihr euch umziehen.« Héctor und Pedro zogen sich zurück, um sich fertigzumachen, und Claudio konnte sich eine seiner typischen Bemerkungen nicht verkneifen. »Diesen Ferkeln riecht der Arsch noch nach Vaseline«, sagte er und lachte laut. Es war sein Lieblingssatz, wenn er von Homosexuellen sprach: »Dem riecht der Arsch noch nach Vaseline.« Diesen Satz hatten sich er und seine Klassenkameraden für die affektierten Priester ausgedacht, die an ihrer Schule unterrichteten. Unverbesserliche Päderasten, die mehrere ihrer Schüler missbraucht hatten. Daher rührten auch Claudios homophobe Anflüge. Er war kein Schwulenhasser. Man musste sich nur vor Augen halten, dass seine Ansichten zu »Schwuchteln« geprägt waren von seinen Erfahrungen an der katholischen Schule. Einer der Grundschullehrer nahm seine sieben- und achtjährigen Schüler immer mit in sein Kabuff. »Das Gift der Sünde ist in mir«, sagte er mit honigsüßer Stimme zu ihnen, »und es bringt mich langsam um. Der Heilige Vater, der von meiner Drangsal weiß, hat mir die Erlaubnis erteilt, mir einen unschuldigen Mund zu suchen, der mir das Gift aussaugt und ihm mit seiner Reinheit die Wirkung nimmt.«
Héctor sah sich selbst als enfant terrible des mexikanischen Kinos und tat alles, um diesen Ruf zu festigen. Gegenüber der Presse gebärdete er sich anstößig, exhibitionistisch und hochmütig. Wenn er über seine Kollegen urteilte, dann mit selbstherrlicher Attitüde; die meisten kanzelte er als plump und nichtssagend ab. Seine eigenen Filme zeigten monströse und perverse Wesen, deren sexuelle Gier unersättlich war. Zwerge, die fettleibige Frauen vergewaltigten, Selbstbefriedigung in Großaufnahme, cellulitegeplagte Hintern und riesige Schwänze. Héctors Filme gossen Eiter und Urin über die Zuschauer, wie Claudio so schön sagte. Kritiker und Festivals vergötterten ihn. Le Monde hatte ihn als »Genie, das wuchtige Bilder zu erschaffen vermag« bezeichnet, Der Spiegel über sein Werk geurteilt: »Als ob Dante und Hieronymus Bosch beschlossen hätten, Filmregisseure zu werden.« Héctor genoss die Buhrufe der Zuschauer, die angeekelt den Saal verließen und ihn beschimpften. Er erfüllte perfekt das Klischee, dass ein Künstler »die Bourgeoisie aufschrecken und ihr geben sollte, was sie verdient«. Dabei war er selbst der personifizierte Bourgeois. Er hatte ein Vermögen geerbt, das auf der Ausbeutung Hunderter Bergarbeiter beruhte, und trotzdem nie den Schmerz und das Elend hinterfragt, das seine Firmen verursachten. Als seine Eltern starben, stieß er die Firmen nicht ab, sondern übernahm ihre Leitung als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Seine Filme waren finanziert von anonymen Menschen, deren Gesichter schwarz waren von Kohle und deren Lungen hart vom jahrelangen Einatmen schändlichen Minenstaubs. »Black lungs matter«, hatte ihm auf einer Pressekonferenz ein Journalist an den Kopf geworfen, um ihn zu provozieren. Héctor ließ ihn rausschmeißen und trat noch nach, indem er ihn diskreditierte: »Noch so ein Idiot, der von meinen Feinden bezahlt wird. Geschickt hat ihn garantiert …« und dann nannte er kurzerhand den Namen irgendeines Kritikers oder Kollegen, der seine Filme verrissen hatte.
Im Gegensatz zu seinem arroganten Auftreten und seinem Ruf als Großkotz war Héctor privat ein netter Kerl. Ein treuer Freund, immer hilfsbereit. Ohne Claudios Wissen hatte Héctor seinen Finanzdirektor angewiesen, Geld seines Unternehmens in den Fonds zu investieren, den Claudio managte. Er tat es für mich, aus Zuneigung, wegen all der Jahre, die wir uns nun schon kannten, aus reiner Großzügigkeit. Jedenfalls verbesserte sich unsere finanzielle Lage von einem Monat auf den anderen. Achtzig Millionen Dollar sind kein Pappenstiel. Claudio, der ein geschicktes Händchen für Geld hatte, sorgte dafür, dass dieses Kapital bald schon konstante Gewinne abwarf. Héctor nahm mir das Versprechen ab, Claudio nie zu verraten, wer diese beträchtliche Summe in seinen Fonds eingezahlt hatte. Und Claudio, der Trampel, schmähte Héctor, ohne zu ahnen, dass er seine gesteigerte Kaufkraft der »Kinoschwuchtel« zu verdanken hatte.
Pedro stammte ebenfalls aus einer »guten Familie«, die über Grundbesitz verfügte. Sein Vermögen war nicht so üppig wie das von Héctor, aber doch üppiger als das von neunundneunzig Prozent aller Sterblichen. Die »Ranch«, wie sie das Haus in Tepoztlán gern nannten, hatte seinen Großeltern gehört. Das Grundstück umfasste zwanzig Hektar, und darauf bauten sie, wie könnte es anders sein, ein Haus, das ein Pritzker-Preisträger entworfen und dessen Inneneinrichtung das berühmte New Yorker Designbüro Ten Rainbows übernommen hatte. Jeder Winkel wurde mit allergrößter Sorgfalt gepflegt. Zwölf Angestellte hielten die Finca in makellosem Zustand. »Bei denen kriegt sogar das Grundstück Maniküre«, scherzte Klaus.
Héctor und Pedro waren leidenschaftliche Mäzene. Sie finanzierten Messen, Galerien, Bildhauerakademien, Orchester und Bibliotheken. Meine Tanzkompanie erhielt ebenfalls Unterstützung von ihnen. Ich achtete zwar immer auf gesunde Finanzen, aber ihre Spenden verschafften mir Luft, befreiten mich von Budgetzwängen, denen andere Kompanien unterworfen waren. Ich konnte für unsere Aufführungen bessere Theater anmieten, Coaches von Weltruf bezahlen und die Verträge der talentiertesten Tänzer verlängern.
Pedro war derjenige, der sich um die Stiftung kümmerte. Trotz aller Großzügigkeit schloss ihr Mäzenatentum nicht aus, dass sie Gewinne machten. Manchmal schenkten Galeristen ihnen Bilder eines vielversprechenden Malers, dessen Wert in nur zwei Jahren um das Zwanzig- oder Dreißigfache anstieg. Wenn eines der Orchester, für das sie die Schirmherrschaft übernommen hatten, im Ausland tourte, strichen sie fünf Prozent der Gage ein. Und natürlich waren ihre Spenden steuerlich absetzbar.
In all den Jahren war ich nur einmal fremdgegangen, und zwar ausgerechnet mit Pedro. Er wiederum gestand mir, dass auch er Héctor nie betrogen hatte. Wir waren also beide Neulinge in Sachen Affäre. Es begann alles mit kleinen Scherzen. »Die einzige Frau, mit der ich schlafen würde, wärst du«, sagte er mir einmal als Kompliment vor zahlreichen Leuten. Sein Witz rief lautes Gelächter hervor. Sogar Claudio lachte mit. »Meine Frau ist so sexy, dass selbst Hunde scharf auf sie sind.« Das war der Auftakt für weitere Koketterien. Pedro ließ keine Gelegenheit aus, um mir den Hof zu machen, wobei es nie über die unschuldige Schmeichelei eines schwulen Freundes hinausging.
Dass wir einmal im Bett landen würden, hätte ich nie gedacht. Mit dazu bei trugen eine gehörige Dosis Tequila und die Tatsache, dass wir beide Badesachen trugen. Wir verbrachten den Nachmittag zusammen mit den Kindern am Swimmingpool der Ranch. Claudio hatte uns am Freitagvormittag hingebracht. Er hatte mit uns gegessen und war dann zu einer Geschäftssitzung zurück in die Stadt gefahren. Héctor, der keinen Alkohol vertrug, lag ausgeknockt auf einer Liege. Zwei Angestellte waren mit meinen Kindern ausgeritten. Pedro und ich waren im Wasser. An den Beckenrand gelehnt, begannen wir, unsere Füße aneinanderzureiben. Es begann als ein unschuldiges Spiel, doch nach und nach schlangen wir unsere Beine umeinander. Wir sahen uns an und grinsten. »Du stehst doch gar nicht auf Frauen«, sagte ich ziemlich erregt. »Auf dich offensichtlich schon«, erwiderte er scherzhaft und blickte auf seine Badehose. Der Stoff war nach vorne ausgebeult. »Aber du bist ja auch keine Frau, du bist eine Göttin.« Dann küsste er mich. Ich versuchte, mich ihm zu entziehen, aber er hielt meinen Kopf mit beiden Händen fest. Diesmal küssten wir uns länger, dann löste ich mich von ihm. Mit dem Kinn deutete ich auf Héctor, der tief schlief. »Ist dir das egal?«, fragte ich. »Natürlich ist mir das nicht egal, schließlich ist er die Liebe meines Lebens. Aber ich will’s eben mal ausprobieren.« Wir schwiegen. Eine Elster landete am Beckenrand, pickte eine Olive vom Teller und flog wieder weg. Wir folgten ihr mit dem Blick, bis sie sich auf einer Palme niedergelassen hatte. »Ich wollte schon immer wissen, wie es sich mit einer Frau anfühlt, und wer wäre dafür besser geeignet als du?«, fuhr er fort. »Aber wenn du nicht willst, höre ich auf.« Ich schüttelte den Kopf. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal mit ihm schlafen würde. Außerdem gab es keinen Grund zum Fremdgehen. Wir waren beide glücklich in unseren Beziehungen. Doch wie gesagt: Der Tequila und das Aneinanderreiben der nackten Haut unter Wasser hatten uns angetörnt.
Wir gingen in ein Gästezimmer und küssten uns. Ich dachte, er wäre, weil schwul, ein sanfter Küsser. Von wegen, seine Küsse waren intensiv und stark. Manchmal biss er so heftig in meine Lippen, dass es mir fast wehtat. Mir wurde bewusst, dass Pedro bisher nur Männer geküsst hatte. Er packte meinen Hintern, und seine primitive, grobe Zärtlichkeit erregte mich.
Wir ließen uns auf das Bett sinken. Er zog mir das Oberteil aus und betastete ausgiebig meine Brüste. »Schön prall«, sagte er. »Kein Wunder, dass Heteros darauf stehen.« Dann löste er die Schnur des Höschens, und ich war nackt. Kurz sah er mich verwundert an, als wäre mein nackter Körper ein seltsamer Gegenstand in seinen Händen. Ohne sich noch weiter aufzuhalten, schob er sich über mich und drang kraftvoll in mich ein. Ich bohrte ihm die Fingernägel in den Rücken. Er begann, sich auf mir zu bewegen, wurde immer dringlicher. »Komm nicht in mir drin«, warnte ich ihn. Ohne die Augen zu öffnen, schüttelte er den Kopf. Ich stand selbst kurz vor einem Orgasmus, als er ihn herausziehen wollte. »Ich komme gleich«, sagte er. Ich umarmte ihn. »Bloß nicht rausziehen jetzt.« Dann kam er, und gleich danach kam ich. Seit Jahren hatte ich beim Sex keinen Orgasmus mehr gehabt.
Ich schlief noch viermal mit ihm, aber an das erste Mal kam es nicht wieder heran. Er hatte Probleme, wirklich erregt zu werden, und mich nervten seine drängenden Küsse und dass er immer sofort in mich eindrang, ohne dass ich richtig feucht war. Beim dritten Mal fragte er, ob er mich von hinten nehmen dürfe. »Das kann ich am besten«, erläuterte er. Ich sagte nein. Ich hatte es noch nie anal gemacht und fand, dass ich diese letzte Jungfräulichkeit Claudio schuldete.
Beim fünften Mal war er besonders feinfühlig und zärtlich. Er küsste mich nicht so grob und wollte auch nicht sofort in mich eindringen. Er nahm sich Zeit, streichelte lange meine Brüste und bat mich schließlich, die Beine zu spreizen. Dann beugte er sich vor und tat etwas, was er bis dahin noch nie getan hatte: Er leckte mir mehrere Minuten lang die Klitoris. Erst dann schob er sich über mich und drang langsam in mich ein. Nach ein, zwei Stößen hielt er inne, streichelte mir übers Gesicht. »Ich wollte, dass es mir gefällt, aber es gefällt mir nicht. Entschuldige«, sagte er. »Mir auch nicht«, gestand ich. Wir setzten uns auf den Bettrand. Er nahm meine Hand und spielte mit meinen Fingern. Ich sah mich um. Cremefarbene Wände. Weiche Teppiche. Klassische Sessel. Balkon mit Blick auf den Garten. Luxus, wo immer man hinsah. Mit meinen früheren Lovern – selbst mit Claudio – war ich immer in Stundenhotels gegangen. Ich mochte es, an Orten Sex zu haben, die speziell dafür gedacht waren. Bei meiner anerzogenen Obsession für keimfreie Reinlichkeit erregte mich der Gedanke, dass es innerhalb dieser vier Wände unzählige Paare heimlich miteinander getrieben hatten, mit Wut und Furor, mit Liebe, Zärtlichkeit und Angst. Als ich Pedro vorschlug, in ein Motel zu gehen, weil das diskreter sei, war er empört. »Ich gehe doch nicht in irgendein Rattenloch, in dem die Bauarbeiter ficken.« Für ihn und Héctor musste alles immer geschmackvoll sein, deshalb waren wir auch dort, wo wir waren, in einer Senior Suite des Four Seasons, ohne uns noch etwas zu sagen zu haben.
An jenem Nachmittag verließen wir das Hotel traurig und enttäuscht. Glücklicherweise verschlechterte sich meine Beziehung zu Pedro nach dieser Liaison nicht, sondern festigte sich sogar noch. Nie gab es irgendeinen Vorwurf, nie wieder erwähnten wir, was vorgefallen war. Stattdessen stellte sich zwischen uns eine Komplizenschaft ein, eine große Nähe. Er war wieder der feste Partner von Héctor, und ich die liebevolle Ehefrau von Claudio. Pedro war schließlich auch derjenige, der mich direkt in die orkanartigen Liebe bugsierte, die mein Leben bis in seine Grundfesten erschüttern und bis zur Unkenntlichkeit durcheinanderwirbeln würde.
Ceferino, woran dachtest du an jenen Nachmittagen in deinem Rollstuhl, wenn mein Bruder dich draußen auf der Terrasse abstellte, egal, ob es regnete, dunkel war oder eiskalt? War es schmerzhaft, dich so hilflos zu fühlen, so erniedrigt; unfähig, dich zu bewegen, dich zu äußern, dich zu wehren? Oder hast du einfach gegrübelt über deine Vergangenheit in bitterer Armut, über die Unterdrückung deines Volkes?
»Du weißt gar nicht, was ich dafür geben würde, den Lauf der Geschichte ändern zu können, meinem Volk das viele Leid zu ersparen«, sagtest du immer. Da es nun mal nicht möglich war, das in der Vergangenheit Geschehene zu ändern, versteiftest du dich darauf, die Geschichte aus einem gerechteren, egalitäreren Blickwinkel zu erzählen. Sie umzuschreiben, sagtest du uns, wurde zu deiner Lebensaufgabe. Deshalb last du mit solchem Feuereifer Geschichtsbücher, um deine obsessive Leidenschaft für die Vergangenheit zu stillen, um niemals zu vergessen. Die Schule war für dich ein heiliger Ort. »Der Schlüssel liegt in der Bildung«, belehrtest du uns. Dein Vater hatte dir und deinen Geschwistern eingebläut, dass Lernen der einzige Ausweg war. Er, der nie lesen und schreiben gelernt hatte. Er, der kaum ein Dutzend Wörter Spanisch konnte. Um euch zu motivieren, führte er als Beispiel Benito Juárez an, »ein Indio wie wir, der es zum Präsidenten gebracht hat«. Dabei glaubte dein Vater nicht daran, dass ihr es bis zum Präsidenten bringen könntet, dass ihr es überhaupt weit bringen könntet, er wollte einfach nur, dass ihr von dort wegkämt. Weg von den Bergen, weg vom Elend und vom Hunger, weg von dem aus Lehm und Ästen gebauten Haus, dem rauchenden Feuer, den in dasselbe Öl getunkten Tacos, in dem ihr zuvor schon Wild gebraten hattet, weg von den Schuhen, die bereits andere Kinder getragen hatten, die sie an andere Kinder weitergaben, und die an wieder andere, bis sie schließlich bei euch gelandet waren. Schuhe, die drückten und Blasen machten, die euer Vater euch jedoch aufzwang, weil ein Indio ohne Schuhe es nie zu Ansehen bringen würde. Ingenieure, Anwälte, Schullehrer trugen keine Huarache-Sandalen.
Wenn du schweigend in deinem Rollstuhl saßt, erinnertest du dich da an jene faden Nachmittage allein in den Bergen, als du Ziegen hütetest und aufpassen musstest, dass die Kojoten sie nicht rissen? Mein Großvater erzählte uns, dass du einmal nach einer guten Ernte Mais gegen sechs abgemagerte Ziegen tauschen konntest, allerdings ohne Bock, um sie zu schwängern, damit zwei oder drei Junge dabei heraussprangen. Sechs Ziegen, deren Knochen zwischen den krätzigen Hautfalten hervortraten und die ihr essen musstet, als die Dürre so viele Monate andauerte, dass ihr auf den harten, unfruchtbaren Schollen eurer winzigen Parzelle nichts aussäen konntet. Sechs Ziegen, die du auf Geheiß deines Vaters enthaupten musstest. »Ceferino weinte die ganze Zeit, während sie in seinen Händen verendeten«, erzählte uns mein Großvater. Diese Ziegen waren deine Schwestern der Berge, mit denen du die Nachmittage verbracht hattest. Ich kann mir vorstellen, wie schmerzhaft es für dich gewesen sein muss, sie eine nach der anderen töten zu müssen und sie dann auch noch vor dir auf dem Teller zu sehen.
Kein Grund war wichtig genug, um nicht zur Schule zu müssen. Es war egal, ob wir uns elend fühlten, Fieber hatten oder einen Knochen gebrochen. Um uns anzutreiben, erzähltest du von dem Morgen, an dem sich auf dem Weg zur vier Kilometer entfernten Schule an einem deiner Schuhe die Sohle gelöst hatte und du mit blutendem Fuß ankamst. »Es waren meine einzigen Schuhe. Für ein neues Paar war kein Geld da. Also ging ich von da an jeden Tag mit nur einem Schuh zum Unterricht, Hunderte Stacheln bohrten sich mir in den Fuß, und Steine schnitten mir die Zehen auf. Sechs Jahre war ich da alt, und ich habe mich nicht ein einziges Mal beklagt. Es vergingen Monate, bevor ich neue Schuhe bekam.« Nach den Odysseen, die du erlebt hattest, denn diese war nur eine von vielen, war es für uns unmöglich, uns vor der Schule zu drücken. Es gab keinen Grund, der gut genug gewesen wäre, und ein einziges Murren brachte uns eine strenge Bestrafung ein, wenn nicht eine Tracht Prügel.
Vermutlich beschworst du, während du im Rollstuhl saßt, ohne auch nur ein Wort sagen zu können, die klirrend kalten Nächte herauf, in denen du deinen Hund umarmtest, damit ihr euch gegenseitig wärmen und dem Peitschen des Windes trotzen konntet, der von Norden wehte. Großvater hat uns verraten, wie sehr dich diese Windböen ängstigten. Du wolltest nicht so sterben, wie der Erzählung deiner Mutter nach deren Mutter in einer eisigen Nacht gestorben war. Deine Großmutter hatte unbedingt nach einem Zicklein suchen wollen, das nicht mit den anderen nach Hause gekommen war, und als sie den Rückweg antrat, brach die Nacht herein. Sie rollte sich im Laub zusammen, um sich gegen den Sturm zu wappnen, der losbrach, kaum dass es dunkel geworden war. Deine Mutter war acht, als ihre Mutter verschwand. Am folgenden Tag ging sie mit ihrem Vater und ihren Geschwistern in die Berge, um nach ihr zu suchen. Sie fanden sie vier Tage später, die Augen von Ameisen zerfressen, aufgebläht und stinkend, den Mund weit aufgerissen vor Anstrengung, noch einen letzten Atemzug zu tun. So beschrieb deine Mutter ihre Leiche, und daher deine Angst vor Winden. Träumtest du als Kind von roten Ameisen, die dir in der Nase herumkrabbelten? Hattest du Angst, dass du eines Tages die brutale Kälte nicht mehr aushalten und so wie sie enden würdest, steif und blau gefroren, mit leeren Augenhöhlen, auf dem Boden liegend, die geschwollene, violette Zunge aus dem Mund hängend? Und dann, Papa, hat es mit dir ein schlimmeres Ende genommen als mit der Mutter deiner Mutter, wurde dein Gehirn überschwemmt von der roten Flut einer unstillbaren Blutung, die deine Neuronen ertränkte und aus dir einen kraftlosen stummen Buckligen machte, der an den Rollstuhl gefesselt war.
Ich erinnere mich noch an den Nachmittag, als du über eine plötzlich einsetzende Migräne klagtest und zu Mama sagtest: »Mir geht’s nicht gut, ich sehe alles rot.« Dann fielst du vornüber auf den Teppich und konntest weder sprechen noch dich bewegen. »Das ist der Tod«, dachtest du bestimmt, während meine Mutter dich anschrie: »Steh auf, steh bitte auf.« Und du sahst nur noch rot, immer noch mehr rot. Eine rote Wirklichkeit, während Mama einen Krankenwagen rief.
Dann kamen deine beiden anderen Kinder dazu, und das Arschloch von José Cuauhtémoc grinste. Wärst du da am liebsten aufgestanden und hättest ihm dieses dämliche Grinsen aus dem Gesicht geprügelt wie so viele Male zuvor? Da der Krankenwagen auf sich warten ließ, trugen wir dich die Treppe hinunter, und wir stellten uns so ungeschickt an, dass du uns aus den Händen glittst und auf die Stufen knalltest, und weil wir dich nicht noch mehr bewegen wollten, legten wir dich in der Küche auf den Boden, wo du offenbar die Kälte der Fliesen spürtest, denn du sagtest dein letztes Wort: »Kalt.« Dein Sohn José Cuauhtémoc grinste erneut, und du dachtest vermutlich: »Verflucht seien die Nachkommen meines Blutes.« Nach zwei Stunden kam endlich der Krankenwagen, und man brachte dich ins Staatliche Krankenhaus in der Calzada Ermita Ixtapalapa, und die Ärzte überprüften deine Pupillen, und einer von ihnen drehte sich zu uns um: »Er hat einen Schlaganfall erlitten und muss dringend operiert werden, um die Blutung zu stoppen.«
Was dachtest du, als Monate später José Cuauhtémoc dich mit Benzin übergoss und dir ins Ohr flüsterte: »Es gibt sie, die Hölle.« Als er ein Streichholz anzündete und es dir in den Schoß warf, um dich in Brand zu stecken? Was dachtest du da, Papa? Sag’s mir, bitte, was dachtest du da?
Im Laufe des Tages trafen die anderen Gäste auf der Ranch ein. Meine Kinder und die Kinder meiner Freunde planschten im Pool, ritten aus, fingen Frösche und angelten Charales in dem Bach, das quer durch das Anwesen floss. Es gab regelmäßig Gezeter, wenn man ihre Aktivitäten unterbrach, um Sonnencreme aufzutragen. Mein Vater war an Hautkrebs gestorben, daher rief ich sie alle halbe Stunde zu mir, um sie neu einzuschmieren.
Héctor und Ruvalcaba zettelten eine Diskussion über »Verano« an, einen mittelmäßigen Bildhauer. Für alle lag auf der Hand, dass seine Arbeiten nichts Besonderes waren, doch Héctor – aus reiner Lust an der Kontroverse – verteidigte ihn, als sei er eine Kunstikone. »Sein Werk ist wie ein Reptil, das die kleinen Insekten des Kapitalismus frisst«, schwadronierte er an diesem herrlichen Tag, während am Pool die Kinder tobten. Héctors Argument, der Künstler »untergrabe die substanzlose Existenz der Bourgeoisie«, stand in krassem Widerspruch zu dem weitläufigen Garten und dem schockierenden Luxus um uns herum. Mich amüsierten sein künstliches Gehabe. Im Grund war Héctor nichts weiter als ein verwöhnter Kerl, der die religiöse Moral seiner erzkonservativen Familie abzuschütteln versuchte. Der Schwule, der jahrelang in einer kleinen, dunklen Truhe gefesselt war, gebärdete sich, kaum dass er seinen Kopf herausstrecken konnte, wie ein Kampfhahn. Ein Kampfhahn, dessen Sporen stumpf waren, der nicht imstande war, seine Komfortzone aufzugeben, seine millionenschweren Einkünfte, seine durch Ausbeutung Tausender Bergleute beschmutzten Unternehmen.
Der Disput zwischen Héctor und Ruvalcaba nahm lächerliche Ausmaße an. Wer konnte ernsthaft über einen Typen diskutieren wollen, der sich selbst Verano nannte, Sommer? Gelangweilt von Héctors Kindereien ging ich Claudio suchen, der sich in irgendeinem Zimmer das Champions-League-Spiel von Real Madrid gegen Bayern München ansah. Claudios Leben kreiste förmlich um die Spiele von Real Madrid. Er war imstande, eine Vorstandssitzung zu unterbrechen oder sich von einer Hochzeit davonzustehlen, nur um sich zwei Stunden lang vor den Fernseher zu setzen und diese Mannschaft spielen zu sehen. Seine Stimmung hing davon ab, ob Madrid gewann oder verlor. Seine Leidenschaft für einen Madrider Club war mir unerklärlich, wo in seinen Adern doch nur noch Reste spanischen Blutes flossen. Er selbst führte es auf den mexikanischen Ausnahmespieler Hugo Sánchez zurück, wie so viele andere Mexikaner auch.
Pedro gesellte sich zu uns. Trotz seines erlesenen Geschmacks war auch er ein Fußballfan. »Guilty pleasure«, pflegte er zu sagen, wohl wissend, dass Héctor ihn deswegen gern piesackte. »Ein von beknackten Arbeitern mit homosexuellen Neigungen erfundenes Spielchen«, hatte der einmal in einer seiner typischen provokanten Anwandlungen geätzt. Héctors Ansicht nach hatte das Tragen kurzer Hosen keine sportlichen Gründe, sondern diente dazu, »die nach einem Tag in der Fabrik verschwitzen Kerle« aufzugeilen. Er sehe sich nur deshalb hin und wieder ein Spiel an, um sich am Anblick der Beine zu ergötzen.
Das Spiel lief in demselben Zimmer, in dem Pedro und ich einige Monate zuvor miteinander geschlafen hatten. Ich hatte das Gefühl, dass er es Claudio überlassen hatte, um ihm heimlich einen mitzugeben. »Hier habe ich deine Frau gebumst, du alter Schwulenhasser«, wobei ich bei Pedro nicht das leiseste Anzeichen dafür entdecken konnte, das diesen Verdacht erhärtet hätte. Kurz erinnerte ich mich an den Moment, in dem er die Schleife meines Bikinihöschens gelöst hatte, an die brüske Penetration, den intensiven Orgasmus. In trauter Eintracht vor dem Fernseher saßen also die beiden einzigen Männer zusammen, mit denen ich in den vergangenen zwölf Jahren geschlafen hatte. Von der Anziehung, die Pedro auf mich ausgeübt hatte, war allerdings nichts mehr übrig.
Als die Partie beendet war, kehrten wir zur Palmenpergola zurück. Glücklicherweise war das Thema Verano abgeschlossen, und Héctor rechtfertigte stattdessen gerade, dass er für einen Film einmal das Haus eines seiner Arbeiter abgefackelt hatte. In seinem Bestreben, eine »überzeugende« Szene zu schaffen, war es ihm egal gewesen, dass sich die Mezquitemöbel, die der Bergmann von seinen Großeltern geerbt hatte, die Wiege seines ersten Kindes, die Fotoalben in Asche verwandelten. »Kein Art Director hätte ein so authentisches Set bauen können«, prahlte Héctor. Der Bergmann kam nach einem zehnstündigen Arbeitstag heim und stieß auf ein Team, das die rauchenden Überreste dessen filmte, was einmal sein Zuhause gewesen war. Gerade ging Jaime deswegen Héctor hart an. »Du hast das Leben dieses Menschen zerstört«, warf er ihm vor. Héctor lächelte spöttisch. »Das Haus des Typen ist irrelevant, der Film hingegen wird über Jahre wirken.« Jaime zitierte Orson Welles, der erklärt hatte: »Das Leben ist wichtiger als das Kino.« Für mich war das ein Dilemma: Kunst oder Leben? Die berühmte Frage: »Wenn in einer Bibliothek mit unveröffentlichten Texten von Shakespeare ein Feuer ausbricht; was würdest du retten, die Texte oder den Bibliothekar?«, ging mir häufig durch den Kopf. Ich neigte dazu, den Bibliothekar zu retten. Héctor machte mir deswegen Vorhaltungen: »Du bist zu weich, deshalb haben deine Choreografien auch keine Kraft.« Ich wurde stinksauer. Was fiel ihm ein, mich dermaßen abzukanzeln? Was ich schaffen wollte, war Tanz, der das Menschliche so gut einfing wie irgend möglich. Ein Werk, das die Widersprüchlichkeit des Lebens zum Ausdruck brachte: Liebe-Hass, Grausamkeit-Schönheit, Geburt-Tod. Fachleute hoben die Strenge und Stimmigkeit meiner Choreografien hervor. Doch keiner pries das, was für mich das Wichtigste war: die emotionale Tiefe. Was das anging, hatte Héctor recht, sosehr es mich auch schmerzte. Meinen Arbeiten fehlte es an Kraft. Ich hatte gedacht, die Mutterschaft würde dazu führen, dass ich tiefgründiger über das Leben würde reflektieren könnten und dies sich in meiner Arbeit widerspiegeln würde. Ich hatte sogar geglaubt, meine flüchtige Affäre mit Pedro würde mir einen frischen Impuls geben. Dem war nicht so. Meine Choreografien waren technisch einwandfrei, aber es fehlte ihnen an Vitalität. Der eine oder andere Kritiker sah in diesem Mangel an Emotion eine Tugend. Zu viel Gefühl, so Flaubert, mache aus Kunst etwas Billiges, Kitschiges. Kunst müsse kalt sein, beherrscht, der Betrachter, nicht der Urheber müsse einem Werk Gefühl verleihen. Alles andere sei Manipulation. Ich wehrte mich gegen diese Argumentation. Ich hatte mehrmals die Arbeit von Biyou gesehen, der berühmten senegalesischen Choreografin. Bei ihr schien jede Bewegung, jede Drehung, Feuer zu schüren. Die Bühne wirkte wie elektrisiert. Aus diesen Körpern hätte jederzeit ein Blitz zucken können. Kein Wunder also, dass Biyou mit ihrer Kompanie auf den gefragtesten Bühnen Europas auftrat, während wir uns mit Einladungen von Universitäten in den USA und Lateinamerika begnügen mussten. Was unterschied uns? Kein Kritiker verriss meine Choreografien oder befand, dass es ihnen an Qualität mangele. Aber – und dieses Eingeständnis schmerzt mich – sie hatten einfach nicht das, was sich nicht in Worte fassen lässt, das, was eine Bewegung auf der Bühne in reines, sich Bahn brechendes Leben verwandelt. Um dahin zu kommen, musste ich Grenzen überschreiten, musste ich meine Tänzer nicht an den Rand ihrer physischen Möglichkeiten treiben, sondern an den Rand ihrer emotionalen Abgründe. Sie pushen, zwingen. Héctor wusste, dass man in der Kunst keine Kompromisse machen durfte. Dass man rücksichtslos sein musste, um Großes zu erreichen. Dass die Kunst kein Ringen um Sympathie war, sondern ein Ringen um Ergebnisse. Dass man nicht zurückweichen durfte, keinen Rückzieher machen, nicht nachgeben. Oder hatte Orson Welles doch recht? Musste das Leben nicht immer über der Kunst stehen, der Bibliothekar über dem unveröffentlichten Shakespeare?
Schließlich musste Jaime sich geschlagen geben. Seine humanistischen Kriterien waren in der Luft zerrissen worden von Héctors wuchtiger Argumentation. In der Kunst und vor allem im Kino, führte Héctor an, dürfe es nicht das leiseste Mitleid geben. Nichts dürfe einen Regisseur von seiner Vision abbringen, selbst wenn das bedeute, dass er Schauspieler quäle, Produzenten erpresse, das Filmteam bedrohe, schreie, beleidige, verführe, hätschele. »Am Ende des Weges«, schloss Héctor, »bleibt einzig und allein das, was man auf der Leinwand sieht, alles andere landet in der Anekdotenkiste.«
Mich freute, dass Héctor Jaime abserviert hatte. Genau dafür bewunderte ich ihn. Niemand kam an gegen seine Wucht, seinen künstlerischen Furor. Mit einem Witz versuchte Pedro, der Situation die Spannung zu nehmen. Niemand lachte. Héctor hatte Jaime nicht nur in die Schranken gewiesen, er hatte ihn erniedrigt. Er hatte ihn als Schwachkopf und Feigling tituliert. Jetzt blieb nur noch eine Schlägerei oder der Rückzug. Jaime und seine Frau wählten Letzteres. Pedro wollte sie aufhalten, »bleibt doch, das Fleisch ist gleich so weit«. Es half nichts. Rita, Jaimes Frau, war außer sich vor Wut. »Warum zum Teufel lädst du dir Leute ein, wenn du dich am Ende immer nur über sie lustig machst?« Sie gingen zu ihrem Auto. Héctor folgte ihn, um sich zu entschuldigen. Sie wechselten einige Worte, dann kehrten alle drei zurück.
Ciudad Acuña. Was zum Teufel hatte er in dieser von Schweiß und Staub überzogenen Stadt verloren? Dort, hatte Máquinas zu ihm gesagt, solle er nach seiner Entlassung hinkommen. »Da tobt das Leben, José Cuauhtémoc«, hatte er gesagt, »da findest du in Nullkommanix einen Job, no fokkin problem.« Máquinas war Auftragskiller der Narcos, ein Profi. Noch so ein Schwerverbrecher, der mit Bargeld rausgeboxt worden war oder, wie er es selbst formulierte, »mit Kopfgeld«. Kein Richter blieb standhaft, wenn ihm der abgetrennte Kopf eines Mitarbeiters zugestellt wurde, hübsch ordentlich zwischen Bierflaschen in einer Kühlbox drapiert. »Na, Herr Richter? Tun Sie uns den kleinen Gefallen und lassen unseren Kumpel frei, oder sollen wir Ihnen noch weitere Aufmerksamkeiten schicken? Prost, mein Freund, lassen Sie sich das Bier schmecken.« Keine Frage, dass der entsetzte Richter umgehend »die Entlassung aus Mangel an Beweisen« anordnete, bevor der nächste Kopf der seiner Frau oder der seines Kindes wäre. »Wir sind eben gute Verhandler«, versicherte Máquinas. Pummelig, breite Unterarme, kräftige Hände. Mechaniker für Lkws, Trucks und Traktoren. Angefangen hatte er als Motorenschrauber. Inzwischen liquidierte er Händler, die partout kein Schutzgeld zahlen wollten. »Und nur, weil sie den Macker spielen wollen, dabei wär’s megaeasy für sie, ein bisschen Kooperationi zu zeigen.«
Wie so viele Grenzbewohner war Máquinas drüben geboren, aber hüben aufgewachsen. »Ich bin ein waschechter Ami, ein stämmiger Zwerg mit American Passport. Fehlen nur die blonden Löckchen und die blue eyes. Deep at heart ich ein Redneck.« Die Polizei schnappte ihn in DF, nachdem er einem Pisser das Gehirn weggepustet hatte. Voll in den Schädel hatte er ihm geschossen, aus nächster Nähe. »Der konnte nicht rechnen«, erklärte er José Cuauhtémoc. »Zwei plus zwei sind vier, fünf plus fünf sind zehn, und das asshole hat sechs und sechs zusammengezählt und fünf geliefert. Das hat den Bossen natürlich nicht gefallen. So was nennt man einen deal breaker, mei friend. Deshalb sage ich auch immer zu meinen Neffen, sie sollen Mathe büffeln, denn wenn man den Bogen überspannt und one plus one nicht two ergibt, tja, dann gibt’s eben Trouble. Entweder die Zahlen stimmen oder es fließt Blut.« Zu Máquinas’ Leidwesen hatten ihn da »die Hauptstadtdenunzis schon auf dem Kieker. Ein Drecksvögelchen hatte ihnen was gezwitschert, und schon hatten sie mich gecasht.«
Máquinas landete im Knast. In einer Zelle mit zwei anderen bösen Buben. Im Speisesaal lernte er José Cuauhtémoc kennen. Sie mochten sich. Mit ihm konnte er Englisch reden, wenn er Lust hatte. Nur wenige Häftlinge verstanden sie. »The guy da likes Ärger«, warnte er, damit JC lookie-lookie machte und auf der Hut war. Er bat die Bosse, mit der Gefängnisleitung zu arrangieren, dass sein neuer Kumpel zu ihm in die Zelle verlegt wurde. Und die Weicheier von Gefängnisleitern gehorchten. José Cuauhtémoc und Máquinas wurden best Buddys. »Eins zwei drei, ich und alle sind frei«, diese Regel vom Versteckspiel gilt auch unter Häftlingen. »Wenn ein Scheißrichter mir den Freifahrtschein ausstellt und ich aus diesem Diätschuppen rauskomme«, sagte Máquinas, »dann geh ich heim, heim in mein Dorf.« Und kaum war er draußen, fuhr er genau dorthin. »Du findest mich in Acuña City, Bro, wenn du dein free ticket kriegst, da hängen wir dann so richtig schön ab.«
Máquinas kehrte in sein Dorf zurück und hatte allen Grund zur Freude. »Dort lebt meine Chubby yummy, meine Fatilicious, mein Michelinchen«, sagte er. Esmeralda, die Liebe seines Lebens. Die Wasserstoffperoxydblondine, die fickte wie eine fokkin Bestie. »Die Kleine weiß, wie man Rohre verlegt«, sagte Máquinas über seine Frau. »Die ist der reinste Wirbelsturm.«
Als JC aus dem Knast kam, wollte er vor allem Strecke zwischen sich und seine Vergangenheit legen. Nie wieder die Klagen seiner Schwester hören, die Vorwürfe seines Bruders, die ewige Jammerei seiner willensschwachen Mutter. Nichts mehr zu tun haben mit seiner Memmenfamilie. Nicht einmal Bescheid geben, dass er draußen war. Er wollte einfach einen Monat lang jobben, ein bisschen Geld zusammenkratzen, in einer der Firmen zur »Wiedereingliederung« (Firmen, die von Gefängnisleitern geführt wurden, angeblich, um denen, die nach der Zeit im Bau knapp bei Kasse waren, die Chance zu geben, sich ein paar Kröten zu verdienen, und die doch nur ein Paradebeispiel waren für die allerschlimmste Ausbeutung), und sich, sobald er genug Kohle hatte, auf den Weg zum Busbahnhof machen und Richtung Norden ziehen. Dort würde Máquinas ihm wie versprochen unter die Arme greifen. Vorher hatte JC ihm noch verklickert, dass er nicht bei den Narcos einsteigen würde, auf keinen Fall. Nicht aus moralischen Gründen, ob die Narcos einen oder tausend Arschlöcher abmurksten, sei ihm egal, sondern weil er die Vorstellung nicht ertrage, dass jemand ihm Befehle erteile. Er wolle nicht, dass ein alter Fettsack mit Mundgeruch bestimmte, ob er dieses oder jenes tun oder nicht tun dürfe. Er sei sich für keine Arbeit zu schade, ob auf einer Farm oder in einer Autowerkstatt oder in einer Schule mit Rotzlöffeln, er mache jeden Job, Hauptsache, niemand versuche, ihn herumzukommandieren.
Die Message kam an. »Die einen halten es aus, die anderen nicht«, sagte Máquinas. »Du gehörst zu denen, die es nicht aushalten, hat also keinen Sinn, dich ändern zu wollen.«
Máquinas besorgte ihm einen Job als Steinesammler für Baumaterialfirmen. »Das wird dein Bisness, Alter. Du und sonst keiner. Du watest in den Fluss, holst säckeweise Kieselsteine raus, in deinem eigenen Tempo, und verkaufst sie dann an diese Bros. Just do it.«
Und so machte er es. Morgens fuhr José Cuauhtémoc zur Ranch Santa Cruz, die einem Doktor Humberto Enríquez gehörte, öffnete das Gatter, folgte dem Feldweg bis zum Fluss, sammelte Steine, wenn er Bock hatte, und wenn nicht, schwamm er ein bisschen oder angelte oder döste oder las ein Buch. Das war ganz nach seinem Geschmack: in Ruhe lesen, in einem Eichenhain, am Ufer eines Flusses. Wenn er fertig war, fuhr er nach Morelos, wo ihm ein Typ namens Cacho Medina sieben Pesos pro Kilo Steine zahlte. Er schlief in einem Zimmer, das ihm Máquinas besorgt hatte, hinter einem Supermarkt, an der Landstraße nach Santa Eulalia; wenn ihm danach war, ging er arbeiten, wenn nicht, dann eben nicht. Der perfekte Job.
Máquinas lebte mit Esmeralda zusammen, der drallen Chubby yummy, in die er so verschossen war. Wie die meisten Auftragskiller nach getanem Job legten ihn die Chefs eine Weile auf Eis. Die Plaza war noch heiß, Soldaten überall, sogar Marines. Lieber eine Weile untertauchen. Die guten Zeiten würden schon wiederkommen. Es musste nur anderswo Wind aufkommen, dann würden die Polizisten und Marines schon weiterziehen. Um das zu bewirken, schickten die Bosse Kanonenfutter aus den eigenen Reihen, das dem rivalisierenden Kartell auf deren Hoheitsgebiet gehörig ins Handwerk pfuschte. »Legt ein paar alte Weiber um, pustet einen drittklassigen Politiker weg und macht ein bisschen Rambazamba.« Und dann zogen sie los, die Grünschnäbel, die gerade noch als Autowäscher oder Parkwächter gearbeitet hatten, und mähten die halbe Bevölkerung nieder. Frauen wurden vergewaltigt und zerstückelt, Männer geköpft und an Brücken gehängt, Gemeinderäte auf offener Straße abgestochen. Dann war die Plaza so richtig heiß, die Bosse des anderen Kartells befahlen, die dreckigen Aufrührer kaltzumachen, und das Gemetzel nahm seinen Lauf. Um die Lage zu beruhigen, verlegte die Bundesregierung Marines und Soldaten also an diese Plaza und räumte »unsere fokkin great Acuña City«. Sobald die Fremde-Plaza-Heißmachen-Taktik funktionierte, beorderten die Bosse Máquinas zurück in die Autowerkstatt. Motoren ausbauen, Differentialgetriebe tauschen, Bremsen einstellen, Servolenkungen reparieren: Das hatte er voll drauf. Die SUVs der Chefs, nichts als Chevys Suburban und Cadillacs Escalade, mussten immer gut in Schuss sein, und wer wäre besser geeignet, dafür zu sorgen, als der Starmechaniker aus den eigenen Reihen. Irgendwann würden sie ihn schon wieder einsetzen können, um den Wichsern von Barbetreibern, die das Schutzgeld verweigerten, zu zeigen, wo der Hammer hing.
Da JC immer spät nach Hause kam und keine Zeit zum Kochen hatte, einigte er sich mit seinem Kumpel auf einen Deal. Er zahlte ihm ein bisschen Kohle, und dafür kochte Esmeralda für ihn mit. Sie stellte das Essen bei ihm vor die Tür. In weiser Voraussicht sorgte Máquinas dafür, dass Esmeralda es ihm nie dann vorbeibrachte, wenn er da war. »Die fokkin Katze lässt das Mausen nicht«, argumentierte er. Warum einen doppelten Verlust riskieren? Die Frau und den Freund verlieren? Lieber schön auseinanderhalten, Freund da, Frau dort. JC musste per Handy Bescheid geben, wenn er auf der Ranch eintraf. Dann gab Máquinas Esmeralda das Okay, und sie konnte das Essen abliefern.
José Cuauhtémoc hatte nicht die leiseste Absicht, mit dem Häschen seines Freundes ins Bett zu steigen. Warum sollte er? Dafür fühlte er sich in Ciudad Acuña viel zu wohl. Hübsche Weiber, billige Kneipen, gute Restaurants, nette, gastfreundliche Leute. Das Einzige, was ihn nervte, war die Mordshitze. Meine Fresse. Fünfundvierzig fokkin Grad im Schatten. Und dann diese Mücken, die einen piesackten, sobald die Sonne untergegangen war. Eine fieberhafte Stecherei. Seine Hände schwollen an, waren immer voller Quaddeln, die juckten wie verrückt, egal, wie viel er sich kratzte. Anfangs gelang es ihm noch, die Mücken mit einer Zigarre zu verscheuchen. Er hatte mal gelesen, dass Stechmücken der eigentliche Grund waren, warum Fidel Castro und Che Guevara Zigarre geraucht hatten, weil die nämlich auch in der Sierra Maestra der größte Feind waren. Hier am Fluss, dem San Antonio, nützte dieser Zigarrenrauch einen Scheiß, wenn die Hitze wütete. Die Luft färbte sich schwarz vor Moskitos. José Cuauhtémoc musste sich mit Mückenspray praktisch einräuchern, immer einen Hut tragen, ein Halstuch umbinden, Handschuhe anziehen. Die Drecksmücken stachen einem sogar durch die Jeans. Und nach den Mücken kamen die Zecken, die sich ihm überall in die Haut bohrten. An den Füßen, an den Armen, zwischen den Schenkeln, am Nacken. Eines Abends war er so müde vom Steineschleppen, dass er in den Bergen einschlief. Als er aufwachte, war er mit einem rötlichen Schorf überzogen. Tausende Zecken hatten sich an den unmöglichsten Stellen in seinen Körper verbissen: ins Zahnfleisch, in die Zunge, in die Ohren, in die Nasenhöhlen, in den Allerwertesten, unter die Achseln, in die Eier, in die Augenlider. Weil das Jucken nicht auszuhalten war, zog er sein Messer und begann, den Zeckenbelag abzukratzen. Ganz dumme Idee. Die Köpfchen der Parasiten blieben in der Haut stecken, und bald schon zeigte sich eine heftige Entzündung. Überall auf seinem Körper bildeten sich Pusteln, er bekam reißenden Durchfall und Fieber in komatöser Höhe.
Nachdem Máquinas ihn zwanzigmal vergeblich auf dem Handy angerufen hatte, fuhr er zu ihm. Er fand ihn zitternd auf dem Boden liegend, im Delirium. »Er sah aus wie eine Kröte, wie so eine aufgeblähte Kröte, mit Krötenaugen und Krötenhaut, und er quakte auch wie eine Kröte«, erklärte Máquinas, dem nichts Besseres einfiel, als ihn zu seinen Chefs zu schleppen. Der Oberboss höchstpersönlich brachte JC ins Krankenhaus und bezahlte die Rechnung. Hätte er das nicht getan, hätte José Cuauhtémoc schon mal einen Termin im Krematorium vereinbaren können. »Big mistake«, sagte Máquinas, in den Bergen einzuschlafen, denn damit hatte er sich praktisch selbst an die Wand gestellt und zur Zielscheibe für Zecken und Moskitos gemacht. Big mistake, keine Hilfe zu rufen und sich mit Dünnschiss in seinem Zimmer einzusperren, dehydriert und mit so hohem Fieber. Big mistake, den Boss der Bosse die Krankenhausrechnung begleichen zu lassen. Hundertsiebenunddreißigtausendfünfhundert Kröten blechte der Capo, um den Kumpel seines Killers zu retten. Hundertsiebenunddreißigtausendfünfhundert Flocken, die José Cuauhtémoc seinem Wohltäter nun zurückerstatten musste. Als er nach zehn Tagen auf der Intensivstation wieder zu Bewusstsein kam, war er erst mal stinksauer auf Máquinas. »Jetzt schulde ich diesem Scheißnarco einen Gefallen«, sagte er, und diese Schuld würde er bis auf den letzten Heller bezahlen müssen. Er verdankte Máquinas’ Boss sein Leben, und der würde im Gegenzug bis in alle Ewigkeit Forderungen stellen, mit Zins und Zinseszins. Big mistake, aber allzu lange konnte er Máquinas nicht böse sein. Wäre sein Kumpel nicht gewesen, läge er jetzt in einem Sarg. Lieber verschuldet und lebendig, als ohne Verpflichtung, aber tot. Verdammt, wie sollte er sich aus den Fängen des Narco wieder befreien? Ihm würde schon was einfallen. Ganz bestimmt.
Carmen, meine Freundin und Edelkitschpoetin, war diejenige, die an diesem Tag den letzten Streit vom Zaun brach. Sie echauffierte sich ständig darüber, dass Orcas und Delphine in Gefangenschaft gehalten wurden, und drängte uns, Petitionen »für ein Verbot des Einsatzes von Meeressäugetieren in Vergnügungsparks« zu unterzeichnen. Andererseits störte es sie nicht im Geringsten, dass auch ihre fünf Katzen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verdammt waren. Diese bedauernswerten Kreaturen erfuhren nie, dass es jenseits ihrer siebzig Quadratmeter großen Wohnung noch eine andere Welt gab. »Sie sind glücklich, ich behandle sie, als wären es meine Kinder«, argumentierte Carmen immer. In ihren Augen war das keine Tierquälerei. Auch nicht, dass sie ihnen Westen anzog, sie sterilisieren ließ und ihnen – um es mal so auszudrücken – jegliches »Katzentum« nahm. Entkatzte Katzen. Katzen in den Händen einer gestörten, ein bisschen verrückten Frau.
Meine Kinder Claudia, Daniela und Mariano kamen angelaufen, um uns das neun Monate alte Junge eines Klammeraffen zu zeigen. Dieses Affenbaby war Pedros und Héctors ganzer Stolz. Klammeraffen waren vom Aussterben bedroht. Wenn sie sich in Gefangenschaft fortpflanzten, war das ein Riesenerfolg. Auf ihrer Ranch pflegten Pedro und Héctor Tiere gesund, die von der Umweltbehörde gerettet worden waren. So waren sie eines Tages auch an eine Horde Klammeraffen gelangt, die bei einem in Ungnade gefallenen Politiker aus Chiapas beschlagnahmt worden war. Pedro und Héctor engagierten Koryphäen auf dem Gebiet der Primatenmedizin. Unter Aufbietung aller Kräfte gelang es den Tierärzten, die zehn Affen wiederaufzupäppeln. Die Geburt des Affenbabys erfüllte Pedro und Héctor mit einer solchen Freude, dass sie auf der Ranch einen Umtrunk gaben, um das Ereignis zu feiern. Dass die Affen in Gefangenschaft lebten, und sei das Areal noch so groß und die Pflege noch so gut, empfand Carmen als Ungeheuerlichkeit. In einem Akt unsäglicher Dummheit entriss sie meinem Sohn das Junge und stampfte entschlossen auf ein Wäldchen zu. Das Äffchen fuchtelte mit den Händen und stieß Angstschreie aus. Pedro stellte sich Carmen in den Weg und fragte, was sie vorhabe. »Ich werde dieses Äffchen befreien«, erwiderte sie melodramatisch. Das Tier in dieser Gegend auszusetzen, hätte seinen sicheren Tod bedeutet. Zum einen war dies nicht sein natürliches Habitat, zum anderen war ein Klammeraffe in seinem Alter allein nicht überlebensfähig. Doch diese biologische Komplexität überforderte den Verstand einer dichtenden Städterin, die ihr Wissen über die Natur von Animal Planet bezog. Verärgert nahm Pedro ihr das Junge ab, um es zurück in den Käfig zu bringen. Aber Carmen wollte das nicht auf sich sitzen lassen. »Wegen Leuten wie euch ist die Welt so kaputt«, provozierte sie ihn. Pedro gab das Äffchen seinen Eltern zurück und schlenderte mit einem spöttischen Grinsen im Gesicht zur Palmenpergola, während Carmen weiter ihre Tierschützerslogans vor sich hin zeterte. Er ließ sie einfach stehen. Sogar ihre Töchter, denen sie die unsäglichen Namen Selva – Dschungel – und Lluvia – Regen – verpasst hatte, quittierten ihren Wutanfall mit lautstarkem Gelächter.
Der weitere Nachmittag verlief ohne größere Zwischenfälle. Die Hitze ließ nicht nach, und gegen Abend hüpften wir in den Swimmingpool, um uns abzukühlen. Meine Kinder planschten um mich herum, während Claudio am Beckenrand mit Klaus plauderte. Kellner servierten Getränke in Bechern aus rostfreiem Stahl (Gläser waren wegen der Bruchgefahr nicht erlaubt, Plastik oder Polyethylen kamen überhaupt nicht infrage). Mit einer Bloody Mary in der Hand lehnte ich am Beckenrand. Pedro kam zu mir. »Was hast du kommenden Monat so vor?«, fragte er. »Nichts Besonderes. Die Kinder in die Schule bringen, Choreografien einstudieren. Warum?« Er zögerte kurz. Ich dachte schon, er wollte ein weiteres Treffen vorschlagen. »Habe ich dir schon mal vom Knastkulturprogramm erzählt?«, fragte er. Viel wusste ich nicht darüber, hatte nur hie und da mal etwas aufgeschnappt. »Nicht wirklich«, erwiderte ich. »Seit drei Monaten organisieren Julián Soto und ich Kulturveranstaltungen für die Häftlinge. Dienstags und donnerstags gebe ich mit ihm zusammen einen Creative-Writing-Workshop.«
Julián Soto war einer der besten Romanciers Mexikos, ja, ganz Lateinamerikas. Seine wilde, harte Prosa hatte wenig zu tun mit dem schwülstigen Süßholzgeraspel seiner Kollegen. Er schrieb so männlich, so authentisch, dass es mich manchmal sogar sexuell erregte. Jedem seiner Sätze entströmten Pheromone. Er war allerdings auch ziemlich reizbar. Einmal stellte er in der Redaktion einer Literaturzeitschrift einen Kritiker zur Rede, der sich über seine Bücher lustig gemacht hatte, und verprügelte ihn. Der Kritiker hatte danach einen gebrochenen Kiefer und eine Augenhöhlenfraktur. Julián landete im Gefängnis, wegen Tätlichkeit, Hausfriedensbruchs, sogar Mordversuchs.
Er bekam sechs Jahre. Nach drei Jahren und vier Monaten wurde er vorzeitig entlassen, nachdem sich die Autorenverbände für ihn eingesetzt hatten (oder wie es der Präsident eines dieser Verbände sagte: »Welcher Autor träumt nicht davon, einem Scheißkritiker die Fresse zu polieren?«). Pedro erzählte mir, wie sehr der Gefängnisaufenthalt Julián geprägt habe. Er habe die wahre Schattenseite des Lebens kennengelernt und gestaunt über das, was die Häftlinge zu erzählen hatten. Er wollte ins Gefängnis zurückkehren und Schreibworkshops abhalten, und er überzeugte Pedro davon, ein paar Initiativen zur Kulturförderung zu finanzieren. Mit seinem Feuereifer brachte er sogar eine Handvoll Verlage dazu, zwanzigtausend Bücher zu spenden; er selbst schenkte der Gefängnisvideothek tausend DVDs mit wichtigen Filmen des zeitgenössischen Kinos und warb für den Bau von Unterrichtsräumen, einer Bibliothek und eines Saals mit zweihundertfünfzig Plätzen, in dem Theaterstücke und andere Bühnenshows aufgeführt werden konnten. »Diesen Jungs fehlt der Horizont«, erklärte Julián. »Die können sich eine Welt, in der nicht Elend, Ungerechtigkeit und Straflosigkeit herrschen, gar nicht vorstellen.« Wie Pedro mir erzählte, gingen aus dem von Julián geleiteten Creative-Writing-Workshop Texte hervor, die zwar durchwachsen und naiv, aber von großer Kraft waren. »Was würden die Möchtegernautoren dieses Landes dafür geben, wenn sie auch nur einen solchen Satz zustande brächten.«
Pedro und Julián hatten auch einige Theaterproduktionen ins Gefängnis gebracht, die gut angekommen waren. Und an jenem Abend im Pool, als die Kinder um uns herum planschten und die Kellner permanenten Nachschub an Getränken und reihenweise Tabletts mit französischem Käse und Jabugo-Schinken anschleppten, machte Pedro den Vorschlag, der mein Leben verändern würde: »Könntest du dir vorstellen, mit deiner Kompanie im Gefängnis aufzutreten? Ich versichere dir, dass keiner der Häftlinge dir oder deinen Tänzern gegenüber übergriffig werden wird. Vielmehr wird es das beste Publikum sein, das du je hattest.« Es klang verlockend. »Ich muss erst die Gruppe fragen«, sagte ich, obwohl ich innerlich bereits entschieden hatte, dass wir auftreten würden.
Hier
Gibt es keinen Gott.
Gibt es keine Eltern.
Gibt es keine Kinder.
Gibt es keine Geschwister.
Gibt es keine Stille.
Gibt es keinen Frieden.
Gibt es keine Liebe.
Gibt es keine Träume.
Gibt es keine Bäume.
Auch keine Flüsse, keine Berge, keinen Himmel.
Es gibt Körper.
Es gibt Schweiß.
Es gibt Blut, Hunger, Schreie.
Es gibt Verzweiflung.
Es gibt Albträume, Beton, Gitter.
Es gibt Schläge.
Es gibt Dämonen.
Es gibt Wunden.
Es gibt Langeweile, Gestank, Verlassenheit.
Und manchmal gibt es Freunde und manchmal Schach und manchmal Gelächter und manchmal Schwein mit Portulak und manchmal Siestas und manchmal Sonne im Hof und manchmal Besuch und manchmal Bücher und manchmal Tischfußball und manchmal ein Radio und manchmal, ja, manchmal gibt es auch Hoffnung.
Macario Gutiérrez
Häftling Nr. 27755-3
Strafmaß: siebzehn Jahre, fünf Monate wegen bewaffneten Raubes und versuchten Mordes
Es dauerte nicht lange, bis der Boss der Bosse in José Cuauhtémocs Leben trat. Der Boss sah sich selbst als wohlwollenden und großzügigen Patron. Nie forderte er Schulden ein. Er verlieh Geld, verschenkte Häuser, Lkws und kiloweise Doña Blanca. »Der Boss ist nicht so Schisser wie die Anführer der anderen Kartelle. Und er ist auch kein Schwätzer oder Schoumen. Was er sagt, gilt«, erklärte Máquinas. Der Capo mochte als Ihr-untertänigster-Diener-und-dieser-ganze-Bullshit auftreten, aber letztlich forderte er trotzdem für alles Zins und Zinseszins ein. »Keine Sorge, Kumpel, dafür sind Freunde ja da. Und die Freunde von Freunden gehören ebenfalls zur Familie.« Das sagte der Boss der Bosse zu ihm, als er ihn am Tag nach seiner Krankenhausentlassung aufsuchte. »Hör mal, mein Aztekenkönig«, sagte Máquinas, »der Boss der Bosse will dich sehen, und wenn er sagt, er will dich sehen, dann will er dich sehen. Capito? Das ist ein gradliniger Typ, kein Bullshit.« Und tatsächlich, das Verhalten vom Boss-Boss war wirklich erste Sahne, er schien besorgt um seine Gesundheit, fragte nach, ob man ihn im Krankenhaus auch gut behandelt habe. »Ich habe es dem Arzt sehr ans Herz gelegt, aber noch viel mehr dem Heiligen Martín de Porres in meinen Gebeten«, sagte der affektierte und paternalistische Boss-Boss. »Siehst du?«, sagte Máquinas. »Wenn er ein Wichser wäre, hätte er für dich zur Santa Muerte gebetet, aber nein, er hat dich direkt dem Obama unter den Heiligen anempfohlen.« José Cuauhtémoc hatte von seinem Vater gelernt, niemandem zu vertrauen. »Lass dich bloß nie blenden«, hatte sein Vater immer gesagt. »Die Menschen sagen das eine und denken das andere.« Also sagte der Boss-Boss das eine, führte mit seinem Gaunerinstinkt aber etwas ganz anderes im Schilde. »Danke, Señor«, erwiderte JC. »Nichts zu danken, mein Freund. Du weißt ja: Eine Hand wäscht die andere.« Der Waschtag wird nicht lang auf sich warten lassen, dachte José Cuauhtémoc. Bald schon würde Máquinas bei ihm auf der Matte stehen und sagen, »Hör mal, der Boss will dich um einen kleinen Gefallen bitten …«, und der kleine Gefallen würde nicht darin bestehen, dass er irgendeine unbedeutende Knallcharge töten sollte, irgendeinen Hol-mir-noch-ein-Bierchen-und-puste-dann-einen-Bullen-ab-Handlanger. Nein, natürlich nicht. Er würde ihn um den klitzekleinen Gefallen bitten, den Capo der Capos eines anderen Kartells zu töten. Máquinas’ Boss hatte ihm das verdammte Leben gerettet. Hätte er ihn nicht ins Hospital Doctor Marco Antonio Ramos Frayjo einliefern lassen, würden ihn jetzt schon längst die Würmer anknabbern. »Dass Sie noch leben, grenzt an ein Wunder, Señor Huiztlic«, hatte der Arzt gesagt. »Die von den Rikettsien ausgelöste Infektion, plus das Fieber im Verbund mit Ihrer schlechten Ernährung hat sie an den Rand des Todes gebracht.« Warum nur mussten Ärzte immer so kitschig sein und so dämliche Ausdrücke wie »an den Rand des Todes« benutzen?, dachte JC. Aber es stimmte. Die Ärzte hatten ihn aus dem Jenseits zurückgeholt. »Shit, mein blonder Ranchboy. Ich dachte wirklich, du würdest bald mit dem Knochenmann Fußball spielen, und jetzt bist du plötzlich der wiederauferstandene Jesus Christ Superstar.«
Tage und Wochen vergingen, ohne dass der Boss ihn um einen Gefallen bat. José Cuauhtémoc nahm sein altes Leben wieder auf. Er sammelte Steine im Fluss, verkaufte sie an Cacho Medina, aß dann und wann mit Doktor Enríquez und fuhr abends nach Hause, wo ihn das von Michelinchen Esmeralda zubereitete Essen erwartete, der fatidelicious Liebe des Lebens von seinem Kumpel Máquinas. Er glaubte nicht, dass die Polizei ihn observierte. Doch die musste rausfinden, welche Art von Fisch er war. Wenn der oberste Boss ihm die Krankenhausrechnung bezahlt hatte, dann musste er ein dicker Fisch sein, ein Hai, wenn nicht gar ein Wal.
Eines Tages standen auf einmal die Schwarzuniformierten bei ihm auf der Matte. Die Bundespolizei, die Federales, die Schlümpfe, die Bullen, die Blutsauger, die Wichser, die Polypen. Gegen sieben Uhr morgens klopfte es. JC spähte durch den Vorhangspalt und sah einen Streifenwagen und zwei Polizisten mit der Hand am Holster. Er öffnete. Schließlich hatte er sich nichts zuschulden kommen lassen. »Tag«, begrüßte ihn ein sonnenbebrilltes Riesenbaby in Uniform. »Tag«, erwiderte JC. »Sind Sie José Cuauhtémoc Huiztlic Ramírez?« Wenn er seinen kompletten Namen kannte, dann kannte er auch seine Akte. »Ja, bin ich.« Um ihn einzuschüchtern, machte der Polizist einen Schritt auf ihn zu. José Cuauhtémoc taxierte ihn. Sollte es nötig werden, ihm die Fresse zu polieren, wäre der Typ in drei Sekunden erledigt. Er war zwar ein Riesenaffe, aber auch schwabbelig. JC