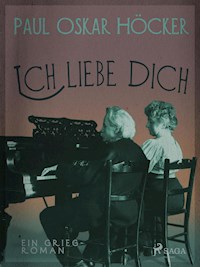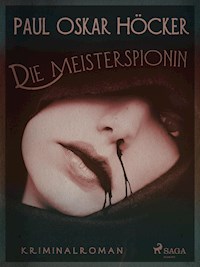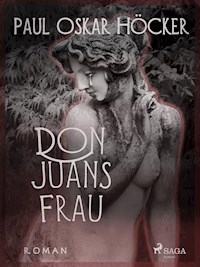Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katarina Lutz ist mit Viktor verlobt, dem Spross einer Familie, die eine große Gärtnerei und Blumenzucht besitzt. Als die Verlobung gelöst wird, betrügt Viktors Familie Katarina um ein Grundstück. Jetzt muss die junge tatkräftige Frau ganz allein und gegen viele Widerstände ihren Lebensplan durchsetzen, eine eigene Gärtnerei aufzubauen. Zum Glück lernt sie in England den beherzten Mr. Gabb kennen, der ihr beisteht. Und es gelingt ihr, eine sensationelle neue Nelkenzüchtung zu kreieren, die auf der Londoner Blumenausstellung einen Preis erringt. Aber eines Nachts wird in ihr Gewächshaus eingebrochen, wertvolle Pflanzen sind verschwunden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Das flammende Kätchen
Roman
Saga
Katarina hatte siebzig Mark Monatsgehalt und Familienanschluss, d. h. sie speiste am Tisch der Herrschaft mit und teilte das hübsche Biedermeierzimmer, das die Tochter des Hauses bis zu ihrer Hochzeit bewohnt hatte, mit der Engländerin. Aber ein Plätzchen, wo sie sich einmal ausweinen konnte, hatte sie nicht.
Kein Mensch ahnte übrigens, dass sie so eines brauchte. Mit ihrer Frische und Behendigkeit, mit ihren immer freundlichen Augen, den hellbraunen, ein wenig ins Grünliche spielenden, mit ihrem drolligen Sommersprossengesicht, das die beiden grossen, rostroten Schnecken einrahmten, mit ihrer warmen Altstimme, die so dankbar und herzlich lachen konnte, war sie ihnen allen seit dem ersten Tage der Sonnenschein im Hause. Und hatte sie nicht die hübscheste Beschäftigung, die man sich für eine aufs Geldverdienen angewiesene junge Dame denken konnte? Sie hielt dem Geheimrat, der in seinen Mussestunden Orchideenzüchter war, die beiden Warmhäuser seiner Grunewaldvilla in Ordnung. Für den Hausgarten, das Gemüsegärtchen und das Spalierobst war der alte Franz da. Aber natürlich nahm Katarina dem etwas klapprig gewordenen Faktotum die meiste Arbeit ab, denn sie war eben jung und flink, sie hatte Feenhände, rasch war sie hier und schnitt Rosen oder putzte ein Erdbeerbeet aus, rasch war sie dort und band Spalierobstzweige mit Bast an oder sprengte den Rasen oder rigolte ein Beet oder harkte die Kieswege. Und dass sie die Vasen in der ganzen Villa besorgte, war ebenso selbstverständlich. Sie hatte Geschmack, sie liebte die Blumen und sie war nun doch einmal Sachverständige: ihr Vater hatte eine Gärtnerei am Rhein gehabt, und sie war als Schülerin der Gartenbauschule in Marienfelde hergekommen. Man konnte sich das Haus heute kaum mehr ohne Fräulein Lutz denken. Auch der Geheimrätin war sie in diesen fünf Monaten in hundert Dingen, die mit der Orchideenzucht nicht die mindeste Berührung hatten, unentbehrlich geworden — obwohl die Stütze und das erste Hausmädchen recht ungnädig werden konnten, wenn sie’s etwa merken liess. Fräulein Lutz zog Wein ab, brachte die elektrische Klingel in Ordnung, behandelte den russischen Seidenspitz, wenn er krank war, sie kannte hundert Spezialrezepte, hundert Adressen. Die besondere Stellung der jungen Rheinländerin war also schwer zu bezeichnen. Kam Besuch, so wurden Miss Lawrence und Fräulein Lutz von der Geheimrätin wohlwollend mit den Worten charakterisiert: „Unsere Miss — und meines Mannes kleine Gartendoktorin.“ Es kam auch vor, dass die liebenswürdige alte Dame dabei Katarina leicht in die Wange kniff. Es herrschte ein guter Ton im Hause. Sogar Otto, der Referendar, der in der jungen Orchideenkundigen zuerst einen gar zu bequemen Huldigungsgegenstand erblicken wollte, behandelte sie respektvoll-kameradschaftlich, nachdem sie ihm einmal gründlich den Kopf gewaschen hatte.
Wenn alle zu Bett gegangen waren, trug Katarina noch sämtliche Blumenvasen in den Wintergarten, regelte dort die Warmwasserleitung, füllte die Vasen mit frischem Wasser, schnitt die Blumen an und duschte sie ab. Fünf oder sechs Stunden später weckte sie schon drüben in der Kutscherwohnung den alten Franz, der die Heizung der Warmhäuser zu besorgen hatte. Und von da an war ihr ganzer Tag besetzt, Stunde für Stunde, sie kam nicht zur Besinnung, — ja, sie kam heute nicht einmal dazu, in Ruhe und Sammlung den Brief zu lesen, der den Poststempel Wiesbaden trug und der über ihr ganzes Schicksal entscheiden sollte.
Wiesbaden war ihre Heimat. Hinter Sonnenberg, auf Rambach zu, lagen die Gartengrundstücke ihres verstorbenen Vaters — dicht neben denen der Familie Troilo. Mit Viktor Troilo war sie seit anderthalb Jahren verlobt — versprochen schon seit ihrer gemeinsamen Kindheit. Und der Brief stammte von Viktors Stiefmama. Viktor sollte nun endlich am 1. April bei den badischen Leibdragonern sein Freiwilligenjahr abdienen. Als er das Polytechnikum in Karlsruhe besuchte, hatte er dort gute Beziehungen angeknüpft, die ihm die Aussicht eröffneten, beim Regiment Reserveoffizier zu werden. Natürlich ging es da nicht länger an, dass seine Braut sich in Berlin in Stellung befand. Solange Viktor im Hause war, hatte ihr Fernbleiben einen gewissen Sinn gehabt. Jetzt aber fiel der Grund weg. Also ...
In der Nacht stellte Katarina den Bettschirm so, dass das Schreibtischlicht die Miss nicht treffen konnte, und schrieb einen langen, langen Brief an Viktor. Geradezu Angst befiel sie bei der Vorstellung, sie sollte wieder mit seiner Stiefmutter unter einem Dache leben. Sie war damals doch nicht seinetwegen aus dem Haus gegangen, das wusste er ja. Sie hatte sich mit dieser Frau niemals vertragen können, und das halbe Jahr nach ihres Vaters Tod, solange sie im Hause Troilo Gastfreundschaft genoss, war das furchtbarste ihres Lebens gewesen. Auf Schritt und Tritt hatte Frau Dora sie’s fühlen lassen, dass sie für ihren Sohn, den einzigen Erben ihres grossen Vermögens, auch nicht annähernd die von ihr gewünschte Partie darstellte. Eine Engelsgeduld hatte dazu gehört, all die Demütigungen still und widerspruchslos über sich ergehen zu lassen. Und innerlich trennte sie eine Welt von dieser Frau. Darum hatte sie den ersten triftigen Vorwand wahrgenommen, um sich ihrer Gastfreundschaft und damit ihrer zänkischen Bevormundung zu entziehen. Jetzt wieder zurückzukehren zu ihr, noch dazu allein, während Viktor sein Jahr abdiente, so dass sie schutzlos ihrer unnoblen Art preisgegeben war, nein, nein, nein, das konnte er nicht von ihr verlangen. Hundertmal lieber arbeitete sie doch bei fremden Menschen. Hier beim Geheimrat lernte sie auch noch eine ganze Menge Dinge hinzu, die sie später im Gärtnereibetrieb gut verwenden konnte, die Zeit war also nicht verloren, dort aber war sie völlig vergeudet, denn was füllte Frau Doras Leben aus? ...
Sie schrieb und schrieb, musste aber immer wieder absetzen, um in ihr Taschentüchlein zu schnauben.
Davon erwachte Miss Lawrence. Verwundert erhob sie sich im Bett, kerzengrade. Wie ein Gespenst erschien sie über dem Bettschirm. „Oh, Miss Kate! What are you doing here in the middle of the night?“
Wie auf einer bösen Tat ertappt entschuldigte sich Katarina wegen der nächtlichen Störung, klappte die Schreibmappe zu und drehte das Licht aus.
Aber die Miss, dankbar für jeden Gesprächsstoff, berichtete andern Tages der Geheimrätin über das Ereignis, und in den verschiedenen Teilen des Hauses Erck ward es darauf erörtert: Fräulein Lutz hatte nachts geweint!
Die Stütze und das erste Hausmädchen verwahrten sich sofort ganz entschieden dagegen, ihr auch nur den geringsten Anlass gegeben zu haben. Der Geheimrat fragte seinen Sohn Otto, ob ihm vielleicht das Gewissen schlage. Und die ängstliche Geheimrätin, die den Gedanken, Fräulein Lutz könnte kündigen, wie eine Schicksalsdrohung empfand, kam abends, als Katarina im Wintergarten zusammenräumte, noch einmal aus dem oberen Stockwerk herunter, eigens um ihr auf den Zahn zu fühlen.
„Sie sahen mir heute ein bisschen angegriffen aus, liebes Kind. Ich nehme lieber wöchentlich einmal eine Aushilfe, als dass es Ihnen zu viel wird.“
„Nein, gnädige Frau, es wird mir nicht zu viel.“
„Hübsch, wie die Clivie aufgeblüht ist, nicht? — Ja, noch eins, Fräulein Lutz: wenn die Leute etwa nicht nett zu Ihnen sein sollten, dann sagen Sie mir’s ruhig. Man wechselt ja nicht gern, es ist ein Kreuz mit den Leuten, aber es liegt mir so viel daran, dass Sie sich hier wohl fühlen und dass wir Sie behalten. — Wollen Sie Zulage, Fräulein Lutz?“
Katarina war ganz rot geworden. „Nein, gnädige Frau, ich bin wirklich zufrieden.“ Sie holte Atem. „Und ich wünschte nur, Sie wären’s auch mit mir.“
Nun lächelte die Geheimrätin und tätschelte ihr die Wange. „Gewiss. Das merken Sie doch. Nicht? Uebrigens — vielleicht haben Sie einmal Lust, abends ins Theater zu gehen. Oder in ein Konzert. Sie brauchen mir’s dann nur zu sagen. Junges Mädchen will doch was sehen von der Welt, sagt mein Mann. Sollen Sie auch. Wie ist denn Miss Lawrence eigentlich?“
„Oh, sehr nett, gnädige Frau, wir vertragen uns gut.“ Katarina konnte sich den Grund des eingehenden Verhörs nicht recht erklären. Verlegen, fast verstört blickte sie zu Boden.
Ratlos musterte die Geheimrätin das junge Ding. Komisch, es war ihr nicht beizukommen. Wenn ihr hier im Hause etwas fehlte, dann sollte sie doch den Mund aufmachen. Man tat ihr ja jeden Willen. Verstimmt sagte sie oben im Schlafzimmer zu ihrem Mann: „Ein rechter Bock ist Dein kleiner Schützling.“
Die ganze Woche hindurch beobachtete sie Fräulein Lutz argwöhnisch. Der kleine Gartendoktor führte nämlich plötzlich einen lebhaften Briefwechsel. War’s vielleicht doch auf einen Stellenwechsel abgesehen? „Ich hab’ ihr Zulage angeboten, alles,“ sagte die Geheimrätin beim Frühstück zu ihrem Mann, zitternd vor Angst, „wenn sie uns trotzdem kündigt, so ist das die Undankbarkeit im Kubik.“
Sonntag früh bat Katarina die Hausfrau, nachmittags ausgehen zu dürfen. Ein Verwandter komme mit dem Fünfuhrzug am Potsdamer Bahnhof an.
Das war eine kleine Sensation für alle Einwohner der Villa Erck: Fräulein Lutz nahm Ausgang! Die Stütze und das erste Hausmädchen hielten von vier Uhr ab Wache in der Anrichte. Sie wollten Fräulein Lutz vorbeikommen sehen, wollten feststellen, in welchem Aufzug sie nach Berlin fuhr. Gewiss würde sie heute die grosse Dame spielen. Aber es gab eine starke Enttäuschung: Fräulein Lutz zog in ihrem englischen Paletot und der englischen Mütze ab, schlicht und unscheinbar, gewissermassen für Regen gekleidet, obwohl es ein heller, sonniger Märztag war, an dem der ganze Gartenvorort nach Veilchen duftete.
Abends um elf Uhr war sie noch nicht aus Berlin zurück. Die Miss nahm den russischen Seidenspitz an die Leine und wanderte am Gartengitter auf und nieder. Durch die Villenstrassen strömten die Berliner noch immer in lebhaft schwatzenden Trupps aus den Grunewaldrestaurants nach der Stadt zurück. Fräulein Lutz würde doch nicht etwa belästigt werden, wenn sie so allein vom Bahnhof kam? Sie war ja schon einundzwanzig Jahre, aber schliesslich ... Es ging jetzt auf Mitternacht ...
Plötzlich blieb die Miss wie angenagelt stehen.
Dem Automobil, das soeben da drüben hielt, entstieg Fräulein Lutz. Und ein junger Herr folgte hastig. Er hielt sich, lebhaft auf sie einredend, an ihrer Seite. Fräulein Lutz presste beide Hände gegen die Schläfen und schüttelte den Kopf. Mehrmals. An der Gartenpforte gab sie ihm die Hand, ohne ihn recht anzusehen. Er wollte sie küssen, aber sie wehrte ihm. Rasch machte sie sich frei und schlüpfte durch die angelehnte Gittertür. Der fremde junge Herr sah ihr ein Weilchen nach, machte langsam kehrt, querte die Strasse und stieg ins Auto ein, das auf Berlin zu davonrasselte.
Keine Silbe sagte Katarina in den nächsten Tagen über ihren Ausgang. Sie war von einer geradezu fanatischen Arbeitswut, sie las dem Ehepaar jeden Wunsch von den Augen ab, sie gönnte sich keinen Atemzug Ruhe, während der Mahlzeiten beteiligte sie sich sogar mit auffallendem Eifer an verschiedenen botanischen Gesprächen. Aber ihr ganzes Wesen war wie ausgewechselt. Als ob ein Schleier über ihr läge, so war es. Wenn sie lachte, klang es fremd, klang es so traurig, dass sie einem leid tat. Und nachts — die Miss berichtete es flüsternd — nachts weinte sie viel und heimlich und geradezu herzbrechend in ihre Kissen.
Otto, der Referendar, fand es ‚äusserst ulkig, dass diese kleine Heilige einen Liebhaber hatte‘. Als seine Mama seufzend betonte, dass sie es doch wahrlich in nichts habe fehlen lassen und dass sie sicher sei, das undankbare Ding werde ihr jetzt trotzdem kündigen, sagte er: „Ihr Weh und Ach ist vielleicht aus einem ganz anderen Punkte zu kurieren, als Du annimmst, beste Mama.“
„Du bist ungezogen, Otto,“ erwiderte sie verstimmt.
Der Geheimrat ahnte die Fülle häuslicher Leiden schon im voraus, die das Fehlen der ‚Perle‘ für ihn mit sich bringen würde: seine Frau war in allen praktischen Dingen ein hilfloses Kind geblieben und war den Aufregungen eines Leutewechsels daher auch heute noch nicht gewachsen. Er liess also Fräulein Lutz in sein Arbeitszimmer rufen.
Katarina kam schüchtern, mit frisch verweinten Augen, und der Geheimrat drückte sie in den mächtigen, kunstreich geschnitzten Kirchenstuhl aus dem sechzehnten Jahrhundert nieder, der neben seinem Schreibtisch stand. „Na, nun berichten Sie mir einmal, liebes Fräulein Lutz. Ich habe Sie sprechen wollen, weil mir’s die ganze letzte Zeit so war, als bedrückte Sie irgend etwas. Sie haben Kummer, Fräulein Lutz?“
Sie hob die Schultern. Wie ein Häuflein Elend hockte sie da in dem Riesenstuhl. Sie rang mit sich, sie kämpfte. Endlich liess sie ihren rotblonden Kopf vornüber in beide Hände fallen, stützte sich mit den Ellbogen auf die Knie, und befreiend löste sich ein Tränenstrom aus ihren Augen. Der Geheimrat blickte väterlich von oben her auf ihren scharf durchgezogenen Scheitel und die beiden rotblonden Schnecken, die ihre Ohren bedeckten.
„Steht nun das, was Sie bedrückt, in irgendeinem Kausalnexus zu Ihrer Stellung hier im Hause, Fräulein Lutz?“
Unter Schluchzen schüttelte sie den Kopf. „Ach Herr Geheimrat — es ist so gut vom Herrn Geheimrat — so gut gemeint — und ich bin für alles so dankbar, was ich hier erfahren habe — so viel gelernt hab’ ich vom Herrn Geheimrat — und von der gnädigen Frau ja auch — aber — aber ich bin so unglücklich ... Und ich weiss gar nicht, wie ich fertig werden soll mit mir ...“
Nun rückte er mit dem Schreibtischstuhl an sie heran, nahm ihre beiden Hände und sagte beschwichtigend: „Na, na, na. Haben Sie Vertrauen, Kleine. Es handelt sich also doch wohl um einen jungen Herrn, wie? Ei, Sie brauchen sich nicht zu genieren. Sie sind verlobt, Kind? Was? Na — oder doch verliebt. Still, still. Denken Sie ’mal, ich sei ein Verwandter von Ihnen. Sie sind Waise, nicht wahr?“
„Ich — hab’ niemanden — auf der ganzen Welt.“
„Hmhm. Ja, meine Frau sagte schon manchmal, man möchte Ihnen so gern ein bisschen näherkommen. Aber Sie waren ja so flink wie ein Aal. Immer gleich auf und davon und mitten in der Arbeit, von früh bis spät. Wir haben Sie unser Juwel genannt. Aber ins Herz haben Sie sich nie blicken lassen. Da sah man Sie nun leiden — und hatte Mitleid, ohne helfen zu können.“
„Es wäre mir ja — so eine Wohltat,“ sagte sie, noch immer unter Schlucken, „mir alles vom Herzen zu wälzen, aber ...“
„Ei, so wälzen Sie doch, Kleine. Ich bin ein verschwiegenes altes Haus. Los. Er ist Ihnen untreu?“
„Ach nein, Herr Geheimrat. Ich glaube, er hat mich sehr gern. Aber er ist jetzt selbst in einen Konflikt geraten, in dem er nicht aus noch ein weiss. Wir haben uns noch zu Lebzeiten meines Vaters verlobt. Er hat da im zweiten Semester auf dem Polytechnikum studiert. Sein Vater war auch Gärtner. Es sind unsere Nachbarn. Die Familie Troilo.“
„Troilo? Die Blumenzüchter, die das Versandgeschäft in Wiesbaden haben?“
Sie nickte. „Viktors Grossvater lebt dort auch noch. Er ist mit Viktors Vater freilich ganz auseinander, seitdem der zum zweitenmal geheiratet hat. Aber von der zweiten Frau stammt das ganze Geld, mit dem die Firma grossgeworden ist.“
„Viktor H. Troilo. Hm, die ist ja bekannt.“
„Frau Dora ist eine geborene Rispeter. Von den schwerreichen Aachenern. Die Rispeters besitzen grosse Tuchfabriken.“
In dieser Branche fühlte sich der Geheimrat weniger zu Hause. „So, so. Weiter. Erzählen Sie nur, Kind.“
Und sie erzählte. Es war viel, viel Trauriges dabei. Katarinas Vater hatte sich der nachbarlichen Konkurrenz nie gewachsen gefühlt. Frühzeitig waren die gichtischen Leiden bei ihm aufgetaucht, die ihn immer weniger arbeitsfähig machten. Als Viktor H. Troilo, sein alter, ewigjunger Batteriekamerad, Nachbar und Vereinsbruder, der immer ein Schwerenöter gewesen war, sich den Aachener Goldfisch kaperte, zu einer Zeit, da sein Sohn erster Ehe schon in die Konfirmandenstunde ging, musste Wilhelm Lutz auf jeden gärtnerischen Ehrgeiz verzichten. Schmalhans war Küchenmeister bei ihnen geworden. Er brachte ja später noch das Opfer, seine Tochter Katarina auf die Gartenbauschule zu schicken, aber er selbst besass weder das Kapital noch die Nervenkraft, um seine Gartenländereien planmässig auszunutzen. In jenen Jahren quälte er sich arg. Doch er blieb leben — und Viktor H. Troilo, der Gesunde, Blühende, starb. Das neue Eheglück hatte nur fünf Jahre gedauert. Troilos Witwe steckte bald nach seinem Tod noch grössere Gelder ins Geschäft. Sie folgte den Ratschlägen ihres Vetters Rispeter, der ihr sehr unternehmender Geschäftsführer geworden war, es wurden riesige Treibhäuser gebaut, in denen man sichere Marktware, hauptsächlich Nelken, in bisher unerhörten Mengen zog. Der Wiesbadener „Blumen-Troilo“ begann so eigentlich erst nach seinem Tode populär zu werden. Als der Erbe des Hauses sich mit seiner früheren Gespielin und Tanzstundenkameradin verlobte, weckte das wenig Begeisterung bei seiner Stiefmama, die mit ihm ganz andere Pläne gehabt hatte. Dagegen war Katarinas Papa als Brautvater restlos glücklich: der einzigen Sorge, die ihn noch drückte, war er ledig, er sah jetzt das Schicksal seines Kindes in sicherer Hut. Und als die Krankheit ihn vollends niederwarf, als er im Sanatorium Dietenmühle zum Liegen kam und die Witwe Troilo ihm die Zumutung stellte, ihr für ein billiges einen grösseren Teil seines Gartenlandes zu verkaufen, den sie zur Anlage neuer Warmhäuser brauchte, ging er gern und dankbar darauf ein. Der Besitzerwechsel war jetzt ja nur noch eine Form. Bald würde ja seine Tochter Katarina als junge Herrin da drüben einziehen, so rechnete er. Nachdem er noch das schliesslich ihm verbliebene Restchen Gartenland an der Dietenmühler Strasse verpachtet hatte, legte er sich ruhig zum Sterben nieder. Frau Troilo nahm die junge Waise, die inzwischen ihre Studien beendet hatte, bei sich auf. Aber das Leben ward dem jungen Ding im Hause ihrer künftigen Schwiegermama zur Hölle. Die protzige Art der Frau Dora, ihr Mangel an Herzenstakt, nicht zuletzt ihr plumper Eigensinn in allen beruflichen Fragen, in denen Katarina sich je mit ihren jungen Kenntnissen hervorwagte, schufen Tag für Tag neue Reibungen. Katarina hatte sich während ihrer Ausbildungszeit in Marienfelde und Dahlem besonders auch für gartenarchitektonische Fragen interessiert, und ihre Freude an künstlerischer Lösung neuer technischer Aufgaben hatte die Lehrkräfte ihrer Schule häufig veranlasst, sie auf diesem Gebiet zu theoretischer und praktischer Mitarbeit heranzuziehen. Allein Frau Doras Eifersucht flammte schon bei Katarinas schüchternsten Versuchen, hier mitzuraten und mitzutaten, hell auf. Immer wieder hatte Viktor, wenn er zu den Ferien heimkam, zwischen der Braut und der Stiefmama zu vermitteln. Katarina flüchtete schliesslich lieber in eine Stellung, in der sie sich ihren Unterhalt selbst verdiente, als dass sie ein Gnadenbrot unter entwürdigenden Begleitumständen ass. So die rechte, tiefe, innige Liebe empfand Viktor wohl auch nicht mehr für seine Braut. In tausend Kleinigkeiten nörgelte seine Stiefmutter an ihr. Und dies und das blieb in seinem Gedächtnis haften. Das überaus fein entwickelte weibliche Gefühl sagte es Katarina bei jeder Begegnung. Viktor war finanziell vollkommen abhängig von seiner Stiefmama, denn der väterliche Anteil am Geschäft war nur gering. Sich mit ihr zu entzweien, das kam dem Selbstmord gleich, hatte er am letzten Sonntag zu seiner Braut gesagt. Er war eigens nach Berlin gefahren, um eine Aussprache mit Katarina herbeizuführen. Wie dachte sie sich die Zukunft? Er hatte studiert, gewiss, ein bisschen Botanik, ein bisschen Nationalökonomie, ein bisschen Chemie, ein bisschen Technik, was ihn eben gelockt hatte, aber auf eine bezahlte Stellung konnte er damit nirgends rechnen. Wollte er auch nicht. Das Leben lag ja klar und schön geordnet vor ihm. Sobald er sein Jahr abgedient hatte, nahm ihn seine Stiefmama als Teilhaber in die Firma auf, dann konnte er heiraten, er bekam für sich und seine junge Frau drüben an der Dietenmühler Strasse ein Landhaus gebaut — Frau Dora hatte dafür schon einen Plan entwerfen lassen — allmählich lebte er sich in die Geschäfte ein — Berufssorgen, Amtsärger lernte er niemals kennen. Katarina sollte also klug sein und das kleine Opfer bringen, das von ihr verlangt wurde, es kam ihnen später tausendfach zugute: sie sollte das Jahr über ihrer künftigen Schwiegermama ein liebenswürdiges, hilfreiches Töchterchen sein.
Dem Geheimrat war die Kleine ein psychologisches Rätsel. Er hatte bisher nur die flinke, eifrige Arbeitsbiene in ihr gesehen und geschätzt. Sie war seiner Meinung nach in diesen fünf Monaten in den Angelegenheiten seines Hauses vollkommen aufgegangen. Dass sie daneben noch ein persönliches Leben führte, war ihm so wenig in den Sinn gekommen wie seiner Frau. Uebrigens hatte sie ihre Verlobung geflissentlich geheimgehalten. Wann hatte sie denn überhaupt Zeit gehabt, an sich und an ihre Zukunft zu denken? Von früh um sechs Uhr bis um Mitternacht war sie doch mit allen Fibern in ihrem wahrlich nicht leichten Dienste. Dass sie diese Unsumme von Pflichten in einem fremden Hause auf ihre Schultern geladen hatte — sie, die künftige Frau Viktor Troilo!
Allmählich hatte Katarina ihre innere Ruhe wiedergefunden. Sie wunderte sich selbst über den Mut, einem Fremden gegenüber all das auszusprechen, was sie sich bis jetzt selber nur ganz unklar und verworren eingestanden hatte. Vieles klärte und löste sich aber, indem sie sich ihm anvertraute. Es war so eine Wohltat, einmal das Buch des Lebens vor sich aufzuschlagen, sich Rechenschaft zu geben. An die Mutter hatte sie nur noch eine matte Erinnerung. Die Wirtschafterin später hatte ihr Tagwerk getan, mehr nicht. So war Katarina immer einsam gewesen, von Kindesbeinen an.
„Es ist schwer, Ihnen zu raten, liebes Kind,“ sagte der Geheimrat lächelnd, nachdem er mit ihr viele Punkte eingehend durchgesprochen hatte, „und ich will Ihnen auch gestehen, dass ich meinen ganzen Mannesmut zusammennehmen muss, wenn ich gerecht bleiben will.“
Mit ihren hellen, ängstlich irrenden Augen sah sie den grossen, starken Mann fragend an.
„Die erste, dringlichste Frage meiner Frau wird sein: Bleibt Fräulein Lutz oder bleibt sie nicht? Darin liegt ein berechtigter Egoismus — und die Dringlichkeit der Frage ist ein grosses Kompliment für Ihre Leistungen im Hause. Nun bedenken Sie aber ’mal den Eindruck, wenn ich erwidere: Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen Fräulein Lutz raten müssen, die Stellung bei uns aufzugeben, denn das ist sie der Zukunft ihres Verlobten unbedingt schuldig.“
Katarina holte tief Atem.
„Ich rate Ihnen aber nicht, jetzt schon nach Wiesbaden zurückzukehren, liebes Fräulein Lutz. Sie sind ein strebsamer Mensch, haben offene Sinne, Sie können draussen im Leben noch eine ganze Menge vorwärtsbringen. Reisen Sie ins Ausland. Gehen Sie nach England. Lassen Sie sich da in irgendeinem grossen Betrieb als Volontär anstellen. Das verträgt sich besser mit Ihrer künftigen Lebensaufgabe als die Stellung hier bei uns. Drüben sind Sie vollkommen Lady. Ich sage nicht, dass meine Frau und ich Sie hier nicht auch so eingeschätzt hätten. Aber in den Augen der fremden Leute zählt das hier anders. Ich glaube darum wirklich, Sie sind es Ihrem Verlobten schuldig, Ihr Amt hier niederzulegen. Dass ich Sie schmerzlich vermissen werde — na, und erst meine Frau — darüber wollen wir uns jetzt gar nicht unterhalten. Also suchen Sie sich ein nettes Plätzchen in der Welt. Wenn Sie wollen, bin ich Ihnen behilflich dabei. Solange Ihr Bräutigam dient, sind Sie auf diese Weise gut und einwandfrei untergebracht. Und wenn Sie übers Jahr im wunderschönen Monat Mai heiraten — dann haben Sie nicht nur als kleiner Gartendoktor bedeutende Fortschritte gemacht, sondern Sie können auch fliessend Englisch sprechen. What do you think about it?“
Das rotblonde Fräulein wälzte schwere Lasten über die Seele. Dies war hier Lebenswende, Schicksalsstunde. „Ich bin Ihnen — so von Herzen dankbar, Herr Geheimrat!“ Tief, tief atmete sie wieder auf. „Ja, ich glaube, so wird es gehen.“ Ein hellerer Schein, fast ein bisschen schelmischer Stolz blitzte jetzt aus ihren hellbraun-grünlichen Augen. „Ich habe nämlich mein Gehalt fast vom ganzen Winter noch unberührt liegen, da brauche ich den Pächter um nichts zu bitten. Das bisschen Gartenland, das jetzt noch mir gehört, und das Haus hat nämlich Vater noch verpachtet. Aber das bringt da draussen so wenig ein. Und die paar Papiere, die auf der Bank liegen, die greife ich unter keinen Umständen an.“
„Sie sind ja ein Tausendsassa, ein Spargenie. Also deswegen sind Sie auch den ganzen Winter über nicht ins Theater gegangen?“
Sie nickte lächelnd, ein bisschen beschämt, und doch zugleich siegesbewusst. „Es hat mich manchmal einen tüchtigen Kampf gekostet, so ein Geizhals zu sein.“
„Hmhmhm. Das hätte ich ahnen sollen. Meine Frau meinte ... Na, da haben Sie nun herzlich wenig von Berlin gehabt, liebes Kind. Wenn Sie nach England kommen, dann wirtschaften Sie mehr aus dem Vollen.“
„Nein, nein, Herr Geheimrat.“ Fast ängstlich sagte sie’s. „Mit ganz leeren Händen will ich dort nicht ankommen.“
„Wo, dort? In Wiesbaden?“
Sie bejahte stumm.
Den seltsamen Stolz begriff er nicht recht. Was konnte sie schon viel mitbringen? Und die Witwe Viktor H. Troilos durfte man doch gut und gern als eine halbe Millionärin einschätzen. Wenn das noch reichte. „Na, mein liebes Fräulein Lutz, hoffentlich finden Sie das Rechte. Soweit ich Ihnen beistehen kann, geschieht es gern, herzlich gern. Ueberlegen Sie sich alles, und wenn Sie mit sich klar geworden sind, dann sprechen wir weiter.“
Katarina trocknete ihre Augen, dankte dem Geheimrat noch einmal tief bewegt und verliess sein Arbeitszimmer — in ihrer stillen, bescheidenen Art, und doch innerlich gehoben und gestärkt.
Der Geheimrat aber stand vom Schreibtisch auf, kniff ein Auge zusammen und starrte entschlusslos auf die gegenüberliegende, dickgepolsterte Tür, die zum Wohnzimmer führte. Dort sass seine Frau mit einer Häkelarbeit auf dem Sofa, in grosser Unruhe auf die Nachricht von ihm wartend: ob Fräulein Lutz zum 1. April ginge oder ob sie bliebe?
Und er musste seiner Frau das Geständnis ablegen, dass er selbst dem rotblonden kleinen Fräulein noch ernstlich zugeredet hatte, nach England zu reisen ...
Er räusperte sich. Na, da hatte er sich ja was Nettes eingebrockt!
Noch verhängnisvoller war der Rat, den ihr bisheriger Brotherr ihr gegeben, für Katarina selbst.
Seiner Verwendung gelang es, ihr bei der weltberühmten Firma A. F. Dutton in Buckinghamshire Zutritt als Volontärin zu verschaffen. Dutton galt für einen der bedeutendsten Nelken-Spezialisten. Seine Saisonneuheiten waren seit Jahren auch auf dem Kontinent viel begehrt. Fräulein Katarina Lutz kannte die englische Firma dem Namen nach längst. Da auch das Haus Viktor H. Troilo neuerdings das Hauptgewicht auf die Nelkenzucht legte, glaubte sich Katarina besonders vom Glück begünstigt, als an sie das Schreiben mit dem Poststempel „Iver, Bucks“ eintraf, das in der den Engländern eigenen Knappheit ihr Mitteilung von ihrer Einstellung zum Mittwoch nach Ostern machte und ihre Pflichten als Volontärin klar bezeichnete.
Aber das Entsetzen, das ihr Entschluss in Wiesbaden hervorrief!
Frau Dora Troilo empfing Katarinas Brief mit den Mitteilungen über ihre Zukunftspläne, als ihr Stiefsohn sie schon verlassen hatte: Viktor musste sich am 1. April morgens 8 Uhr in Karlsruhe auf dem Kasernenhof der badischen Leibdragoner einfinden. An demselben Tage nahm Katarina von der tieferschütterten Geheimrätin Abschied, um nach ihrer Vaterstadt abzureisen und bis zum Dienstag nach Ostern als Gast im Hause ihrer künftigen Schwiegermama zu bleiben. Eine Antwort auf ihr Schreiben, worin sie ihren Entschluss ausführlich begründet hatte, war ihr vor ihrer Abfahrt von Berlin nicht zugegangen. Die ward ihr nun mündlich gleich nach ihrer Ankunft in Sonnenberg.
Es war kurz nach sieben Uhr früh, als der Zug in Wiesbaden einlief. Katarina fror, trotzdem die Sonne schon strahlend am Himmel stand. Sie war nach der langen Nachtfahrt in der dritten Wagenklasse wie gerädert. Das Badeleben hatte noch nicht begonnen: in den Anlagen, an denen ihr Droschken-Einspänner vorbeikam, herrschte kein Betrieb, an vielen Landhäusern waren sämtliche Rolläden herabgelassen.
Nördlich vom Sanatorium Dietenmühle fiel der Droschkengaul in Schritt. Hier ging es bergauf. Sobald die Strasse um den Amselberg herumbog, hatte man die ganze schöne Fernsicht vor sich, die Katarina von Kindheit an kannte und liebte. Ein schmales, sonniges Tal, waldige Höhenzüge schlossen es ab, in blauem Duft verschwimmend, im Vordergrund ein paar freundliche Dörfer, viele, viele obstreiche Gärten, in denen jetzt die Baumblüte begann, den Mittelpunkt bildete die Sonnenburg mit ihrem roten, alten Steinturm. Jenseits der Sonnenburger Strasse der Villenvorort Eigenheim mit den braunroten Ziegeldächern inmitten jungangepflanzten Laubwerks, und zwischen Sonnenberg und der Bingertstrasse das weite Troilosche Gartenland mit den grossen Treibhäusern und Frühbeeten, auf deren Glasdächern jetzt blendend die Morgensonne lag. Das neue, stattliche Herrschaftshaus, das die Witwe Troilo mitten in den Park gesetzt hatte, war von hier aus nicht zu sehen, aber die paar kleinen, einstöckigen Gebäude am Dietenmühler Weg, die den Grundstamm dieser Gärtnerkolonie gebildet hatten und in deren letztem, dem kleinsten, Katarina Lutz vor bald einundzwanzig Jahren zur Welt gekommen war. In dem kleinen Hause wohnten seit dem Tod von Katarinas Vater fremde Leute. Unter dem Pächter, der eine Milchwirtschaft betrieb, war leider alles sehr verwahrlost. Mit umflortem Blick sah Katarina hinüber. Es kostete sie jedesmal eine starke Ueberwindung, das Haus zu betreten. Der Pachtvertrag schloss mit dem Herbst des nächsten Jahres. Natürlich wollte sie ihn nicht erneuern. Es war auch anzunehmen, dass der Platz sehr bald für die Zwecke der Firma gebraucht würde. Viktor hatte schon davon gesprochen, wie seine Stiefmama und Onkel Rispeter, ihre rechte Hand, sich die Umwandlung dachten. Das junge Paar bekam eine kleine Villa an die westliche Grenze hingesetzt, und Katarinas Geburtshaus ward für einen neuen Teil des Versandgeschäftes ausgebaut, es sollte Lager- und Packräume abgeben.
Die Droschke fuhr durch das breite Gartentor auf das Troilosche Grundstück. Geradeaus lagen die Treibhäuser, links die grossen Felder mit den Frühbeeten, rechts das Wohnhaus mitten in einem Kranz von Edeltannen. Es waren schöne, kostbare Bäume, aber — auf dem wohlgepflegten Parkrasen zu ihren Füssen waren ein paar Gnomen und Rehe aus Steingut aufgestellt.
Noch nie war es Katarina so beschämend klar zum Bewusstsein gelangt: wie stillos diese ganze Neuschöpfung der Witwe Troilo doch im Grunde war. Ein künstlerisch empfindender Architekt war bei dem Entwurf des Herrschaftshauses nicht zu Rate gezogen worden, sondern ein biederer Maurerpolier hatte die unklaren Vorstellungen seiner Auftraggeberin von einem Rokokoschlösschen in grausame Wirklichkeit umgesetzt. Es war etwas Schauderhaftes herausgekommen. Die Ueberladenheit mit Stuck erinnerte Katarina an die wüstesten Greuel der Grunewaldkolonie. Noch schlimmer war’s drinnen. Frau Dora hatte sich von vielen ihr teuern Andenken der „Schmücke Dein Heim“-Zeit nicht zu trennen vermocht. Von der in der Diele aufgestellten bleigepressten Ritterrüstung an, in deren starren Fausthandschuhen die Visitenkartenschale ruhte, bis zu den Steinkrügen in komischer Mönchsgestalt, die auf dem Bordbrett im Speisesaal standen, fehlte kaum eine der unendlichen Verirrungen, die sich das zur Fabrikarbeit erstarrte Kunstgewerbe in den achtziger und neunziger Jahren hatte zuschulden kommen lassen. Und die Besitzerin all dieser Herrlichkeiten selbst fügte sich stilgerecht ein. Sie trug ein hochschnürendes Panzerkorsett, sämtliche Kleider knapp auf Taille gearbeitet, wodurch ihre Anlage zur Ueppigkeit, die verheimlicht werden sollte, besonders betont wurde, ihr dunkles Haar, ihre buschigen Augenbrauen waren gefärbt, sie trug viel Brillanten, auch gleich morgens nach dem Aufstehn.
Als Katarina gemeldet wurde, stand Frau Dora vor ihrem Toilettenspiegel. Sie hatte das Vorfahren der Droschke gehört. „Ich lass’ bitten!“ sagte sie lässig und steckte sich eine Haarnadel zurecht. Sie bemühte sich, hochdeutsch zu sprechen. Mit ihrem Vetter Rispeter und anderen Verwandten gab sie sich diese Mühe nicht. Wenn sie gemütlich wurde, sprach sie, wie ihr der Schnabel gewachsen war. Der Wiesbadener Einschlag war in ihrem Dialekt der stärkste, weil ihre Mutter aus der Kochbrunnenstadt stammte und weil sie als Kind, als Mädchen, hier lange Zeiten bei Verwandten zugebracht hatte.
„No, Du kommst ebe zum Frühstück zurecht, Kätche. Huch, wie verfrore siehst aus. Willst erst ablegen oder lieber gleich Kaffee trinken?“
Während sie sprach, verabfolgte sie dem Ankömmling links und rechts zwei schallende Küsse, die auf Katarinas Wangen deutliche Spuren des Drucks und der Lippenpomade zurückliessen.
Katarina bat, zunächst ablegen zu dürfen. Das flinke Hausmädchen hatte inzwischen ihr Handgepäck ins Fremdenzimmer gebracht, das im Giebel lag. Das Zimmer war blitzblank wie das ganze Haus. Es wurde hier unausgesetzt gescheuert. Frau Dora war die strengste und unerbittlichste Hausfrau, die man sich denken konnte. Sie genoss hier im Hause nicht weniger Respekt als drüben im Geschäft.
Als Katarina ins Speisezimmer kam — es war „altdeutsch“ mit Butzenscheibenfenstern und Muschelaufsätzen —, sass ihre Schwiegermama schon am Frühstückstisch, der in der Trinklaube gedeckt war. Auf dem Stuhle neben sich hatte sie ihre Bulldogge sitzen. Knurrend duldete das Tier das Näherkommen des Gastes. Frau Dora hatte ihm eine Serviette umgebunden und einen Teller Milch mit Brocken Weissbrot vorgesetzt. Schlappernd verzehrte Fricka, die Dogge, ihr Mahl, den grossen, nackten, menschenähnlichen Schädel immer wieder missgünstig dem Neuling zuwendend.
Katarina drehte sich jedesmal fast der Magen um, wenn sie im Hause ihrer Schwiegermama gezwungen war, auf diese Weise eine Mahlzeit mit dem über alle Beschreibung hässlichen Hund zu teilen. Frau Dora liebte ihre Fricka abgöttisch. Sie unterhielt sich mit der Dogge auch häufig, wenn sie allein war, und behauptete, das kluge Tier verstünde jedes Wort. Katarina schloss die Augen und tat einen tiefen Zug aus ihrer Tasse starkduftenden schwarzen Kaffees.
„Ohne Rahm? Ha, geh’, was ist das für eine neue Mod’. Ja, und jetzt sag’ bloss emal, Kätche, was für Sache sind denn das, wo Du Dir in den Kopf gesetzt hast? Nach England? Ins Herr Duttons? Als Volontär? Ha, neu, Du denkst doch nit, dass ich das duld’?“
Da waren sie gleich mitten im strittigen Thema drin. Frau Dora sprach jetzt fortgesetzt, sie liess den Gegner grundsätzlich nicht zu Worte kommen, aber sie ass auch fortgesetzt und fütterte zudem ihren Hund dabei. Eine Unmenge mürber Kipfel füllten den Brotkorb. Frau Dora ass sie ohne Butter — sie sprach sehr viel von ihren Massnahmen, um nicht dick zu werden, hatte aber schon längst eine durchaus ausreichende Fülle — einen Kipfel nach dem andern tauchte sie in ihren Milchkaffee, biss das eine Ende ab, tauchte den Rest nochmals ein und liess dann den Hund danach schnappen.
Immer wieder versuchte Katarina einen Einwand. Frau Dora hörte nicht. Sie sprach mit vollem Munde, grollend, ohne Absatz weiter. Wie sie so ass und zankte, hatte sie für Katarina eine nicht wegzustreitende Aehnlichkeit mit der gierig schnappenden und feindselig nach ihr glupschenden Bulldogge.
„Du wirst den Herre Engländern jetzt also ein Briefche schreiben, hörst, Kätche, dass Du Dir das anders überlegt hast, ich bitt’ mir’s aus, und kein Wort mehr höre will ich von dem Unsinn. — Da, nimm, allons, Fricka, mein Tierche. Ein gutes Viech bist. Ja, bist Du mein gutes Viech? Nein, ein Strolch bist. — Jetzt guck nur, wie lieb die Kröt’ wieder ist, das Mienespiel, wie auf dem Theater, nit? Ja, und dem Hausser gibst den Gepäckschein, dass er die grossen Sachen von der Bahn holt. Ist ausserdem noch Fracht, Kätche?“ Sie war aufgestanden und nahm dem Hund die Serviette ab. Er war darauf dressiert, ihr nun die Schnauze wie zum Kusse hinzuhalten, worauf sie ihm im Spass eine Ohrfeige verabreichte. Der Hund sprang zu Boden und an ihr empor, sie verliess die Trinklaube und führte rund um den grossen Speisetisch einen Tanz mit ihm auf. Er bellte, jaulte, lärmte, und sie amüsierte sich köstlich; so lange trieb sie das Spiel, bis sie ganz atemlos war.
Inzwischen war das Stubenmädchen eingetreten.
„Mina, sagen Sie dem Hausser, er müsst’ auf die Bahn, er sollt’ sich einmal ein bissche eilen. Geh’ her, Kätche, und geb’ der Mina gleich den Zettel. Hast ihn nit bei Dir? Ja, da liegt doch Dein Täschche, nit?“
Nun erst kam sie zu Wort — und nun musste grade das Stubenmädchen dabei sein, ein erschwerender Umstand, den Frau Dora ihrer Schwiegertochter nie verzieh.
„Es ist kein Gepäck mehr, Mama.“
„Ha, neu, wieso? Ich hab’ Dich doch mit dem Einspänner ankomme sehn. Da war doch bloss das ein Köfferche? Ha, und die anderen Sachen?“
„Die anderen Sachen — die sind schon in England, liebe Mama.“
„Ich denk’, ich soll hinschlagen und krieg’ die Kränk. In England? Ja, wie denkst Du Dir denn das?“
„Ich hab’ Dir doch alles geschrieben, Mama. Und Viktor hab’ ich’s ausführlich erklärt. Müssen wir denn jetzt gleich ... Ich meine, es wäre doch besser ...“
„Ach neu, ich bitt’ recht schön. Gelt, Du denkst, es kann mir vor der Mina nit gleichgültig sein, wie ich von meiner Schwiegertochter behandelt werd’? Sie bleiben, Mina. Davon ist jetzt keine Red’, dass Sie davonlaufen und das Geschirr jetzt liegen lassen. Allons. Es ist grad genug zu tun im Haus. Die Nachthemder mit den Spitzen müssen auch endlich gebügelt werden heut vormittag. Sie kommen rein zu gar nix mehr, Mina, so geht das nit weiter. Und im Zimmer vom jungen Herr, da liegt oben auf dem Bücherschrank der Staub fingerdick — kohlschwarz wird man, wenn man hinfasst — Sie denken, da fass’ ich nit hin, und der junge Herr auch nit — aber ich seh’ alles, Mina, alles. Und Du kannst Dich jetzt gleich einmal hinsetzen, Kätche, und ins Herr Duttons nach England schreiben: wenn das Gepäck ankommt, geht’s zurück. Oder wart’, wir telegraphiere gleich.“
„Liebe Mama, das ist unmöglich. Und zwecklos. Erstens ist das Gepäck natürlich nicht an die Firma adressiert, sondern an einen Spediteur — und zweitens werde ich den Leuten mein Wort halten.“
„Dein Wort. Dein Wort. So.“ Frau Dora Troilo war ganz ausser Atem. Ihr Busen wogte auf und nieder. Ihre dunklen Augen, die kleinen schwarzen Jetknöpfen glichen, rollten. Man sah das Weisse. Sie hatte nun wirklich etwas von ihrer Bulldogge: in der missgünstigen Art, in der sie das junge Ding musterte. „Ich denk’ als, Dein Wort hat der Viktor?“
„Aber Mama —“
„Mama hin, Mama her. Antwort will ich.“ In plötzlichem Jähzorn stampfte sie auf. „Stehn Sie nit so dreist da und lauschen, Mina, wenn Ihre Herrschaft ebbes zu besprechen hat.“ Der Hund, die Stimmung der Herrin erratend, fuhr bellend auf das Hausmädchen zu, das flink und erschrocken mit dem schwer beladenen Brett zur Tür eilte. „Und natürlich wieder so voll gepackt, dass es ein Wunder ist, wenn’s keine Scherben gibt. Aber das kostet ja nit das eigene Geld, die Frau Troilo hat’s ja. Schämen sollen Sie sich. Auf gar niemand ist heutzutag mehr Verlass. Ich kann Dir bloss raten, Kätche, bring’ mich nit in Wut. Also da ist gar keine Red’ davon, dass Du nach England fahren tust.“
„Ich — muss!“ Katarina hämmerte das Herz vor Angst. Aber sie nahm alle Kraft zusammen.
„Ich verbiet’ Dir’s! Ha, neu, das wär’ ja noch schöner. Junges Ding wird sich den Kuckuck nach einem richten. Gelt? Aber ich mach’ kurzen Prozess. Ich war bloss zu gutmütig zu Dir im Herbst. Das macht Dir jetzt Courage. Ich lass nit mit mir fackle. Du bleibst.“