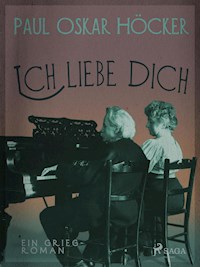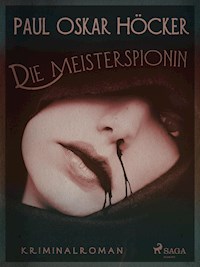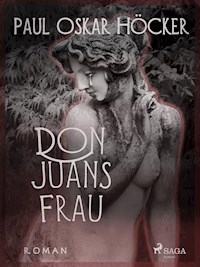Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helyett ist in Indien groß geworden und diese Welt hat sie mehr geprägt, als sie glauben möchte. In Wien lebt sie nun als junge Frau ziemlich auf sich allein gestellt. Kunst ja, aber was genau ist ihre künstlerische Bestimmung – die Komposition, der Gesang oder der Tanz? Und dann ist da noch die Liebe. Es sind einige Verwicklungen zu lösen, bis Heylett, das "Indian girl", ihren Weg gefunden hat.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Die indische Tänzerin
Roman
Zweiter Band
Saga
Der Brief stammte vom Konsul Pohl. Er war kurz und geschäftlich. Aber er enthielt eine umfangreiche Einlage: ein Schreiben von Helyetts Vater.
Helyett schwante sogleich nichts Gutes, als sie die Schriftzüge sah. Aber ihre schlimmsten Befürchtungen wurden durch die Tatsachen übertroffen. Ihr Vater hatte das Kapital, das ihm im Februar zur Verfügung gestellt worden war, zur Begleichung der dringendsten Schulden aufgebraucht. Er hätte von Simla sonst überhaupt nicht fortgekonnt, schrieb er. Nun sass er in Benares, wiederum von allen Mitteln entblösst, und sein Brief an Konsul Pohl erging sich im Ton Heller Verzweiflung. Er klagte darin seine Schwägerin an, er zieh sie ebenso wie seine Tochter der Undankbarkeit. Mit welchem Recht sie ihm den andern Teil vom Erlös aus dem Verkauf seiner Sammlungen vorenthielten? Vertrauten sie ihm nicht? War es nicht himmelschreiend, dass sie sich seine Ohnmacht zunutze machten, während er krank lag im fremden Lande? Sie wollten ihn bevormunden — als ob er nicht ganz genau wüsste, welche Verantwortung er besass. Von Deutschland aus könnten sie die Sachlage doch gar nicht übersehen. Er hatte gegen den Rakam Haidar den Prozess wieder aufgenommen. Wichtige Papiere waren ihm in die Hände gefallen; die bewiesen klar die Berechtigung seiner Ansprüche. Sein Schwiegervater hatte kurz vor seinem Tod eine Nachforderung von fünfzigtausend Pfund Sterling bei Haidar geltend gemacht. Die Summe hielt sich noch immer innerhalb der Maximalgrenze, die für den Bau des Sommerpalastes in Simla festgesetzt worden war. Der Bau dort bildete heute den Stolz der ganzen Sommerresidenz. Haidar hatte bei der Fertigstellung des Palastes dem berühmten Baumeister vor Zeugen ein wertvolles Ehrengeschenk überreicht — ein Zeichen also, dass er mit der Rechnungslegung damals vollkommen einverstanden gewesen war. Dass er die Nachforderung nach Sir Williams Tod nicht honorieren wollte, dass er sich hinter allerlei Spitzfindigkeiten verschanzte, das war eine unerhörte Vergewaltigung des Rechts. Die Wiederaufnahme des Prozesses — jetzt, wo er wieder gesund war — musste zum Sieg führen. Freilich erforderte die Durchführung der Angelegenheit grössere Barmittel.
„Fünfzigtausend Pfund Sterling sind gerettet, wenn ich jetzt rund tausend zur Verfügung habe. Im andern Falle ist alles verloren — und ich verlasse das Land als Bettler.“
Der Ton, in dem ihr Vater schrieb, war Helyett unerträglich. Wenn er in seiner flotten, eleganten Art die gleichen Worte zu ihr gesprochen hätte, so würde sie ihm genau wie früher ohne weiteres Nachdenken alles geglaubt haben. Er besass ja das Talent, zu bezaubern. Es war das grösste — vielleicht das einzige Talent, das er besass. Aber der liebenswürdige Firnis fehlte nun, und das gewisse Pathos hatte etwas Unwahres, etwas Gespieltes. Helyett glaubte darum an diesen Prozess nicht mehr.
„Schreibe Papa, er solle auf die fünfzigtausend Pfund verzichten und jetzt schon das Land verlassen — dann rettet er immer noch mehr, als wenn du ihm den Rest schickst und er bleibt.“
Die Gräfin Eltz beurteilte die Sachlage nicht anders. Ihre Erregung aber war natürlich noch grösser. Sie hatte ihrem Schwager damals in einem langen, eindringlichen Schreiben vorgehalten, dass das, was sie aus dem Verkauf der „indischen Herrlichkeiten“ zurückbehielt, den einzigen Rückhalt Helyetts bildete: „Das muss für ihre Aussteuer bleiben, für den Fall, dass sie heiratet; das ist ihr Notgroschen, für den Fall, dass sie noch unverheiratet ist, wenn ich sterbe.“ Und darauf nun trotzdem seine bestimmte Forderung: er müsse das Geld haben!
„Papa ist eben der alte Optimist geblieben,“ sagte Helyett. Aber ihr Ausdruck gab dem Wort eine bittere, fast geringschätzige Bedeutung.
„Sag’ lieber: es ist sein alter Spielerleichtsinn!“ fiel Tante Linda erregt ein. „Das Sichere opfern, um Unsicheres einzutauschen. — Und er mag schreiben, was er will, er mag mir meinethalben selber den Prozess machen: ich schicke ihm das Geld nicht!“
Helyett hatte die Stirn in die Hände gelegt. Ein trotziger Ausdruck spielte um ihren Mund. Heftig fuhr sie nun plötzlich auf. „Aber ich will es nicht, das Geld, Tante. Nein, nein, ich will es nicht. Für mich brauchst du’s nicht aufzubewahren, hörst du? Für mich nicht. Gottlob steh’ ich ja nicht mehr mittellos da.“
Verwundert sah die Gräfin sie an. „Nicht mittellos? Wie meinst du das, Kind?“
„Ich habe mein Talent — und meinen Fleiss — und meinen Ehrgeiz.“
Tante Linda seufzte nur. „Nun ja,“ sagte sie dann kleinlaut, da der leidenschaftlich aufflammende Blick Helyetts eine Beantwortung zu fordern schien. Wieder gab es darauf eine Pause. „Aber für die allernächsten Jahre wenigstens musst du doch sichergestellt sein, Kind. Ich will ja ums Himmels willen an deinen Erwartungen und Hoffnungen nicht zweifeln. Immerhin — alles braucht seine Zeit. Schliesslich macht doch auch Harrach gar kein Hehl daraus, dass du dir deine Karriere ein bisschen stürmischer denkst, als er selbst annimmt.“
Mit grossen Schritten durchmass Helyett das Zimmer. Die Arme hatte sie auf dem Rücken gekreuzt. „Die Zeit hier war sehr lehrreich für mich, Tantchen. In jeder Hinsicht. Ich hab’ auch endlich gesehen, dass man, um glücklich zu sein, den Aufwand nicht braucht, den wir in Indien getrieben haben.“
„Hm. Aber auch hier, mein liebes Kind, gibt’s jede Woche eine Rechnung zu bezahlen. So sparsam wir leben. Und der Sommer wird Geld kosten — ob wir uns noch so sehr einschränken. Und im Winter willst du nach Wien. Ausserdem“ — es ward ihr schwer, all das zu sagen, weil Helyett in ihrer praktischen Unerfahrenheit von den Dingen des täglichen Lebens noch gar keine rechte Vorstellung besass — „ausserdem hat doch auch Harrach schon einige Ansprüche an uns. Wenn ich jetzt das Honorar bezahlt habe, dann muss ich so wie so das Guthaben bei Pohl angreifen.“
Helyett fiel aus allen Wolken. Sie hatte die Beträge ihrer Rechnung hier in der Pension bisher für lächerlich gering gehalten. Ganz allmählich dämmerte ihr nun, dass Tante Linda ihr auch materiell Opfer brachte, die sie nie wieder wettmachen konnte.
„O — ich sehe — da hab’ ich allerdings kein Recht mehr, stolz zu sein.“
Sie sagte es so niedergeschmettert, dass die Gräfin sie rasch an sich zog, ihr tröstend die Hand pätschelte.
„Zunächst haben wir die Pflicht, klug zu sein, Helyett.“
Und darauf entwickelte sie ihre praktischen Vorschläge. Wie die Dinge rechtlich lagen, konnte Helyetts Vater ihrer Ansicht nach die Auszahlung des ganzen Kapitals nicht fordern. Und an dem rechtlichen Standpunkt musste nun festgehalten werden. Das sollte kein Misstrauen gegen den guten Willen ihres Schwagers bedeuten — aber gegen seinen temperamentvollen Wagemut wollte sie den kleinen Rest von Helyetts Vermögen schützen.
„Ich muss darüber mit Pohl verhandeln, er ist in geschäftlichen Dingen erfahren, er wird uns raten, uns helfen.“
Helyett hatte wieder grübelnd die Stirn in die Hände gelegt. Mit verächtlichem Ausdruck sagte sie: „Und er wird der Residenz eine Geschichte erzählen ...“ Verzweifelt fuhr sie auf. „Ach, wie klein, wie erbärmlich man wird, wenn man arm ist!“
Gelassen schüttelte die Gräfin den Kopf. „Es ist nicht nötig, Helyett, dass man’s wird. Man darf sich nur nicht selbst verlieren. Ich habe meine Armut so getragen, dass niemand im Städtchen — so arg der Klatsch da zu Hause ist — die Nase über mich hat rümpfen können.“
„Ja — du, Tantchen! Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste zurück ... grässlich, grässlich! Und so wenig nett ich’s von Papa finde, dass er uns so in Zwiespalt mit uns selber bringt — weisst du, die Vorstellung, andre könnten über ihn herziehen, die macht mich ganz rabiat.“
„Ich will’s auch gar nicht von dir verlangen, Helyett, dass du jetzt mitkommst. Wie die Dinge nun einmal liegen. Es genügt, dass ich mit Pohl alles bespreche. Aber es kann möglich sein, dass er Erklärungen vor dem Notar für nötig hält. Ich weiss ja nicht. Dann müsst’ ich dich bitten, folgsam zu sein. Du verstehst, Helyett. Was ich mit Pohl verabrede, das ist zu deinem Besten.“
„Kein Wort weiter, Tante. Ich werde tun, was du anordnest.“ Und plötzlich ergriff sie ihre Hand und küsste sie. „Du sorgst dich um mich, immer sorgst du für mich — und ich habe dir noch nie gedankt.“
Die Gräfin war fast erschrocken über den Gefühlsausbruch. Das war ihr etwas so Fremdes an ihrer Nichte.
In vollem Einvernehmen besprachen sie dann die Reisevorbereitungen. Tante Linda hoffte, nicht länger als vier, fünf Tage wegbleiben zu müssen.
Noch in der gleichen Stunde suchte Helyett dann Harrach auf, um ihm die ganze Angelegenheit ohne jeden Rückhalt darzustellen. Sie hatte ihm aus ihren misslichen Verhältnissen ja von vornherein kein Hehl gemacht.
Aber Harrach war seltsam abwesend. Ein paar Zwischenfragen, die er tat, klangen so zerstreut, dass Helyett es ihm übelnahm.
Hinterher sagte sie sich: Harrach war gewiss gekränkt über ihre Unbeständigkeit im Unterricht. Er hatte sie in den letzten Tagen frei schalten und walten lassen und gar nicht mehr zu den ihr so entsetzlichen Kontrapunktstudien angehalten.
Wenn erst Tante Linda abgereist war, fand sie mehr Zeit, ihr Tag ward grösser, dann wollte sie sich wieder emsiger ihren kontrapunktischen Studien widmen, um ihren strengen Lehrmeister zu versöhnen. Aber der Grund von Harrachs Zerstreutheit und Interesselosigkeit war ein ganz andrer. In nicht geringem Schreck nahm sie das wahr.
Als Helyett in dem Wagen, in dem sie Tante Linda nach Bozen zur Bahn begleitet hatte, bei der Pension Aurora vorfuhr, hörte sie Harrach Klavier spielen. Sie erkannte das Thema sofort wieder. Es war das gleiche, das sie in Radhas Tempeltanz vorgebracht und kürzlich in ihrer Skizze zum „Paria“ verwendet hatte. Aber es war nur das Thema, die Durcharbeitung war ganz neu.
Sie blieb im Vorgarten stehen und lauschte. Und je länger sie lauschte, desto beklommener ward ihr zumute.
Harrachs Spiel brachte das Thema zu grossartiger Steigerung. Eine Fülle polyphoner Arbeit lag darin. Helyett konnte nicht all den einzelnen Stimmen folgen. Das reiche Figurenwerk war es auch weniger, was sie verblüffte. Die Grosszügigkeit der sinfonischen Führung machte sie staunen.
Ein paarmal wollte sie in einen Beifallsruf ausbrechen. Steigerungen des Themas, die sie selbst schon gefühlt, harmonische Wendungen, denen sie nachgesonnen hatte, ohne sie zu finden, entwickelte Harrach mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, dass ihr’s wie eine Erlösung vorkam.
Aber ihre Begeisterung war nicht restlos erquicklich. Eine seltsame Eifersucht ergriff sie. Auch eine Art Beschämung.
Wenn Harrach schon die ganze Zeit über, wo sie sich mit der Weiterführung einzelner Themen gequält hatte, in dieser Weise Meister über den gleichen Stoff gewesen war, warum hatte er ihr’s dann verheimlicht?
Jetzt schwieg das Spiel. Harrach hatte einen kurzen Hustenanfall. Er stand vom Flügel auf und ging ein paarmal hastig übers Zimmer.
Der Wagen hatte längst das Tor wieder verlassen. Helyett trat ins Haus ein und nahm rasch den Weg zu ihrer Stube, ohne beim Musikzimmer innezuhalten. Nachdem sie abgelegt hatte, öffnete sie einen Türspalt, um es sofort zu hören, wenn Harrach weiterspielte.
Eine halbe Stunde später begann er wieder.
Nun trat sie auf den Flur hinaus. Sollte sie sich ihm zeigen? Ihn zur Rede stellen? Es war doch unerhört, dass er ihr all die Zeit über nicht einmal eine leise Andeutung über dieses neue Werk gemacht hatte.
Lange war sie unschlüssig.
Neben dem Salon lag das Lesezimmer. Hier liess sie sich, eine Zeitung nehmend, unter den andern schweigend lesenden Pensionären nieder. Aber sie las keine Zeile.
In dieser Stunde, bei diesem Spiel, das sie künstlerisch mit fortriss, machte sie eine gewaltige Erschütterung und Enttäuschung durch. Ihr ganzer Glaube an ihr Talent ward zertrümmert.
Unbedingt war es ein gross angelegtes dramatisches Werk, dessen Abfassung Harrach beschäftigte. Und zweifellos spielte es in Indien. All die Originalthemen, die sie in ihren eigenen Versuchen benutzt hatte, kamen auch in seiner Arbeit vor. Aber welch gewaltige Wandlung hatten sie durchgemacht! Was sie geschrieben hatte, erschien ihr so unsagbar dürftig und dilettantisch neben seiner vollen, reifen Kunst der thematischen Führung, der harmonischen Steigerung.
Sie hatte das Blatt in den Schoss sinken lassen und starrte abwesend vor sich hin. Ihre Hände waren eiskalt geworden — aber hinter ihren Schläfen brannte es.
Scham und Eifersucht rangen in ihr.
Längst hatte Harrach zu spielen aufgehört. Er war summend, dazwischen leicht sich räuspernd und hustend, den Flur entlang und die Treppe zu seinem Zimmer hinaufgegangen. Der Gong schlug an — das erste Zeichen für die Abendmahlzeit — und die Pensionäre erhoben sich. Fragende Blicke streiften Helyett, die mit so finster abweisender Miene dasass.
Warum hatte ihr Harrach verschwiegen, dass er den „Paria“ selbst komponieren wollte? Hatte er etwa geglaubt, sie würde Anspruch auf die Originalthemen erheben? War nur das der Grund, dass er sie immer wieder am freien Komponieren hatte verhindern wollen? War Egoismus dabei?
Plötzlich sprang sie auf. Voller Zorn, voller Hohn über sich selbst. Was war sie denn künstlerisch, was leistete sie — neben Harrach? Sie war ja noch eine blutige Anfängerin, und er war ein fertiger Meister!
Ja, als Anregung hatte ihre Arbeit ihm gedient. Ihre Themen gaben seinem Werk das echte Kolorit. Aber er überragte sie doch himmelhoch. Wenn er zu Tisch herunterkam, wollte sie ihn abfangen und offen mit ihm reden.
Aber er erschien heute nicht. Bei der Mahlzeit erfuhr sie dann, er hätte bitten lassen, dass ihm auf seinem Zimmer serviert würde. „Er hat sich wieder zu arg angestrengt, der Herr Hofkapellmeister,“ meinte seine Zimmernachbarin, eine Wienerin, „das geht ja jetzt schon wochenlang, dass er nicht ins Bett findet. Die Wände sind oben so dünn, es ist schrecklich. Er schreibt, er schreibt, und man hört das Rascheln der Feder bis zu mir herein. Und dazwischen summt er leise vor sich hin. Wenn er nicht sonst so ein scharmanter Mensch wäre ... ich werde mich schliesslich aber doch umquartieren lassen müssen.“
Die ganze Rede war an Helyetts Adresse gerichtet. Vermutlich sollte sie ihrem Freund den Tadel ausrichten. Sie hörte das aber gar nicht heraus. Das Wesentliche war für sie, dass Harrach tatsächlich schon wochenlang mit einer grösseren Komposition beschäftigt war, und dass sie in seinem geistigen Ohr schon so voll und fertig klang, schon so abgeklärt Gestalt gewonnen hatte, dass er gar nicht einmal mehr des Klaviers als Hilfsmittel bedurft hatte.
Morgens hatte er ihr’s früher immer durch das Stubenmädchen sagen lassen, wenn er zum Unterricht bereit war. Am folgenden Tage wartete sie vergeblich. Schliesslich schickte sie zu ihm.
Das Mädchen brachte gleich darauf ein mit Bleistift beschriebenes Kärtchen.
„Verehrteste Komtesse, seien Sie mir doch ja nicht böse, aber ich muss eine Woche lang den Unterricht aussetzen. Heute stecke ich tief in allerlei Arbeit — morgen will ich in teils beruflichen, teils geschäftlichen Angelegenheiten nach Wien fahren. Wenn ich zurückkehre, sprechen wir ausführlich.
Mit Handkuss Ihr gehorsamster
Vinzenz Harrach.“
Sie fand nicht die Sammlung, heute zu arbeiten. Ihre Skizzen für den „Paria“ konnte sie nicht mehr ansehen, geschweige denn durchspielen. Überhaupt scheute sie sich, auch nur eine Taste auf dem Klavier anzuschlagen. Die Vorstellung, dass Harrach es hören müsste, hatte etwas Aufreizendes und zugleich Demütigendes für sie.
Ob er ihr ganzes Streben wohl insgeheim belächelte?
In grossem Schreck legte sie sich die Frage vor.
Aber dann hätte er sie ja von Anfang an schwer getäuscht — und auch schwer geschädigt — sie in unverantwortlicher Weise aus ihrer Bahn gerissen!
Galt sein Interesse etwa überhaupt nicht ihrer Person, ihrer Individualität, ihrem Können und ihren Absichten, sondern hatte eben nur die Anregung, die sie seiner Arbeit hatte geben können, ihn verlockt, sie hier festzuhalten?
Den ganzen Vormittag über bekam sie ihn nicht zu sehen. Und kurz vor dem Mittagessen erfuhr sie von einer Änderung seines Reiseplans: er wollte Gries nicht erst am folgenden Morgen, sondern noch heute abend verlassen. Bei Tisch ward darüber gesprochen, dass morgen früh eine neu angemeldete Pensionärin sein Zimmer bezog.
„Wird er denn von Wien aus nicht mehr hierher zurückkehren?“ fragte irgendwer an der Tafel.
„Dauernd nicht — aber sonst ist noch gar nichts bestimmt,“ sagte die Pensionsinhaberin, die am Tisch präsidierte.
Helyett wollte dazwischenrufen: Mir ist er’s schuldig, dass er zurückkehrt! Aber sie schwieg. Sie presste die Lippen aufeinander und schlang unterm Tisch die Hände krampfhaft ineinander. Es war ihr elend zumute.
„Ich muss Sie sofort sprechen. Dringlich. H. E.“ Ein Kärtchen mit dieser Zeile gab sie dem Stubenmädchen. Dann wartete sie in grosser Erregung. Im Salon waren Gäste. Sie musste ihn also in ihrem Zimmer empfangen. Ungeduldig ging sie auf und nieder. Immer wieder trat sie auf den Balkon hinaus.
Die Rebenblüte verbreitete ihren würzigen Hauch, die Gärten strömten ihren Blumenduft aus. Windstill und balsamisch war die Luft. Es war ein richtiger Frühsommertag. Köstlich waren die Luftstimmungen in diesen Tagen. Der Rosengarten und die andern Dolomitgruppen, die bisher in starres Weiss gehüllt waren, streiften mehr und mehr ihre Schneemäntel ab. Im Schein der sich westwärts wendenden Sonne begannen sie sich zartrosa zu färben.
Leichte, flotte Schritte näherten sich der Tür. Ein kurzes Pochen, dann stand Harrach im Zimmer. Er steckte schon im Reiseanzug. Seitdem die gleichmässig warme Witterung eingesetzt hatte, war er nur selten von Hustenanfällen belästigt worden. Helyett war aber geradezu erstaunt über die Frische, mit der er ihr jetzt entgegentrat. In seinen Augen blitzte Unternehmungslust, er sah so gut und gesund aus wie nie zuvor, seitdem sie ihn kannte.
„Ich weiss schon, Sie sind mir böse, Komtesse. Gelt, ich hab’ Sie ein bissel vernachlässigt? Aber gedulden Sie sich bloss noch ein paar Tage, dann bin ich wieder da und erklär’ Ihnen alles. Machen Sie’s jetzt gnädig mit mir! Das Reisefieber steckt mir schon in den Knochen.“
Sie musterte ihn voll Unruhe und Misstrauen. „Warum haben Sie mir verschwiegen, Harrach, dass Sie an einer grossen Komposition arbeiten?“
Er machte eine abwehrende Geste. „Gerade darüber will ich heute noch nichts sagen.“
„Warum nicht?“
„Weil die Sache noch nicht spruchreif ist. Deswegen. Wenn ich aus Wien zurück bin, ist’s Zeit. Heute noch nicht.“
Sie schluckte ein paarmal. Plötzlich trieb sie die Angst, und sie stiess fast atemlos aus: „Sie kommen ja gar nicht mehr zurück!“
„Komtesse —!“
„Sie verheimlichen mir etwas. Die andern hier, die wissen’s. Nur ich nicht. Ihr Zimmer haben Sie aufgegeben. Sie — Sie wollen mich los sein.“
Er war zuerst bestürzt über ihre leidenschaftliche Art. Aber überlegen schüttelte er dann den Kopf. „Ein rechtes Kind sind Sie doch noch, Komtesse. Was hätte ich für einen Grund, mich davonzuschleichen?“
„Ich habe Sie gestern spielen hören. Gewiss, es ist kindisch von mir, dass ich eifersüchtig bin. Ich — die Anfängerin. Aber es ist mir doch klar geworden: Sie schreiben die Oper selbst.“
„Hm.“ Er lächelte noch immer. „Also so meinen Sie’s.“ Nun liess er sich auf einen Sessel an der Balkontür nieder und blickte über das Geländer ins Bozener Land hinaus. „Was ich damit vorhabe, Komtesse, das darf ich Ihnen heute noch nicht verraten. Und wenn Sie mir noch so böse Augen machen — Sie werden mir nichts darüber herauspressen. Nur das eine will ich Ihnen sagen: wenn die Geschichte so ausfällt, wie ich’s erhoffe, so hat sie grosse Bedeutung für Sie.“
„Für mich? Inwiefern?“
„Ja, das ist eben noch mein Geheimnis.“ Es lag fast so etwas wie Schalk in seiner Miene. „Ein bissel Geduld müssen Sie jetzt halt haben.“
„Aber ich habe sie nicht!“ Sie presste die Hände ineinander. „Ich bin doch in solcher Not! Verstehen Sie denn nicht? Jeder Tag ist für mich ein Verlust!“
Er nickte, ganz ernst werdend. „Das weiss ich, Komtesse. Sie haben mir’s ja unumwunden gesagt. Und das ist mir der Hauptgrund, dass ich jetzt schon nach Wien fahre.“
„Es hängt mit der Oper zusammen — mit dem ‚Paria‘ — mit Ihrer Komposition? Oder mit meinen Versuchen? Gott im Himmel, so sagen Sie doch!“
„Nein. Ich darf nicht. Das wäre verfrüht. Dass Sie die paar Tage warten — geduldig und vertrauensvoll — das kann ich verlangen.“
„Sie martern mich. Sie sehen, wie ich mich quäle, und sind so starr und trotzig.“
„Nachher werden Sie sagen, dass ich recht hatte. Wenn ich zurück bin und Ihnen einen fertigen Plan vorlegen kann.“
„Wenn Sie — wirklich zurückkommen!“
Leicht aufstampfend erhob er sich. „Also gar kein bissel Vertrauen haben Sie zu mir? Hab’ ich’s so etwa verdient?“
„Ich weiss, dass ich Ihnen Dank schuldig bin. Aber seit gestern ... ich bin in Sorge, in schwerer Sorge. Ich hab’ kein Vertrauen mehr zu mir. Zu meinem Talent. Und da ist mir’s mit einem Male, als hätten Sie’s auch verloren.“
„Hm. Ah so. Und da meinen Sie, ich sähe, dass ich mir eine böse Suppe eingebrockt hab’, die ich nicht auslöffeln will, und darum ergriff ich schleunigst das Hasenpanier?“
Ein paar Sekunden lang blickte sie vor sich nieder, dann hob sie den Kopf und sah ihm flammend ins Auge. „Ja!“ stiess sie atemlos aus.
„Sehr schön. Bravo, Komtesse! Für einen Malefizschelm scheinen Sie mich ja zu halten.“ Er machte einen erregten Gang übers Zimmer. Dann blieb er ihr gegenüber stehen. „Aber nun will ich Ihnen einmal etwas sagen. Wenn ich nicht grosse Stücke auf Sie baute, wenn Sie mir nicht als ein ganz hervorragendes Talent erschienen, das noch viel — sehr viel — erreichen kann, dann machte ich mir nicht so viel Skrupel daraus“ — er schnippte mit den Fingern in die Luft — „Ihnen das in aller schuldigen Ehrerbietung deutlich und unumwunden zu sagen. Und Ihnen darauf mein Kompliment zu machen, ‚küss d’ Hand‘ zu sagen und zu sehen, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat, um auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden.“
Helyett war erschöpft. „Ich kränke Sie — ich will’s nicht — aber ich bin doch so ratlos geworden.“
„Heute kann ich Ihnen nicht helfen. Ich muss nach Wien. Dort bin ich drei, vier Tage nötig. Ich steig’ in meinem alten Quartier ab. Schreiben Sie mir morgen eine Zeile dahin. Ja? Bitt’ schön. Bis morgen haben Sie sich hoffentlich beruhigt. Und hernach reden wir weiter.“
Er hielt ihr die Hand hin. Sie erfasste sie hastig.
„Sie wollen mir nicht sagen, was Sie vorhaben? Nicht jetzt gleich?“
„Nein, Komtesse. Ihr Vertrauen verlang’ ich.“
Sie seufzte tief und schwer. „Gut. Ich warte also.“
Zwei Stunden später fuhr sein Wagen in der Richtung auf Bozen davon. Helyett stand an der Brüstung des Balkons. Mit beiden Händen hielt sie sich am Geländer, während ihre unruhig flackernden Blicke dem Gefährt folgten.
Abends hörte sie über Harrach sprechen. Man fand es gewagt, dass er schon wieder die Grossstadt aufsuchte. Sein Gesundheitszustand hatte sich ja erstaunlich gebessert, trotzdem er in der letzten Zeit so übermässig gearbeitet hatte; aber hier war er nicht dem Staub, der Hetze ausgesetzt gewesen, wie doch gewiss wieder in Wien. Was er dort vorhatte, wusste niemand. Nur das schien festzustehen, dass er nicht daran dachte, auf längere Zeit nach Gries zurückzukehren. Sonst hätte er doch das Anerbieten der Besitzerin der „Aurora“ angenommen, die ihm sein Zimmer reservieren wollte.
Helyett hatte ihr Misstrauen mühsam überwunden. In der Einsamkeit dieses Abends, bei der Erinnerung an diese Gespräche stellte sich’s verstärkt wieder ein.
Was plante Harrach? Warum hatte er ihr nicht reinen Wein eingeschenkt? Worauf vertröstete er sie?
Sie kannte ihn nur als Künstler, als Lehrer. Als Mensch war er ihr noch immer wie ein Buch mit sieben Siegeln. Sie wusste: zwei Seelen rangen in seiner Brust. Eine grosse, heilige Begeisterung hob ihn in ernsten Kunstdingen oft hoch über den Alltag. Aber ebenso oft regte sich das leichte Blut in ihm — das Theaterblut, das ihm seine lärmenden Erfolge verschafft hatte. Was war in ihm stärker? Und wem sollte sie glauben und vertrauen?
Die letzte Abendpost hatte ihr ein Briefchen von Tante Linda gebracht, aufgegeben nach der ersten Besprechung mit Konsul Pohl. Die paar Zeilen sollten sie beruhigen — regten sie aber von neuem auf. Tante Linda brachte Opfer für sie, grosse Opfer; sie verstand von musikalischen Dingen nichts, aber sie hatte doch sofort unbedingtes Vertrauen zu Harrach und seinem Urteil gehabt.
Wie, wenn Harrach sie täuschte?
In dieser Nacht quälte sich Helyett mit den trübsten Vorstellungen. Ihr ganzes Unternehmen schien ihr gewagt. Ihre künstlerische Zukunft stand ja auf so schwachem Boden. Es war doch geradezu Wahnwitz, wenn sie hoffte, mit ihren kleinen, noch so unfertigen Leistungen durchzudringen.